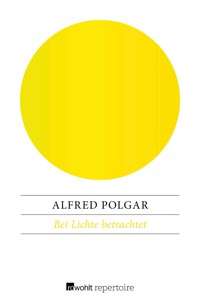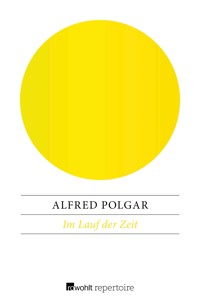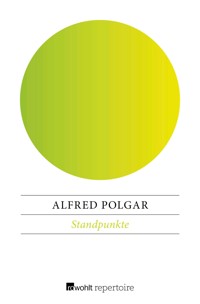9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alfred Polgar, von dem Joseph Hofmiller äußerte, daß «seine Prosa in kommenden Zeiten als klassisch empfunden werde», war nicht nur nach einer anderen Formulierung der «Marquis Prosa» der modernen deutschen Literatur, sondern mit Alfred Kerr einer der wenigen großen und produktiven Kritiker des deutschen Theaters. Er war Geist von Lessings Geist. Wie Lessing spielte er mit den Worten, wie Lessing spielte er nie mit leeren Worten. Seine graziösen Einfälle, seine blitzenden Antithesen, seine geschliffenen Formulierungen enthüllen immer das Wesentliche der Bühnenkunst. Seine theaterkritischen Arbeiten, einst in vier Bänden «Ja und Nein» gesammelt, sind längst vergriffen. Die vorliegende Auswahl enthält die wichtigsten, durch Form und Inhalt für die Dauer bestimmten Stücke dieses kritischen Werkes: Anmerkungen zu Stücken der Klassiker und anderer älterer Dichter, Würdigungen von Strindberg, Wedekind, Shaw, Hauptmann, Schnitzler, Hofmannsthal, Kaiser, Werfel. Sie gibt einen Querschnitt durch das Repertoire der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber auch unvergleichliche, von Ironie funkelnde, kurze Ansichten über Produkte ephemerer Autoren, deren Ruhm es bleibt, Polgar angeregt zu haben. Dieser Band enthält Polgars brillante, knappe Stichworte zu Inszenierungen, Regisseuren und Darstellern und eine lebensvolle Bildergalerie der Mimen Fritzi Massary, Max Pallenberg, Josef Kainz, Werner Krauß, Albert Bassermann, Käthe Dorsch, Elisabeth Bergner und vieler anderer. Ein nach Personen geordnetes Register macht diesen Band jedem Theaterfreund unentbehrlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alfred Polgar
Ja und Nein
Darstellungen von Darstellungen
Über Alfred Polgar
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Der Auswahl liegt Alfred Polgars Sammlung «Ja und nein. Schriften des Kritikers» zugrunde (4 Bände, 1926/27 im Rowohlt Verlag); sie wurde durch Kritiken aus den Jahren 1927–1933 und 1949–1955 ergänzt.
Zum Beginn
Nun ist es Herbst und kühl, der Senne muß scheiden, die Natur hört auf, und das Theater beginnt. Gar schöne Spiele spielt es mit dir. Und zeigt dir Leben in vielerlei Gestalt, Leben, wie es dem Schöpfer nicht eingefallen ist, wie es ihm aber hätte einfallen können. Indem du, Mensch, dich selbst auf der Bühne siehst, wirst du deiner vergessen; indem du dich zerstreust, wirst du dich sammeln; und je mehr du vom Spiel eines erfundenen Schicksals gefesselt bist, desto mehr wirst du dich vom Ernst des wahrhaftigen Schicksals befreit fühlen.
Oder auch nicht.
Ich habe mit meiner Cousine, als wir beide Kinder waren – vier Wochen hinter Weihnachten oder einige Jahrhunderte vorm Krieg war das – oft Theater gespielt. Einer machte den Zuschauer, der andre das Theater. Es bestand im wesentlichen aus einem hölzernen Schemel, in dessen Brett eine schlüssellochförmige Öffnung war; durch diese Öffnung liefen zwei Spagatschnüre, an ihren untern Enden hing je ein Holzklötzchen, die obern hatte der Spielleiter in der Hand. Er ließ die Klötzchen allerlei Bewegungen gegeneinander machen, in die Höhe schnellen und zu Boden stürzen, und sprach dazu einen Phantasietext. Der Zuschauer saß mit Herzklopfen zwei Schritte vom Theater auf dem Fußboden und war entrückt.
Auf den Höhepunkten der Handlung (oder wenn ihr nichts mehr einfiel) sprach meine Cousine folgenden geheimnisvollen Satz: «Ivn istn, eivn istn, kolin, molin, zin, zin, zin!» Ich weiß bis heute nicht, was er bedeutet, und sie hat es vermutlich nie gewußt. Aber er schloß eine ungeheure Menge von Möglichkeiten in sich. Er klang wie Gottes Richterspruch, unverstehbar den Sterblichen; oder wie eine Extrakt-Formel für des Lebens und des Theaters Unvernunft; oder wie ein magischer Satz, der die Holzklötzchen aus der Verzauberung zu beseelten Figuren wieder in die tote Unempfindsamkeit ihrer Holzklötzchenschaft entließ.
Ich glaube, in den kindischen Worten, die keinen Sinn hatten, nur Klang, lebte was vom geheimnisvollen Zauber der Kunst: Rhythmus, der einlullt und zu Träumen anregt.
Und wenn wir den Sinn des Daseins, rückblickend vom Höhepunkt der Handlung, in eine letzte, knappste, erschöpfende Formel fassen wollen: könnte sie viel anders lauten wie der Zauberspruch meiner Cousine?
Heute ist sie Versicherungsbeamtin. Eine ältere Dame mit spitziger Suada. Damals, in den Tagen des Holzschemels, wollte sie Tragödin werden oder Tramway-Kondukteur.
Das zweite war auch mein Herzenswunsch.
Jetzt bin ich aber Theaterkritiker. Ich sitze, so oft es was Neues gibt, vor dem herabhängenden Vorhang und warte auf den Augenblick, da der Zuschauerraum vom Dunkel überfallen wird, das Geschwätz der Menschen jählings verstummt, als ob eine Riesenfliege endlich den Ausweg durchs Fenster gefunden hätte, da der Gong tönt und es aufrauscht wie ein Schwarm von tausend Plüsch-Vögelchen. Das ist der herrlichste, der eigentliche Herzklopf-Augenblick des ganzen Theaterabends.
Hier ist niedergeschrieben, was ich dann weiter, nach jenen schönsten Augenblicken, im Theater erlebt habe. Getreulich niedergeschrieben, mit Nutz- und Schadenfreude, und so, als ob wir mitsammen gar keine andern Sorgen hätten.
Ivn istn, eivn istn!
Dichter
Shakespeare
CORIOLAN – Unsre Liebe gehört dem Coriolan, aber recht geben wir dem Demos, der den Herrischen aus der Stadt treibt. Shakespeare tut freilich alles, den Coriolan auch ins Recht zu setzen. Höchste Tugenden häuft er auf des Römers Haupt, und selbst die Hoffart, deren er ihn sich schuldig machen läßt, hängt dem Helden nur an wie der Schatten, den seine adelige Seele wirft. «Ich kann nicht Volkesdiener sein!» spricht er ungefähr, und es klingt genauso stolz, tapfer, männlich wie des Posa Wort: «Ich kann nicht Fürstendiener sein.« Der innere Tonfall ist es, der beiden Dikten das Hinreißende gibt. Abkehr von der praktischen Notwendigkeit zugunsten einer, im eignen Wesen tief begründeten, ideellen Notwendigkeit ist ja die Formel, auf die fast alles Heroentum zu bringen ist. Wir werten den Helden nicht nach Güte oder Schlechtheit der Sache, der er dient, sondern nach der Intensität und Unbedingtheit, mit der er ihr dient. Shakespeares Drama lehrt nicht die Volks-Verachtung, es ist vielmehr das Drama des kompromißunfähigen Besonder-Menschen. Nirgends ist gesagt, daß der hochgeartete Einzel-Mensch in natürlichem Gegensatz zur Masse stehen müsse. Aber wohl ist gesagt, daß die Masse in solchem Gegensatz zum besondern Individuum stehe. Und insofern darf «Coriolan» freilich ein antidemokratisches Stück heißen. Die Tribunen hassen den Besieger der Volsker nicht um seiner aristokratischen Gesinnung willen, sondern aus einem Instinkt heraus, der sie das große Individuum hassen heißt. Sie nützen nur seinen Aristokratismus, um ihn zu Fall zu bringen, und er könnte sie gar nicht empfindlicher treffen, als wenn er aus einem Verächter der Volksgunst ein Werber um diese würde. Daß des Coriolan Volksverachtung als tragische Schuld empfunden werden könnte, dazu wären gleichwertige Gegenspieler nötig, Volksfreunde von der gleichen Charakterstärke, Gesinnungshöhe, Unbedingtheit wie er. Aber was ihm der Dichter entgegenstellt, ist dürftig an Geist und Seele, feige, tückisch und der Größe bar. Die Sache des Volkes wird in diesem Drama nicht entschieden, denn sie wird zu schlecht vertreten. Nicht ihre Gegner, nicht sie selbst: ihre Anwälte setzen sie ins Unrecht.
Coriolans Mutter: Frau Bleibtreu. Sie füllt ohne Verlust an lebendiger Substanz das Heroenmaß der Figur.
Menenius Agrippa: Hugo Thimig, Vater der talentgesegneten Dynastie. Wie menschlich, klug und fein, wie behaglich-klassisch und klassisch-behaglich stellt er den alten Patrizier hin, durchwärmt von Lebensfreude, väterlich-gütig und väterlich-aggressiv, weise, herzhaft, humorvoll. Ein Mensch von unvergeßlicher Daseins-Fülle, vor dessen Atem Leimgeruch des Theaters restlos hinschwindet.
KÖNIG LEAR – (bei Reinhardt). Das Stück voll Blut und Wunden spielt zu legendärer Vorzeit. Wie das organische Leben früherer Erdperioden in Riesenformen Erscheinung wurde, so manifestieren sich, in der Vorzeitwelt des «König Lear», Empfindung, Wort, Tat überlebensgroß. Um diese Überlebensgröße wirbt Reinhardts Regie. Ihr Leitgedanke ist: gesteigerte Natur. Reinhardt intensiviert seine Schauspieler. Sprache und Gebärde recken sich zur erreichbaren Höhe: jeder in jedem Augenblick seine eigene Statue. Das kommt auch in den Kostümen, die in ihrer steifen Faltigkeit mehr geschnitzt als geschnitten scheinen, zur Geltung. Die Szenengestaltung dient der Idee: legendarer Raum. Die Bühnenwirklichkeit, wie ausgespart aus Unwirklichem, gibt nur Andeutungen, Stichworte für die Phantasie des Auges. Musik hilft die gemeinen Linien des Geschehens verwischen, bindet, was der Zwischenvorhang streng geteilt; ihre Welle spiegelt den dunklen, sternenlosen Himmel des Werks schwermütig wider. Es war so schön wie, auch für die Frömmsten, ermüdend. Besonders dann, wenn der Geist des Spiels vom Ritus des Spiels erdrückt wurde. Das geschieht bei Reinhardt manchmal. Sein Gefühl für szenische Valeurs setzt gelegentlich aus, seine sicher formende und zusammenschließende Hand läßt locker: dann duldet er Länge und Langeweile, und die Szene geht auseinander wie Papierschiffchen im Wasser. Im «König Lear» geschah das zum Beispiel beim Terzett der drei Narrheiten. Eine Viertelstunde lang deckte Wimmern und Schreien allen Text, das Zeremoniell der Tollheit lief leer, das Theater ging auf der eignen flachen Spur.
Reinhardts Regie erhält ihre kräftigsten Impulse nicht vom Geistigen, sondern vom Sinnlichen der Dichtung. Dies macht sich als Störung im Rhythmus fühlbar: auf unbetonten Teilen des Spieles liegt, bieten sie nur bildhafte oder musikalische Möglichkeiten, ein Akzent, der ihnen ideell nicht zukommt, und Betontes, ist es theatralisch unergiebig, fällt in die Senkung. Es ist eine Regie, die, etwa von der Vision: «tödlicher Schuß» heimgesucht, das Tödliche als sekundär empfände, den Licht- und Knalleffekt aber und die Silhouette des Revolvers als das eigentlich Wichtige und Verführerische des Vorfalls. Erotiker, der Reinhardt vermutlich ist, geht es ihm vor allem darum, ein Maximum an lustvoller Irritation für Aug’ und Ohr und Rückenmark aus der Dichtung herauszuholen. Mit einigem Recht mimt diese, die es ja auch mit dem Geiste hat, so behandelt, die unverstandene Frau.
Reinhardts Regie treibt das Theater im Theaterstück großartig vor und fixiert es in Chiffren von starker Leuchtkraft. Durch die Form, in die sie das dramatische Geschehen zwingt, stilisiert sie es nicht nur, sondern sterilisiert es auch. Der Zuschauer empfindet die Szene zugleich als entfesselt und gebändigt: aus dieser Empfindung fließt seinem gereizten «Furcht- und Mitleids»-Komplex kostbare Beruhigung zu. Eine Komponente von Reinhardts Begabung, vielleicht die stärkste, ist sein sicheres Gefühl für das Spiel in Menschen, Dingen und Schicksalen, für das Dekorative in Tod und Leben, für den Farbenzauber von Blut und Tränen. So hat er ja auch die katholische Kirche entdeckt und zu gelegentlicher Mitwirkung seinem Theater verpflichtet. Phantasievolle Verliebtheit ins Spiel erklärt auch die Schwäche dieses Regisseurs für Pomp und Reichtum (die Worte nicht nur im materiellen Sinn verstanden). Figuren mit luxuriösem Ich, Gestalten im Purpur der Leidenschaft, Seelen, die Gefühlsaufwand treiben, sind seinem Theaterherzen nahe; wenn es einem armen Menschen (von Dichters Gnaden) sich neigt, so wird das zumindest ein Armer sein, der reich an Armut ist.
Dadurch, daß Reinhardt der Dichtung ein Äußerstes an spielerischem und formalem Reiz entbindet, also dem Zuschauer vorwiegend ästhetische Beteiligung (die gefühlsmäßige kommt erst in zweiter Linie) abnötigt, bringt er ihn zu den Theaterfiguren und deren Schicksalen in ein Verhältnis, ähnlich dem, das zu den Menschen die Götter haben. Wie diese, im sichern Gefühl der Entrücktheit, dem Lauf der Welt mit freudevollem Gruseln folgen mögen – ergötztes Publikum, das noch aus dem Jammer, den es vernimmt, Musik keltert –, so, hingerissen und unberührt, folgen wir dem Lauf der Welt auf Reinhardts Brettern, die sie bedeuten. Denn dort scheint Natur eine Funktion der Kunst, schön oder nicht schön ist allein die Frage, und das Leben deklariert sich herrlich schamlos als Vorwand zu Theater. In solchem Verhältnis unbeteiligten Beteiligtseins, in das der Zuschauer gerät, in solchem Trost über das Geschehen durch das Bild des Geschehens steckt vielleicht eine tief geheimnisvolle Wurzel alles Theatervergnügens.
Klöpfers Lear hat großes Format. Jeder Zoll ein Mann. Seine Gebärde greift weit über den Raum hinaus, den sie umfaßt, sie trifft, wie der Blick, ins Ferne. Seine Stimme ist gebieterisch auch in Not und Klage; ein leidenschaftliches Herz, nie genötigt, sich zu verhehlen, füllt sie mit schwingender Substanz. Manchmal folgt ihr, der Stimme, eine Suite von Nebengeräuschen, doch ist das vielleicht nur Gewohnheit königlichen Pomps. Klöpfers Darstellung schließt die Not des gedemütigten Königs und die Not des gekränkten alten Mannes und Vaters zu einer höhern Einheit zusammen: er spielt die beleidigte Majestät edlen Menschentums. Herrlich in der Anfangsszene, da Cordelias nur korrekte Antwort alles Süße seiner Brust in Bitteres verwandelt, wird Klöpfer dann, in den Stadien der Demütigung und Verzweiflung, etwas umständlich im realistischen Ausdruck greiser Hilflosigkeit. Aber sein Strauchelschritt eines verwundeten Riesen, sein Tasten ins Leere, die Qual im Blick und auf der zitternden Lippe, und wie sich immer dichter und dunkler Gewölk um seinen Geist zusammenzieht, das hat durchaus Größe. Wunderschön, wie er dann, im Wahnsinn, eigentlich nicht mit Willen redet, sondern aus zerbrochener Seele der Inhalt ausfließt. Das Wiedersehen mit Cordelia findet gewissermaßen schon über den Wolken statt, in der klaren, reinen Höhe absoluter Liebe, und die Klage um das tote Kind hat zartesten Klang: die schon vom Leib gelöste, entschwebende Seele spricht sie. Klöpfers Lear steht wurzelfest und wipfelbreit da auf Shakespeares Erde. Ein paar tote Äst’ und Zweige besagen nichts gegen die naturgesegnete Lebensfülle der Erscheinung.
Shakespeares Narren haben etwas geheimnisvoll Unpersönliches. Es ist schwer zu glauben, daß sie außerhalb ihres Narren-Seins noch ein Sein besitzen; ich kann mir diese Hüpfenden und Kauernden in keiner andern Lebensfunktion denken als in der besondern, die sie auf der Szene üben. Sie sind namenlos, eine Art Einzel-Chor, die als Torheit verstellte Stimme der Vernunft, die witz- und gleichnis-reiche Kritik des Geschehens, Warnung und Prophetie, Spott und Trost. Sie produzieren Sinn durch Kreuzung von Unsinn und Übersinn. Sie sind zwei-dimensional, Wort ohne Mund, Geist ohne Kopf, Mitleid ohne Herz.
Gustav Waldaus bezaubernder Narr hat nichts Irreales. Er ist ein warmblütiges, inniges Lebewesen mit Herkunft und Schicksal, Diener und Kamerad des Königs, gewiß zumindest Hofrat im Ministerium für Narretei, ein delikater älterer Herr, ein feiner Mensch, aus Mitleid wissend, Treu und Liebe im sanften Bernhardinerblick.
Helene Thimigs lichte Cordelia: eine Symphonie in Weiß und Weich. Wahrlich, der arme Lear darf diese Cordelia sein Schmerzenskind nennen. Auf ihren Lippen brennt das süße Salz der Tränen, ihre Augen sitzen wie Stigmata des Leids im durchsichtigen Antlitz. Immer ist man gewärtig, die zarte Erscheinung Flügel aufspannen und entschweben zu sehen. Blick und Stimme tun das ja auch. Was sie sinnt, ist Harfe, und was sie spricht, vox celestis. Da sie dem König tot im Arme hängt, scheint Cordelia wie abgenommen vom Kreuz des Lebens; keinen würde es wundern, oben, in Schnürbodenhöhe, eine weiße Taube flattern zu sehen. Es ist schlechterdings die Legende von der heiligen Cordelia, die Frau Thimig, obgleich Shakespeare ja als profaner Schriftsteller gelten darf, uns vorspielt.
RICHARDII – erleidet ein Spezial-Schicksal, wie es nur Männern der monarchischen Branche widerfahren kann … aber dieses Schicksal schmilzt über in ein Menschenschicksal von bezwingend allgemeiner und großartiger Gültigkeit. Das ist der Geniezug des wunderbaren Werks, in dem, zwischen hingetürmten Quadern des Geschehens, hoch der Gedanke steht und Empfindung in sattester Herzblutfarbe blüht. Richard stürzt vom Gipfel – Königspech! – aber sein Sturz wirft ihn in die Gemeinschaft der Erniedrigten und Beleidigten. Alle Gekränkten, Mißhandelten, Verstümmelten dürfen ihn als Bruder im Leide grüßen. Er war von Gottes Gnaden ein flacher, leerer König und wird von Gottes Ungnaden ein voller, strömender Mensch, aus dem die Not Süßigkeit und Weisheit keltert. Er stürzt in die Tiefe aufwärts.
RICHARDIII – Jeßners «Richard III» gibt den Versuch einer theatrischen Kristallisierung des Werkes. Im Bühnenbild, im Bühnenvorgang, in Spiel, Ton, Haltung der Akteure soll sich das Essentielle der Dichtung, ihre wirkende Idee, ihr innerstes Formgesetz prägnantest offenbaren. Als Gewinne solcher Regie ergeben sich: Reinheit, Härte, Schärfung aller dramatischen Linien und deren Zusammenfassung zu ein paar formbestimmenden Kanten, Durchsichtigkeit, Ersparnisse an Zeit und Mitteln. Verloren geht: die Shakespearesche Fülle, Rund- und Buntheit, Wärme, Farbe, das reizvoll Schwankende und Fließende organischen Lebens, aller Zauber gemeinen Theaters, alle Ober- und Zwischentöne der dramatischen Melodie.
Die Gruppen, die Jeßner stellt, erstreben Reliefwirkung. Richard hält seinen Monolog vor geschlossenem Vorhang: er tritt aus der Bühnensphäre heraus in eine neutrale Luftschicht. Will sagen: er begibt sich auch körperlich ins Prinzipielle. Die drei Bürger, die Volkesstimme sprechen, tun dies gleichfalls vor der Kurtine, so ihre Unpersönlichkeit, ihr Typisches betonend. Des Clarence muntre Mörder setzen sich, Rücken an Rücken, auf den Souffleurkasten. Wir sind Theaterfiguren, heißt das, Kinder des Witzes und der Phantasie.
Alles sehr schön und fesselnd, aber alles auch sehr kalt und abstrakt. Hingeopfert dem Geist der Dichtung … fließt in Strömen ihr Blut.
Grundsatz der Knappheit und Exaktheit wird übersteigert. Beispiel: Richard hat den Leichenzug aufgehalten, entschlossen, ein Weib in solcher Laun’ zu freien. Bei dieser Freiung sind Zeugen überflüssig. Jeßner läßt Träger und Begleitpersonen der Leiche nicht von der Bühne abgehen, sondern auf Kommando kehrtmachen. Nun stehen sie (indes Richard wirbt) minutenlang mit dem Gesicht zur Mauer, ganz nah bei ihr. Es sieht so aus, als ob sie ihre kleine Notdurft verrichteten.
Gar nicht komisch ist die Clowngeste, ist das «Ksch, ksch», mit dem der Mörder den Dolch in Clarences Brust stößt; gar nicht komisch, sondern nur albern. Shakespeares Mörder haben ihre Komik, aber es ist nicht die des Wurstels. Sie erfließt aus dem vollkommenen Fehlen des Pathetischen bei einem Tun, dem, nach gemeinem Gefühl, höchstes Pathos zukäme. Wenn der Clown die Hacke, die ihm im Schädel stecken geblieben ist, gar nicht spürt, so wirkt das heiter. Wenn die Seele des Shakespeareschen Mörders den Mord, den sie auf sich nimmt, gar nicht spürt, so wirkt das auch heiter. Was dort der drollig-unverletzbare Schädel, ist hier die drollig-unverletzbare Amoralität. Es ist Seelen-Clownerie. Mit den Techniken des dummen August hat sie nichts zu tun.
Nachdem Richard König geworden ist, erscheint die vielberühmte Treppe auf der Szene. Sie verjüngt sich nach oben und steht frei und unvermittelt im Raum. Zeichen, daß wir sie nicht als Treppe zu nehmen haben, sondern als Spielebene in der Vertikalrichtung. Dem Spiel wird gleichsam eine neue Dimension gegeben, die uncharakteristische Bewegung nach rechts oder links wird ergänzt durch signifikante Bewegungen nach oben oder unten. Da Menschen aber nicht wie Fliegen auf einer senkrechten Wand sich fortbewegen können, mußte diese Wand (eigentlich sollte sie rechtwinkelig zur Bühne stehen) zur Treppe werden. Wenn schon nichts anderes, erwirkt sie zumindest jene oft und gern geforderte «Gestuftheit» des Spiels.
Auf dieser Treppe träumt Richard seinen Schreckenstraum vor der Schlacht. Höchst wirkungsvoll die rhythmische Unterstützung, die dem Stöhnen seines bedrängten Herzens durch Trommelschläge zuteil wird. Auf dieser Treppe produziert Richard, rot beleuchtet, die letzten Haß- und Wutkonvulsionen seiner furchtbaren Seele, auf dieser Treppe kündet der flache Richmond, weiß beleuchtet, seine edlen Entschließungen, von dieser Treppe endlich reitet Richard, verstrickt und verfangen in den Rhythmus seines Schreis: «Ein Pferd, ein Pferd …» in die Spieße der Rächer. Warum er mit nacktem Oberkörper erscheint, weiß ich nicht, könnte es aber so oder so oder so erklären. Zum Beispiel damit, daß diese Nacktheit den Eindruck vermittle: letztes Freisein von jenerlei Hemmung. Gewissermaßen: das nackte Tier kommt zum Vorschein. Jedenfalls hat der rote Furor, der über diese Treppe schäumt und stampft und rast, vorwärtsgepeitscht von unerbittlichen – Shakespeares Wort überdröhnenden – Paukenschlägen und Drommetenklängen, sein Hinreißendes und Mitreißendes. Zuschauers Aug’ und Ohr bekommen Feuer zu schlucken; kein Wunder, daß er in Hitze gerät. Nur glaube ich, daß solche Wirkung ganz unabhängig ist von Shakespeare und seinem Werk. Sie stellte sich wohl ein, auch wenn keiner wüßte, hier handle es sich um Verkörperung einer dichterischen Vision, um einen tragischen König und einen königlichen Tragiker.
Jeßners Richard reitet in die Schlacht. Aber ohne Pferd. Er hopst nur, mit gegrätschten Beinen, so, als wäre ihm ein Pferd zwischen den Schenkeln. Das Pferd bleibt also weg: das Roß absorbiert vom Reiter, die Idee Pferd ausgedrückt durch stilisierte Bewegung. Es kann auch sein, daß Richard, vom Wunsch nach einem Pferd besessen, dieses Tier so lebhaft imaginiert, daß er es tatsächlich zwischen den Beinen zu haben wähnt. Jedenfalls wirkt es verblüffend, denselben Richard, der auf einem nicht vorhandenen Pferd reitet, die – metaphorische – Krone, die er für ein Roß ausbietet, tatsächlich in Händen halten zu sehen. Hier scheinen die Regie-Grundsätze ins Wanken geraten. Oder wie ließe sich Verflüchtigung der Realität und Handgreiflichmachung der Metaphern unter einen Stil bringen?
Kortners Richard ist ein Schwarzalbe. Ein Exekutivorgan der Finsternis. Ein dämonisches Scheusal, losgelassen auf eine faulende Welt, ihren Zerfall zu beschleunigen. Das alles ist er. Nur ein König ist er nicht, weder in der Horizontalen noch auf der Treppe. Er bleibt immer ein reißender Plebejer, ein finsterer Nieder-Mensch. Daß, wo er hintritt, Friedhofsgras wächst, ist zu glauben. Weniger, daß nicht augenblicklich jedermann das Gemeine in ihm spüren sollte, den schlechten Geruch von seiner Seele Atem. Am allerwenigsten, daß eine königliche Frau, und wäre sie selbst in weit besserer Laune als die arme Anna, an dem Schleim dieser Kreatur kleben bliebe. Die schauspielerische Urkraft, die in Kortner steckt, die Hitze seines komödiantischen Geblüts, die Leidenschaft, mit der er zugreift, die Figur in sich, sich in die Figur hineinwühlt und niemals locker läßt, hat ihr Bezwingendes.
DER KAUFMANN VON VENEDIG – In diesem hochberühmten Theaterstück wird dargestellt, wie die Gradheit und Genauigkeit eines schlimmen Juden an dem talmudischen Dreh braver Christen zuschanden wird. Um einen Schwarzalben dreht sich leichtsinniger Reigen der Lichtalben, treiben Amoretten ihr vergnügliches Spiel. Aber der Schwarzalbe ist der einzige Mensch in der Komödie, der einzige Mann, der einzige Charakter. Er ist böse, finster, häßlich, aber treu sich selbst, folgerichtig denkend und handelnd, tapfer stehend gegen übermächtige Mehrheit. Er ist das einzige Temperament in der Komödie, die einzige Figur, die ein Schicksal durchleidet und in Verstrickung gerät, deren Fäden aus ihrem eigensten besondern Sein gesponnen sind. Er ist der wahre Held des Dramas, hingerissen zu Kampf, Triumph und Sturz. Die andern? Dutzendmenschen, Lebemänner, Beaux, Spieler und Springer, übermütige, reiche Mädchen, Karnevalsfiguren, umkreist von einem Schwarm von Narren, Tänzern, Musikanten, Köchen und Liebedienern. Er, Shylock, das einzige Antlitz inmitten hohler Masken, durch die unbegreifliche Kunst des großen Perruquiers William für Abend-Dauer menschenähnlich gemacht.
EIN SOMMERNACHTSTRAUM – I. IM BURGTHEATER. Im «Sommernachtstraum» des Burgtheaters gibt es vielerlei Schabernack, zum Beispiel wenn Zettel an einem plötzlichen Seil über die ganze Bühne schwingt, oder wenn Hermia sich dem unsichtbaren Oberon auf den Schoß setzt. Auch Puck wird einmal, zweimal hochgezogen und schwebt in Lüften. Aber solch armes Wunder der Technik stört in einer Zauberwelt, in der ja nichts ist, das nicht Wunder wäre, Spuk, Geisteratem und übermütige Natur, entbunden vom Gesetz, in einer Welt also, in der Spinngewebe, fühlt man nur, daß es da, besser hält und trägt als das Drahtseil des Bühnenmaschinisten.
Fräulein Hilde Wageners Puck ist ein munterer Kobold, ein Rüpelchen, das Oberon adoptiert hat, mehr ein erdig als ein luftig Wesen, vergnügt bis zur Quietschvergnügtheit und der schlimmen Streiche froh. Der Busch, in dem dieser Puck zu Hause ist, heißt Wilhelm.
Frau Wohlgemuts Elfenkönigin brachte Kühlung in die Sommernacht. Was wäre sie für eine herrliche Titania im Schnee! Von des Burgtheaters Theseus und Hippolyta kann man gar nichts sagen, von den Liebespaaren, daß sie ihr Streitquartett ohne sich zu schonen exekutierten. Es wurden da große Mengen Fröhlichkeit herangeschafft. Die Fröhlichkeit selber sah man nicht recht, aber man sah, wie sie ausgepackt wurde, und es muß ihrer wohl, zu schließen nach dem emsigen Tun, das hierbei sich entfaltete, ein ziemliches Quantum gewesen sein. Was aber die Handwerker anlangt, so glaube ich, daß auch die Drastik ein Maß hat, über das hinausgequält sie aufhört, komisch zu sein. Einfalt, wird sie zur Viecherei übersteigert, verliert ihre köstlichsten Essenzen; denn die sind immerhin an Menschliches gebunden und schwinden, wenn dieses schwindet. Es hat mich stets gewurmt, daß Herzog Theseus nicht zum Ende der Rüpelkomödie sagt: «Gebt den braven Leuten Wein und ein Stück Geld», daß er sie ohne was Huldreiches abziehen läßt. Seit der Aufführung im Burgtheater kränkt es mich nicht mehr.
Die Musik hinter die Bühne zu verlegen, war gewiß ein netter Einfall. So lieblich und sommernachtverträumt sie ist, es wäre doch reizvoll, einmal diesen Shakespeare ohne Mendelssohn zu hören, mit einer diffuseren, verwehten, weniger orchesterstückhaft auftretenden Musik, mit einer also, die nicht so richtiggehend «Musik» wäre (und dann auch nicht, wie im Burgtheater, Opern-Ballett und -Chor heranlockte). Viertel, in Dresden, hat das versucht – ich glaube, nur hochschwirrende Geigentöne machten das Klingen des Waldes –, und es soll wunderschön gewesen sein. Doch mit oder ohne Mendelssohn: das unbegreifliche Werk steckt ja so voll ewiger Melodie, daß die Engel unter allen Umständen mitsingen. Es ist eine Dichtung, die die Erde tanzen macht. Und sie wäre einsame Genietat, auch wenn sie nichts enthielte als das Wissen darum, daß die Liebe Blick-Trübung ist, mit ein bißchen Blumensaft hervorgerufen, mit Tropfen andern Augenwassers wieder weggewischt.
EIN SOMMERNACHTSTRAUM – II. BEI REINHARDT. Das Vergnügen – es war eines – dauerte dreieinhalb Stunden. Manchmal blieb das Spiel, wie Helenas und Hermias Kleid am Gesträuch, am zierlichen oder komischen Einfall hängen, kam nur mit Verlust von Minuten wieder los. Doch es ist zu begreifen, daß der Gärtner nicht das Herz hatte, seine Schere zu brauchen.
Zwei gute Genien halfen dem Theaterabend, daß er festlich würde: Grazie und Humor. Aus Seide und Pechdraht war ein Netz geknüpft, eine Schaukel (zwischen Erd’ und Himmel hat das Spiel ja seinen rechten Platz), lieblich bewegt vom Atem der Sommernacht. Die war mit Licht und Klang heraufbeschworen. Von ihrem Zauber angerührt fielen die Menschen aus der Vernunft-, fielen Baum und Strauch in die Märchenrolle. Der Wald lebte sein panisches Leben, die Stille tönte, und wie Sternbild leuchtete durch die Nacht die heidnische Trinität: Natur und Menschenwelt und Geisterwelt. Das ist zwar alles schon von Shakespeare so, aber von Reinhardt ist, daß er, es sei so, fühlbar gemacht hat. Der Spiegel seines Temperaments mühte sich, aller Schönheit und Heiterkeit der Dichtung zu schmeicheln, der Hokuspokus seines Theaters diente ihrer Magie. Manchmal wirkte dieses Bemühen, einen echten Zauber künstlich vorzuzaubern, freilich so, als befördere man einen Vogel, der fliegen kann, mittels Luftschiffs. Vom letzten Gelingen entfernt sich Reinhardts Regie durch ihren Hang zur Reichlichkeit – man sah oft den Wald vor Waldweben nicht –, durch ihre ungarische Freude am Auftischen und Nötigen. Witz und Phantasie tragen mehr zu, als der Dichtung zuträglich ist, und Shakespeare hätte es besser bei Reinhardt, wenn er es nicht so gut bei ihm hätte.
Die Dekorateure bauten dem Geist des Spiels einen transpa renten Körper. Gemalte Vorhänge, von einer gemalten Schnur gerafft, fügten sich zum hohen, luftigen Zelt: sollte Wald sein, wurden die Vorhänge durchsichtig, zeigten Ast-Geäder, und die Schnur konnte als Liane gelten. Es kamen dann Sträucher herein (auch als efeuumsponnene Baumstrünke oder lebende Blätterhäufchen zu deuten), und die Schauspieler hatten manchmal ihre Not mit den Blättern, aber das sind sie ja gewöhnt. Die Sträucher waren von armen Statisten-Elfen getragen, die während des ganzen Abends so umbuscht auf der Bühne hocken mußten. Ein Strauch wurde müde und legte sich, recht hatte er, ein wenig nieder. Über Zettels Rückverwandlung neigte sich anmutigst eine ad hoc heraufgestiegene sanfte Birke. Auch Oberon war belaubt: ein Waldkönig mit grünender Krone. Sein wunderschönes Kostüm (von dem jungen Amerikaner Ernest de Weerth) kommunizierte durch einen vier Meter langen silbergrauen Schleier – mein Sohn, es ist ein Nebelstreif – mit dem Dunstlicht des Waldes. Die Elfen tanzten, wie eben Elfen auf der Bühne tanzen, mit Arme-Schwingen und Kreisen und Nicken und Huschen. Daß ihnen die Bewegung Freude macht, glaube ich, auch daß Titania, wenn sie einschlafen will, sich zu diesem Zweck etwas vortanzen läßt, ist plausibel.
Der Herzog von Athen, Herr Kalbeck, machte sich nicht viel aus der Würde, sah lieber mit vergnügten Sinnen auf Frau Servaes, seine Hippolyta, eine fesche Amazonenkönigin, strahlend von Gesundheit und Laune.
Reizend spielt Hans Thimig den Lysander. Soviel Herz reimt sich auf seinen Scherz, und so natürlich gewachsen sind noch seine närrischsten Drolerien. Er hat ein Lächeln, das Verbindung herstellt zwischen Gefühl und Spott übers Gefühl.
Der große Bruder Hermann hat das auch und noch einiges mehr. Sein Zettel ist ein Sanguiniker, trunken vor Lust an der Lustbarkeit, die er bereiten helfen darf … dabei auch ein armer Teufel, der des Glücks, aus der eignen Haut schlüpfen zu dürfen, gar nicht satt werden kann. Daß grade er zum Eselskopf kommt, ist wie Strafe für seine Sucht, sich zu verwandeln. Sein Spaß übertreibt, gewiß, aber es ist ein Treiben, ein Über-Treiben im vegetativen Sinn. Wie herzig ist er mit Senfsamen, Bohnenblüte, Spinnweb, ganz gerührt, er weiß selbst nicht warum, gleichsam als Esel in zärtlicherer Nähe zur Natur denn als Mensch.
Puck: Helene Thimig. Ein Kobold in Moll, schwerübermütig. Er übte Schabernack als seine Pflicht.
Gustav Waldaus Peter Squenz bleibt immer ein glaubhaftes Menschenwesen, Fülle der kleinen Welt, in der er lebt, um sich und in sich. Hier in eine Situation gebracht, die er so gar nicht beherrscht, und in der er doch auch seinen Mann stellen mag, kommt er aus dem Gleichgewicht. Und wie er dieses Gleichgewicht verliert und nicht verlieren will, wie er den Eifer seiner Kumpane zu disziplinieren sucht und selbst von ihm mitgerissen wird, wie ihm Zettels ehrgeiziger Ungestüm, den er als wertvoll für die Sache schätzt, heimlich auf die Nerven geht, wie das Lichtchen seines Verstands schüchtern in die Narretei hineinblinzelt, wie er schließlich, Sprecher des Prologs, alle Sicherung als ohnehin egal aufgebend, still und bescheiden dahinrudert im Unsinn, sich treibt läßt, wohin es treibt – das ist von A bis Z meisterhaft, liebenswürdigst, ohne jede Gewaltsamkeit, ohne Tropfen Schweiß, von einer komischen Kraft, die so ganz natürlich und so ganz unbegreiflich ist wie das Leben selbst und zu Helfern manchen aus der Schar guter Geister hat, die Girardi dienten.
Calderon
DER RICHTER VON ZALAMEA – Ein Drama der Männer und der Mannestugenden, zusammengefaßt in einen Brennpunkt: «Ehre». Diesen Begriff haben die Jahrhunderte einigermaßen revidiert; in der romantischen Unbedingtheit, wie ihn der spanische Dichter gebraucht, ist er kaum mehr in Geltung. Dem Bauer, dem die Tochter vergewaltigt wird, mag das Leid und Kränkung bedeuten, aber seine Ehre nimmt von solchem Akzidens, heutigem Gefühl nach, keinen Schaden. Pedro Crespo denkt darüber noch anders. Da der Ehre nicht Recht geschieht, übersiedelt er auf die sittliche Forderung, daß dem Recht Ehre geschehen müsse. Eine hübsche Volte, die da seine Schlauheit schlägt. Uns, die Zuschauer befriedigt nicht so sehr das befriedigte Recht, als vielmehr etwas weit Erquicklicheres: der befriedigte Charakter! Daß einer kann, wie er will, daß einer sich behauptet, unverbrüchlich treu den Gesetzen, die sein Ich bestimmen, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen seiner Konsequenz, ist ein Märchen, so hold und unwahrscheinlich, daß ihm zu lauschen (erzähle es der Dichter oder das Leben) wir niemals müde werden.
In diesem Drama haben allein die Männer Seele. Von der Frau spielt nur das Antlitz mit, die Erscheinung, der Leib. Also doch ihre Seele.
Kleist
DIE HERMANNSSCHLACHT – Die «Hermannsschlacht» ist in des Wortes reinstem Sinne eine Gelegenheitsdichtung. Die Gelegenheit ergriff den Dichter, nicht umgekehrt. «Die Hermannsschlacht» ist auch im reinsten Sinne ein nationales Werk. Ein trotziges Lied der eigenen Art, keineswegs ein Loblied. Eine Erhöhung deutschen Wesens ins Überlebensgroße, nicht ins Überlebensschöne. Die Wurzeln deutscher Kraft und die Wurzeln deutscher Schwäche, ineinander verfasert, liegen bloß. Liebe zur bedrängten Heimat durchglüht das Werk; Wissen um die innern Gründe der Bedrängnis schmiedet das Glühende hart.
Kleists Hermann ist ein Genie. Ein witziger, weit vorberechnender Diplomat, ein skeptischer Menschenkenner, in Künsten der treuherzigen Verstellung unheimlich bewandert. Er zögert nicht, Not und Brand, als kämen sie von Feindesseite, in die eigenen Lager zu schmuggeln, um künstliche Quellen des Hasses zu erschließen, wo die natürlichen allzu träge springen. Er geht so weit, den Reiz der eigenen Frau seiner Politik als Hilfsmittel dienstbar zu machen, und nützt den Glauben an deutsche Treue, um besser Untreue üben zu können. Die Idee des befreiten Vaterlandes ist das Zentralgestirn, um das sein Denken und Wünschen kreist; ihr Sonnenlicht saugt den Sternenglanz aller andern sittlichen Ideen restlos auf. Sie scheinen verlöscht, sind aber nur überleuchtet. Nicht: so ist der Deutsche. Sondern: so kann der Deutsche sein, Weib, Kind, Besitz, Leib und Seele zum Opfer bringend, wenn es um Heimat und Freiheit geht, das eigene Selbst verratend, um das Vaterland nicht verraten zu müssen.
Thusnelda: Ein Riesenkind, ein Löwenkätzchen, spielerisch, königlich; ein tausendfach vergrößertes, echtestes Weibchen, zugehörig, hörig dem Manne, ihm verwandt an Stolz, Würde, hohem Sinn, dies alles aber locker im Gefüge. Aus ihrem Tun gleißt es sachte von geheimster Ur-Perfidie der Nerven. Und um ihre goldene Reinheit schimmert es sündhaft. Hermann und sein Weib: menschlichste Gigantenpärchen. Mit welcher klügsten Zartheit sänftigt er die fremde Unruhe, die er in ihrem Blute spürt. Wie ärztlichfein (und modern) ist das scheinbar rohe Gradezu, mit dem er ihr heimliches Gefallen am Ventidius heraufhebt aus ihrem Unbewußten, damit es dort nicht vergiftend weiterschwäre. Und wie unerbittlich schneidet seine Hand, als es die letzte radikale Heilung gilt. Es ist das kleine, sinnreiche Abbild der gewaltigen Kur, die er an dem faszinierten, schwachmütigen Deutschland übt.
Prachtvoll auch die Römerfiguren. Mit wutentzündeten Augen gesehen, aber doch: gesehen! Ein kleiner Ruck an der Belichtung, und es stünden begeisterungswürdige Helden da. Diener einer großartigen Macht-Idee, Genies ihres Dünkels, Eroberer aus einem Überschuß an Kraft und Können. Doch kein Wort von Schätzung, die der Mann dem Manne auch im Streite gern gewährt, fällt hier für die Römer. Es rinnt kein Tropfen Blutes «neutral» in Hermann. Der Haß hat den Mann zum Ding verzaubert. Er ist nicht Krieger, sondern Schwert. Nun scheint er gefühllos, herzlos, nicht wie ein grausamer Mensch, sondern wie eine Sache, für die moralische Wertungen überhaupt unzulässig sind. Und nur ein einziges Mal, echt deutsch, lockert sich der Zauber: als Hermann Gesang hört. Männergesang, nebenbei.
Ein dunkel tönendes Monument des Zornes steht die Dichtung da. Menschenbilder von hinreißender Leidenschaft der Haltung und Gebärde. Profile, in deren Linien wie in einer knappsten Formel ein unveräußerliches Gesetz der Art gefaßt ist. Szenen von solcher Wildheit, wie sie nur dem Blick ins Chaos menschlicher Natur sich offenbart. Szenen von mystischem Zwielicht angefüllt, darin der weitgeschwungene Kreis zwischen Gottheit, Mensch und Schicksal geschlossen scheint. Und Verse von dunkelfarbener schwirrender Pracht, so streng und klar gefügt und geschlungen, daß sie zu hören fast auch optisches Entzücken ist.
Büchner
DANTONS TOD – Die Revolution ist nicht eigentlich «Thema» der Szenenfolge, die der dreiundzwanzigjährige Georg Büchner, zwei Jahre vor seinem Tod, sozusagen erumpiert hat. Er nimmt auch keine Stellung zu ihr. Er verneint und bejaht sie nicht. Er sieht sie als gewaltige Blase im Schaum des Geschehens, tauglich, Erhabenheit und Erbärmlichkeit der Menschendinge, Macht und Ohnmacht des Menschengeistes in kühner Vergrößerung und Verzerrung widerzuspiegeln. Held des Dramas ist nicht Danton und nicht das Volk und nicht die Idee der Freiheit. Held des Dramas ist: der entfesselte Mensch. Unterm Höchstdruck der politischen Atmosphäre wird der essentielle Tropfen Bestialität, der ihm im Blute kreist, hervorgepreßt, aber auch die höchste Spannung erwirkt, deren seine Seele fähig ist. Höchst schauderbar und höchst liebenswert steht er da unter den spöttischen Sternen. Das ewig Wollende zieht ihn hinan, das ewig Hoffnungslose sperrt den ziellosen Weg. Daß er nicht begreifen kann, ist Gipfelhöhe seines Begreifens. Daß sein Sinnen sinnlos, Sinn seines Erlebens und Ersterbens. Darum triumphieren die «fixen Ideen» gegen die wandelbaren, das Starre gegen das Fließende, die Diener des Augenblicks gegen die Höflinge der Ewigkeit.
Die Figuren des Dramas sind überlebensgroß. Aufgereckt zu ihrem intensivsten Sein. Ihre Wildheit und Tücke, ihr gelassenes Töten und Sterben, ihre Ruhe und ihr Sprung haben was Raubtier-Prächtiges. Ihr Gehirn ist Pranke, ihr Wort Zahn, der ins Fleisch schlägt. Es geht ein Spiel um die Freiheit – im Käfig. Die Käfigstäbe, das sind: die Enge alles Wissens und Wollens, die unerschütterliche Tyrannei der Torheit im Menschenpferch, die Ohnmacht der Liebe, die Blindheit, die das Aug befällt, wenn es sich gottwärts wendet. Diese Käfigstäbe, zwischen denen der Kampf um die Freiheit tobt, prägen ihm (wie allen Menschendingen) das Gitterzeichen auf, das Mal, das bis an der Zeiten Ende versklavt. Dantons Seele trägt das Zeichen. Es macht ihn kraftlos und todbereit, stürzt ihn in Schwermut und zynische Gleichgültigkeit: das Rad läuft ohne Reibung. Er meditiert und formuliert und resigniert. Er ist müde, und seinem Herzen, angenagt vom taedium vitae, verströmt der Lebenswille ins Nichts. Seine Abkehr von Blut und Terror ist keine «sittliche». Die Fähigkeit, zweckzumorden, hört einfach auf, sie fällt ihm aus der Seele wie ein Gegenstand aus geöffneter, des Haltens müder Hand. Seine Reue über September und Revolutionstribunal wird zu kalt serviert, um das Herz zu wärmen. Die Diagnose: Erleuchtung und Erhöhung kann nicht gestellt werden. Eher die Diagnose: nervöser Zusammenbruch.
Unter der edlen Glasur des schwärmerischen Desmoulins steckt zu wenig menschliche Substanz, als daß man ihn recht zu spüren bekäme. Die Frauen haben Schillersches Format. Sie tragen ein schönes Herz in schönen Händen, aber sie huschen ganz schattenhaft hin, nur ein eiliger Hauch ihrer Wärme streift vorüber. Wie Danton und die Seinen zum Tode stehen, das hat Heroenmaß. Der Hörer ist erschüttert – und lechzt nach Verwirrung des Faltenwurfs, nach einem Stück nackter Kreatur, das die Toga freigäbe. Sind diese Verächter des Todes nicht abgeblitzte Liebhaber des Lebens? O edler Prinz von Homburg! Und das Volk? Es soll, wie kritische Klischeeisten das von jedem Revolutionsstück behaupten, der eigentliche Held sein. Wahrlich, dazu hat es Büchner nicht gemacht. Es wälzt sich um die großen Individuen des Spiels als eine amorphe, dumme, grausame Masse, die den Gestürzten höhnt, dem, der das letzte Wort hat, Zustimmung brüllt und nicht am selben Tage, nein, mit demselben Atem noch, mit dem es «Hosiannah!» schrie, «Crucifige!» ruft.
Durch das Werk springt eine Flamme, die Gesichter und Gesichte, auf die ihr Schein fällt, mit Glut übergießt und alle Erscheinungen gespenstische Schatten werfen macht. Es ist die Inbrunst des geistigen Fassen- und sprachlichen Gestalten-Wollens, die dem Werk, das undramatisch, skizzenhaft und zerrissen ist, Magie der Bedeutsamkeit gibt. In der Sprache von «Dantons Tod» klingt die Stimme einer kreißenden, mit Unheil und Erhabenheit schwangeren Zeit. Neben dem finsteren Pathos, dem heroischen Witz, der Ekstase des Wollens und des Verzichtens, die in dieser Sprache laut werden, tönt der konstruierte Überschwang heutiger Stürmer und Dränger wie eitel Blech. Man sagt mit Recht: Shakespeare, wenn man Büchners Diktion werten will, so kühn und reich strömt der Gedanke, und so bis an den Rand füllt er die Worte-Form, in die er, sie schaffend, sich ergießt. Nur das über den Dingen Schwebende, der umspannende Schöpferblick, der Gleichmut der Distanz fehlt natürlich dem Jünglingswerk. Es ist, vom Fieber der Genialität geschüttelt, «bald Frost, bald Hitze».
WOYZECK – Füsilier Woyzeck müht sich, der Geliebten und dem Kind ein paar Groschen zuzuschanzen. Er verdingt sich der Wissenschaft, dem Doktor, als Versuchsobjekt. Er darf, experimenti causa, nur Erbsen fressen und den Harn nicht lassen, außer in des Doktors Tiegel. An dem armen, dummen Teufel wischt sich jeder die Schuhe. Die «Mächtigen», der Doktor, der Hauptmann, treiben Schindluder mit seiner Ohnmacht, die guten Menschen sind ahnungslos, die gleichgültigen roh, die Natur eine boshafte Einrichtung zur Pflege von Elend und Unrecht, goldfarbene Pappe sind die ew’gen Sterne, die Erde ein umgestürzter Hafen, und in des Schicksals Hand ruhst Du, Mensch, sicher wie im offnen Raubtier-Rachen. Ein Kerl mit fuchsrotem Bart, Typ des echt deutschen Mannes, greift nach Woyzecks Mädel. Sie gibt sich ihm, einem bestialisch-gesunden Naturgesetz gehorsam. Und der Füsilier tötet sie. Ohne Haß, ohne Zorn, gleichsam durch seiner Seele Schwere in die Tat gestürzt.
Daß er kein Geld hat, ist sein Unglück. Das Tragische des Woyzeck aber ist ein anderes: daß er keine Worte hat. Daß er sein Leid nicht artikulieren kann. (Wie dem Hund auf dem Weg vom Herzen zum Maul alles nur Gebell wird.) Daß ihm Erlösung versagt ist aus der Hölle der Dumpfheit. Gefühl des Verfolgt- und Gehetztseins kann sich nicht entspannen in Klage, Anklage. So sprengt es die Nähte von des braven Woyzeck Seele, macht sie undicht: einströmt alle Finsternis der Welt. In dem Dichter erstand dem erdgebundenen Opfer, das seine Sache nicht führen kann, der Fürsprecher. Aus solcher Fürsprach’, aus der sanften Gebärde, mit der der Poet die arme Kreatur ans Herz nimmt, strömt ein Hauch evangelischer Milde durch das düstere Spiel, der Zorn ist und Anklage.
Es demaskiert das Antlitz der Welt als gespenstische Fratze. Es demaskiert den Menschen. Wo der nicht Dämon ist, ist er von Nestroy.
Ein deutschestes Stück. Urdeutsch diese Trübsal, dieser Galgenhumor, dieses grimme Mitleid, diese Fronde gegen Gott und diese tief verhehlte romantische Sehnsucht nach seiner Dazwischenkunft.
Der «Woyzeck»-Entwurf scheint wie Fieberarbeit eines Menschen, der keine Zeit hatte. Er hatte ja auch keine Zeit, der Jüngling-Dichter, dem schon das Abrakadabra moderner Theatermagie auf den Lippen war, als der Tod sie eilig schloß (wie um einen Vorlauten am Ausplaudern noch nicht reifer Geheimnisse zu hindern).
Eine Reihe von Szenen, kurz aufleuchtend: wie Fragmente einer Landschaft, die der Blitz für Sekunden aus dem Dunkel reißt.
Hebbel
MARIA MAGDALENA – ist so quälend wie am ersten Tag. Katharsis und Befreiung wollen sich nicht einstellen. Ein weiches Menschenkind gerät in die törichteste bürgerliche Moral-Maschine und wird zu Tode torquiert. Meister Antons «Knorrigkeit» ist hassenswerter als des Kassierers Leonhard Niedertracht. Es steckt Majestätisches in dem harten Tischlermeister, aber eine viehische Majestät. Seine Rechtschaffenheit ist ein drohend aufgesperrter Rachen: Wehe dem, was zwischen ihre eisernen Kinnbacken gerät! Sie zermalmen alles, auch das eigene Fleisch. Aber der Kinderfresser, indes ihm das Blut von den Zähnen tropft, bewahrt Haltung. Sein Avis an die Tochter, er würde sich, hütete sie nicht ihre Tugend, die Kehle durchrasieren, ist Erpressung, Nötigung, Verbrechen. Seine Anständigkeit finsterer, barbarischer Hochmut. Sein kleinbürgerliches Ich-Gefühl, in pathologische Zersetzung übergegangen, lähmt und vergiftet, was in seines Atems Bereich kommt. Meister Anton sollte trotz seinen sechzig Jahren einen pechschwarzen Vollbart haben. Viele Helden Hebbels tragen schwarzen Vollbart: Herodes, Holofernes, Kandaules, Hagen. Das muß was zu bedeuten haben.
Raimund
DER ALPENKÖNIG UND DER MENSCHENFEIND. An der Spitze des Zuges wunderlicher und liebenswerter Gestalten, der Ferdinand Raimund, dem Mann aus dem Volke, als fürstliche Suite in die Unsterblichkeit folgt, schreitet der Rappelkopf. Er ist um einen Kopf höher, um ein Herz reicher, um ein paar Nervenbündel komplizierter als die andern, und seine Stirne zeigt das Falten-Zeichen der tragischen Würde, die der Titel Mensch verleiht. Zur Schöpfung dieser Figur hat der Dichter den Dämon, der ihn selbst plagte, in Dienstpflicht genommen. Und ihm glückte hier, mit den arglosen Listen des Zauberstücks, in Possen- und Märchenfarben, ein Charakterbild, das viele spätere Psychologie und Pathologie genialisch vorwegnimmt. Rappelkopf ist ein Kranker. Seine Seele hat, wie man heute sagen würde, ein «Trauma» erlitten, das Gifte des Mißtrauens und des Hasses zeugte. Eine natürliche Disposition war freilich auch vorhanden: Rappelkopf, wie das kostbare Lieschen sagt, hatte «was Düsteres, selbst wie er noch Buchhändler war». Die Heilung des Misanthropen vollzieht sich nach neuesten Methoden: der gute Alpenkönig – ein gemütvoller Zauberer, der nur leider eine, bei so naturverwandtem Wesen doch sonderbare Sympathie für den Tier-Mord der Jägerei hat – verdoppelt das Ich des Rappelkopf und erzielt damit die gleiche Wirkung, als ob er es gespalten hätte. Nun sieht er sich, der Menschenfeind, das Schlimme, das er in Tiefen herbergte, kommt ihm zu Bewußtsein, wird dort gefaßt und hinausbefördert. Im Märchenspiel geschieht das so, daß Rappelkopf, der in der Tinte sitzt, wo sie am galligsten ist, vom Alpenkönig mit der Kratzbürste reingescheuert wird. Die Heilung des Gemütskranken vollzieht sich hier noch mit allem Applomb einer moralischen Besserung. Der Geist, der des Dunkels Herr wird, erscheint nach außen projiziert, als leibhaftiger Geist mit Kron’ und Bart, den Tempel der Erkenntnis deckt ein marmornes, kein Schädel-Dach, und der gleiche Mechanismus, der die Kulissen bewegt, bewegt auch die Seelen.
Aber wie viel echte Magie wirkt der kindliche, theatralische Zauber! Wie viel Blutwärme und Lebenston hat diese prinzipielle Figur des Menschenfeinds von dem Dichterherzen, an dem sie gelegen, abgekriegt! Wie grünt und blüht der Pappendeckel, aus dem die Welt des «romantisch-komischen Märchens» geschnitten ist! Wie kräftig atmet die gemalte Erde, wärmt die Sonne aus Goldpapier! Ganz erfüllt von Menschenliebe scheint dieses Spiel von Menschenhaß. Mit welch gütigem Humor, wie zärtlich-nahe ist das Lumpenvolk in der Köhlerhütte gesehen, wie viel frohe Bejahung selbst des elenden Lebens in der Realistik dieser unvergleichlichen Szene! Auch die Tränen, die in diesem Märchen geweint werden, sind ein Spiegel, der der Welt schmeichelt, ihre Bosheit und Torheit zu Schönheitsfehlern herabmildert. Das tiefste Stimmungsdunkel, das erreicht wird, ist das eines melancholischen Optimismus.
Thallers Rappelkopf ist prachtvoll in seiner Mischung von Galligkeit, Narretei und Mutterwitz. Die Wut dieses Menschenfeindes schmeckt wie ranzig gewordene Bonhomie. Der Strom von Bitterkeit, der ihm aus dem Busen springt, schleppt so viel Skurriles und Launiges mit, daß er die Landschaft mehr heiter als düster belebt. Dieses wienerische Herz kann keinen Winter vormachen, höchstens einen verregneten Sommer.
DER RAIMUND ALS MILLIONÄR – «Der Bauer als Millionär», Original-Zaubermärchen von Ferdinand Raimund, im Burgtheater mit höchstem Aufwand ausgestattet, mitwirkend, was gut und teuer, Fortunatus Wurzel: Herr Girardi.
Sicherlich eine Ehre für Ferdinand Raimund, so leutselig von Original-Hofschauspielern bedient zu werden. Aber «die Zufriedenheit» schüttelte ihr sanftes Haupt und sagte, sie ziehe lieber in die Vorstadt. Auch «der Humor» fühlte sich nicht wohl. Es fröstelte ihn inmitten der Pracht, er schlich scheu die Wände entlang und drückte sich, sowie er nur konnte, aus der protzigen Gesellschaft. Ihm folgte «die Gemütlichkeit», «das Behagen», «die trauliche Stimmung», «das Märchen» und «die himmlische Einfalt». Ihre lästige Kopie, die falsche Naivität, blieb und machte sich breit.
Ein Raimund für neue Reiche. Alles ganz «echt», und eben darum so dürftig. Hätte sich unter dem allegorischen Personal des Raimund-Spiels die «Armut» befunden, so wäre sie im Burgtheater mit einem Hungertuch aus Brokat erschienen und einem Bettelstab aus dem vornehmsten Atelier für Kunstgewerbe.
Ein so aufgeblasenes Zaubermärchen ward noch nie gesehen. Aber schließlich: was sollte, was konnte das Burgtheater denn andres für den «Bauer als Millionär» leisten? Er machte sich der Grundlüge schuldig, so zu tun, als handle sich’s da um ein Werk, dem in seiner Totalität höchste Theaterehre zu erweisen sei. Und aus dieser Grundlüge quoll alles Übel. Das Märchen hat zwei bezaubernde Szenen, in denen unverlöschbar der Dichtung Urlicht brennt, und ein paar liebe Worte im traulich-fidelsten Dialekt des wienerischen Herzens. Der Rest ist rührender Tand. Urväter-Poesiehausrat, längst teils der Rumpelkammer, teils dem Museum verfallen. Das Burgtheater aber heuchelte auch hier Liebe. Und schenkte, wie man eben nach dem Leitsatz: «Vornehmheit verpflichtet» schenkt. Nicht, weil’s den Geber freut, und daß es den Beschenkten freue, sondern so, daß das Geschenk «nach etwas aussähe».
Die Feen trugen herrliche Toiletten, die Magier Phantasiekostüme edler Art und kostbare Pelzbarette. Als sie noch Zuckerhüte trugen, mit aufgeklebten Sternen aus Goldpapier, waren sie viel magischer, die Magier.
Der spaßige Märchen-Krimskrams erschien feierlich und festlich aufgedonnert. Ach, die lieben Feen, Zauberer und Geister! Im Burgtheater kamen sie hochdramatisch, und es gab Charakterstudien.
Die Musik, sonst ein sanftes Bächlein, Landschaft freundlich widerspiegelnd, war zum Strom geschwollen. Er drängte sich zwischen die Szenen und schäumte wagnerisch. Zu Fortunatus Wurzels Verwandlung in einen armen Bauern blies das Englischhorn Tristan-Melancholien. Raimund dachte sich’s wesentlich spaßiger. Seine entzückende Regiebemerkung lautet: «Die Musik drückt das Brüllen der Ochsen aus.»
Illi, Briefbote im Geisterreich, kam auf einem lebenden Schimmel, weil sich das Burgtheater das leisten kann. Um so erstaunlicher, daß in Wurzels Heimatstall kaschierte Ochsen den Kopf aus dem Stall stecken. Ist das Burgtheater auf kaschierte Ochsen angewiesen?
Aber den Fortunatus Wurzel spielte Herr Girardi. Da ging es wirklich zu wie in der Raimundschen Feenkomödie: mit einem Schlag versank all der kostbare Plunder, Natur übte ihren schlichten Zauber und ließ die Menschen froh werden. Da war, so mühelos!, alles da, was die ganze pompöse Raimund-Andacht dem Himmel nicht abzubetteln vermocht hatte: Humor und Rührung und Märchen-Schwerlosigkeit und der weiche Atem wienerischer Luft. Da kamen, ohne Wolkenschleier und Nebelschwaden, alle guten Geister des Volksstücks und dienten ihrem Herrn. Nie war der Genius Girardis deutlicher fühlbar als diesmal, inmitten von so viel Fleiß, Tüchtigkeit, Arbeit und Aufwand. Nie war seine Laune erquicklicher als an dieser steifen Hoftafel zu Raimunds Ehren. Nie war sein schmeichlerisches Wienertum so bezaubernd wie inmitten dieses angestrengten, mit großem Rituale den Geist eines liebenswerten Volksdichters mehr hinab- als heraufbeschwörenden Hokuspokus.
Die bombastisch-naive, verlogen-volkstümliche Aufführung des «Bauer als Millionär» war etwa so, wie wenn Elektrotechniker, mit vollkommenen Apparaten ausgerüstet, sich bemüht hätten, die Illusion einer herrlichen Ölfunzerl-Beleuchtung hervorzurufen. Ganz entgegen dieser närrischen Methode wirkt Girardis Künstlerschaft: sie erhöht Geringstes zum Symbol des Großen. Sie macht aus einer Geste ein Charakterporträt, aus wenigen schlichtesten Worten die Formel für einen Menschen. Und verzaubert mühelos das Ölfunzerl zur lieben Sonne.
Nestroy
OPUS VIRUMQUE CANO – Nestroys Figuren sind ein Produkt der Luft, die sie atmen, der Sonne, die ihnen scheint. Sie stecken in ihren Gassen und Stuben, in den Stätten ihrer Arbeit und ihres Vergnügens, in den Tugenden und Lastern, die das moralische Klima des Erdenflecks gedeihen läßt, wie in ihrer Haut, aus der sie nicht können. Der Geist der Dinge, um die ihr Sinn im engsten Kreise kreist, ist in sie gefahren. Es gilt nicht nur so zum Spaß, daß sie Zwirn, Leim, Knieriem heißen: das Handwerk, das sie üben, übt sie.
Nestroys Stücke sind leichthin konstruierte, spielerisch bewegliche Modelle der Welt, die ihm Heimat war. Dem Klaren und Trüben, dem Witz und Aberwitz, Geist und Ungeist, Charakter und Uncharakter dieser Welt gab er Gestalt und Wort. Seine Hellhörigkeit vernahm die Naturstimmen des Lebens, der Land- und Menschenschaft um ihn, und sein Genie fand die witzigsten Zeichen, sie zu fixieren.
Über seinen Gestalten schwebt das Lächeln der Götter, zumindest jener, die mit Wien etwas zu tun haben. Denn Nestroys Menschen sind artikulierte Natur, seine Schwänke lustigste, weiseste Menschen-Fabeln. Man muß diese närrischen, vom Dichter belebten Lebewesen aus dem Wiener Busch, auch die Argen und Schlimmen, die Faulen und Gefräßigen, die Tölpel und die Übertölpelten, lieben, man kann Reineke Mensch so wenig böse sein wie Reineke Fuchs. Nestroy war kein Moralist. Wenn bei ihm die Tugend das Laster besiegt und Hochmut vor dem Fall kommt, so ist das ein sittliches Ordnungmachen weniger um der Sittlichkeit als der Ordnung willen. Nur keine Schlamperei.
Den Kleinen von den Seinen kam er als Erlöser. Er lockerte ihnen das Herz und die schwere Zunge: nun reden sie im Idiom ihres Mundes das Idiom ihrer Seele. Er gab der Einfalt Witz, sich zu bekennen, den Armen im Geiste die Philosophie dieser Armut, der Narrheit Grazie, den Plumpen und Schweren die Impertinenz ihres bessern Gleichgewichts, den Vagabunden die goldene Laune der Freiheit, den Habenichtsen den Humor des Unbelastetseins und Nichts-mehr-verlieren-könnens. In der Komik dieser Figuren löst sich alles Niedrige ihrer Art und Gesinnung. Verwandelt und verklärt ist das Gemeine (das uns alle bindet) durch das Lächerliche (das dies auch tut). Unvergleichlich heitere Landschaft der engen Horizonte, Fata morgana einer allerfidelsten Kleinbürgerei, holder Trug der Wienerluft-Spiegelung. Weich im Raume stoßen sich die Menschen. Pathetische Substanz wird zerbröselt und weggeweht von Gelächter.
Nestroy hat den absoluten Humor der Welt, in der er zu Hause ist, gesehen, ihre konstitutionelle, nicht zufällige Possierlichkeit. In den Figuren (die er, sie entdeckend, erfand) scheint der Typus auf seine letzte Spaßigkeitsformel gebracht, seine innerste Komik befreit, herausgesprengt aus allen Bindungen. Naturalistisch ist an diesen Figuren, trotz ihrer himmlischen Echtheit, gar nichts. Von den Sternen, unter denen sie geboren sind, leuchten nur die goldpapierenen. Eine beglückende astrologische Konstellation, der die Hausknechte und Lehrbuben die Luzidität ihrer Dummheit, die Commis ihre hinreißende Beredsamkeit, die Kutscher, Kellner, Wächter das Bezaubernde ihrer Gefräßigkeit, Grobheit und Habgier verdanken. Nestroys Dichtung ist das schönste Monument, das je dem Mutterwitz eines Volkes errichtet wurde.
Er selbst, dieses Witzes souveräner, schonungsloser Gebraucher, sah durch ihn die Menschen, die er sah, in allen Farben und Ultrafarben. Und baute aus solcher Buntheit den heitern Regenbogen seines Possenwerkes: als Zeichen der Versöhnung zwischen Schöpfer und Kreatur.
ZU EBENER ERDE UND ERSTER STOCK – Eines der erfreulichsten, liebenswertesten Stücke des Wiener Meisters, von allen guten Geistern seines Humors gesegnet. Eine Handvoll Leben, gespiegelt im Genie-Auge, das Welt erschafft, indem es sie sieht. Aus der Gegenüberstellung: arm-reich, im Wort und optisch, holt die Posse, dem Märchen angenähert, würzigste Fülle heiteren und wunderlichen Geschehens, Zufall und Unverhofft zur rechten Zeit (Abgesandte aus Feenland) treiben ihr Spiel mit dem Spiel, Weisheit, in der Tarnkappe der Simplizität, übt ihren bittersüßen Witz an ihm. Aus dieser Posse leuchtet das Theater-Ingenium Nestroys besonders hell. Wie sicher hält er den verwickelten Mechanismus seiner Doppel-Szene in Gang, wie vielfädig verknüpft er die Beziehungen zwischen der ebenen Erde und dem ersten Stock (einmal wird solcher Faden – als Spagatschnur – sogar sinnfällig), in welch’ humoriger Symmetrie falten Elend und Wohlstand ihre Welt und ihre Anschauung von dieser aus, mit welcher Meisterschaft sind die Stimmen unten zu den Stimmen oben kontrapungiert, wie lustig wird, wenn arm und reich die Etage wechseln, das moralische Bild von den Niedrigen, die erhöht, und von den Hohen, die erniedrigt werden, Vorgang, und was für übermütige Possen-Chemie ist schließlich am Werk, Glück und Unglück ineinander, und damit alles in Wohlgefallen, aufzulösen. Das Ganze so leicht gefügt und geführt (und von so himmlischer Wurschtigkeit in Sachen der Kausalität), daß es anmutet wie ein wienerischer Sommernachtstraum. In der Tat haben ja die Figuren Nestroys, so erdgebunden sie sind, etwas von Stuben-, Gassen-, Wirtshaus-Geistern, die zu allerlei Unfug, Narretei, Weltkritik, Menschenerziehung, gutem und bösem Werk ausschwärmen, wie im entfesselten Märchenwald die Baum- und Quell- und Wiesengeister.
Ibsen
BRAND – Die Profilschärfe der Figuren, die Spiegelungen ihres Wesens im Wort, die Tiefe, bis zu der die Schraube des Dialogs in die Materie eindringt, verraten schon den großen Ibsen.
Brand ist der noch primitive Ahnherr aller ethischen Forderer, die durch das Ibsen-Werk gehen. (Das Fordern ist des Ibsen Lust, das Fordern.) Er ist der rohe Typus des unbedingten Welt- und Menschenbesserers. Ein Seelen-Flagellant, ein Christ, der an dem «Haupt voll Blut und Wunden» vor Blut und Wunden das Haupt nicht sieht. Er opfert das Leben um des Lebens willen. Eine mystische Formel, bei der sich zwar keiner was denken kann, vor deren großem Klang aber sich jeder mit Lust der Lust des Denkens entschlägt, eine Formel, deren Dunst dem schändlichsten Hokuspokus der Menschheitsgeschichte die Mauer gemacht hat und noch macht. Brand will Opfer und bringt sie selbst. Wem zuliebe? Genau besehen: dem Prinzip, daß geopfert werden muß. Er schlachtet Weib und Kind auf dem Altar dieses Prinzip-Götzen. Aber hat er damit das getan, was er von den anderen fordert: sein Liebstes dargebracht? Folgerichtig müßte er seine Unbedingtheit opfern – denn die ist sein Liebstes –, seine Grundsätze, seine Selbst-Behauptung, seine Opfer-Lust.
Eine Dichtung von der Erbarmungslosigkeit der Erbarmer-Religion.
PEER GYNT – Die Dichtung von Peer Gynt – dem Phantasten, Lügner, Macht- und Geltungs-Träumer, dem Entwurf zum Genie, dem Springer über eignen Schatten, dem herzhaften Schwächling und verbrecherischen Romantiker, dem Manne, der auf der Suche nach seinem Ich stets auf der Flucht vor ihm, der sich preisgibt, um sich zu bewahren, viele Gestalten annimmt, um er selbst zu bleiben – diese Dichtung hat das Format einer Menschheitsdichtung. Denn Tropfen vom Blut des Peer Gynt kreisen in jedem, dessen Leben nur seines Willens Schatten ist (also, nach Schopenhauer, wirklich: in jedem), und in der Gleichung dieses sehr komplexen Sünders Peer sind alle, die, an ihr Ich verloren, einhertaumeln auf der eignen Spur, ausgedrückt. Die besondere Lösung, die ihr der familienfromme Ibsen findet – da er seinen Helden einen halben Meter vorm Tode erkennen läßt, wo sein eigentlichstes Selbst verankert ruhte: in Glaube, Liebe, Hoffnung des ergebenen Weibes –, diese bürgerlich-sentimentale Lösung gilt allerdings nur für den Spezialfall Peer Gynt. Die Dichtung, schwelgerisch in Philosophie und Vision, durchschimmert vom rosafarbenen Licht zarter Rührung, wie sie aus menschlichen Ur-Beziehungen gewonnen wird, und auch durchblitzt von etwas Schwefelflamme, erschließt ihre volle Schönheit nur dem Leser. Das poetische Rankenwerk, das Geflecht von Bild, Wort und Symbol, das den Sinn des Dramas sommerlich umblüht, verfilzt auf dem Theater zur Hecke, über die kein Mann hinwegkommt. Vor ihr liegt der Drache Langeweile.
In Ludwig Fuldas Übertragung sind die Verse abgeschliffen wie im Bach die Kieselsteine. Am Reime hängt, nach Reime drängt da alles. Von ihm getreten krümmt sich die Zeile, ihn zu erreichen renkt sich der Satz aus seinem natürlichen Gefüge, neigen die Bilder sich bis zur gefährlichsten Schiefe. Solcher Tyrannei des Reimes fügt sich die edle Sprache oft nur mit sichtlicher Qual («ward Ihnen einmal nur im Leben … der Sieg, der aufblüht aus dem Beben?»), und man merkt fast, wie sie vor Verlegenheit errötet, wenn sie, etwa damit es auf das Wort «alle» klappe, zu der Wendung sich haben muß: «Sein Heim wird geplagt von des Hungers Kralle.» Aber der großen Mehrheit von Fuldas Versen fällt der Reim-Dienst ganz leicht. Sie biegen und fügen sich ohne Beschwerden, mit freiester subalterner Anmut. Es ist eine Sprache, die mehr Elastizität hat als Rückgrat, mehr Geschmeidigkeit als Charakter. Zu Ibsens Original dürfte sie sich etwa so verhalten wie Streusand zur Felsformation.
Im Burgtheater erwächst aus vielen schönen Bildern, trotz rascher Verwandlung, kein Bild, aus vielen Tönen keine melodische Linie. Die Regie, gute Spielerei zum bösen Spiel machend, konnte doch nicht hindern, daß zwischen scheintoten Versatzstücken das dramatische Gedicht ein kaltes, wächsernes Scheinleben führte. Von seinem großen Atem spürte man kaum einen Hauch. Grablegung des Textes ins Theater, nicht Auferstehung.