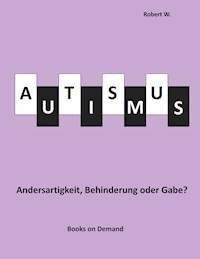
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leben sie wirklich in ihrer eigenen Welt? Nein! Autisten nehmen die Welt nur anders wahr als die Mehrheit der Menschen. Unterscheiden sich zwei Individuen in ihrer Wahrnehmung, dann werden sie sich auch in ihrem Verhalten unterscheiden. Ist Autismus eine Krankheit wie Grippe,Krebs oder Malaria, die jemand hat oder eben nicht? Nein! Autismus ist eher vergleichbar mit Kreativität, Intelligenz oder Höhenangst. Jeder hat etwas davon, der eine mehr, der andere weniger. Autismus wird einem von der Gesellschaft zugeschrieben. Dadurch aber werden Definition und Diagnose zum Spielball von Interessen. Erschwerend hinzu kommt die dem Menschen eigene Neigung, von sich auf andere zu schließen, die ein tieferes Verständnis des Phänomens Autismus erschwert und zu den klassischen Missverständnissen führt. In diesem Buch soll der Versuch unternommen werden, fernab jeglichen Anspruchs auf wissenschaftliche Korrektheit, Autismus anhand eines Gedankenmodells sowohl für Autisten als auch für sogenannte Neurotypische ein Stück weit verstehbar zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Die Filterfunktion des Gehirns
Neurotypen
Missverständnisse und Denkfehler
Beruf – Chancen und Fallstricke
Begabung, Behinderung oder Krankheit?
Jeder lebt in seiner eigenen Wahrnehmungswelt
Auf der Suche nach des Rätsels Lösung
Man sieht es ihnen nicht an. Oder doch?
Fazit
Vorwort
Stellen Sie sich vor, Sie befahren mit Ihrem Auto eine Ihnen bekannte Strecke. Ihre Fahrt führt Sie über das flache Land, es passiert nicht viel, das niedrige Verkehrsaufkommen verlangt Ihnen nicht viel Aufmerksamkeit ab, ebenso wenig die Streckenführung, meist geht es geradeaus, ab und an ein paar Kurven, ihre Fahrt verläuft ähnlich unspektakulär wie schon zahlreiche zuvor. Um sich nicht zu langweilen, haben Sie das Radio an und auch für die Landschaft, durch die Sie fahren, haben Sie hin und wieder ein paar Blicke übrig.
Dann der Schock: Sie haben Sich allzu intensiv mit den Reizen der Landschaft beschäftigt und nicht sofort erkannt, dass sie auf ein Stauende zufahren. Nun schießt Ihnen der Schreck in alle Glieder, Sie umklammern das Lenkrad und steigen in die Eisen. Für ein paar Sekundenbruchteile wissen Sie nicht, ob sie noch vor dem Stauende zu stehen kommen, Sie sehen nur noch das Heck des letzten Fahrzeugs auf sich zukommen. Dann ist Aufatmen angesagt: Sie kamen doch noch gerade rechtzeitig zum Stehen. Sie können Ihre Fahrt, wenn zunächst auch mit ein wenig Herzklopfen, doch noch wie geplant fortsetzen.
Anhand dieser kleinen Geschichte möchte ich Ihnen den Unterschied von zwei verschiedenen Formen von Wahrnehmung verdeutlichen. Was ist also passiert? Die meiste Zeit Ihrer Autofahrt verbrachten Sie in einem relativ entspannten Zustand, relativ deshalb, weil Autofahren auch für diejenigen, die schon viele Kilometer am Steuer eines Fahrzeugs heruntergespult haben, immer noch ein gewisses Maß an Konzentration erfordert, selbst wenn sie eine ihnen bekannte Strecke befahren. Andernfalls könnte man nicht angemessen auf unvorhersehbare Verkehrssituationen reagieren.
Der Zustand relativer Entspannung ändert sich abrupt in jenem Moment, in dem Sie bemerken, dass Sie Gefahr laufen, in das Stauende zu krachen. Dieser Zustand der Wahrnehmung ist geprägt von äußerster Anspannung. Sie sehen nichts mehr außer das Heck des letzten Fahrzeugs, in das Sie zu krachen drohen. Sie nehmen auch nichts mehr von der Landschaft wahr und von der Musik, die aus dem Radio an Ihr nun gar nicht mehr so geneigtes Ohr dringt, gelangt auch nichts mehr in Ihr Bewusstsein. Im Zustand relativer Entspannung können Sie mehr Aspekte Ihrer Umgebung wahrnehmen; da der menschlichen Wahrnehmung jedoch Grenzen gesetzt sind, werden Sie jedem dieser Aspekte nur mehr oder weniger oberflächlich Beachtung schenken können. In dem Moment aber, in dem Sie Ihre komplette Wahrnehmung auf ein bestimmtes Objekt lenken, wie zum Beispiel das Heck des letzten Fahrzeug eines Staus (oder nur auf einen Teil davon, etwa die Stoßstange), ist Ihre periphere Wahrnehmung ausgeschaltet. Ihre Wahrnehmungskapazität fokussiert sich und Sie nehmen Details an dem Objekt, auf das Sie fokussiert sind, wahr, die Ihnen im Zustand mittlerer oder hohen Entspanntheit vermutlich gar nicht aufgefallen wären.
Der Unterschied zwischen einem autistischen und einem nichtautistischen Menschen besteht nun meiner unmaßgeblichen Meinung nach darin, dass das Gehirn von Autisten nicht, so wie das von Nichtautisten, in den Zustand größerer Entspannung wechseln kann (etwa nach der Abwehr einer Gefahr), sondern, je nach Schweregrad des Autismus, solange es bewusst arbeitet auch mehr oder weniger auf irgendetwas fokussiert bleibt. Man könnte es mit einem Muskel vergleichen, der sich nicht entspannen kann, unabhängig davon, ob er gerade gebraucht wird oder nicht. Autisten scheinen mir immer ein Stück näher an dem Zustand zu sein, den ein nichtautistischer Autofahrer erlebt, wenn er auf ein Stauende zurast.
Damit wären wir auch schon bei den Kernproblemen des Verständnisses von Autismus angelangt: der Definition dessen, was Autismus ist und der Frage, wer dies anhand welcher Kriterien festlegt. Jeder, ob Autist oder Nichtautist, sieht die Welt so wie er – und nur er – sie nun einmal sieht. Wohl niemand, der seine Tage als Einsiedler ohne soziale Kontakte fristen würde, käme von sich aus auf die Idee, er könnte ein Autist oder Nichtautist sein. Autismus ist etwas, das einem von der Gesellschaft zugeschrieben wird, so wie Intelligenz oder der Mangel davon, so wie Sportlichkeit und Musikalität oder deren Gegenteil. Nun ist diese Gesellschaft eine, die Autismus so definiert, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen als nichtautistisch gelten. Aber sind die, die von der Gesellschaft als befähigt angesehen werden, Autismus zutreffend zu diagnostizieren, im Besitz einer absoluten Wahrheit oder wird die Beantwortung der Frage, ob jemand als Autist zu gelten hat, nicht auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen – von denen die davon profitieren, die ihre berufliche Laufbahn mit diesem Phänomen verknüpfen?
Ein musikalischer Mensch wird die Musikalität eines weniger musikalischen Menschen besser einschätzen können als umgekehrt. Auch wird jemand, der sportlicher als der Durchschnitt ist, besser beurteilen können, wie es um Maß an Sportlichkeit bestellt ist, das ein grobmotorischer Couch-Potato, der diesbezüglich weit unterhalb des Durchschnitts rangiert, offenbart.
Aber ist die Sichtweise von Nichtautisten tatsächlich geeignet, Autismus zu definieren? Jeder Mensch verfügt über ein bestimmtes Maß an Intelligenz, aber nur intelligentere Zeitgenossen kommen in den Genuss, als intelligent wahrgenommen zu werden (und das meist auch nicht von allen gleichermaßen). Intelligenztest erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Doch kommen wir tatsächlich mit einem angeborenen Intelligenzquotienten zur Welt, der sich durch einen wie auch immer gearteten Test ermitteln lässt, wie etwa die Blutgruppe? Wohl kaum. Theoretisch lässt sich jede menschliche Fähigkeit in einem Test ermitteln (wie vollständig und aussagekräftig dieser dann auch immer sein mag) und in irgendeiner Zahl oder einem Quotienten darstellen. Wir müssten also unzählige Quotienten in uns tragen, die nur darauf warten, mit einem Test ermittelt und mit anderen verglichen zu werden. Ich glaube jedoch, wir kommen gänzlich ohne Quotienten zur Welt, wir leben ohne sie und wenn uns das Zeitliche segnet, erlischt auch kein Quotient in uns. Dies alles sind Erfindungen der Gesellschaft. Aber sind sie deshalb ohne jegliche Aussagekraft? Ich denke nein. Auch hier sollte es so sein, dass jemand, der viele Aufgaben eines einigermaßen aussagekräftigen Intelligenztests lösen kann, besser geeignet ist, selbst einen relativ aussagekräftigen IQ-Test zu entwickeln, als jemand, der beharrlich an den einfachsten Aufgaben scheitert. Wie aber ist das bei der Frage, wer darüber befindet, ob jemand als Autist zu gelten hat und wer nicht? Der Intelligente unterscheidet sich vom weniger Intelligenten, der Sportliche vom Grobmotoriker und der Musikalische vom Unmusikalischen dadurch, dass er auf einem bestimmten Gebiet größere Fähigkeiten besitzt als sein Pendant. Er kann die Dinge gleichsam aus einer "höheren Perspektive" betrachten. Aber ist Nichtautismus die "höhere Perspektive" gegenüber dem Autismus? Sind bei der Diagnosestellung Autismus wirklich ausschließlich Nichtautisten beteiligt? Zur endgültigen Klärung des Phänomens Autismus bedürfte es eines Wesens, dem nichts Menschliches fremd ist, das aber weder Autist noch Nichtautist ist, das eben fähig wäre, eine solche "höhere Perspektive" einzunehmen. Doch auf ein solches Wesen werden wir sicher nicht stoßen.
Was bleibt, ist der Versuch, sich der Thematik indirekt zu nähern. Doch das ist leichter gesagt als getan. Das größte Hindernis, das einem besseren Verständnis des Phänomens Autismus im Weg zu stehen scheint, dürfte meines Erachtens die dem Menschen eigene Neigung sein, von sich auf andere zu schließen. Doch jeder sieht die Welt ein bisschen anders und gerade diese Andersartigkeit gilt es, beim Versuch einer Erklärung autistischer und nichtautistischer Verhaltensweisen zu berücksichtigen.
Auch die einleitende Geschichte ist ein Beispiel für den Kardinalfehler, der uns, egal ob Autist oder nicht, immer wieder unterläuft. Ich habe Ihnen einfach unterstellt, Sie würden eine Autofahrt auf einer Ihnen bekannten Strecke in gleicher Weise wahrnehmen, wie ich dies tue. Doch diese Annahme ist vollkommen unzulässig. Gleichwohl sind wir alle Vertreter eines Spezies, deren Überleben in grauer Vorzeit davon abhing, dass viele Individuen eine vergleichsweise ähnliche Wahrnehmung ihrer Umgebung hatten. Die meisten von uns hören ungefähr gleich gut, finden Lärm ab einer bestimmten Lautstärke lästig, können unterschiedliche Abstufungen einer Farbe ähnlich gut unterscheiden, empfinden Temperaturen oberhalb oder unterhalb einer gewissen Grenze als unangenehm.
Ich glaube nicht, dass ich ein Autist bin, bin mir dessen jedoch nicht ganz sicher. Sollte ich recht haben und Sie ebenfalls ein sogenannter "Neurotypischer", also ein nichtautistischer Mensch sind, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch Sie, falls Sie im Besitz eines Führerscheins sind und über eine gewisse Fahrpraxis verfügen, die Fahrt auf einer Strecke, auf der Sie häufiger unterwegs sind, in ähnlicher Weise wahrnehmen wie ich. Sind Sie jedoch ein Autist, können Sie mit meiner Beschreibung womöglich nichts anfangen oder Sie interpretieren sie in einer Weise, die Ihrer Art der Wahrnehmung entspricht. Es bedürfte einer Art Übersetzungswörterbuch, in dem sowohl Autisten als auch Nichtautisten nachsehen können, was der jeweils andere meint, wenn er dieses oder jenes sagt. Doch wer sollte eine solche Übersetzung leisten können? Ich jedenfalls kann es nicht, ich werde mich in diesem Buch jedoch nach Kräften bemühen, mich zumindest ein wenig in die Sichtweise von Autisten hineinzuversetzen.
Da es jedoch nicht die eine autistische Sichtweise und die eine nichtautistische Sichtweise gibt, sondern weder bei Autisten noch bei Nichtautisten sowohl die Wahrnehmung als auch die Sichtweise bei zwei Menschen absolut identisch sind, sollte alles was in diesem Buch behandelt wird, nur als grobe Annäherung an ein Phänomen verstanden werden, das die gesamte Gesellschaft betrifft.
Erschwerend hinzu kommt das Bombardement mit Begrifflichkeiten, das auf den geneigten Leser, der sich eingehender mit der Thematik beschäftigen möchte, einzuprasseln droht: frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, hochfunktionaler Autismus, atypischer Autismus, Geek-Syndrom, Nerd-Syndrom, Little-Professor-Syndrom, Savant-Syndrom – Autismus-Spektrum-Störung. Durchblick behalten schwer gemacht. Was also ist Autismus?
Laut Wikipedia ist Autismus
"[...]eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die als Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird. Diese tritt in der Regel vor dem dritten Lebensjahr auf und zeigt sich in drei Bereichen:
Problemen im sozialen Umgang (z. B. beim Verständnis und Aufbau von Beziehungen)
Auffälligkeiten bei der sprachlichen und non-verbalen Kommunikation (etwa bei Blickkontakt und Körpersprache)
eingeschränkte Interessen mit sich wieder-holenden, stereotyp ablaufenden Verhaltensweisen[...]"
1
Bei autismus.de findet sich folgende Definition:
"[...]Autismus ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störungen auch als Störungen der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirken.[...]"2
Wenn in diesem Buch von Autisten und Nichtautisten die Rede ist, dann ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und eigentlich falsch. Die Grenze, ab der jemand als Autist eingestuft wird, wird immer eine willkürliche sein. Auch die Grenze, ab der jemand von der Gesellschaft als groß eingestuft wird, ist willkürlich. Jeder Mensch, auch wenn er nur 1,50 Meter oder weniger misst, hat eine Körpergröße. Wenn wir aber jemanden von einem großen Menschen sprechen hören, haben die meisten von uns eine ähnliche Vorstellung davon, was gemeint sein dürfte. Gleiches gilt für Autismus. Jeder Mensch ist zu einem gewissen Maße ein Autist. Von Autisten ist im folgenden aber nur dann die Rede, wenn dieses Maß weit über dem Durchschnitt liegt.
Eines scheint alle Autisten von Nichtautisten zu unterscheiden: die unterschiedliche Informationsverarbeitung des Gehirns.
1https://de.wikipedia.org/wiki/Autismus (Abgerufen: 29. Juni 2019, 11:55 UTC)
2https://www.autismus.de/was-ist-autismus.html (Abgerufen: 29. Juni 2019)
Die Filterfunktion des Gehirns
Wir sind tagtäglich einer Fülle an Sinnesreizen ausgesetzt, die wir unmöglich alle auf bewusster Ebene verarbeiten können. Zum Glück verfügt unser Gehirn über Mechanismen, die es ihm erlauben, Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden, sodass wir uns ohne aller Informationen, die auf uns einprasseln, gewahr werden zu müssen, auf das Wesentliche konzentrieren können. Damit unser Gehirn eine der jeweiligen Situation, in der wir uns befinden, angepasste Filterfunktion ausüben kann, ist ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Neurotransmittern unerlässlich. Neurotransmitter sind Botenstoffe mit deren Hilfe die Neuronen unseres Nervensystem an den synaptischen Verbindungen miteinander interagieren.
Die Neurotransmitter lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die erregenden (exzitatorischen) und die hemmenden (inhibitorischen). Wird durch einen Sinnesreiz ein erregender Neurotransmitter von einem Neuron an ein anderes weitergegeben, so bewirkt dies, dass dieses ebenfalls aktiv wird und seinerseits wiederum andere mit ihm in Verbindung stehende Neuronen anregt. Umgekehrt bewirkt die Ausschüttung eines hemmenden Neurotransmitters, dass die Erregbarkeit des empfangenden Neurons herabgesetzt wird. Der wichtigste schnell erregende Neurotransmitter ist lt. gehirnlernen.de3 Glutamat, sein Gegenspieler Gammaaminobuttersäure (GABA)4 ist der wichtigste hemmende.
Würden in einem Gehirn ausschließlich hemmende Neurotransmitter ausgeschüttet, hätte dies zur Folge, dass es überhaupt nicht mehr aktiv sein könnte; ein Gehirn, in dem ausschließlich erregende Neurotransmitter zugange wären, wäre seiner Filterfunktion beraubt und ständig mit der Verarbeitung völlig unwichtiger Informationen überlastet. Wie jede andere Spezies auch, ist der Mensch das Produkt der Evolution, deren Anpassungsdruck die Entwicklung von Körper und Geist in eine bestimmte Richtung zwang. Ein hohes Maß an Homogenität ist für Vertreter derselben Spezies daher charakteristisch, dies gilt für den Körperbau ebenso wie für die Funktionsweise des Gehirns. Auf der anderen Seite kann aber auch eine gewisse Heterogenität einer Gruppe von Individuen Vorteile sichern. Der Homo sapiens erhielt seine stammesgeschichtliche Prägung in den etwa zwei Millionen Jahren, in denen er als nomadisierender Jäger und Sammler durch die Landschaft zog. So können beispielsweise bestimmte geschlechtsspezifische Unterschiede bei Frauen und Männern erklärt werden. Männer sind in der Regel einen Tick besser, wenn es darum geht, sich räumlich zu orientieren; die meisten Frauen dagegen können Farbtöne besser unterscheiden – beides war sicher von Vorteil. Frauen waren besser in der Lage, den Reifegrad von Früchten abzuschätzen und den Männern dürfte die Fähigkeit zur räumlichen Orientierung bei der Jagd genützt haben. Beides, räumliches Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit, Farbtöne besser unterscheiden zu können, sind auf die geringfügig unterschiedliche Verarbeitung von Sinneseindrücken zurückzuführen. In diesem Buch geht es um die Unterschiede der Filterfunktion der Gehirne von Autisten und Nichtautisten und um die zahlreichen Missverständnisse, die diese Unterschiede hervorrufen.
Untersucht man eine hinreichend große Zahl an Individuen auf ein bestimmtes Merkmal, zum Beispiel die Körpergröße, und wertet die Ergebnisse anschließend graphisch aus, erhält man normalerweise eine Gaußsche Normalverteilungskurve.
Die Körpergröße der meisten Menschen liegt nahe am Durchschnitt, einige aber sind außergewöhnlich groß oder klein. Damit ist jedoch noch nichts darüber gesagt, ob die Kleinwüchsigkeit oder das Gegenteil davon eine Krankheit oder Behinderung darstellt.
Es scheint wenig gegen die Annahme zu sprechen, dass auch das Maß, in dem das Gehirn Sinneseindrücke filtert, von Individuum zu Individuum unterschiedlich ausgeprägt ist, wobei analog zum obigen Beispiel davon auszugehen sein dürfte, dass ebenfalls viele nahe am Durchschnitt und wenige weit davon weg liegen.
Das Bild oben soll das Bewusstsein eines Gehirns zu einem bestimmten Zeitpunkt symbolhaft darstellen. Der innere Kreis steht für den Bereich der Aufmerksamkeit, der äußere für den Bereich, den ich als periphere Wahrnehmung bezeichne. Die periphere Wahrnehmung dient in erster Linie dazu, die Umgebung zu einem gewissen Grad wahrzunehmen. Eine Person, die nichts von dem mitbekäme, was sich in ihrem Umfeld abspielt, liefe ständig Gefahr, in unliebsame Zwischenfälle verwickelt zu werden, was unter Umständen fatale Konsequenzen haben könnte. Die grauen Punkte stellen die Sinneseindrücke dar, die das Gehirn herausfiltert, also unbewusst wahrnimmt. Die schwarzen Punkte stehen für die bewusst wahrgenommenen Sinneseindrücke. Im Bereich der Aufmerksamkeit werden 50 Prozent der Sinneseindrücke gefiltert, im Bereich der peripheren Wahrnehmung sind es deutlich mehr. All diese Zahlen sind völlig aus der Luft gegriffen - es geht einzig und allein ums Prinzip. Nehmen wir an, dieses Gehirn befindet sich im Zustand durchschnittlicher Konzentration. Das einleitende Beispiel mit der Autofahrt mag Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, was in etwa unter durchschnittlich verstanden werden kann.
In diesem Beispiel werden im Bereich der Aufmerksamkeit ebenso viel Sinnesreize bewusst wahrgenommen wie im Bereich der peripheren Wahrnehmung. Da aber in Letzterem wesentlich mehr Sinnesreize gefiltert werden, ist auch der Bereich, aus dem diese Eindrücke empfangen werden können, viel größer.





























