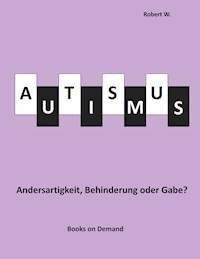4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geboren, verarscht, gestorben - das Leben des überwiegenden Teils unserer Artgenossen verläuft in relativ vorgezeichneten Bahnen. Die kollektive Verarschung als gesellschaftsprägende Umgangsform hat Tradition; sie trat ihren Siegeszug mit der Sesshaftwerdung des Menschen an und ist durch nichts und niemanden zu stoppen. Dieses Buch wurde auch nicht etwa geschrieben, um den Verarschten Hoffnung auf Besserung zu machen; es soll vielmehr ein bescheidener Beitrag dazu sein, sie von der Alternativlosigkeit ihres Schicksals zu überzeugen. Das Zusammenspiel von vier Komponenten garantiert den Fortbestand des globalen Verarschungssystems bis zu dem Zeitpunkt, an dem es zusammen mit jener Spezies, deren Vertreter es ersonnen haben, vom Antlitz dieses Planeten verschwinden wird. das Geldwesen die Unfähigkeit des Menschen, Staaten zu bilden der unzureichende Einblick der Individuen in die gesellschaftlichen Verflechtungen, in die sie eingebunden sind Wettbewerb, der unter den in den ersten drei Punkten genannten Bedingungen stattfindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
Eine Frage des Maßstabs und der Perspektive
Es war einmal...
Vom Fluch und Segen des Wettbewerbs
Fehlende Kooperation am Beispiel Doping
Bonussysteme – für König Kunde nur das Beste! Oder?
Schwellenpreise und wer wirklich davon profitiert
Wie das Geld in die Welt kommt
Geld und Schulden - die beiden Seiten derselben Medaille
Der Staat als Abfallprodukt des Finanzwesens
Alle Staatsgewalt geht von den Banken aus
Politik – der verlängerte Arm von Banken und Privatwirtschaft
Gezerre statt Gestaltung auf allen politischen Ebenen
Über die Unfähigkeit des Menschen, Staaten zu bilden
Über die Absurdität menschlichen Verhaltens
Wenn aus Werten Worthülsen werden
Arbeiten um des Arbeitens willen
Durchblick behalten schwer gemacht – zunehmende Komplexität raubt uns den Horizont
Geplante Obsoleszenz – gewünschter Verschleiß, um Nachfrage zu generieren
Wer die Zeitarbeit nicht ehrt, ist der Prostitution nicht wert
Hilfsleistungen – ein wahrer Segen?
Dem Herztod ein Schnippchen schlagen – senken Sie ihren Cholesterinspiegel!
Arbeitslosigkeit - eine systemische Zwangsläufigkeit
Die Medien - unser Schlüsselloch zur Welt
Wider dem Meinungsmonopolismus
Realitäten nach Bedarf: Umfragen, Preisverleihungen etc.
Service Clubs und Logen – Wohltäter unter sich
Anhang: Anleitung zur Rettung der Welt an einem Tag ;-)
Eine Frage des Maßstabs und der Perspektive
Wir schreiben das Jahr 2020. Mehr als sieben Milliarden potenzielle Verarschungsobjekte tummeln sich auf unserem Planeten, der nun schon seit über vier Milliarden Jahren seine Bahnen um die Sonne zieht. Kurioserweise sind es nicht etwa irgendwelche Außerirdischen, die uns Erdlingen Böses wollen, nein, für die Verarschung zeichnen ausschließlich Vertreter unserer eigenen Spezies verantwortlich. Dabei ist es keineswegs so, dass der eine Teil der Menschheit sich nur in der Rolle der Verarscher und der andere in der der Verarschten wiederfindet. Wer es zu etwas gebracht hat, und sei es auch nur zum Chef einer Drückerkolonne, ist nur zu oft beides in Personalunion. Wahrscheinlich liegt genau darin das Erfolgsgeheimnis des globalen Verarschungssystems: Es zeichnet sich dadurch aus, dass es gerade das Maß ist, in dem sich ein Verarschter zum Verarscher emporgearbeitet hat, das diesem Status verleiht.
Vielfach sind sich die Verarschten der ihnen von den Verarschern aufoktroyierten Verarschung gar nicht bewusst. Häufig betrachten sie sie auch aus Gewohnheit als etwas völlig Natürliches. Andernfalls wird sie ihnen seitens der Verarscher eben als alternativlos verkauft, was es erträglicher erscheinen lässt, sie über sich ergehen zu lassen. Als besonders nützlich erweist sich den Verarschern der Umstand, dass den Verarschten vielfältige Möglichkeiten der Zerstreuung zur Verfügung stehen, mittels derer sich deren Aufmerksamkeit von ihrem Verarscht-Werden weg- und zu den schönen Dingen des Lebens hinlenken lässt.
Die Verarschung als gesellschaftsprägende Umgangsform hat Tradition. Seit der Sesshaftwerdung des Menschen vor etwa 10 000 Jahren formt sie in mannigfaltigen Erscheinungsformen das Weltgeschehen. Leider können sich die Verarschten wenig Hoffnung auf Besserung machen. Es gibt einfach viel zu viele von ihnen, als dass ihre Existenz ohne die Etablierung eines Systems sichergestellt werden könnte, das interessierten Kreisen nicht zugleich auch alle Möglichkeiten zur Verarschung bietet.
Voraussetzung für Verarschung ist die Ohnmacht der Verarschten, sich ihr zu entziehen, weil die Ressourcen, die sie dafür benötigen würden, von den Verarschern kontrolliert werden. Hierbei kann es sich sowohl um materielle als auch um geistige Ressourcen handeln. In der Regel ist es eine Mischung aus beiden. So lieferte beispielsweise der weitverbreitete Analphabetismus den Verarschern früherer Zeiten wertvollen Dienste, und in den unterentwickelten Teilen der Welt tut er dies bis heute. Wohingegen die vermeintliche Aufgeklärtheit der Bewohner der entwickelten Teile der Welt unserer Tage nach subtileren Verarschungsmethoden verlangt. In den meisten Fällen ist es der fehlende Einblick in die Verflechtungen und Zusammenhänge, die ihr Leben bestimmen, die den Verarschten zum Verhängnis wird. Ihnen ergeht es wie dem Hamster, der sich im Rad abstrampelt und vergeblich versucht, an ein Stück Käse zu kommen, nicht ahnend, dass er Opfer einer Verarschung ist.
Die ressourcenschonendste Form der Verarschung ist die, bei der die Verarschten den Schwachsinn, für den sie abgerichtet wurden, mit einem Höchstmaß an innerer Überzeugung ausführen und die ihnen zugedachten Zumutungen mit schicksalhafter Ergebenheit hinnehmen. Um die Verarschten so weit zu kriegen, müssen sie von den Verarschern vorher entsprechend konditioniert worden sein.
Versierten Verarschern gelingt es, die Verarschten in der Annahme zu bestärken, es würde ihnen gut gehen und die Verarschung, die man ihnen angedeihen lässt, wäre die Voraussetzung dafür. Ist dies den Verarschten jedoch selbst unter Zuhilfenahme raffiniertester Suggestionstechniken nicht mehr zu vermitteln, sind die Verführungskünstler gefragt, die es verstehen, sich als Wohltäter zu gerieren und ihnen, konformes Wohlverhalten vorausgesetzt, Besserung in Aussicht zu stellen - ob prä- oder postmortal.
Deutschland im Jahr 2020. Uns geht es gut! Vergleichsweise. Wir hören dies nicht nur von Politikern, die ihre Verdienste um diesen Sachverhalt gebührend gewürdigt zu sehen wünschen. Nein, es stimmt auch: geringe Arbeitslosenquote, solides, wenn auch zuletzt etwas abgeschwächtes, Wirtschaftswachstum, moderate Kriminalitätsrate, Exportüberschuss. Ach, hätten unsere Jungs 2018 doch nur den Titel des Fußballweltmeisters verteidigt, dann wären die Zustände nahezu paradiesisch. Aber auch so sollten wir die Lage mit der geboten Zufriedenheit und Dankbarkeit zur Kenntnis nehmen. Klar doch, zu kritisieren gibt es immer auch noch etwas. Miesepeter, Nörgler und Bedenkenträger finden bei allem das sprichwörtliche Haar in der Suppe. Den einen ist die Staatsverschuldung ein Dorn im Auge, die Ungleichverteilung des Vermögens mag andere stören. Sogar der möglicherweise drohende Klimakollaps dient so manchen dieser notorischen Querulanten als Grund zur Besorgnis. All ihnen sei an dieser Stelle gesagt: Alles ist eine Frage des Maßstabs und der Perspektive.
Bezüglich des Staatsverschuldung brauchen wir uns überhaupt keine grauen Haare wachsen zu lassen. Erstens sind andere Staaten, gemessen an der Einwohnerzahl und Wirtschaftsleistung, momentan weitaus höher verschuldet als wir. Zweitens ist die Staatsschuldenlast Deutschlands in jüngster Zeit sogar leicht zurückgegangen. Und falls sich das, wie zu Befürchten ist, in naher Zukunft wieder ändern würde, kann uns, drittens, niemand daran hindern, zu tun, was frühere Generationen auch taten: Wir übernehmen deren Schulden, häufen neue an und hinterlassen sie einfach unseren Nachkommen, die selbst schuld sind, falls sie es nicht genauso machen. Im Vergleich mit deren zu erwartender Schuldenlast nimmt sich unsere gewiss noch recht übersichtlich aus. Alles nur eine Frage der richtigen Perspektive! Ganz ähnlich verhält es sich mit der Ungleichverteilung des erwirtschafteten Wohlstands. Mag die Schere zwischen Reich und Arm in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer weiter auseinandergegangen sein, so können wir doch mit Genugtuung von der Annahme ausgehen, dass dieser Prozess auch in Zukunft nichts von seiner Dynamik einbüßen wird. Verglichen mit unseren Nachfolgegenerationen leben wir in einer Zeit des sozialen Ausgleichs und der gesellschaftlichen Teilhabe breiter Schichten der Bevölkerung. Man muss die Sachen eben nur aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Und die drohende Klimakatastrophe? Solange sie nur droht, ist sie ja noch nicht da. Außerdem wäre sie ohnehin nicht durch nationale Alleingänge zu stoppen. Sollen sich unsere hochverschuldeten und sozial gespaltenen Nachkommen doch mit denen anderer Länder zusammenraufen und etwas ausdenken, um das drohende Unheil vielleicht doch noch ein wenig abzumildern. Uns jedenfalls geht es gut!
Verändern wir den Blickwinkel, mit dem wir Glückspilze auf unsere Lage blicken, ruhig ein wenig. Betrachten wir uns und unsere Zeit doch einmal im geschichtlichen Rahmen.
Mal ehrlich: Mit wem würden Sie tauschen wollen? Mit dem Jäger und Sammler der Steinzeit etwa? Den allgegenwärtigen Gefahren einer potenziell feindlichen Umgebung ausgesetzt, mussten sich unsere Vorfahren ihr bestenfalls 40 Jahre währendes Leben nicht nur mit Höhlenbär, Wollnashorn und Mammut herumschlagen, sondern auch noch eiszeitlicher Kälte trotzen. Und wir? Wie viele von uns werden noch vom bösen Wolf gefressen? Und wenn es kalt wird, drehen wir eben die Heizung auf (auch wenn’s langsam ein bisschen teuer wird).
Mit der Sesshaftwerdung kamen unsere Ahnen auch nur vom Regen in die Traufe. Einigermaßen geschützt vor wilden Tieren, erkauften sie sich die weitgehende Sicherheit doch mit einem kargen, entbehrungsreichen und eintönigen Lebensstil. Würden Sie etwa gerne einem Ochsen hinterherstiefeln und mit eigenen Händen einen Pflug in den steinigen Boden drücken, um Getreide ansäen zu können, das es später in endlosem Gebuckle abzuernten und per Hand in nicht minder endloser Monotonie zu mahlen gilt? Wir gehen in den Supermarkt und die Sache ist geregelt.
Hatten es die Menschen der Antike etwa besser als wir? Oder die des finsteren Mittelalters? Nichts als Kriege, Sklaverei oder Leibeigenschaft. Der Willkür weltlicher und geistlicher Feudalherren schutzlos ausgeliefert, von der Möglichkeit, gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten ausgeschlossen, meist unter katastrophalen hygienischen Zuständen hausend, von Seuchen bedroht – so ein Drecksleben kann einem wahrhaft gestohlen bleiben!
Dann die frühe Neuzeit: Hexenverbrennung, Dreißigjähriger Krieg, Absolutismus – kein Wunder, dass es so viele in die Neue Welt zog. Später, während der Frühindustrialisierung, durften – dem Fortschritt sei Dank - viele unserer Vorfahren als Lohnsklaven in stinkenden Fabrikhallen ihre Gesundheit in ruinösen 80-Stunden-Arbeitswochen zu Markte tragen.
Dann das 20. Jahrhundert mit all seinen Irrungen, Wirrungen und Katastrophen: Erster Weltkrieg, Spanische Grippe, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg: vielfache Verelendung, Millionen Tote, dazu unzählige Verstümmelte und Traumatisierte.
Oder hatten es die Arbeiter und Bauern unter dem Joch kommunistischer Führungskader etwa besser als wir? Wohl kaum: Keine Entscheidungsfreiheit, keine Reisefreiheit, kein Recht auf freie Meinungsäußerung – dafür aber Bevormundung, Restriktion, Bespitzelung.
Und da soll es uns nicht gut gehen? An die Stelle allmächtiger Feudalherren sind Machthaber auf Zeit getreten, die, von uns in freien, gleichen und geheimen Wahlen bestimmt, diese Macht unter öffentlicher Kontrolle zu unserem Wohle einzusetzen beauftragt sind. Waren einst Standesdünkel und absolutistische Allmachtsfantasien irgendwelcher egomanischen Sonnenkönige die Triebfedern politischen Handelns, so ist es nun der Dienstleistungsgedanke, der in die Politik unserer Tage Einzug gehalten hat. "Den Nutzen des Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden", gilt es nun. Das ist ziemlich neu.
Auch in die Frage, wem wir unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollen, ist Bewegung gekommen. Hatte man in früheren Zeiten allenfalls die Option zwischen Feldarbeit, Kloster und Krieg, so stehen uns heute Wahlmöglichkeiten ohne Ende offen, um eine Beschäftigung zu finden, bei der wir nicht nur unsere Neigungen und Fähigkeiten am besten entfalten können, sondern die uns überdies die Chance eröffnet, uns selbst zu verwirklichen.
Doch damit nicht genug: Diejenigen von uns, die ihre Selbstverwirklichung als abhängig Beschäftigte in Angriff nehmen, tun dies bei einem Arbeitgeber, dem nicht nur die Pflicht zur Fürsorge gegenüber seinen Arbeitern und Angestellten obliegt, sondern mit dem sie sogar ein Vertrauensverhältnis verbindet!
Sollte uns hierzulande dennoch unverständlicherweise etwas nicht so ganz zusagen, hindert uns niemand daran, unser Glück anderswo zu versuchen. Wir leben ja nicht in einem mauer- und stacheldrahtumzäunten Open-Air-Knast kommunistischer Machart, sondern in einem freien Land, das seinen Bürgern ein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf Freizügigkeit einräumt.
Und alle meinen es gut mit uns: unsere Lehrer, die während unserer Schulzeit aufopfernd darum bemüht sind, bei uns Herz und Charakter zu formen und uns im Geiste der Demokratie zu erziehen, unsere Ausbilder, die uns auf unser (Erwerbs-)Leben in einer modernen, kundenorientierten Dienstleistungsgesellschaft vorbereiten, Polizei und Justiz, die unsere Sicherheit garantieren, die Heerscharen von Sozialarbeitern, die den Benachteiligten zu Seite stehen, die Wirtschaft, die Güter und Dienstleistungen bereitstellt, mit deren Hilfe wir unsere Bedürfnisse befriedigen können, die Medien, die sich um unsere Informiertheit verdient machen, Ärzte und Pharmaindustrie, die uns ein immer längeres Leben bei immer besserer Gesundheit ermöglichen, die Volksvertreter hier und anderswo, deren Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein wir es zu verdanken haben, dass wir dieses Leben in Frieden und Freiheit verbringen dürfen.
Hätten wir nicht längst unter einem Atompilz verdampfen können? Die Technologie dafür besteht seit über 70 Jahren. Es ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, dass sie bislang nicht eingesetzt wurde. Warum sollten wir uns also beklagen? So gesehen geht es uns gut.
Wer wollte dem widersprechen? Dennoch gibt es Klärungsbedarf. Wer ist eigentlich wir? Und was bedeutet gut? Geht es jemandem gut, der sich subjektiv gesehen wohlfühlt, der keine Sorgen hat und sein Leben in vollen Zügen genießen kann? Oder ist gut relativ, d. h. im Vergleich zu anderen, zu verstehen? Dann könnte es auch demjenigen vergleichsweise gut gehen, der zwar nicht gesund ist, dem es aber nicht ganz so dreckig geht wie demjenigen, der richtig schlecht dran ist. Relativ gesehen kann es auch dem Hamster im Rad gut gehen. Im Gegensatz zu den meisten seiner tierischen Verwandten braucht er keine Fressfeinde zu fürchten und ein bisschen Bewegung kann sicher auch ihm nicht schaden. Müssen subjektives Wohlbefinden und Verarscht-Werden einander überhaupt ausschließen? Sicher nicht, die Sichtweise des Verarschten entscheidet darüber - und die lässt sich beeinflussen.
In gewisser Weise ähnelt die Situation, in der wir uns befinden, der von Legehennen. Da gibt es die "glücklichen", die im Freien gehalten werden und solche, die zumindest noch ein bisschen auf dem Boden herumlaufen dürfen. Und schließlich gibt es solche, die, in Legebatterien zusammengepfercht und vollends dem Diktat der Gewinnmaximierung unterworfen, ihr Leben lang auf die ihnen zugedachte Rolle als Produktionsfaktoren reduziert bleiben.1 Zwei Dinge sind allen drei Gruppen gemein: Sie werden fremdbestimmt und sie kennen nichts anderes als das, woran sie gewöhnt sind. Ersteres trifft auch auf uns zu, Letzteres zum Glück nicht: Wir haben die Möglichkeit, uns über Dinge, die sich jenseits unserer Alltagserfahrungen abspielen, zu informieren, wobei es von der Qualität der Information abhängt, inwieweit das Bild, das wir uns von der Welt machen, der Realität nahekommt. Die Legehennen in der Batterie jedoch wissen nichts von denen in Freilandhaltung. Die Welt jenseits ihrer Batterie ist für sie nicht existent.
Hätten die Hennen in der Batterie die Fähigkeit, ihr Dasein zu reflektieren, kämen sie wohl zu dem Schluss, dass es den anderen wenigstens nicht schlechter geht.
Dem Einfluss wirtschaftlicher Interessen kann sich auf diesem Planeten kein höheres Lebewesen entziehen - er ist keineswegs nur auf Nutztiere und Menschen beschränkt, wenngleich für diese beiden doch in besonderem Maße. Auch der Affe, dem der Regenwald unterm glutroten Hintern weggeholzt wird, ist betroffen. Je stärker die Fremdbestimmung infolge des ökonomischen Anpassungsdrucks wird, desto größer ist die Gefahr, dass sich die, die ihr ausgesetzt sind - ob Mensch oder Tier - immer weiter von ihrer natürlichen Lebensweise entfernen. Artgerechte Tier- und Menschhaltung wird dann zur reinen Utopie. Jede Spezies war im Laufe der Evolution Anpassungen an sich ändernde Lebensumstände unterworfen. Gehen die Änderungen jedoch zu schnell vonstatten, als dass diese Anpassung auf natürliche Weise erfolgen könnte, werden den Individuen unter Umständen Verhaltensweisen aufgezwungen, die alles andere als artspezifisch sein können. Wie alle anderen Wesen auch, zeichnet sich der Mensch durch besondere Fähigkeiten aus, ist auf der anderen Seite aber nicht besonders gut darin, bestimmte Verhaltensweisen zu adaptieren. Schlangen können nicht fliegen, Schmetterlinge nicht bellen und Menschen geht die Fähigkeit ab, sich in Staaten zu organisieren. Der Mensch ist ein Hordentier, kein Staatentier, wie es etwa Termiten oder Bienen sind. Ähnlich den Hennen in der Legebatterie hat der moderne Mensch jedoch nie etwas anderes kennengelernt, als Bürger eines Staates2 zu sein - seiner Art wird diese Form des Zusammenlebens jedoch nicht gerecht, sie überfordert und stresst ihn, auch wenn er sich dessen, als Folge seiner Gewöhnung, nicht bewusst ist.
Überdies beraubt ihn das Zusammenleben in großen und komplexen Organisationen der Möglichkeit, als "Homo sapiens", also als "weiser Mensch" in Erscheinung zu treten. Weise kann nur handeln, wer das Geflecht, in das er eingebunden ist, durchschaut und über Handlungsoptionen verfügt, die es ihm erlauben, Sinnvolles zu tun und Sinnloses zu unterlassen. Der Hamster im Hamsterrad kann niemals ein weiser Hamster sein.
So gesehen ist der Homo sapiens zwar noch physisch auf diesem Planeten anwesend, er selbst jedoch hat seinen Lebensraum so stark verändert, dass er jene wesensbestimmende Eigenschaft, die er sich selbst zuschreibt, nämlich "weise" zu sein, verlieren musste.
Ist es zulässig, zu behaupten, uns gehe es schon allein deshalb gut, weil wir eine im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften geringe Arbeitslosenquote ausweisen? Oder sollten nicht auch andere Aspekte in die Betrachtung einfließen? Um welche Form von Arbeit handelt es sich überhaupt? Wie gut ist sie bezahlt? Welchen Einfluss hat sie auf Gesundheit und Lebensqualität - sowohl in Bezug auf den, der sie verrichtet als auch für die Allgemeinheit? Auch der Galeerensklave der Antike konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Ging es ihm deshalb gut? Eine Frage des Maßstabs und der Perspektive.
Um etwas einigermaßen zutreffend beurteilen zu können, ist es hilfreich, gedanklich einen Schritt zurückzutreten, um die Dinge in einem größeren Rahmen betrachten zu können. Man könnte mit Blick auf die Steigerungsraten des Bruttoinlandsproduktes in den letzten 60 Jahren auch die ketzerische Frage in den Raum stellen: Warum geht es uns nicht viel besser?
Stellen Sie sich eine Pokerrunde mit 10 Spielern vor, von denen jeder 1 000 Euro Einsatz mitbringt. Die Runde endet erst, wenn einer der Spieler das ganze Geld der anderen gewonnen hat. Wieder lässt sich das Szenario aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten: aus dem der Spieler und aus dem eines Außenstehenden. Zudem können Beteiligte und Außenstehende das Geschehen für sich genommen betrachten, oder, soweit es ihnen möglich ist, den Rahmen, in dem es sich vollzieht, mit in den Blick nehmen. Zu Beginn der Runde geht es allen Spielern gleich gut; nach Beendigung des Spiels geht es immerhin noch 90 Prozent der Spieler gleich gut, wenngleich auch deutlich schlechter als vorher.
Der Gewinner wird kaum bestreiten können, dass es ihm sehr viel besser geht, sowohl im Vergleich zu seiner Ausgangslage als auch im Verhältnis zu seinen Mitspielern. Die Verlierer haben die Wahl. Sie können sich damit trösten, dass es der überwältigenden Mehrheit ebenso ergangen ist wie ihnen selbst. "Wenn es 90 Prozent nicht besser geht, kann es mir doch nicht schlecht gehen, oder?" Oder sie können ihre Lage anhand des Durchschnitts definieren. An dem hat sich nichts geändert - nur mit dem nicht ganz unwesentlichen Unterschied, dass es nun, anders als vor Beginn des Pokerspiels, neun von zehn Spielern schlechter geht als dem Durchschnitt und einem sehr, sehr viel besser. "Wenn es mir schlechter geht als dem Durchschnitt, kann es mir nicht gut gehen."
Der Außenstehende wird die Geschehnisse umso zutreffender einordnen können, je mehr Informationen ihm zur Verfügung stehen, zum einen was das Spiel selbst betrifft und zum anderen auch hinsichtlich der Gesamtumstände, unter denen es gespielt wird. Überdies ist zu unterscheiden, ob er die Pokerrunde selbst beobachtet oder von Dritten, z. B. von Medien, darüber informiert wird. Ist Letzteres der Fall, kommt es darauf an, wie vollständig die Information ist, die er bekommt. Wer sind die Spieler? Ist ihre Spielstärke in etwa vergleichbar oder treffen abgezockte Routiniers auf blutige Anfänger? Geht es mit rechten Dingen zu oder steht das Ergebnis von vornherein fest? Wie sind die Spieler finanziell gestellt? Treffen womöglich Milliardäre auf arme Schlucker, die sich die 1 000 Euro mühsam zusammengespart haben? Findet das Spiel auf freiwilliger Basis statt oder werden die Spieler dazu gezwungen? Wer zwingt die Spieler? Wie zwingt er sie und warum?
Je weniger Informationen dem Außenstehenden zur Verfügung stehen, desto bruchstückhafter wird das Bild sein, das er sich von den Geschehnissen machen kann. Womöglich weiß er gar nicht, was Poker ist. Wird ihm dann lediglich mitgeteilt, dass die Spieler nach der Runde im Durchschnitt ebenso viel Geld besessen haben wie davor, wird er vielleicht geneigt sein, der Sache keine besondere Bedeutung beizumessen. Vielleicht wird ihm nach dem Spiel das Schicksal eines der Verlierer, der soeben seine letzten Kröten verzockt hat, mit gespielter Anteilnahme und begleitet von gefühlsduseliger Hintergrundmusik näher gebracht. Oder es ist nur der Gewinner des Spiels, dem mediales Interesse zuteil wird, etwa indem man ihn zu den Klängen von "So sehen Sieger aus..." vor laufender Kamera posieren lässt. All das hat Einfluss darauf, wie der Außenstehende die Geschehnisse einordnet.
Vieles mag ihn daran hindern, sich ein umfassendes Bild zu machen. Entweder er interessiert sich einfach nicht für Poker oder er hat schlicht keine Zeit, sich eingehender mit der Runde zu beschäftigen. Gut möglich, dass er etwas besseres zu tun hat, als anderen Leuten beim Kartenspielen zuzuschauen und stattdessen lieber eigenen Hobbys nachgeht. Vielleicht ist ihm das Spiel auch zu kompliziert oder er wirft nur einen flüchtigen Blick darauf, weil er anderweitig zu viel um die Ohren hat. Oder es ist die mangelnde Qualität der Berichterstattung, die es ihm unmöglich macht, einen tieferen Einblick zu gewinnen.
Nicht anders ergeht es uns, wenn wir verstehen wollen, was in der Welt so vor sich geht. Wir können uns unmöglich über alles umfassend informieren, dazu haben wir weder die Zeit noch die kognitive Kapazität. Anders als der Außenstehende, der die Pokerspieler beobachtet, sind wir aber mittendrin im Geschehen. Seitdem wir das Licht der Welt erblickt haben, sind wir Spieler in einem Spiel, von dem wir allenfalls hoffen dürfen, ihm nach und nach einige wenige seiner Geheimnisse entlocken zu können. Wie bei jedem Spiel, gibt es gute (Verarscher) und schlechte Spieler (Verarschte). Und die guten, die, denen sich ein paar dieser Geheimnisse mehr gelüftet haben, werden einen Teufel tun, den schlechten dabei zu helfen, besser zu werden. Sie würden dadurch ihre relativ gute Position innerhalb des Spiels gefährden, was ziemlich hirnrissig wäre. Stattdessen werden sie danach trachten, all das zu fördern, was geeignet ist, den schlechteren Spielern den Blick auf die wesentlichen Aspekte des Spiels zu verstellen: Desinformation, Ablenkung, Überfrachtung. Dabei kommt ihnen zugute, dass das menschliche Gehirn dazu neigt, in Dinge, die es nicht vollständig verstehen kann, ihm naheliegend erscheinende Annahmen hineinzuinterpretieren, sodass sich ein scheinbar stimmiges Bild ergibt. Wer auf Dauer zu den Gewinnern des Spiels zählen möchte, ist gut beraten, sich in der Kunst der Manipulation zu üben und seine Mitspieler in Annahmen zu bestärken, die seiner Position innerhalb des Spiels zugute kommen.
Wer versuchen möchte, sein Verständnis vom Wesen des Spiels zu verbessern, kommt nicht umhin, gedanklich zuweilen einen Perspektivwechsel vorzunehmen, sich mit Hilfe seiner Fantasie vorzustellen, er würde aus dem Spiel heraustreten und den Akteuren quasi als Außenstehender zusehen – ganz so wie ein Fußballtrainer, der seine Rumpelfüßler zur Videoanalyse bittet, um ihnen zu zeigen, wie ihr Gebolze auf Unbeteiligte wirkt. Die Perspektive zu ändern mag nicht immer ganz einfach sein, sind wir doch in vielfältiger Weise in all die Abhängigkeiten, Verflechtungen und Wechselwirkungen eingebunden, die uns den Blick fürs große Ganze zu rauben drohen. Doch keine Panik! Ganz so schwierig ist es, ein wenig Übung vorausgesetzt, nun auch wieder nicht.
Ich bitte Sie nun, ihren Alltagstrott eine Zeit lang zu vergessen und sich auf eine Fantasiereise zu begeben, so wie früher, als Ihnen Ihre Eltern aus einem Märchenbuch vorlasen. Märchen haben den Vorteil, dass sich das Geschehen darin so weit von unserer Alltagswelt unterscheidet, dass es ein Leichtes für uns ist, die Perspektive eines Außenstehenden einzunehmen.
1 mit einer kleinen Einschränkung allerdings: In der Legehennen-Batterie wurde das vielbeschworene Ideal der gleichen Lebensverhältnisse bereits Wirklichkeit.
2 Auch große Unternehmen mit mehreren tausend Beschäftigten ähneln hinsichtlich ihrer Organisationsstruktur eher Staaten als Horden.
Es war einmal...
Die Reise führt uns zu einer kleinen Inselgruppe mit einer Haupt- und einigen kleinen Nebeninseln in einer der klimatisch privilegierten Regionen unserer Erde, sagen wir der Südsee.
Während die Nebeninseln unbewohnt sind, gibt es in einer der malerischen Buchten eine kleine Ansiedlung, in der die Ureinwohner, ein Naturvolk auf vorgeschichtlicher Entwicklungsstufe, ein Leben führen, wie es unzählige Generationen vor ihnen nicht anders geführt haben. Sie jagen einige kleinere Tiere, die es auf der Insel gibt, sammeln Früchte und befahren mit ihren Booten die küstennahen Gewässer, um Fischfang zu betreiben. Nach getaner Arbeit finden sie sich am Strand zusammen, feiern Feste, basteln Schmuckstücke, baden im türkisfarbenen Wasser mit ihren Kindern, diskutieren über ihre Erlebnisse, verzaubern mit ihren Südseeklängen die ganze Gemeinschaft oder liegen einfach nur faul am Strand und hängen ihren Gedanken nach. Kurzum: sie tun all das, was das Leben lebenswert macht.
Die anfallenden Arbeiten werden so aufgeteilt, dass alle arbeitsfähigen Inselbewohner einen Teil zum Überleben der Gemeinschaft beizutragen haben. Die jungen Männer sind hauptsächlich für den Fischfang und die Jagd zuständig, die etwas Älteren mit dem errichten der Hütten, dem Anfertigen der Waffen und dem Bootbau. Den Frauen ist vornehmlich das Sammeln von Pflanzen und Früchten, die Zubereitung der Speisen und die Beaufsichtigung der Kinder vorbehalten. im Wesentlichen jedoch sind die Inselbewohner noch Generalisten, die mehrere Arbeiten auszuführen in der Lage sein müssen.
Sicher benötigt die Inselgemeinschaft auch zwei oder drei Medizinmänner oder -frauen, die aufgrund ihrer Spezialkenntnisse einen besonderen Stellenwert in der Gemeinschaft einnehmen.
Einigen besonders weitsichtigen Stammesmitgliedern, dem Ältestenrat, ist es vorbehalten, die Geschicke der Gemeinschaft zu lenken. Diesem Rat gehören verdiente Stammesmitglieder an, denen es aufgrund ihres Wissens, ihrer Erfahrung und Klugheit vorbehalten ist, Streitigkeiten zu schlichten und maßgebliche Direktiven des Gemeinschaftslebens vorzugeben. Der Ältestenrat stellt sozusagen die oberste Autorität in der Gemeinschaft dar und der Wert seines Handelns ist für die übrigen Stammesmitglieder im Großen und Ganzen nachvollziehbar. Alles in allem jedoch ist das soziale Gefüge durch eine eher flache Hierarchie gekennzeichnet.
Nehmen wir weiter an, unser fiktives Inselvolk verfügt über 1 000 arbeitsfähige Mitglieder, von denen jeder im Durchschnitt vier Stunden pro Tag arbeiten muss, damit das Wohlergehen und den Fortbestand der Gemeinschaft sichergestellt ist. Weil Menschen nun einmal unterschiedlich leistungsfähig sind, benötigen die etwas Schnelleren und Geschickteren nur drei Stunden, um ihr Arbeitssoll zu erfüllen, die etwas Langsameren dafür fünf. Die übrige Zeit steht den Bewohnern zur freien Verfügung. Natürlich müssen die Fischer ab und zu einmal einen ganzen Tag auf See verbringen, sie kommen dann aber auch in den Genuss, einen oder zwei Tage gar nicht arbeiten zu müssen. Alle Stammesmitglieder könnten auf diese Weise mehr oder weniger glücklich und zufrieden ihr Leben in ihrem Inselparadies genießen.
Doch einigen von ihnen, lassen wir es fünf sein, ist dieses Leben auf Dauer zu langweilig und sie kommen eines Tages auf die Idee, die Gemeinschaft so zu reformieren, dass sie selbst ein wenig mehr Luxus und dafür einige andere etwas mehr Arbeit abbekommen sollen. Da sie sich jedoch darüber im Klaren sind, dass der Ältestenrat ihr Ansinnen aus naheliegenden Gründen zurückweisen würde, schmieden sie ein Komplott, mit dem Ziel, dessen Autorität zu untergraben.
Sie beginnen damit, eine Serie von „schicksalhaften“ Begebenheiten heraufzubeschwören und so bei den Stammesmitgliedern Unmut und Verärgerung auszulösen. So schleichen sie sich etwa nachts zu den Booten, um einige von ihnen zu sabotieren. Ein andermal stehlen sie klammheimlich ein paar Vorräte. Ab und zu zerstört ein von ihnen gelegtes Feuer einige Hütten. Dann ist es der bittere Geschmack einiger unauffällig beigemengter ungenießbarer Beeren, der den Inselbewohnern das Festessen gründlich vermiest.
Die fünf Stammesmitglieder sind beharrlich und durchtrieben genug, die "Unglücksserie" so lange in Gang zu halten, bis der Verdruss der Insulaner dermaßen überhand nimmt, dass sie den Ältestenrat zu einer Besprechung drängen, bei der über Maßnahmen zur Vermeidung der ungeheuerlichen Vorkommnisse beraten werden soll. Um der Bedeutung dieser Besprechung Rechnung zu tragen, sollen alle Stammesmitglieder an ihr teilnehmen. Das ist die Gelegenheit für die fünf Kollaborateure, ihre Pläne in die Tat umzusetzen.
Im Laufe einer hitzigen und von gegenseitigen Schuldzuweisungen geprägten Diskussion gelingt es einem der fünf Intriganten, einem brillanten Demagogen, die Mehrheit der Stammesmitglieder davon zu überzeugen, dass die Hauptursache für die Vorkommnisse in der Unzulänglichkeit ihres Gesellschaftssystems zu suchen ist. Schlüssig und plausibel argumentiert er: „Es könne nicht angehen, dass selbst bei einem nur vierstündigen Arbeitstag einige Stammesmitglieder offenbar nicht fähig oder willens sind, sich auch nur für diese kurze Zeit ein bisschen zusammenzureißen und eine zum Wohle der Allgemeinheit notwendige Leistung zu erbringen.“ „Offenbar,“ so unser begabter Redner, „hat sich infolge des Übermaßes an Freizeit bei einigen Stammesmitgliedern ein Schlendrian eingeschlichen, den es ab sofort abzustellen gelte. Und überhaupt: Warum ist der Ältestenrat eigentlich nicht schon lange auf die Idee gekommen, Hütten und Boote nachts bewachen zu lassen? Was da alles passieren kann! Denkt eigentlich auch einmal jemand an die Sicherheit unserer Kinder? Und wer garantiert uns, dass wir nicht vergiftet werden oder im Meer ersaufen, nur weil ein paar unterbelichtete Faulenzer die Beeren verwechseln oder beim Bootbau herumpfuschen? Wir brauchen ein Gesellschaftssystem, in dem jeder die Arbeit verrichten soll, die er am besten ausführen kann und in dem es den Unfähigen untersagt werden muss, durch ihre Unzulänglichkeiten Sicherheit und Wohlergehen der Gemeinschaft zu gefährden. Wir brauchen ein System der Arbeitsteilung und der Überwachung. Und wer sollte fähig sein, so ein System einzuführen und auszubauen? Der Ältestenrat vielleicht? Konnte er die Serie der Unglücksfälle etwa stoppen? Wo waren seine Mitglieder, als wir beinahe ertrunken wären? Was taten sie, als einige von uns in letzter Sekunde der Flammenhölle entkommen konnten? Nein! Solchen Versagern dürfen die Geschicke unseres Volkes nicht länger anvertraut bleiben! Lasst uns unser Gesellschaftssystem so umstrukturieren, dass wir wieder alle in Sicherheit leben können!“ So endet das Plädoyer des hinterlistigen Verschwörers.
Schließlich gelingt der Putsch und der Redner erredet sich das Vertrauen der Stammesmitglieder. Er überzeugt sie davon, dass es für das Wohlergehen der Gemeinschaft notwendig ist, dass er und seine vier Mitstreiter für eine gewisse Zeit, vielleicht ein Jahr oder zwei, das Ruder übernehmen, um die erforderlichen Maßnahmen zur Umstrukturierung der Gesellschaftsordnung durchzuführen. Und weil er kein Blender zu sein vorgibt, der den Stammesmitgliedern das Blaue vom Himmel verspricht, konfrontiert er sie gleich mit einer unangenehmen Wahrheit: "Ohne Mehrarbeit können wir unsere Ziele nicht erreichen." so mahnt er. „Dies ergebe sich schon aus der Tatsache, dass ab sofort die verrichtete Arbeit einer effizienten Kontrolle unterzogen werden müsse und die Leistungsschwächsten nicht mehr in den Arbeitsprozess integriert sein dürfen. Und überhaupt: Je mehr jetzt gearbeitet werde, desto schneller ginge der Umbau der Gemeinschaft vonstatten - ist der erst einmal vollzogen, könne man ja die Arbeitszeit wieder verringern."
Zunächst aber müssen die Mitglieder des Ältestenrates von ihren bisherigen Aufgaben entbunden und zu gewöhnlichen Stammesmitgliedern degradiert werden. Anschließend lassen sich die fünf Umstürzler im Rahmen einer feierlichen Zeremonie von den übrigen Stammesmitgliedern in ihre neu geschaffenen Ämter einführen. Da aber der Bezeichnung "Ältestenrat" inzwischen ein negatives Image anhaftet, nennen sie sich ab sofort Stammesmanager.
Nun folgt Teil zwei der Neugestaltung der Gesellschaftsordnung. Die Stammesmanager entwickeln einen Test, mit dem die Fähigkeit aller arbeitsfähigen Stammesmitglieder, mit Zahlen umzugehen, ermittelt wird; schließlich muss die Arbeitsleistung irgendwie quantifiziert werden, um eine Vergleichsbasis zu schaffen. Die 30 besten Rechner werden von den Stammesmanagern zu Stammescontrollern ernannt, die um die Sicherstellung der Arbeitsleistung und -effizienz mittels Kontrolle sich verdient zu machen bestimmt werden.
Die Erste Aufgabe der Stammescontroller ist es nun, den Gesamtarbeitsbedarf zu ermitteln. Um die Stammesmitglieder in der Annahme zu bestärken, ihre Wünsche und Neigungen würden Berücksichtigung finden im neuen Gesellschaftsmodell, befragen die Stammescontroller alle Mitglieder nach der Arbeit, die sie am liebsten ausführen würden – ihre "Traumarbeit". Endlich bräuchte sich der handwerklich Begabte nicht mehr mit Jagen und Fallenstellen abzugeben, das könne von nun an jemand übernehmen, der dann seinerseits von der Pflicht entbunden wäre, auf See zu fahren und mitzuhelfen, den Fischbedarf zu decken, vielleicht jemand, dessen Anfälligkeit, seekrank zu werden, ihn ohnehin eher zu einer Tätigkeit an Land prädestinieren würde. Ein dermaßen auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder zugeschnittenes Gesellschaftsmodell ist fraglos dazu geeignet, auf Akzeptanz und Zuspruch zu stoßen.
Die Stammesmanager machen allen klar, dass es nun an ihnen selbst liegt, eine Arbeit zugeteilt zu bekommen, die ihren Wünschen, Neigungen und Fähigkeiten am besten entspricht. Alles was sie tun müssten, ist, sich im Wettbewerb mit anderen Stammesmitgliedern, die sich um die gleiche Arbeit bemühen, zu bestehen, d. h. zu den Besten zu gehören. Wie viele der "Bewerber" dann ihre Wunscharbeit verrichten können, hängt vom Bedarf ab, den die Stammescontroller zuvor ermittelt haben. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass es für alle anfallenden Arbeiten genügend Bewerber gibt.
Derart motiviert, haben die Stammesmitglieder nun einen Testlauf zu absolvieren, bei dem alle arbeitsfähigen unter ihnen unter den wachsamen Augen der Stammescontroller den Beweis anzutreten haben, dass sie würdig sind, ihre "Traumarbeit" zum Wohle der Gemeinschaft auszuführen. Entscheidende Kriterien sind Qualität und Effizienz.
Ist der Testlauf beendet, die Arbeitsleistung der Stammesmitglieder von den Stammescontrollern erfasst, protokolliert und den Stammesmanagern über die Resultate Bericht erstattet, erfolgt die Teilung der Gesellschaft.
Unser fiktives Inselvolk hat, wie gesagt, 1 000 arbeitsfähige Mitglieder; bei einem vierstündigen Arbeitstag sind also 4 000 Arbeitsstunden nötig, um alle anfallenden Tätigkeiten zu verrichten. Die Arbeit von 4 000 Stunden erledigen die besonders Geschickten, die ja durch den Testlauf ermittelt wurden, in 3 000 Stunden (wir erinnern uns: die etwas Schnelleren müssten schließlich nur drei Stunden arbeiten, um die durchschnittliche Arbeitsleistung zu erbringen).
Um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen, entscheiden sich die Stammesmanager dafür die Arbeitszeit von vier auf zehn Stunden zu erhöhen – macht bei 3 000 Stunden 300 Arbeiter, die von jetzt an die Bezeichnung Facharbeiter erhalten, zum Beispiel: Fachfischer, Fachjäger, Fachfallensteller, Fachbootbauer, Fachbeerenpflückerin, Fachhüttenbauer, Fachmedizinfrau, Fachhängemattenknüpferin, Fachlendenschurzschneider usw.
In der neuen Gesellschaftsordnung wird den Facharbeitern der zweitniedrigste Status zugesprochen. Nur eine Gruppe rangiert noch unter ihnen: die Aussätzigen.
Die Kaste der Aussätzigen rekrutiert sich nämlich aus denjenigen, die sich beim Testlauf als die Langsamsten, Ungeschicktesten oder Unmotiviertesten erwiesen haben, und denen muss es schließlich untersagt werden, durch ihren Pfusch Sicherheit und Wohlergehen des gesamten Stammes in Gefahr zu bringen. Die Stammesmanager entscheiden sich dafür, zehn Prozent aller arbeitsfähigen Stammesmitglieder auszusortieren. Doch was tun mit dem Pack?
Der Behandlung der Aussätzigen wird im späteren Verlauf der Gesellschaftsreform noch größere Aufmerksamkeit erfordern. Einstweilen begnügen sich die Stammesmanager damit, sie in ein Lager zu stecken, dass von nun an der Abschreckung der übrigen Stammesmitglieder (z. B. vor Leistungsverweigerung, Aufruhr oder Sabotageakten) dient.
Dieses Lager wird an einem unwirtlichen Ort im Inneren der Hauptinsel errichtet, an dem die darin Untergebrachten alles vermissen sollen, was ihnen an ihrem früheren Leben erstrebenswert schien: der Blick auf das Meer zum Beispiel, der Tanz und die Gesänge der bezaubernden Inselschönheiten oder die Gespräche am Lagerfeuer. Der Tagesablauf der Aussätzigen ist von nun an von Entbehrung und Monotonie geprägt, in der nur die Schikanen des noch von den Stammesmanagern zu bestimmenden Aufsichtspersonals für ein wenig Abwechslung sorgen.
Auch hinsichtlich ihrer Verpflegung kommen die Aussätzigen nicht umhin, eine von den Stammesmanagern erdachte Sonderbehandlung über sich ergehen zu lassen. All die schmackhaften Köstlichkeiten, die das Inselparadies im Überfluss zu bieten hat, bleiben ihnen natürlich vorenthalten. Stattdessen kommen sie in den Genuss eines bestenfalls noch als genießbar einzustufenden Einheitsbreis, verfeinert mit ein paar übelriechenden Fischinnereien, die die vollwertigen Stammesmitglieder als Abfall hinterlassen haben.
Eine dunkle Höhle erweist sich als passender Ort, um deren Eingang ein massiver Zaun errichtet wird, sodass immer einmal ein paar Aussätzige für kurze Zeit an die frische Luft gehen könnten. Der Personalaufwand, der für die Überwachung der Aussätzigen aufgebracht werden muss, bleibt, die entsprechende Bewaffnung vorausgesetzt, so auch im Rahmen bleiben.
Das Aussätzigenlager erfüllt die ihm zugedachte Funktion nur, wenn es für alle darin Einsitzenden zur Hölle auf Erden gemacht wird. Der Wunsch, ihr zu entkommen, soll für sie Motivation genug sein, um irgendwann einmal wieder in den Kreis der anständigen und willigen Stammesmitglieder aufgenommen zu werden.
Unter „entkommen“ ist selbstverständlich nicht etwa ein gewaltsamer Ausbruch zu verstehen, sondern die nach einer bestimmten Zeit der Läuterung eröffnete Chance der sozialverträglichen Wiedereingliederung. Den vollwertigen Stammesmitgliedern wird diese Einrichtung als notwendiges Übel verkauft und dient somit als Instrument der Abschreckung, für das es zur Aufrechterhaltung der Arbeitsmoral, Leistungsbereitschaft, Loyalität und Unterwürfigkeit der Stammesmitglieder keine Alternative gibt. Ebenso alternativlos ist folglich auch die Etablierung einer neuen, zur Durchsetzung dieser Maßnahme erforderlichen, Berufsgruppe: der Stammespolizei.
Sind die "Leistungsschwachen" erst einmal ergriffen, ins Aussätzigenlager überführt und eine hinreichend große Zahl von Stammespolizisten zu deren Bewachung abgestellt, werden die übrigen zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit eingesetzt. Ihnen obliegt von nun an die Aufgabe, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und soziale Spannungen, mit deren Auftreten als Folge der Ungleichbehandlung nun vermehrt zu rechnen sein wird, mit geeigneten Mitteln der Repression abzubauen. Ausgestattet mit einem Gewaltmonopol hat die Stammespolizei nicht nur Streitigkeiten zu schlichten und den Schutz der Bevölkerung zu garantieren, sie muss auch frei zugängliche Ressourcen vor dem unbefugten Zugriff allzu gieriger Stammesmitglieder schützen. So könnte beispielsweise ein Fachhüttenbauer auf die unverfrorene Idee kommen, in seiner spärlich bemessenen Freizeit selbst ein Boot zu bauen und ein bisschen Fischfang für sich und seine Familie zu betreiben. Das aber wäre Schwarzarbeit und ginge zulasten der Fachbootbauer und Fachfischer, in deren Interesse diese Schwarzarbeit natürlich unterbunden und bestraft werden muss, und zwar mit der Einweisung ins Aussätzigenlager. Die Errichtung eines zusätzlichen Straflagers wäre bei der primitiven Frühform der Leistungsgesellschaft ziemlich sinnlos.
Warum geht eigentlich die Schwarzarbeit zulasten der Fachbootbauer und Fachfischer? Schließlich wäre ein Teil der Nachfrage nach Booten und Fischen bereits gedeckt, was ihnen ein bisschen zusätzliche Freizeit verschaffen würde? Jetzt kommen die Stammescontroller wieder ins Spiel, die ja, nachdem sie sich durch das Aussortieren der Schwächsten bereits große Verdienste um das Gemeinwohl erworben haben, neue Betätigungsfelder benötigen, um den von ihnen Aussortierten nicht ins Aussätzigenlager folgen zu müssen. Und diese neue Betätigung ist von nun an die Kontrolle der Facharbeiter und die Optimierung von Arbeitsprozessen. Es ist daher unumgänglich, dass ein Stammescontroller die Fachfischer auf Hohe See begleitet und ihr Tun wachsam beäugt. Ihm würde es nicht entgehen, wenn die Fachfischer den Bedarf an Fischen in nur acht Stunden täglicher Arbeit decken könnten. Die Folge wäre natürlich, dass ein Fünftel der Fischer und der Boote eingespart werden könnte, was einem Fünftel der Fachfischer und Fachbootbauer den Job kosten und für sie den Gang ins Aussätzigenlager bedeuten würde. Deshalb stellt Arbeit von jetzt an ein schützenswertes Gut dar, und diesen Schutz zu garantieren, ist von nun an eine der Aufgaben des Stammespolizei. Neben der Bekämpfung der Korruption, die dieses System ständig in seinen Grundfesten zu erschüttern droht, denn natürlich wären die Fachfischer immer der Versuchung ausgesetzt, die Stammescontroller zu bestechen und durch Überlassung einiger Fische dazu zu bewegen, ihre Kontrollfunktion ein bisschen lascher zu handhaben. Also müssen auch die Controller kontrolliert werden – auch das übernimmt ab sofort die Stammespolizei. 50 ihnen besonders geeignet erscheinende Stammesmitglieder werden von den Stammesmanagern zu Stammespolizisten ernannt.
Von den ursprünglich 1 000 arbeitsfähigen Stammesmitgliedern haben nunmehr 485 eine neue Funktion erhalten:
5
Stammesmanager
300
Facharbeiter
30
Stammescontroller
50
Stammespolizisten
100
Aussätzige
515 Stammesmitglieder müssen noch einer Verwendung zugeführt werden. Kein Problem, sind die Umstrukturierungsmaßnahmen doch noch lange nicht zu Ende.
Die Stammesmanager halten die Zeit für gekommen, um auch einmal an sich zu denken. Jeder von ihnen schnappt sich eine gut aussehende Insulanerin, heiratet sie und führt sie in ihre neue Rolle als Society-Lady ein. Vier Mätressen sollten für jeden der verdienten Stammesmanager auch noch drin sein. Die Society-Ladies und Mätressen arbeiten selbstverständlich nicht zehn Stunden pro Tag, sondern dienen ausschließlich der Steigerung des Wohlbefindens der Stammesmanager. Wer so viel Gutes tut, hat sicher auch ein Anrecht auf ein bisschen Vergnügen.
Schwuppdiwupp, schon finden sich über die Hälfte, nämlich 510, der Insulaner in ihrer neuen Rolle als Funktionsträger wieder:
5
Stammesmanager
300
Facharbeiter
30
Stammescontroller
50
Stammespolizisten
100
Aussätzige
5
Society-Ladies
20
Mätressen
Die Strafzumessung der von der Stammespolizei überführten Stammesmitglieder erfolgt durch eine ebenfalls neu einzuführende Kaste: der Stammesjustiz. Diese hat sich dabei selbstverständlich an den von den Stammesmanagern vorgegebenen Rahmen zu halten. Die Stammesmanager tun gut daran, bei der Auswahl der Stammesjuristen besonders auf absolute Loyalität und ein gerüttelt Maß an Skrupellosigkeit zu achten, denn übermäßige Skrupel sind für die Durchsetzung eines jeden Rechtssystems wenig förderlich, dies gilt in besonderer Weise, wenn es sich um ein Rechtssystem handelt, in dem diejenigen, die ihm unterworfen werden, so manche Ungerechtigkeiten über sich ergehen lassen müssen. Treue Erfüllungsgehilfen sind gefragt, keine das Rechtssystem übermäßig reflektierenden Moralapostel. Nur so können die Stammesmanager sicher gehen, dass in ihrem Sinn Recht gesprochen wird.
In der Hierarchie rangieren die Stammesjuristen über allen anderen bisher eingeführten Berufsgruppen - außer den Stammesmanagern versteht sich. Allzu viele braucht man von ihnen vorerst auch nicht, die Stammesmanager belassen es bei zehn.
Besondere Erwähnung soll an dieser Stelle ein Charakteristikum finden, dass die Berufsgruppen der Stammespolizisten und Stammesjuristen von denen der Facharbeiter unterscheidet: sie wären in einer Gesellschaft, in der es nur noch gesetzestreue Mitglieder gäbe, überflüssig. Sind die Fische erst einmal gegessen, müssen neue her. Die Fachfischer decken also einen fortlaufenden Bedarf, nämlich den an Fischen. Die Fachbootbauer sichern den Bedarf an Booten, die ja von Zeit zu Zeit durch neue ersetzt werden müssen. Für Fachbeerenpflückerinnen, Fachlendenschurzschneider und alle anderen Facharbeiter gilt dasselbe: sie werden immer gebraucht.
Wie aber verhält es sich bei Stammespolizei und Stammesjustiz? Was tun sie, wenn alle Gesetzesbrecher überführt und abgeurteilt sind? Was hätten sie noch für eine Aufgabe in einer Gesellschaft, in der die Abschreckung der verhängten Strafen alle Stammesmitglieder auf alle Zeit in gesetzestreue Untertanen verwandeln würde? Wozu würden sie dann noch gebraucht? Sie wären schlicht überflüssig!
Es liegt also an der Schläue und am Geschick der Stammesmanager, die Rahmenbedingungen für die Strafzumessung, die Lebensbedingungen der Stammesmitglieder und die personelle Ausstattung der Stammespolizei so auszutarieren, dass zu allen Zeiten eine in etwa konstante Zahl an Stammesmitgliedern zum Rechtsbruch verleitet wird. Die Aufrechterhaltung großer gesellschaftlicher Unterschiede und deren permanente Zurschaustellung erweisen sich hierfür als probate Mittel. Ein bestimmter Anteil der Straftaten muss dabei immer unaufgeklärt bleiben, sonst hätten potenzielle Straftäter ja keinen Anreiz, Rechtsbruch zu begehen (wobei schlechte Arbeitsleistungen und fehlende Leistungsbereitschaft ebenfalls als Formen von Rechtsbruch zu verstehen sind). Nur so lässt sich die Nachfrage nach den Diensten von Stammesjustiz und Stammespolizei konstant halten und diese Berufsgruppen können dauerhaft im Sozialgefüge verankert werden.
Noch immer harrt fast die Hälfte (480) der arbeitsfähigen Stammesmitglieder in der freudigen Erwartung, durch Zuweisung einer Tätigkeit, Eingang in den privilegierten Kreis vollwertiger Gemeinschaftsmitglieder zu finden. Und diese Erwartung ist tatsächlich alles andere als unbegründet, gibt es doch noch reichlich zu tun, in der neuen arbeitsteiligen Gesellschaftsordnung.
Eine Begleiterscheinung des neuen Gesellschaftssystems ist die Tatsache, dass die Kindererziehung nun in die Hände professioneller Kräfte gelegt werden muss, zum einen, weil die leiblichen Eltern ja jetzt mit der Erfüllung der ihnen zugedachten Pflichten weitgehend ausgelastet sind und zum anderen, um maßgebliche Erziehungsinhalte am neuen Gesellschaftsmodell ausrichten zu können – ein neues Berufsbild entsteht. Wie vor ihnen schon die Stammescontroller, Stammespolizisten und Stammesjuristen müssen auch die Vertreter der neu geschaffenen Arbeitsgruppe eine ihnen die Wichtigkeit ihrer Aufgabe suggerierende Berufsbezeichnung erhalten: Die Stammesmanager entscheiden sich für Stammespädagoge.
Als nicht zu unterschätzender Vorteil des eingeführten Erziehungsmodells wird sich alsbald der überaus nützliche Umstand erweisen, dass das Konkurrenzdenken von den süßen Kleinen sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen wird. Denn natürlich muss bei der Vermittlung der Bildungsinhalte auch ein System von Belohnung und Bestrafung eingeführt werden, was den Stammesmanagern der nächsten Generation die mühsame Überzeugungsarbeit, Konsens über die Richtigkeit und Notwendigkeit des von ihnen propagierten Gesellschaftsmodells herzustellen, erheblich erleichtern sollte. Dinge, an die man sich gewöhnt hat, werden seltener hinterfragt. Man betrachtet sie als selbstverständlich. "Bei der Bildung darf keinesfalls gespart werden!", so lautet der einhellige Tenor der Stammesmanager, was ihnen die Abstellung von 30 Stammespädagogen wert ist.
Als Führungskräfte, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, ist es den Stammesmanagern eine Herzensangelegenheit, den Stammesmitgliedern etwas Gutes zu tun. Ihnen ein wenig Abwechslung zu verschaffen vom grauen Alltag. Somit erschließt sich ein neues Betätigungsfeld für 50 der noch 450 in Lohn und Brot zu bringenden Stammesmitglieder: Kunst, Kultur und Sport.
Was die Stammesmitglieder früher selbst tun konnten, nämlich singen, tanzen, Höhlenwände bemalen oder sportliche Wettkämpfe austragen, das müssen sie, als Ergebnis der erhöhten Arbeitsbelastung, jetzt im Wesentlichen den Stammestänzerinnen, Stammeskünstlern, Stammessportlern und Stammessängerinnen überlassen. Deren Aufgabe besteht von nun an darin, bei den wenigen öffentlichen Veranstaltungen, die die Stammesmanager den Inselbewohnern noch gönnen, für ein bisschen Unterhaltung und Zerstreuung zu sorgen. So arrangieren die Stammesmanager von Zeit zu Zeit eine Ruderregatta, bei der einige Stammessportler gegeneinander antreten oder einen Heimat- und Liederabend an dem die Stammessängerinnen, begleitet von den anmutigen Darbietungen der Stammestänzerinnen, den Zuschauern die schönen alten Lieder vorsingen, die sonst in Vergessenheit zu geraten drohen, da den hart arbeitenden Stammesmitgliedern für unproduktive Aktivitäten wie singen einfach kaum noch Zeit bleibt.
Den nächsten 20 Inselbewohnern ist es vorbehalten, eine sehr bedeutungsvolle und für die Aufrechterhaltung der neu geschaffenen Gesellschaftsform unverzichtbare Funktion zu übernehmen: die Beeinflussung des Denkens der Stammesmitglieder.
Sind Stammesjustiz, Stammespolizei und Stammescontroller dafür zuständig, das Tun der Stammesmitglieder in die "richtigen“ Bahnen zu lenken, so ist es die Aufgabe der neuen, kleinen aber einflussreichen und deshalb in der Hierarchie weit oben stehenden Berufsgruppe, deren Denken zu kanalisieren. Die Stammesmanager ernennen sie zu Stammespropagandisten.
Den Stammespropagandisten obliegt es, fortzusetzen, was der redegewandte Stammesmanager bei der Machtübernahme so erfolgreich vorgemacht hat: das kollektive Bewusstsein mittels geeigneter Methoden der Gehirnwäsche so zu manipulieren, dass das aufoktroyierte Gesellschaftsmodell von den Stammesmitgliedern entweder als notwendig, gut und alternativlos wahrgenommen oder aber, was noch viel besser wäre, gar nicht hinterfragt wird.
Da sich das Inselvolk noch auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe befindet, fehlt den Stammenspropagandisten die Möglichkeit, ihre Thesen via Medien zu verkünden. Notgedrungen müssen sie auf das gesprochene Wort setzen.
Sie halten Ansprachen vor der gesamten Bevölkerung, wenn es darum geht, das Gemeinschaftsgefühl zu fördern oder etwas mehr Opferbereitschaft einzufordern, etwa nach Unglücksfällen.
Sie sprechen vor den einzelnen Facharbeitergruppen, um ihre wertvollen Dienste für die Gemeinschaft zu loben, geben ihnen aber auch unmissverständlich zu verstehen, dass es außerhalb ihres Tätigkeitsfeldes keinen Verwendungszweck für sie geben kann, weil sie infolge der fortschreitenden Spezialisierung in einem anderen Fachbereich nicht mit den auf die dortigen Tätigkeiten spezialisierten Facharbeitern konkurrieren könnten. Es müsse also in ihrem ureigensten Interesse liegen, die ihnen angetragenen Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit der Stammesmanager auszuführen, da andernfalls problemlos Ersatz für sie beschafft werden könne. Die Aussätzigen warten schließlich nur darauf, ihr Lager zu verlassen zu dürfen und eine Chance zu bekommen, zu vollwertigen Gesellschaftsmitglieder aufzusteigen.
Den Stammespolizisten und Stammesjuristen machen die Stammespropagandisten glauben, dass es ohne Repression weder Sicherheit noch Ordnung geben könne, von deren Aufrechterhaltung schließlich das Gemeinwohl abhänge.
Die Stammescontroller mahnen sie zur Wachsamkeit und weisen sie auf die Notwendigkeit hin, bei der Qualitätssicherung keine Zugeständnisse zu machen und Fehlverhalten sowie Leistungsverweigerung ausnahmslos der Stammespolizei zu melden.
Den Stammeskünstlern und Stammessportlern führen sie ständig ihre Privilegien vor Augen und sichern den Stammesmanagern dadurch deren Dankbarkeit und Wohlverhalten.