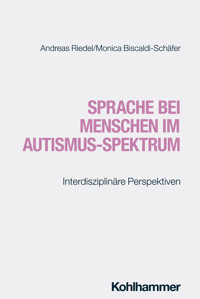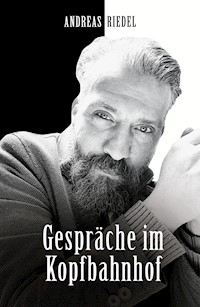Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Praxiswissen
- Sprache: Deutsch
Hochfunktionaler Autismus bei Erwachsenen Autismus-Spektrum-Störungen wurden lange Zeit vor allem als eine Entwicklungsauffälligkeit bei Kindern wahrgenommen. Es liegt aber in ihrer Natur, dass sie in späteren Lebensphasen andauern. Das vorliegende Buch bietet fundiertes Wissen zu Autismus im Erwachsenenalter und hilft psychiatrisch, psychotherapeutisch und psychosozial Tätigen, erwachsene Menschen aus dem Autismus-Spektrum diagnostisch richtig einzuschätzen und angemessen zu begleiten. Die Autoren nehmen Ausprägungen, Diagnostik und Therapie in den Blick und legen dabei das Hauptaugenmerk auf hochfunktionalen Autismus. Sie geben einen fundierten Überblick über das Thema und stärken das gegenseitige Verstehen zwischen Menschen mit und ohne Autismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PraxisWissen
Andreas Riedel, Jens Jürgen Clausen
Autismus-Spektrum-Störungen bei Erwachsenen
PD DR. MED. DR. PHIL. ANDREAS RIEDEL
ist Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg und leitet die Spezialsprechstunde für das Asperger-Syndrom.
PROF. DR. PHIL. JENS JÜRGEN CLAUSEN
ist Erziehungswissenschaftler und Analytischer Gruppentherapeut und lehrt im Studiengang Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule Freiburg.
Wir danken Frau Prof.Dr.Minou Banafsche für die kritische Durchsicht des Textes und für wichtige und relevante Differenzierungen im Rechtsteil.
Die Reihe PraxisWissen wird herausgegeben von:
Michaela Amering, Andreas Bechdolf, Michael Eink,
Caroline Gurtner, Klaus Obert und Tobias Teismann
Andreas Riedel und Jens Jürgen Clausen
Autismus-Spektrum-Störungen bei Erwachsenen
PraxisWissen 7
1. Auflage 2020
ISBN: 978-3-96605-030-2
ISBN E-Book (PDF): 978-3-96605-031-9
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-96605-032-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-db.de abrufbar.
© Psychiatrie Verlag GmbH, Köln 2020
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Lektorat: Uwe Britten, Eisenach
Umschlagkonzeption und -gestaltung: studio goe, Düsseldorf, unter Verwendung eines Fotos von geogif/iStock.com Typografiekonzeption und Satz: Iga Bielejec, Nierstein
Inhalt
Cover
Titel
Zu den Autoren
Impressum
Intuition und Fachwissen sinnvoll verbinden – Einleitung –
Was ist Autismus?
Historische Entwicklung, Definition und Terminologie
»Autistische Züge« – der Randbereich des autistischen Spektrums
Ursachen und Häufigkeit
Symptomatik
Kognitionspsychologische und neurobiologische Erklärungsansätze
Kompensationsleistungen
Krankheit, Behinderung, Normvariante?
Diagnosestellung und Komorbidität
Hochfunktionaler Autismus und Sprache
»Autistische« Ressourcen
Helfender und therapeutischer Zugang
Gestaltung der Kommunikationssituation
Sich einlassen und Vertrauen bilden – Beziehungsaufbau
Die Gegenübertragung: Was löst der Patient bei mir aus?
Umgang mit den Varianten des autistischen Gedächtnisses
Psychotherapeutische Konzepte
Achtsamkeitsbasierte und andere therapeutische Verfahren
Lebenswelten und Lebenslagen autistischer Menschen
Erfahrungen in der Arbeitswelt – berufliche Teilhabe
Gestaltung des Wohnens – kommunale Teilhabe
Freie Zeit, Urlaub, Sport, Kreativität – kulturelle Teilhabe
Selbsthilfe, Selbstvertretung, Partizipation – gesellschaftliche Teilhabe
Freundschaften – Partnerschaften – Beziehungen
Rechtliche Aspekte und Unterstützungsmöglichkeiten
Krankheit und Behinderung – sozialrechtlich verstanden
Die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention
Rechtliche Unterstützungsmöglichkeiten
Das Persönliche Budget
Bedarfsermittlung, Hilfeplanung und persönliche Zukunftsplanung
Berufliche Unterstützung
Konkrete schwierige Situationen im Umgang mit Erwachsenen aus dem Autismusspektrum
Umgang mit Schwierigkeiten in der Kommunikation
Umgang mit Aggression und selbstverletzendem Verhalten
Umgang mit Overloads
Umgang mit Suizidalität
Häufige Fehlerquellen im Umgang mit Erwachsenen aus dem Autismusspektrum
Häufige Themen im therapeutischen Umgang
Psychoedukation
Hilfe bei Organisation und Strukturierung
Alltagsthemen im helfenden Kontakt
Offenlegung der Diagnose
Klärung konkreter sozialer Situationen
Vorwürfe und Schuldgefühle – Angehörigenarbeit
Die rationale Arbeit am Wertesystem
Zielfindung
Vom Defiziterleben über die »autistische Identität« zum menschlichen Pluralismus – Schlussbemerkungen
Ausgewählte Literatur
Intuition und Fachwissen sinnvoll verbinden – Einleitung
Dieses Buch ist eine praktische Einführung in Fragen des angemessenen und reflektierten Umgangs mit Menschen aus dem Autismusspektrum. Es richtet sich an ambulant und stationär arbeitende Psychiater und Psychiaterinnen, Psychologinnen und Psychologen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, an Mitarbeitende in der Psychiatrie und Psychotherapie, an Beschäftigte psychosozialer Einrichtungen, an Betroffene und ihre Angehörigen, an Arbeitgeber und Kollegen und an alle interessierten Menschen, die mit autistischen Erwachsenen umgehen. Der Fokus des Buches liegt dabei erstens auf den sogenannten hochfunktionalen Formen von Autismus und zweitens auf dem Umgang mit autistischen Erwachsenen.
Betrachtet man die Entwicklung bis vor etwa fünfzehn Jahren, so fällt auf, wie still es in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie lange Jahre um das Thema »Autismus« blieb. Die ersten wissenschaftlichen Beschreibungen hochfunktionaler Autismusformen sind nun fast neunzig Jahre alt; in den 1990er-Jahren wurde das Asperger-Syndrom (AS) als bekannteste Form hochfunktionalen Autismus (HFA) in die internationalen Krankheitsklassifikationssysteme aufgenommen. Dennoch blieb es lange der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP) vorbehalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dort finden die betroffenen Kinder und Jugendlichen heute ein recht gutes Netz mit spezialisierten Kliniken, ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatern und -psychotherapeuten, Schulbegleitern, Autismusbeauftragten, Autismuszentren, Berufsbildungswerken und Beratungsstellen vor.
Mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter änderte sich das schlagartig. Man kann es kaum anders sagen: In der deutschen Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie bestand über viele Jahrzehnte eine Art Neglect für das Thema – obwohl wahrscheinlich niemand behauptet hätte, dass sich eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) mit dem 18. Lebensjahr in Luft auflöst. Abgesehen von wenigen Einzelpersonen beschäftigte sich bis vor wenigen Jahren kaum jemand im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie systematisch mit dem Thema, weswegen auch die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung erwachsener hochfunktionaler Autisten praktisch nicht existent war.
Seit etwa zehn Jahren hat sich nun eine rasche, eher ungewöhnliche Entwicklung ergeben: Das wissenschaftliche und Medieninteresse an Menschen mit hochfunktionalem Autismus hat stark zugenommen; die Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen, Autobiografien, Kinofilmen, Zeitungsartikeln und Fernsehbeiträgen ist drastisch gestiegen. Neben größeren Filmproduktionen finden sich in – meist amerikanischen – Fernsehserien immer häufiger mehr oder weniger realistische hochfunktionale »Autisten«, oft ohne dass sie als solche benannt würden: zum Beispiel in Monk, Bones, The Big Bang Theory, Die Brücke oder Sherlock. Mittlerweile wird das Asperger-Syndrom schon medial als »Modediagnose« gehandelt.
Auch im Bereich der klinischen Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie hat eine gewisse Öffnung für das Thema stattgefunden, sie hinkt aber deutlich hinter den wissenschaftlichen und medialen Entwicklungen her. Die Zahl der Kliniken, die eine entsprechende Diagnostik im Erwachsenenalter anbieten, liegt in Deutschland noch immer im einstelligen Bereich. Wurde es beispielsweise in der Kindheit versäumt, eine Autismusdiagnose zu stellen, oder hat der Betreffende das Pech, vor 1980 geboren zu sein, wodurch sein Autismus aufgrund weithin fehlender Kenntnis auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht erkannt wurde, dann gestaltet sich die Suche nach einer Diagnosestellung im Erwachsenenalter meist sehr schwierig. Wartezeiten von über einem Jahr müssen in Kauf genommen werden.
Auch fühlen sich nur wenige ambulante Psychiater für die Betreuung von erwachsenen Menschen aus dem Autismusspektrum zuständig. Und die Suche nach einem Psychotherapeuten, der sich fundierte Kenntnisse in der Autismusbehandlung erarbeitet hat, verläuft nach wie vor oft erfolglos. Unseres Wissens gibt es in Deutschland – bei geschätzten 500.000 Betroffenen – etwa fünfzig stationär-psychiatrische Behandlungsplätze, die auf erwachsene hochfunktionale Autisten zugeschnitten sind. Uns sind nur eine Handvoll Rehabilitationskliniken bekannt, deren Angebot sich explizit an erwachsene Menschen mit hochfunktionalem Autismus richten würde. Das führt für Erwachsene mit hochfunktionalen Autismusformen in die paradoxe Situation, dass ihnen einerseits vorgeworfen wird, mit einer Modediagnose »unterwegs« zu sein, und dass sie andererseits mit dem Problem konfrontiert sind, dass sich im erwachsenenpsychiatrischen Versorgungssystem niemand für sie zuständig fühlt. Um es auf einen Nenner zu bringen: Trotz einer deutlich erhöhten Medienpräsenz des Themas »Autismus« existiert bis heute nur eine minimale psychiatrische Versorgungsstruktur für Erwachsene mit hochfunktionalen Autismusformen.
Der Umgang mit autistischen Erwachsenen ist zuerst einmal für viele Menschen befremdlich und nicht selten beängstigend. Wahrscheinlich spüren viele nichtautistische (»neurotypische«) Menschen recht bald, dass sie spontan und intuitiv nicht oder nur unzureichend verstehen, was in ihrem Gegenüber vor sich geht. Bei manchen Menschen führt dies zu einer verstärkten Aktivität projektiver Vorgänge (es werden eigene Gefühle, Vorstellungen und Mechanismen in das Gegenüber hineinprojiziert), bei anderen führt das intuitive Nichtverstehen zu blanker Verwirrung. Ersteres führt zu schnellen und grundlegenden Missverständnissen, Letzteres häufig zu vorsichtiger Distanznahme oder gar zu allzu schnellen menschlichen, medizinisch-fachlichen oder moralischen Verurteilungen. Diese manchmal fast existenzielle Verunsicherung im Umgang mit autistischen Erwachsenen und die vielen kommunikativen Missverständnisse lassen bei diesen ein hochgradiges Misstrauen entstehen, das die kommunikative Situation noch weiter verkomplizieren kann. Dabei – und dies zu vermitteln ist eines der Hauptanliegen dieses Buches – ist ein Stehenbleiben bei diesem Nichtverstehen keineswegs schicksalhaft, sondern mit gar nicht so viel Aufwand durchaus überwindbar.
Dafür eignet sich die »Theory of Mind« (die Fähigkeit, dem Gegenüber ein konkretes Innenleben mit Wünschen, Gefühlen, Gedanken, Vorwissen etc. im Hier und Jetzt zuzuschreiben) mehr als viele andere. Und zwar nicht nur in der Form, dass Autisten mit ihr ein Problem haben (darauf wird noch weiter einzugehen sein), sondern auch in der Weise, dass neurotypische Menschen im Umgang mit Autisten zuerst einmal eines lernen müssen: nämlich ihre eigene Theory of Mind infrage zu stellen.
Konkret geht es um das Erlernen einer kritischen Haltung der eigenen zwischenmenschlichen Intuition gegenüber, die nicht selten mit einem Höchstmaß an Evidenzsicherheit daherkommt, im Sinne von »Ich habe verstanden, was der andere meint, will oder vorhat«. In der Kommunikation mit autistischen Menschen ist schon ein großer Schritt gemacht, wenn jeder sich zugesteht, dass er nur vielleicht weiß, was der andere zwischen den Zeilen mitteilen will, welche impliziten Ziele er verfolgt oder was er über die gemeinsame Beziehung sagen möchte. Damit wird dann aus der Gewissheit eine fragende Haltung, aus der heraus die Kommunikation zwischen autistischen und neurotypischen Gesprächspartnern eine deutlich bessere Chance hat zu gelingen.
Somit ist es erklärtes Ziel dieses Bandes, Schwellenängste vonseiten des Versorgungssystems und insbesondere von im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie Tätigen zu senken und die weitverbreiteten Bedenken gegenüber der Behandlung von Menschen mit ASS reduzieren zu helfen. Die Arbeit mit autistischen Erwachsenen kann viel Spaß machen und sehr befriedigend sein.
An dieser Stelle sei kurz darauf hingewiesen, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die parallele Verwendung von weiblichen und männlichen Formen verzichtet werden soll. Natürlich sind bei Verwendung nur einer Form (»der Patient«) immer Frauen und Männer in gleicher Weise gemeint.
Ein zentraler Aspekt dieses Bandes ist der konkrete Arbeitsalltag mit Menschen aus dem Autismusspektrum. Die immer mitlaufende Frage lautet: »Wie kann ich als psychiatrisch Tätiger die Beziehung und den Kontakt mit autistischen Menschen so gestalten, dass sie für beide fruchtbar und lebendig sind?« Antworten auf diese Frage muss natürlich jeder selbst in der individuellen Situation finden. Dies gelingt allerdings nach unserem Eindruck am besten dann, wenn ein differenziertes Wissen darüber vorhanden ist, was Autismus ist und für den einzelnen Menschen bedeutet. Aus diesem Grund soll dieses Buch ein grundlegendes Verständnis für autistische Eigenschaften vermitteln, aus dem heraus jeder Einzelne einen verbesserten Umgang mit autistischen Menschen entwickeln kann. Vielleicht kann es auch dazu beitragen, die gegenseitige Empathie zwischen Menschen mit und ohne Autismus zu stärken.
Was ist Autismus?
Dieser Teil soll die historische Entwicklung nachzeichnen, Ursachen und neuropsychiatrische Auffälligkeiten beschreiben, Probleme der Terminologie und Abgrenzung umreißen und dabei so plastisch wie möglich machen, was Autismus eigentlich ist.
Historische Entwicklung, Definition und Terminologie
Der Begriff »Autismus« entstammt ursprünglich dem Bereich der Psychoseforschung und wurde von Eugen BLEULER (1911) verwendet, um ein »Grundsymptom« der »Gruppe der Schizophrenien« zu beschreiben. Gemeint war der Rückzug von der realen Welt in eine Binnenwelt, der im Rahmen einer schizophrenen Episode auftreten kann. Diese Begriffsherkunft – und auch eine gewisse Ähnlichkeit der Symptomatik – führte bis in die 1970er-Jahre dazu, dass die Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) den Schizophrenien zugeordnet oder als ihnen verwandt angesehen wurden.
Bis heute kann die Mehrdeutigkeit des Begriffs »Autismus« zu Verwirrung führen, da er sowohl das Symptom einer schizophrenen Psychose beschreiben als auch als Überbegriff für eine große Gruppe tiefgreifender Entwicklungsstörungen dienen kann. Da aus heutiger Sicht ASS und Schizophrenien scharf getrennte Entitäten sind – Erstere beginnen in frühester Kindheit und haben einen weitgehend konstanten Verlauf, Letztere beginnen in der Adoleszenz oder im Erwachsenenalter und haben einen phasenhaften und heterogenen Verlauf –, soll im Folgenden »Autismus« nur die Gruppe der ASS bezeichnen und nicht – wie ursprünglich bei Bleuler – das Symptom einer Schizophrenie.
Die erste wissenschaftliche Beschreibung eines Syndroms, das wir retrospektiv den hochfunktionalen ASS zuordnen würden, stammt von der russischen Psychiaterin Grunja Jefimowna Sucharewa, die 1926 in dem Aufsatz Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter sechs Kinder beschrieb, die in ihrer sozialen Kommunikation und Interaktion deutlich eingeschränkt erschienen. Der Begriff »Autismus« wurde erstmals von den österreichischstämmigen Ärzten Leo Kanner und Hans Asperger in Bezug auf Krankheitsbilder, die wir heute als ASS beschreiben würden, aufgegriffen. Der Kinder- und Jugendpsychiater KANNER beschrieb 1943 unter dem Titel Autistic disturbancesof affective contact elf Kinder, die schwere Auffälligkeiten in der zwischenmenschlichen Kontaktaufnahme und Kommunikation, bis hin zur »Eingekapseltheit« von Geburt an, aufwiesen. Der Kinderarzt und Heilpädagoge Asperger habilitierte zum Thema Die »AutistischenPsychopathen« im Kindesalter (1944) und beschrieb dabei vier Fälle männlicher Heranwachsender, die ebenfalls Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation zeigten, allerdings weniger stark betroffen waren als die bei Kanner beschriebenen Fälle und auch erst im Kindergartenalter auffällig wurden.
ICD-10 In der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) wurden die beiden Hauptkategorien des Autismus nach diesen beiden Autoren benannt. Unter dem Überbegriff der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen finden sich der frühkindliche Autismus (»Kanner-Syndrom«; F 84.0), das Asperger-Syndrom (F 84.5), das (seltene) Rett-Syndrom (F 84.2) und der atypische Autismus (F 84.1).
Definitionsgemäß versteht man unter frühkindlichem Autismus eine sich vor dem dritten Lebensjahr manifestierende Störung der sozialen Interaktion und Kommunikation mit reduzierter Fähigkeit zur Kontaktaufnahme, Kontaktpflege und zur nonverbalen Kommunikation. Die Störung ist außerdem charakterisiert durch sich wiederho- lende Verhaltensmuster (Rituale, Routinen), eingeschränkte (Sonder-) Interessen und verbale und motorische Stereotypien (Schaukeln mit dem Oberkörper, Flattern mit den Händen etc.). In der ICD-10 nicht genannt, aber sehr häufig auftretend ist eine sensorische Hochempfindlichkeit bzw. Reizfilterstörung mit einer Neigung zu Reizüberflutungserleben. Hinzu kommen nicht selten Probleme im Bereich der Priorisierung und Alltagsorganisation.
Das Intelligenzniveau umfasst beim frühkindlichen Autismus das gesamte Spektrum von schweren Intelligenzminderungen bis zu überdurchschnittlichen Begabungen, wobei zumindest in älteren Studien bei etwa der Hälfte der Betroffenen Intelligenzminderungen vorliegen. Die Sprachentwicklung ist per definitionem verzögert, das Sprachniveau im Erwachsenenalter kann aber zwischen einer vollkommenen Unfähigkeit zur Lautsprache und einer – zumindest auf semantischer Ebene – normalen Fähigkeit zum Sprechen schwanken.
Nach ICD-10 wird das Asperger-Syndrom vom frühkindlichen Autismus vor allem dadurch abgegrenzt, dass eine Entwicklungsverzögerung der Sprache oder der kognitiven Funktionen fehlt. Zusätzlich wird auf die häufige motorische Ungeschicklichkeit und gelegentlich auftretende psychotische Episoden hingewiesen. > Symptomatik, Seiten 23 f.
Die Benennung von Symptomen und Syndromen aus dem autistischen Bereich befindet sich seit einigen Jahren im Umbruch. Das hat vor allem damit zu tun, dass sich die beschriebene kategoriale Trennung von Kanner-Syndrom und Asperger-Syndrom empirisch nicht aufrechterhalten ließ: Vielmehr zeigte sich in vielen Studien, dass es einen breiten Übergangs- bzw. Überlappungsbereich gibt, in dem keine klare Abgrenzung möglich ist. Auch die Unterscheidung von hochfunktionalem frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom erwies sich nicht als sinnvoll angesichts von Verlaufsuntersuchungen, die zeigten, dass sich beide Autismusformen im Verlauf des Lebens oft überhaupt nicht mehr unterscheiden lassen. Zunehmend wurde deutlich, dass sich keine natürliche Grenze zwischen Autismus und »Normalität« aufweisen ließ, sondern ein fließender Übergang zwischen mehr oder weniger stark ausgeprägten autistischen Eigenschaften besteht. Um das besser zu verstehen, ist die Terminologie von Karl Jaspers hier ausgesprochen hilfreich.
Jaspers unterscheidet in seiner Allgemeinen Psychopathologie (1913) zwischen »Gattungen« und »Typologien«. Gattungen sind dabei durch natürliche Grenzen definierte Entitäten. Beispiele für Gattungen sind etwa die Chorea Huntington oder die Trisomie 21: Sie lassen sich – wie Blaumeise und Kohlmeise – eindeutig voneinander und von anderen Zuständen unterscheiden, es gibt keine (oder nur extrem seltene) Grenzfälle. Dem Begriff der Gattung setzte Jaspers den Begriff der Typologie entgegen: Damit gemeint sind durch »künstliche« Grenzen definierte Bereiche in einem natürlichen Kontinuum, zum Beispiel »Übergröße«, »Intelligenzminderung« oder »Hochbegabung«. Der »Typus« hat keine natürliche, sondern lediglich eine im Konsens festgelegte Grenze zur Normalität.
Die deutliche Mehrzahl der empirischen Untersuchungsbefunde zeigt in die Richtung, dass es sich bei »Autismus« nicht um eine Gattung, sondern vielmehr um eine Typologie handelt. Während die Unterscheidung von Blaumeise und Kohlmeise richtig oder falsch sein kann (es könnten ja auch nur unterschiedliche Erscheinungsformen der gleichen Spezies sein), gibt es also keine richtige, also naturgegebene Grenze zwischen Autismus und Normalität, sondern nur eine – nie ganz von Willkür freie – Konvention. Es sei allerdings angemerkt, dass diese Diskussion keineswegs abgeschlossen ist, nach wie vor melden sich im wissenschaftlichen Kontext Vertreter der »Gattungshypothese« zu Wort. Weiterhin müssen syndromale (also etwa monogenetische, siehe unten) Formen von ASS gesondert betrachtet werden, da diese häufig einer kategorialen Grunderkrankung (zum Beispiel Fragiles-X-Syndrom) entspringen und insofern einem kategorialen Krankheitsverständnis eher zugänglich sind.
DSM-5 Zuletzt zeigte sich zudem, dass die Grenze von Autismus zu anderen früh angelegten Störungen wie dem Tourette-Syndrom, den Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen, verschiedenen Lernund Kommunikationsstörungen sowie den Intelligenzminderungen deutlich unschärfer und verschwommener ist als erhofft: Mischbilder und Grenzfälle sind häufiger, als die kategorial – oder in Gattungsbegriffen – gefassten ICD-10-Diagnosen dies hatten vermuten lassen. Diese Beobachtungen führten dazu, dass in der fünften Fassung des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), das in den USA seit 2013 gültig ist, die genannten Auffälligkeiten der Entwicklung (inklusive Autismus) unter dem Überbegriff der »neuronalen Entwicklungsstörung« zusammengeführt wurden.
Die verschiedenen autistischen Subkategorien wurden – aufgrund der beschriebenen fehlenden scharfen Unterscheidbarkeit – als »Autismus-Spektrum-Störungen« zusammengefasst. Ausgeklammert aus den ASS wurde allerdings die neu definierte »Sozialpragmatische Kommunikationsstörung«, die viele Gemeinsamkeiten mit den ASS hat, wobei stereotype und repetitive Verhaltensweisen allerdings fehlen. Eine wichtige und sinnvolle Neuerung im DSM-5 ist die diagnostische Verschlüsselbarkeit von funktionellen Ausfällen oder Problemen in der Alltagsbewältigung, die unter anderem eine neutrale, nicht pathologisierende Beschreibung von Normvarianten ohne relevante Funktionsstörungen zulässt.
Der Begriff des Asperger-Syndroms wird im DSM-5 nicht mehr verwendet, was aus der beschriebenen Logik heraus auch Sinn ergibt; sozialpsychologisch allerdings wird damit ein Begriff aus der Fachsprache entfernt, der für viele Betroffene einen hohen identifikatorischen Charakter hat und einen Assoziationsraum von Würde und Gemeinschaft entfaltete, der dem eher technokratischen und eindeutig pathologisierenden Begriff der »Autismus-Spektrum-Störung« weitgehend fehlt.
BEGRIFFLICHKEITEN Der Rückblick in die Begriffsgeschichte macht deutlich, warum in Bezug auf die Nomenklatur eine gewisse Konfusion zu herrschen scheint – und auch eine gewisse Notwendigkeit besteht, dem vorliegenden Buch eine zumindest grob umreißende Definition der wesentlichen Begriffe voranzustellen. Meist werden wir – der Entwicklung des üblichen Sprachgebrauchs folgend – von »Autismus-Spektrum-Störungen« (ASS) sprechen, gelegentlich aber auch vom »Asperger-Syndrom« oder von »Autismus«, insbesondere wenn es um individualpsychologische Belange geht. Auch die Begriffe »Autisten« und »Menschen aus dem Autismus-Spektrum« werden verwendet, insbesondere in Kontexten, in denen der pathologisierende Beiklang von »ASS« explizit vermieden werden soll. Dabei soll mit »Autismus« immer eine Typologie im Jaspers’schen Sinn gedacht sein, nicht eine klar abgrenzbare Kategorie. Auch meint »Autismus« – wie bereits erwähnt – nicht die Symptomatik einer »Schizophrenie«. Da wir hier von psychiatrischen und therapeutischen Kontexten berichten, wird auch öfter von »Patienten« die Rede sein; dabei muss immer klar bleiben, dass Menschen aus dem Autismusspektrum nicht per se »Patienten« sind, sondern dies nur unter bestimmten Umständen werden können.
Der Begriff »hochfunktional« bezog sich früher nur auf Menschen mit frühkindlichem Autismus mit hoher Intelligenz und Sprachfähigkeit und ist in der Abgrenzung zu Patienten von Bedeutung, die beispielsweise nicht sprechen, da der helfende Zugang zu diesen in vielen Fällen natürlich ein anderer ist. Heutzutage und auch in diesem Buch wird er weiter gefasst und bezeichnet Autisten (jedweden Untertyps) von mindestens mittlerer Intelligenz, guten Sprachfähigkeiten und mit hoher Anpassungsfähigkeit. Wenn es also im Kern um diese Formen von Autismus gehen soll, wird der Begriff »hochfunktionaler Autismus« verwendet. Um Menschen zu bezeichnen, die nicht autistisch sind, wird der Begriff der »Neurotypie« verwendet, der zwar bis heute einen leichten ironischen Beiklang hat, sich aber als Kontrastbegriff zum Autismus unter mit Autismus befassten Menschen eingebürgert hat und sich unseres Erachtens besser zum »täglichen Gebrauch« eignet als der wertende und ironiefreie Begriff der »Normalität«. Wir wollen Nichtautisten also als »neurotypische Menschen« bezeichnen.
Unter dem Begriff »Autismus-Spektrum-Störungen« werden unterschiedliche Formen und Schweregrade von Autismus verstanden; davon abzugrenzen sind Personen mit lediglich »autistischen Zügen« sowie jene ohne autistische Merkmale (»neurotypische Menschen«).
»Autistische Züge« – der Randbereich des autistischen Spektrums
Stellt man sich die Verteilung des Merkmals »autistische Eigenschaften« über die Gesamtbevölkerung als Gauß-Kurve (»Normalverteilung«) vor, wird schnell klar, dass im extremen (diagnosewürdigen) Randbereich nur wenige Individuen zu finden sind, in jenem Bereich aber, der zwischen Randbereich und Mitte liegt, das Integral unter der Kurve größer und damit die Zahl der betroffenen Individuen höher wird. Das heißt, schon rein statistisch gibt es einen großen »Graubereich« zwischen deutlich ausgeprägten autistischen Eigenschaften (= ASS) und dem Bereich der statistischen »Normalität«. Während bis vor wenigen Jahren unter dem Vorzeichen eines kategorialen Autismusbegriffs noch versucht wurde, diesen Grenzbereich zu negieren, findet nun auch zunehmend eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit statt. Im Englischen hat sich für dafür der Begriff des »Broader Autism Phenotype« (BAP) eingebürgert; im Deutschen entspricht dem am ehesten der Begriff »autistische Züge« (ohne eigenen Krankheitswert). Bereits Leo Kanner bemerkte bei den Angehörigen seiner Patienten deutliche autistische Züge, ohne dass er diese als »krank« klassifiziert hätte.
Jüngere Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass autistische Züge bei bestimmten psychiatrischen Krankheitsbildern, zum Beispiel Anorexia nervosa oder chronischer Depression, gehäuft anzutreffen sind, ebenso allerdings bei Personen mit besonderen Fähigkeiten, beispielsweise im Bereich der Informationstechnologie oder des Ingenieurwesens. Einiges spricht dafür, dass autistische Züge als »Basisstörung« oder besser »autistische Basisstruktur« bestimmter anderer Erkrankungen verstanden werden können, also einen Vulnerabilitätsfaktor für andere psychiatrische Erkrankungen darstellen. Weniger untersucht wurde bisher, vor welchen Erkrankungen diese Basisstruktur schützt, wobei es sehr wahrscheinlich ist, dass dies der Fall ist. Eine Studie (OBERMAN & PASCUAL-LEONE 2014) wies auf die Möglichkeit hin, dass die autistische Basisstruktur einen gewissen Schutz vor Demenzen vom Alzheimertyp bieten könnte; die Hypothese kann aber bislang nicht als bewiesen gelten.
In der Autismusdiagnostik stellt sich bei vielen Personen die Frage, ob eine (diagnosewürdige) ASS oder autistische Züge ohne eigenen Krankheitswert vorliegen. Letztlich ist es wichtig – und auch ein Stück weit entspannend –, sich dabei immer wieder klarzumachen, dass die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen willkürlich gelegt wurde und sich über die letzten Jahre immer wieder verändert hat: So ist der Grenzverlauf des DSM-5 vom Grenzverlauf der ICD-10 deutlich unterschieden. Und auch die Verzehnfachung der Prävalenzzahlen in den letzten dreißig Jahren ist ohne eine deutliche Verschiebung der genannten Grenze nicht zu erklären. So wichtig eine sorgfältige differenzialdiagnostische Abgrenzung der ASS von anderen Krankheitsbildern ist, so wenig sollte man sich bezüglich bestimmter quantitativer Ausprägungsgrade, die eine Diagnose rechtfertigen (oder auch nicht), in Dogmenkriege verwickeln lassen. Sinnvoll und auch bei der Unterscheidung zwischen ASS und autistischen Zügen oft wegweisend ist unseres Erachtens die Operationalisierung des Schweregrades nach Funktionseinschränkungen und Hilfsbedürftigkeit, wie sie im DSM-5 neu eingeführt wurde.
Ursachen und Häufigkeit
GENETIK In der wissenschaftlichen Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass es sich bei Autismus-Spektrum-Störungen im Kern um genetisch verursachte Zustandsbilder handelt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen mono- bzw. oligogenetischen Formen von ASS, die etwa 15 Prozent der Fälle ausmachen, und komplex-polygenetisch vererbten, die etwa 85 Prozent ausmachen. Bei Ersteren handelt es sich häufig um »syndromalen Autismus«, womit das Auftreten von Autismus im Rahmen bekannter monogenetisch verursachter Syndrome (Fragiles-X-Syndrom, Angelman-Syndrom, tuberöse Sklerose, isodizentrisches Chromosom 15, Phelan-McDermid-Syndrom, SotosSyndrom u.v.a.) gemeint ist.