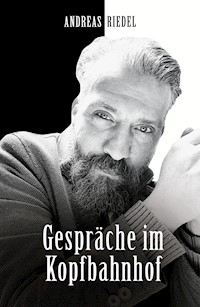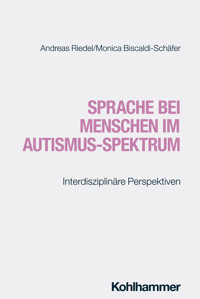
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Obwohl Besonderheiten der Sprache und Sprachpragmatik bereits bei den Erstbeschreibungen von Autismus als hochcharakteristisch aufgefasst wurden, fanden sie als Bestandteil autistischer Symptomatik erst kürzlich Eingang in die Klassifikationssysteme. Deshalb ist es höchste Zeit, sich des Themas "autistischer Sprache" eingehender anzunehmen. Das vorliegende Werk beleuchtet diese aus klinischer, historischer, linguistischer, wissenschaftlich-empirischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive, abgerundet durch den Blick auf neurotypische Sprache aus autistischer Sicht. Der vielfältige und sehr "spezielle" Umgang mit Sprache, den viele Menschen mit Autismus aufweisen, und die daraus entstehenden Hindernisse und Missverständnisse in der Kommunikation werden anhand zahlreicher klinischer Beispiele veranschaulicht, um anschließend die Implikationen für die Diagnostik und Therapie im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter darzustellen. Dabei werden zahlreiche konkrete sprachliche Phänomene in den Blick genommen, u.a. die Verwendung von Small-Talk, Floskeln, Ironie und Metaphern, das "Zwischen-den-Zeilen-Lesen-Können", die Einbettung von Aussagen in den Kontext, die hochexakte Semantik, dialogisches vs. monologisches Sprechen und die auf das Notwendigste reduzierte sprachliche Kommunikation bei manchen autistischen Kindern. Übergeordnetes Ziel des Buches ist es, die "Übersetzungsarbeit" zwischen autistischen und neurotypischen Kommunikationspartnern zu erleichtern und das gegenseitige Verständnis zu fördern. "Das Buch ist inhaltlich spannend, pespektivenreich, unterhaltsam und kann aus meiner Sicht nur empfohlen werden." (aus dem Geleitwort zum selbigen Werk von Prof. Dr. Ludger Tebartz van Elst)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Geleitwort
1 Einleitung
2 Historische Einordnung
2.1 Beobachtungen von Grunja Ssucharewa, Leo Kanner und Hans Asperger
2.2 Autistische Störungen und Sprachentwicklungsstörung in der ICD-10
2.3 Die Rolle der Sprache bei ASS in der ICD-11
2.4 Die sozialpragmatische Kommunikationsstörung im DSM-5 und die pragmatische Sprachentwicklungsstörung in der ICD-11
3 Störungen der Sprachentwicklung bei Kindern mit und ohne ASS
3.1 Klassifikation und Definition von Störungen der Sprachentwicklung
3.2 ASS und Störungen der Sprachentwicklung
3.3 Beeinträchtigungen der Sprachpragmatik bei Kindern mit und ohne ASS
4 Linguistische Pragmatik – Theorie und Empirie
4.1 Warum linguistische Pragmatik?
4.2 Kurze Einführung in die linguistische Pragmatik
4.2.1 Konversationelle Implikaturen
4.2.2 Deixis
4.2.3 Sprechakttheorie
4.2.4 Weitere Gebiete der linguistischen Pragmatik
4.3 Ironie als pragmatisches Phänomen
4.4 Pragmatik und Autismus – empirische Befunde
4.5 Sprachliches Alignment bei neurotypischen und autistischen Menschen – eine Übersicht
4.5.1 Definition der Begriffe
Alignment
und
Prosodie
4.5.2 Erklärung und Wirkung von Alignment
4.5.3 Bisherige Studien: Alignment in neurotypischer Kommunikation
4.5.4 Alignment in der Kommunikation bei ASS
4.5.5 Zusammenfassung
4.6 Warum sich die klinisch oft eindeutigen pragmatischen Auffälligkeiten experimentell oft nicht gut nachweisen lassen
4.7 Wie hilft uns die linguistische Pragmatik beim Verstehen autistischer Sprache?
5 Elemente autistischer Sprache aus klinischer Perspektive
5.1 Einleitung
5.2 Elemente autistischer Sprache bei Kindern und Jugendlichen
5.2.1 Kinder mit minimal verbalem Sprachvermögen
5.2.2 »Sprechfaulheit«, Beschränkung auf das Allernotwendigste (»Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«)
5.2.3 Flüssige Sprache mit Monologisierung, fehlender Dialogfähigkeit
5.2.4 Sprache und Peergroup-Integration bei Adoleszenten mit ASS
5.3 Elemente autistischer Sprache bei Erwachsenen
5.3.1 Der Beginn des Gesprächs, grüßen, zustimmen, widersprechen
5.3.2 Smalltalk
5.3.3 Floskeln: »Wie geht´s« und andere
5.3.4 Ironie und Humor
5.3.5 Sprachbilder und Metaphern
5.3.6 Sprechakte und »Das-zwischen-den-Zeilen-Lesbare«
5.3.7 Konversationelle Implikaturen – warum manches so kompliziert ausgedrückt wird
5.3.8 Synchronisation und Hierarchien im Gespräch, Organisation des Sprecherwechsels
5.3.9 Das Ende des Gesprächs
5.3.10 »High Visualizing« – Denken in Bildern
5.3.11 »High Verbalizing« – Das Phänomen der hochexakten Semantik
6 Autistisch-Neurotypische Kommunikation – Wie soll ich das verstehen?
6.1 Einführung
6.1.1 Autobiografische Erinnerungen
6.2 Zur Begriffsbildung
6.2.1 Autobiografische Erinnerungen, ein Beispiel zum Thema hören, verstehen und einordnen:
6.3 Der egozentrische Fehlschluss
6.3.1 Ähnliche Sozialisation
6.4 Erkennen von Kontextabhängigkeit
6.5 Die zwei autobiografischen Beispiele
6.5.1 Annahmen von Menschen mit und ohne Autismus
6.6 Beispiele zur neurotypischen Kontextfixiertheit
6.7 Wie soll ich das verstehen? – Fazit
7 Die Bedeutung der Sprache in der Diagnostik
7.1 Diagnostische Bedeutung der Sprache in der pädiatrischen und kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis
7.2 (Differenzial-)Diagnostik in Bezug auf Sprachproduktion und -kompetenz
7.3 Diagnostische Bedeutung der Sprache im Erwachsenenalter
7.3.1 Stellung der Sprachpragmatik in der Diagnostik
7.3.2 Untersuchungen mit Fragebogen
7.3.3 Diagnostische Eigenanmnese
7.3.4 Untersuchung und Verhaltensbeobachtung
8 Die Bedeutung der Sprache in Therapie und Beratung
8.1 Die Bedeutung der Sprache in Therapie und Beratung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus
8.2 Die Bedeutung der Sprache in Therapie und Beratung von Erwachsenen mit Autismus
8.2.1 Umgang mit Sprache in der Therapie
8.2.2 Sprechen über Sprache in der Psychotherapie
9 Das Ich in der Fremde: Autismus und Sprache aus literaturwissenschaftlicher Sicht
9.1 Schreiben über sich: Autobiografik und Authentizität
9.2 Das Ich als Vexierbild: Erzählendes und erlebendes Ich
9.3 Ein Leben in Listen: Enumeratives Erzählen
9.4 Erzählen über sich – Erzählen über ein Drittes
9.5 Hohe Erwartungen: Neurotypische Leser:innen und »autistische« Autobiografien
9.6 Kompromisse, Grenzgänge, Übersetzungen
9.7 Sprache als Klang und Bild
9.8 Resümee
9.9 Sekundärliteratur
Literatur
Autorenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Anhang
Sprachpragmatikfragebogen
Auswertungsalgorithmus Freiburger Sprachpragmatikfragebogen
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
210
211
212
213
214
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Der Autor und die Autorin
PD Dr. med. Dr. phil. Andreas Riedel studierte Philosophie und Medizin in Freiburg im Breisgau, Kathmandu und London. Er promovierte im Fach Neurologie mit einer Arbeit zum autonomen Nervensystem und im Fach Philosophie mit einer Arbeit zu wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Erkenntnismethoden der Medizin, insbesondere anhand von Karl Jaspers´ Werk. Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie – mit tiefenpsychologischem Schwerpunkt – am Zentrum für Psychiatrie Emmendingen. Von 2009 bis 2020 Leiter der Spezialsprechstunde für Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Freiburg, seit 2016 auch Oberarzt der dortigen Spezialstation für Zwangserkrankungen. 2016 Habilitation zum Thema Autismus im Erwachsenenalter bei Prof. Mathias Berger. Seit 2020 Leitender Arzt und stellvertretender Chefarzt an der Luzerner Psychiatrie und Leiter der Fachstelle Autismus im Erwachsenenalter. Er ist Vater zweier fast erwachsener Kinder und arbeitet gerne und überzeugt in Teilzeit.
PD Dr. Monica Biscaldi-Schäfer studierte Medizin in Verona. Ihre Promotion hat sie zweimal, in Verona und in Freiburg, absolviert mit experimentellen Themen aus der Neurophysiologie und Verhaltensforschung. Nach einigen Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit mit Schwerpunkt in der Messung von Blickbewegungen zur Erfassung visueller und kognitiver Prozessen bei der typischen und atypischen Entwicklung erfolgte die Facharztweiterbildung an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter am Universitätsklinikum Freiburg. Dort ist sie seit 2006 Oberärztin und seit 2020 kommissarisch Leitende Oberärztin und im Universitären Zentrum Autismus-Spektrum (UZAS-Freiburg) ist sie Leiterin des Kinder- und Jugendbereichs. In 2018 hat sie mit dem Thema »Kognitive und Optomotorische Leistungsmuster bei Kindern mit Entwicklungsstörungen« habilitiert. Ihre wissenschaftliche Tätigkeit umfasst, über die Untersuchung kognitiver Prozesse im visuellen System und die Erfassung der Blickmotorik bei Entwicklungsstörungen hinaus, die Erarbeitung und Evaluation von verhaltenstherapeutisch basierten, manualisierten Therapieprogrammen für Autismus-Spektrum-Störung. Sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter.
Andreas RiedelMonica Biscaldi-Schäfer
Sprache bei Menschen im Autismus-Spektrum
Interdisziplinäre Perspektiven
Mit Beiträgen von Charlotte Bellinghausen, Matthias Huber, Miriam Nandi undVerena Haser
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043208-6
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043209-3epub: ISBN 978-3-17-043210-9
Geleitwort
Von Ludger Tebartz van Elst
»Wovon man nicht sprechen kann, soll man schweigen!« Dieser berühmte Satz von Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) aus seinem Tractatus Logico-Philosophicus ist Teil einer der Kapitelüberschriften des Buches »Sprache bei Menschen im Autismusspektrum« von Andreas Riedel und Monica Biscaldi-Schäfer. Und dieses eigentümliche, viel diskutierte Zitat umreißt in seiner eigenen Unbestimmtheit gar nicht so schlecht den thematischen Raum, den Riedel und Biscaldi-Schäfer in ihrem Buch ausleuchten wollen.
Über Wittgenstein selbst wurde viel spekuliert, ob er womöglich eine autistische Persönlichkeitsstruktur gehabt habe – vieles spricht dafür (Fitzgerald, 2000a/b). Und es ist wirklich interessant festzustellen, dass die Themen, die Wittgenstein umtrieben, viele Anknüpfungspunkte bieten zu der Thematik, die Riedel und Biscaldi in diesem Herausgeberbuch bearbeiten.
So ist es zunächst einmal bemerkenswert, das Wittgenstein als autistisch strukturierter Mensch sich dem Problem der Uneindeutigkeit der Sprache im Sinne eines Lebensthemas zuwendet. Dabei geht er in seinem o. g. Frühwerk noch von einer Abbildtheorie der Sprache aus, gemäß der die Sätze der Sprache die Tatsachen der Welt abbilden sollten: das, was der Fall ist. Er postulierte – vielleicht wünschte er es sich auch nur vor dem Hintergrund seiner eigenen Schwierigkeiten im kommunikativen Miteinander mit anderen Menschen – dass sich die Bedeutung eines Satzes aus seiner Beziehung zu den ausgedrückten Sachverhalten klar ergebe. Er kam zu dem Schluss, dass viele philosophische Probleme sich aus Missverständnissen im Gebrauch der Sprache entwickelten. Dieser Intuition können sicher viele Leserinnen und Leser zustimmen, die sich auf die Abenteuer philosophischer Diskussionen in illustrer Runde einlassen und nach kurzer Zeit bemerken, wie die unterschiedlich gemeinten Bedeutungen identischer Begriffe mit jeder Stunde und jedem Glas Wein weiter auseinanderdriften. Aber es mag auch die Erfahrung der Dramatik desselben Phänomens in alltäglicher Kommunikation gewesen sein, die dieses »Feierabendproblem« für Wittgenstein zu einem existenziellen Problem machte. Die apodiktische Forderung seines Frühwerks, dass nur das, was klar gesagt werden könne, auch sinnvoll sei und man über den Rest doch bitte lieber schweigen möge, kann auch als verzweifelter Appell eines autistischen Menschen nachvollzogen werden, der sich mehr Klarheit und weniger Verwirrung in seiner alltäglichen Kommunikation wünscht.
Wäre diese Erfahrung eines autistisch strukturierten Menschen wirklich der motivationale Hintergrund für Wittgensteins frühe philosophische Überlegungen, so würde dieser motivationale Aspekt deren philosophischen Gehalt in keinster Weise beeinträchtigen oder schmälern. Im vorliegenden Buch werden viele Beispiele solcher Missverständnisse zwischen autistischem und neurotypischem – vielleicht besser durchschnittlichem – Begriffs- und Sprachgebrauch anschaulich dargelegt und unter unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet. Wittgenstein beschäftigte die Sprache sein Leben lang – sicher primär mit einem philosophischen Blickwinkel. Dasselbe Phänomen – die Sprache – ist Thema dieses Buches, wobei der Blickwinkel eher der der klinischen Diagnostik und Therapie im Kontext der Autismusthematik ist. Die vielen unterschiedlichen Blickwinkel auf die Musterhaftigkeiten eines autistischen und neurotypischen Sprachgebrauchs sind gut zu lesen und ebenso unterhaltsam wie lehrreich. Mir hat besonders gut der Impetus gefallen, Versuche zu unternehmen die häufigen Missverständnisse zwischen den verschiedenen Sprachteilnehmern und -teilnehmerinnen zu überwinden und zwar von beiden Polen musterhafter Ähnlichkeit her gedacht in die jeweils andere Richtung – also vom neurotypischen Pol Richtung autistischem Sprachgebrauch und umgekehrt. Dieses Anliegen war auch das Wittgensteins, wenn auch mit einer primär philosophischen Perspektive, während in diesem Buch eher die alltägliche sprachliche Lebenswirklichkeit ganz durchschnittlicher Menschen – seien sie nun autistisch strukturiert oder nicht – in den Fokus genommen wird.
Während Wittgenstein in seinem Frühwerk die Grenzen der Welt noch in den Grenzen der Sprache sieht, wobei zumindest für mich in Verbindung mit seinem Schweigegebot noch der Wunsch nach Klarheit und Eindeutigkeit mitschwingt, zeigen die überzeugenden Kerngedanken seines Spätwerks in meinen Augen die Weisheit und Lebenserfahrung eines klugen autistischen Menschen auf. Nun ist die Rede davon, dass sich die Bedeutung von Wörtern und Sätzen nicht so sehr aus klaren und festen Beziehungen zu Fakten und Tatsachen ergeben, sondern dass sie sich vielmehr im sozialen Miteinander, den Sprachspielen des alltäglichen Sprechens von Menschen, ergeben. Es könnte der Eindruck entstehen, Wittgenstein hat die Sprachpragmatik für sich und die Philosophie entdeckt und sich mit ihrer faktischen Relevanz für die alltägliche Kommunikation abgefunden. Nun hebt er darauf ab, dass Sprache durch Musterhaftigkeiten und Regeln strukturiert und geprägt wird, die im sozialen Miteinander der Sprachteilnehmer und -teilnehmerinnen entstehen, durch den spielerischen Gebrauch von Wörtern und Sätzen und den Gesang ihrer Melodien. Man könnte den Eindruck gewinnen, als habe er das vorliegende Buch gelesen und dessen Implikationen für die allgemeine Sprachphilosophie formuliert. Philosophie – so Wittgenstein nun – soll nicht abstrakte Theorien aufstellen, sondern Klarheit über die Verwendung von Sprache herbeiführen.
In diesem Sinne kann das vorliegende Herausgeberwerk auch als philosophisches Buch verstanden werden, auch wenn es diesen Anspruch nicht erhebt. Aber es will erklärtermaßen einen Beitrag dazu leisten, mehr Klarheit zu schaffen darüber, was in der sprachlichen Kommunikation zwischen durchschnittlich und autistisch strukturierten Menschen alles so passiert, welche Muster beobachtet werden können, und wie die unterschiedlichen Strukturiertheiten wiederum zu musterhaften Missverständnissen führen können. Dass diese Missverständnisse nicht nur Gegenstand witziger Anekdoten sind, hervorragend geeignet für jeden Table Talk, sondern zur Quelle heftigster zwischenmenschlicher Konflikte werden können und großes Leid verursachen können, weiß dieses Buch zu berichten – und dies musste Wittgenstein vielleicht ja auch am eigenen Leibe erfahren. Umso wichtiger ist jeder Beitrag der versucht, solche Missverständnisse zu überwinden.
Das vorliegende Buch sammelt dabei ganz unterschiedliche, lehrreiche, spannende und unterhaltsame Perspektiven auf das Phänomen Sprache als zentrales Kommunikationsmittel zwischen allen Menschen, seien sie nun autistisch oder nicht. Dass Autismus dabei in den allermeisten Fällen nicht als kategoriales Phänomen, sondern ebenso wie viele andere körperliche und mentale Phänotypen eher als dimensionales Strukturphänomen begriffen werden muss (Tebartz van Elst, 2023), wird in den letzten Jahren mehr und mehr deutlich.
Das Buch ist inhaltlich spannend, perspektivenreich, unterhaltsam und kann aus meiner Sicht nur empfohlen werden. Ich wünsche ihm eine breite Leserschaft und den Erfolg, den es verdient!
Freiburg im April 2025Ludger Tebartz van Elst
1 Einleitung
Irgendetwas ist anders an der Sprache von Menschen aus dem Autismusspektrum. Sie klingt anders, sie hat oft eine andere Struktur, sie meint oft etwas anderes. Zwischen neurotypischen und autistischen Gesprächspartnern1 gibt es dauernd Missverständnisse, auch und gerade bei sehr »hochfunktionalen« autistischen Menschen. Und das sind – wenn man genauer hinsieht – nicht etwa emotionale, sondern tatsächlich oft sprachliche Missverständnisse. Es scheint sich also zu lohnen, der Sprache von autistischen Menschen einmal genauer auf den Grund zu gehen.
»Wieso denn das?« könnte man fragen, schreiben doch die klassischen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV die Sprach-(Entwicklungs)-Störung lediglich dem »Frühkindlichen Autismus« zu, wobei hier vor allem schwere funktionale und semantische Sprachstörungen gemeint waren und nicht die eher im Feingewebe der Sprache zu findenden Besonderheiten, die man bei höherfunktionalen Menschen aus dem Autismusspektrum findet. Damit war lange Zeit impliziert, dass Auffälligkeiten der Sprache bei sogenannten hochfunktionalen Autismusformen (i. e. das Asperger-Syndrom und Formen des Frühkindlichen Autismus ohne Intelligenzminderung und mit normalem Spracherwerb im Verlauf der Entwicklung) als vernachlässigbar angesehen werden könnten bzw. nur im Rahmen von Einschränkungen in der wechselseitigen Konversation thematisiert zu werden brauchten. So verwundert es nicht, dass die spezifischen Besonderheiten der Sprache bei »hochfunktionalem« Autismus lange wenig Beachtung fanden. Dabei zeigt sich der sehr »spezielle« Umgang mit Sprache, den viele Menschen mit Autismus aufweisen, den klinisch Tätigen in mannigfaltiger Weise: Bei Kindern z. B. kann oft beobachtet werden, dass sie einen ungewöhnlich ausgeprägten Wortschatz entwickeln, mit der Fähigkeit zu detailgenauesten und treffendsten Beschreibungen. Manchmal wirkt der Umgang mit Sprache geradezu spielerisch, mit Fokussierung auf Besonderheiten der Semantik, Verwendung treffender Fremdwörter oder sogar mit der Entwicklung von (der Sache oft angemessenen) Neologismen. Manche jugendlichen oder erwachsenen Autisten zeigen eine grammatische Korrektheit auch in der mündlichen Kommunikation, die eher in einem juristischen Fachbuch zu erwarten wäre; andere können spontan Sachverhalte mit einer sprachlichen Finesse beschreiben, die bei neurotypischen Sprechern langes Nachdenken erfordern würde. Gleichzeitig scheitern viele Autisten am Verstehen von mehrdeutigen Aussagen, Ironie, höflichen Andeutungen und (sinn-)bildlich Ausgedrücktem, sodass das neurotypische Gegenüber nicht selten am guten Willen zum Verstehen zu zweifeln beginnt. Die Aufzählung der klinisch bedeutsamen Sprachbesonderheiten ließe sich beliebig fortsetzen, was aber selbstredend nicht Gegenstand dieser Einleitung sein soll.
Als Autoren dieses Buches sind wir froh, dass in der ICD-11 die sprachlichen Besonderheiten im Autismusspektrum nun ihren festen Platz gefunden haben, was nach Erfahrung der allermeisten erfahrenen Kliniker auch der Sache völlig angemessen ist. Es dürfte bereits implizit klar geworden sein, dass der »autistische Umgang mit Sprache« weder richtiger noch falscher als der »neurotypische Umgang mit Sprache« ist, sondern hier zuerst einmal als Variante aufgefasst werden soll, mit ihren Stärken und ihren Schwächen, so wie auch die »neurotypische Sprache« ihre Stärken und ihre Schwächen hat.
Da »autistische Sprache« und »neurotypische Sprache« nun einmal die gleichen Wörter verwenden und auf den ersten Blick auch die gleiche Syntax, liegt es auf der Hand, dass die Kommunikation zwischen den Sprechern dieser »Sprachen« zu heftigen und folgenreichen Missverständnissen führen und auch gründlich schiefgehen kann. Im klinischen Umgang und insbesondere in der Psychotherapie mit autistischen Menschen erwächst aus diesen Missverständnis-Erfahrungen sehr häufig ein explizites (und manchmal auch implizites) Bedürfnis nach Übersetzung. Nicht selten erscheint es autistischen Menschen so, als wären sie in der Kommunikation mit neurotypischen Menschen mit einer Sprache konfrontiert, die sie zwar zuerst einmal zu verstehen glauben, von der sie dann aber nach und nach feststellen müssen, dass es doch eine Fremdsprache ist, deren Bedeutung sie oft nicht erfassen. Viele autistische Menschen geben im Laufe ihres Lebens auf, leben resigniert mit den vielen Missverständnissen und lernen, gekonnt über das gegenseitige Nicht-Verstehen hinwegzugehen. Ein großes Anliegen dieses Buches ist es darum, zu verdeutlichen, dass die autistisch-neurotypische Verständigung zwar manchmal schwierig ist, aber durchaus gelingen kann. Die Aufklärung der Missverständnisse mithilfe von Übersetzungstechniken ist oft langwierig, aber sie führt tatsächlich zu gegenseitigem Verstehen und Empathie. Diese Übersetzungstechniken werden aus neurotypischer Sicht insbesondere in den klinischen Abschnitten besprochen; vice versa beleuchtet Matthias Huber die neurotypische Sprache aus autistischer Sicht – ebenfalls mit dem Ziel, Übersetzung zu ermöglichen.
Der vorliegende Band soll sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven nähern. Da die Perspektiven jeweils in sehr eigener Weise an das Phänomen der »autistischen Sprache« herangehen, unterliegen sie keiner gemeinsamen Systematik, sondern ergänzen sich in den von ihnen erzeugten Bildern. Das Buch versteht sich als Lesebuch, als Anregung zum eigenen »Übersetzen« und als Inspiration zum Weiterdenken. Es versteht sich nicht als Übersichtswerk zum Thema, betreibt nur wenig »systemizing« und hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Eine Leitperspektive soll dabei die klinische Warte sein, also die mannigfaltigen Erfahrungen, die wir und unsere Kollegen über die Jahre gesammelt haben (▸ Kap. 5, ▸ Kap. 7 und ▸ Kap. 8). Dies wird selbstverständlich durch zahlreiche Fallbeispiele erklärt, illustriert und ergänzt. Auch die wissenschaftlich-empirische Sicht soll ihren Platz haben (▸ Kap. 4.4 und ▸ Kap. 4.5), wobei die – oft widersprüchlichen – wissenschaftlich-empirischen Befunde nicht im Zentrum dieses Buches stehen sollen. Die theoretischere Perspektive der linguistischen Pragmatikwird einen etwas größeren Raum einnehmen (in den ▸ Kap. 4.2 und ▸ Kap. 4.3 von Verena Haser): Sie soll als Hintergrundtheorie dienen, anhand derer sich viele Phänomene neurotypischen Umgangs mit Sprache, die im alltäglichen Umgang meist unbewusst bleiben (und schwer sprachlich zu fassen sind), besser beschreiben lassen. Und gerade diese Phänomenbereiche sind es, in denen sich autistische von neurotypischer Sprache unterscheidet. Betrachtet man also autistisch-neurotypische Missverständnisse durch die »Brille« der linguistischen Pragmatik, lassen sie sich nach unserer Einschätzung deutlich besser in Worte fassen und aufklären. Wir möchten aber ganz explizit darauf hinweisen, dass die klinischen Kapitel auch ohne Kenntnis der (zum Teil etwas mühsamer zu lesenden) theoretischen und empirischen ▸ Kap. 5.2, ▸ Kap. 5.3 verstehbar sind. Eine historische Einordnung, die deutlich macht, dass sprachliche Phänomene schon in den drei Erstbeschreibungen autistischer Bilder mit im Zentrum standen, erfolgt in ▸ Kap. 2.
Welche Implikationen die autistischen Besonderheiten der Sprache für die Diagnostik im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter haben, wird ausführlich in Kapitel 8 beschrieben und auch die Ableitungen für das therapeutische Herangehen (von der Psychoedukation über sprachliche Quellen von Kommunikationsproblemen in der Psychotherapie und detaillierte Situationsanalysen bis zum Umgang mit metaphorischen Deutungen) sowie für den pädagogisch-erzieherischen Stationsalltag werden mit vielen klinischen Beispielen dargelegt (▸ Kap. 8). Der Vielfalt der Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern und den Störungen der funktionalen Sprache bei Menschen im Autismusspektrum (bzw. beim Frühkindlichen Autismus nach der ICD-10) widmen sich die ▸ Kap. 3 und ▸ Kap. 5.2 sowie die historische Einordnung (▸ Kap. 2). In den ▸ Kap. 7.1 und ▸ Kap. 8.1 werden die diagnostische Bedeutung und der Umgang mit Störungen der funktionalen Sprache kurz dargestellt. Das vorliegende Buch fokussiert dabei jedoch in seiner Gesamtanlage – das muss einleitend betont werden – mehr auf diejenigen Sprachauffälligkeiten, die insbesondere bei Menschen mit anscheinend unauffälligem Spracherwerb sowie relativ guten kognitiven Fähigkeiten und deutlich besseren Anpassungsleistungen auftreten.
Das Phänomen »autistischer Sprache« lässt sich natürlich nicht in scharfer Weise vom Bereich der »Kommunikation« trennen, Sprache ist Teil der Kommunikation und in der Natur immer eingebettet in nonverbalen und paraverbalen Ausdruck sowie Kontextfaktoren, die ihr erst ihre pragmatische und situative Bedeutung verleihen. Insofern geht es im vorliegenden Band auch immer wieder um Kommunikation in ihrer Gesamtgestalt. Beispielsweise ist mündliche Sprache immer mit einer Sprachmelodie (Prosodie) verbunden, die oft auch bedeutungstragend ist (vgl. ▸ Kap. 5). Auch hat der gelingende Dialog immer etwas damit zu tun, wie gut sich die Gesprächspartner aufeinander einschwingen können (Synchronisation, Entrainment). Auch diesem Thema soll sich ein eigener Abschnitt (von Charlotte Bellinghausen) widmen (▸ Kap. 4.5). Im Zentrum des Buches soll allerdings – wie der Titel schon sagt – die Sprache im engeren Sinne stehen. Die Perspektivenvielfalt wird schließlich ergänzt durch die »autistische Sicht« auf neurotypische Sprache (Matthias Huber, ▸ Kap. 6) und einen Blick in die Sprache von Literatur von (und über) Autisten (Miriam Nandi, ▸ Kap. 9).
Wir haben das Buch für alle am Thema »Autismus und Sprache« interessierten Leser geschrieben. Die Kapitel 5.2 – 5.5 enthalten viel Fachterminologie, können aber – wie gesagt – auch übersprungen werden. Wahrscheinlich sind auch die anderen Kapitel nicht frei von Fachbegriffen geworden, aber hoffentlich – zumindest in den klinisch-praktischen Teilen – doch so »jargonarm«, dass sie sich auch von Nicht-Fachleuten flüssig lesen lassen. Es richtet sich u. a. an professionelle Helfer, Pädagogen, Pflegekräfte, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Ärzte, die sich um ein gegenseitiges Verstehen mit ihren autistischen Klienten bemühen, aber auch an autistische Menschen und ihre Angehörigen, die hoffentlich von der »Doppelperspektive« des Buches auf autistische und neurotypische Sprache profitieren und es als »Übersetzungsratgeber« nutzen können.
Einige kurze Anmerkungen zur Terminologie seien hier noch gemacht: Dieses Buch ist letztlich keines über Krankheit oder Behinderung, sondern ein Buch über menschliche Varianz, über Diversität. Es soll also um Autismus als Phänomen, nicht um Autismus als Krankheit gehen. Damit soll nicht gesagt sein, dass Autismus nicht auch als Krankheit auftreten kann, die großes Leiden verursacht, sondern nur die Perspektivnahme dieses Buches beschrieben werden. Aus diesem Grund sprechen wir nur dann von Autismus-Spektrum-Störung (abgekürzt ASS), wenn explizit ein psychiatrisches Leiden gemeint ist, und in allen anderen Fällen von Autistinnen, Menschen mit Autismus oder Menschen im Autismusspektrum.
Klärungsbedürftig ist der – umstrittene und hier verwendete – Begriff des »hochfunktionalen Autismus«: Historisch bezog er sich nur auf Menschen mit Frühkindlichem Autismus mit hoher Intelligenz und Sprachfähigkeit und war in der Abgrenzung zu Patienten von Bedeutung, die beispielsweise nicht sprechen. Im vorliegenden Text wird er weiter gefasst und bezeichnet keine genau abgegrenzte Kategorie. Gemeint sind Autisten (jedweden Untertyps) von mindestens mittlerer Intelligenz, guten Sprachfähigkeiten und mit hoher Anpassungsfähigkeit. Er umfasst das Fehlen einer intellektuellen Beeinträchtigung und das Vorhandensein eines vollständigen Spracherwerbs als Kommunikationsmittel. Dabei ist den Autoren bewusst, dass der Begriff umstritten ist und sich im Umbruch befindet. Seine Implikation, dass es damit einen »niedrigfunktionalen Autismus« geben muss, der dadurch eine Abwertung erfahren kann, sehen wir durchaus als problematisch an. In Ermangelung einer passenderen Bezeichnung für diesen »Teil des Spektrums« haben wir den Terminus einstweilen beibehalten.
In diesem Buch wird häufig von »autistischer Sprache« und »neurotypischer Sprache« die Rede sein, was zugegebenermaßen sehr danach klingt, als handle es sich um klar abgrenzbare, distinkte Kategorien. Dies ist so nicht gemeint. Es gibt keine einheitliche autistische oder neurotypische Sprache, jeder Mensch spricht anders, jede Gesprächssituation muss sich eine gemeinsame Sprache schaffen, die beidseits verstanden wird. Auch spricht kein Mensch »nur autistisch« oder »nur neurotypisch«, jeder mischt die Elemente in seiner Weise. Die verwendeten Begriffe »autistische Sprache« und »neurotypische Sprache« sind also lediglich als Idealtypen zu verstehen, nicht als schubladenmäßig voneinander abgegrenzte Kategorien. Damit gemeint ist, dass der durchschnittliche Autist sich wahrscheinlich mehr der »autistischen Sprache« bedient, der durchschnittliche neurotypische Mensch mehr der »neurotypischen Sprache«. Aufgrund der häufigen Verwendung dieser Begriffe haben wir uns entschieden, die Anführungszeichen wegzulassen; wir hoffen, dass das selbstironische Augenzwinkern in den Begriffen dennoch erhalten bleibt.
Dank
Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Bernhard Schröder, bei Angela Debl, bei Dr. Nantke Pecht und bei Paula Dahmen, M.Ed. für Hilfe und Unterstützung beim Schreiben des Kapitels 4.5. und bei Jasmine Glauser für das Gegenlesen vieler Kapitel und die vielen konstruktiven Anregungen.
Endnoten
1Im Folgenden verwenden wir das Generische Maskulinum und subsumieren hierbei männliche, weibliche und diverse Personen.
2 Historische Einordnung
2.1 Beobachtungen von Grunja Ssucharewa, Leo Kanner und Hans Asperger
Die Besonderheiten der Sprache, die aus klinischer Sicht bei Autismus häufig auftreten, ja sogar für ihn kennzeichnend sind, fanden leider nur einen beschränkten Eingang in das seit 30 Jahren gültige Klassifikationssystem der ICD-10 (vgl. ▸ Kap. 2.2), sodass sie lange Zeit einen etwas »unklaren Status« in Diagnostik und Therapie von ASS hatten. Während die bei Kanner beschriebenen semantischen und grammatikalischen Auffälligkeiten (s. u.) ihren Platz in der ICD-10 fanden (z. B. Pronominalumkehr und Echolalie), blieben die pragmatischen Auffälligkeiten, die alle drei frühen Autoren beschreiben, eher »unterbelichtet«. Erst in der ICD-11 fanden nun diejenigen Besonderheiten der Sprache, die sich auch bei hochfunktionalen Formen der ASS zeigen, unter dem Begriff der sprachpragmatischen Defizite ihren Platz (vgl. ▸ Kap. 2.3). Aus Sicht der Autoren: Besser spät als nie. Dabei sind die sprachlichen Besonderheiten mitnichten ein Phänomen, das erst in jüngster Zeit in den Blick genommen wurde. Das zeigt sich beim Blick in die Erstbeschreibungen erstaunlich deutlich. Insbesondere Hans Asperger legte dabei auch großen Wert auf das Phänomen »sprachlicher Ausdruckserscheinungen«, die heutzutage sicher als Teil der Sprachpragmatik aufgefasst würden und die ihm bei seinen jungen Patienten doch deutlich verändert schienen.
Grunja E. Ssucharewa beschreibt in dem 1926 erschienen Artikel »Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter« (Ssucharewa, 1926), der vielen Autoren als Erstbeschreibung von ASS gilt, sechs Knaben zwischen 2 und 14 Jahren, deren Entwicklung sie jeweils über mehrere Jahre verfolgte. Alle zeigen mehr oder minder prägnante sprachliche Auffälligkeiten, die ersten vier beschriebenen Fälle lernten zwischen 4 und 5 Jahren lesen und schienen über das geschriebene Wort weitaus mehr Zugang zur Welt zu finden als über den Kontakt zu Gleichaltrigen, den alle Knaben eher vermieden. Am eindrücklichsten fällt die Beschreibung der Sprache des 13-jährigen, musikalisch-künstlerisch hochbegabten »M. Sch.« aus; unter anderem wird er folgendermaßen beschrieben:
»(...) stellt an die umgebenden Menschen eine Menge absurder Fragen. Wiederholt mehrmals ein und dasselbe und beruhigt sich nur in dem Falle, wenn er eine erschöpfende Antwort erhält.« (Ssucharewa, 1926, S. 239)
Es scheint so, dass das Kind »die Wahrheit« wissen will und an Sprache in dem Sinne interessiert ist, dass sie Trägerin der semantisch richtigen Information ist. Dass beispielsweise die gestellte Frage nicht paraphrasiert wird, wenn das Gegenüber sie offenkundig nicht versteht oder nicht beantworten kann, kann dahingehend interpretiert werden, dass die Verwendung von Sprache als Mittel zum sozialen Austausch deutlich unterrepräsentiert ist. Weiterhin wird vermerkt, dass die Sprache »nicht genügend moduliert« sowie »eilend und unbestimmt« erscheint, was insbesondere deshalb auffällt, weil der Knabe ein absolutes Gehör hat und als junger Erwachsener erfolgreich an einem Konservatorium Violone (Bratsche, A. R.) studiert. Eindrücklich wird herausgearbeitet, dass der Junge (semantisch klar gestellte, A. R.) Fragen »sofort auffasst« und »die logischen Prozesse vollkommen befriedigend verlaufen«, gleichzeitig aber Schwierigkeiten hat, die Frage, wie es ihm gehe, zu verstehen: »Ich weiß nicht, vielleicht gut, vielleicht schlechter, überhaupt geht es den Menschen verschieden« (ebd., S. 240). Hier scheint er wie nach einem objektiven Gehalt der Frage zu suchen, den er nicht finden kann (vgl. ▸ Kap. 5.2 und ▸ Kap. 8.1). Vorausgreifend auf das Kapitel zu Autismus und Literatur (vgl. ▸ Kap. 9), finden sich bei Ssucharewa auch Beschreibungen, die den literaturwissenschaftlichen Beobachtungen erstaunlich ähnlich sind. Der Patient schildert: »Oft kommt es vor, daß bei mir im Kopf sich ein Wort dreht, so daß ich von ihm auf keine Weise loswerden kann; (...)« (ebd., S. 241). Hier deutet sich eine ähnliche, sehr spezielle Wahl der Worte an, wie man sie auch bei Axel Brauns oder Birger Sellin findet. Auch den Sinn für sprachliche »Klänge« hat der geschilderte junge Patient offenkundig: »Macht Verse, die inhaltlich unoriginell, jedoch klangvoll sind« (ebd., S. 242). Auch das Kind »M. R.« zeigt eine monotone Stimmführung und eine reduzierte Dialogfähigkeit: »Wenn er unterbrochen wird, so kommt er nicht zur Ruhe, wartet bis auf einen bequemen Augenblick ab und fängt seinen Bericht von neuem mit den geringsten Einzelheiten wieder an« (ebd., S. 244).
Leo Kanner publizierte seine ersten elf Beobachtungen von Fällen »kindlicher Psychosen«, die den Fallbeschreibungen von Ssucharewa ähneln, in der 1943 erschienenen Ausgabe von »The nervous Child« (Kanner, 1943). Seinem Artikel gab er allerdings den vielversprechenden Titel »Autistic disturbances of affective contact« und brachte einige Argumente für die Notwendigkeit ein, die beschriebenen Störungsbilder in Abgrenzung zu Psychosen zu betrachten. Auch konnte er feststellen, dass in einigen der Fälle die sozialen, kommunikativen und emotionalen Fertigkeiten in deutlicher Diskrepanz zu den allgemeinen, teilweise sehr guten, kognitiven Fertigkeiten standen. Die Eigenartigkeit des sprachlichen Ausdrucks bei seinen Patienten wird sehr ausführlich beschrieben, Leo Kanner gibt einen differenzierten Einblick in die Besonderheiten der Kommunikation und Wahrnehmung der Patientinnen (drei davon sind weiblich). Bei diesen Kindern, die ausnahmslos ebenfalls eine schwere Störung der nonverbalen sozialen Kommunikation zeigen, ist die sprachliche Produktion meistens stark reduziert im Sinne von repetitiver, wenig variabler und wenig flexibler Sätze; es findet kaum Anpassung an Situationen, Kontexte und Bezugspersonen statt (was aus Sicht der Autoren klar als sprachpragmatisches Phänomen aufzufassen ist). Bis zum Alter von ca. 6 Jahren drücken sich die Kinder meistens mittels stereotyper Sprachäußerungen, ritualisierter Sätze und ständiger Wiederholungen von Fragen und Feststellungen aus. Nur drei der elf Kinder sind (fast) komplett stumm. Selbst hier jedoch werden hin und wieder plötzliche sprachliche Äußerungen beobachtet, die aus einzelnen Wörtern bzw. aus ganzen (dann grammatikalisch und artikulatorisch korrekten) verständlichen Sätzen bestehen (vgl. auch »Sprechfaulheit«, siehe ▸ Kap. 5.2). Kanner stellt Folgendes fest: »In none of the eight ›speaking‹ children has language over a period of time served to convey meaning to others« (Kanner, 1943, S. 243). Fast alle Kinder sind mit einem beträchtlichen Gedächtnis ausgestattet. Im sprachlichen Bereich bezieht sich dies auf Wörter (egal wie lang und ungewöhnlich) und manchmal auch auf Kinderlieder und -reime, Gebete oder auf lange Listen von Namen, die den eigenen Spezialinteressen entsprechen (Tiere, Abfolge der Präsidenten, Alphabet vorwärts und rückwärts, ausländische Wörter). Laut Kanner dient der Erwerb der Sprache in den ersten Jahren (später sind die Kinder mit Spracherwerb in der Lage, auf Fragen adäquate Antworten zu geben und weisen eine gewisse spontane Variation von Sätzen auf) weder semantischen (bezogen auf dem Zuhörer, siehe unten) noch kommunikativen Zwecken. Andere Besonderheiten bei diesen fallbasierten Beobachtungen sind z. B. die Verwendung von Pronomina wie in einer Art »Spiegelung« des Interaktionspartners, die Kanner mit folgenden Beispielen erklärt:
»... ›Now I will give you your milk‹ expresses the desire for milk in exactly the same words (he heard from his mother)«, »... The repetition ›Are you ready for your dessert‹« means the child is ready for his dessert« (Kanner, 1943, S. 244)
Ebenfalls häufig kommen Echolalien vor, z. B. im Sinne der Bestätigung der vom Interaktionspartner gestellten Frage, durch die buchstäbliche Wiederholung dieser und nicht durch ein zustimmendes »Ja« (normalerweise sind Kinder zur symbolischen Verwendung des Wortes »Ja« im 2. Lebensjahr fähig). Kanner ist davon überzeugt, dass die beschriebenen Sprachbesonderheiten (genauso wie das repetitive Verhalten und das Festhalten an Routinen und Abläufen, deren Unterbrechung zu extremer Irritation bis zu dramatischen, emotionalen Ausbrüchen führen kann) mit einem »... anxiously obsessive desire for the maintenance of sameness, that nobody but the child may disrupt on rare occasions« (Kanner, 1943, S. 245) in Verbindung stehen. Kanner bringt dann noch eine zweite Erklärung für diese autistischen Besonderheiten ein: »The inability to experience wholes without full attention to the constituent parts ...« (Kanner, 1943, S. 246). Dabei zieht er einen Vergleich mit der Legasthenie, im Sinne einer erworbenen Unfähigkeit, Wörter aus ihren alphabetischen (bzw. phonetischen) Komponenten aufzubauen, in Betracht.
Drei Jahre nach seiner ersten Schrift ist die Anzahl seiner Fallbeobachtungen auf 23 gestiegen und Kanner widmet einen ganzen Artikel den sprachlichen Besonderheiten seiner Patienten und Patientinnen mit dem Titel »Irrelevant und metaphorical language in early infantile autism« (Kanner, 1946). Kanner bemerkte nach intensiven Beobachtungen der betroffenen Kinder, dass viele anscheinend bedeutungslose und merkwürdige Äußerungen dieser Kinder in der Tat für diese selbst eine völlig nachvollziehbare, semantische Bedeutung besitzen, und zwar, indem das Kind seine persönlichen, originellen und individualisierten Referenzen verwendet, statt sich an allgemein geläufige, bekannte Analogien zu halten. In dieser Schrift scheint Kanner daher seine erste Aussage über die »semantische Bedeutungslosigkeit der autistischen Sprachproduktion« in entscheidendem Sinne zu revidieren. Ein Beispiel: Der fast 4-jährige Jay nennt sich selbst »Blum«, wenn seine Eltern vermuten, dass er gelogen hat. Kanner erklärt, was hinter dieser anscheinend sinnlosen Äußerung verborgen ist, wie folgt: »The mystery of this ›irrelevance‹ was explained when Jay, who could read fluently, once pointed to the advertisement of a furniture firm in the newspaper, which said in large letters: ›Blum tells the truth‹« (Kanner, 1946, S. 243). Das Kind meinte also damit, die Wahrheit gesagt zu haben (er ist Blum). Kanner nennt das ein Beispiel von »metaphorischem Ausdruck«, jedoch nicht auf allgemein akzeptierte Konventionen gerichtet, sondern auf konkrete, spezifische und sehr persönliche Erfahrungen basierend. Weiterhin wird der 5-jährige Anthony beschrieben, der eine Vorliebe für die Zahl »55« zeigte, auf die er sich unerklärlicherweise fast in jedem Satz bezog, bis das Umfeld darauf kam, dass er damit das Alter seiner geliebten Oma meinte und somit seiner Zuneigung für sie Ausdruck gab. Teilweise nehmen solche, nach Kanners Definition »metaphorische Substitutionen« quasi Züge einer ungewöhnlichen Begabung an. Als weiteres Beispiel sei der 5-jährige Donald genannt, der beim Malen plötzlich sagt »Annette and Cecile make purple«. Donald hatte nämlich seine fünf Farbflaschen nach den berühmten Dionne-Fünflingen (die ersten, damals aus der Zeitung bekannten, lebenden Fünflingsmädchen) genannt und bezog sich z. B. für die blaue Farbe auf das Mädchen Annette und für die rote Farbe auf deren Schwester Cecile (blau und rot gemischt ergibt die Farbe Lila!). Anhand solcher Beispiele erklärt Kanner:
»The autistic child does not depend upon (such) prearranged semantic transfers. He makes up his own as he goes along.« (Kanner, 1946, S. 244)
Aus diesen und zahlreichen anderen Beobachtungen kommt Kanner zu einer sehr interessanten Schlussfolgerung, die leider in den Klassifikationen bzgl. der autistischen Symptomatik nicht weiterverfolgt wurde, und zwar, dass Kinder mit ASS sehr wohl zur metaphorischen, semantischen, generalisierenden Manipulation der Sprache in der Lage sind (unter Umständen besser und häufiger als typisch entwickelte Menschen). Der Unterschied liegt lediglich darin, dass sie ihre eigenen, völlig originellen Transferleistungen durchführen und als autistische Kinder nicht versuchen, den Zuhörer in ihre Denkwege zu involvieren und sich nicht darum kümmern (können), verstanden zu werden.
Aus der klinischen Erfahrung kann diese Ansicht zumindest für einige Individuen mit ASS bestätigt werden. Es wird daraus die Notwendigkeit deutlich, die autistische Perspektive annehmen und verstehen zu können, um in diagnostischen Konzepten sowie Interventionskonzepten und -prozessen effektiv arbeiten zu können.
Hans Asperger zeigt – ebenfalls in den 1940er Jahren – bei den vier von ihm ausgearbeiteten Fallvignetten (aus 200, der gleichen Typologie zugehörigen Fällen) sehr plastisch sprachliche Besonderheiten auf, denen er auch einen zentralen Abschnitt seiner Habilitationsschrift widmet (Asperger, 1944). Über die phänomenologische Beschreibung hinaus, versucht er, die sprachlichen Besonderheiten seiner Patienten in einer Systematik zu erfassen. Dabei schränkt er methodologisch entschieden ein: »Die Erfahrung hat uns gezeigt, daß das Streben, Persönlichkeiten nach vorher festgelegten Gesichtspunkten zu erfassen, den Blick einengt, die Gefahr in sich birgt, daß man gerade das Einmalige – und damit das Wesentliche dieses Menschen übersieht« (ebd., S. 7). Es finden sich dann die folgenden konkreten Beschreibungen:
»Ernst K. (...) Der Sprechbeginn war etwas verzögert (erste Worte mit 1 ½ Jahren), der Knabe soll auch längere Zeit Worte nicht richtig gesprochen haben (Stammeln), jetzt rede er aber besonders gut, wie ein Erwachsener.« (ebd., S. 32)
»Fritz V. (...) lernte sehr früh reden: Mit 10 Monaten (...) sprach er die ersten Worte, lernte rasch sich in guten Sätzen ausdrücken, sprach bald ›wie ein Alter‹.« (ebd., S. 11)
»Harro L. (...) die Formulierung seiner Gedanken erstaunlich gut. Er hat eine ganz ungewöhnlich reife, fertige, erwachsene Ausdrucksweise, (...) nicht als fertige unerlebte Redensart übernommen, sondern aus eigener unkindlich-reifer Erfahrung kommend. Man hat das Gefühl, er prägt sich im Augenblick das gerade passende Wort.« (ebd., S. 25)
Hier zeigen sich zuerst einmal die (autistischen) Stärken im semantischen Gebrauch der Sprache, wie sie auch schon Ssucharewa aufgefallen waren. Bereits einleitend entwirft er keine reine »Pathologie«, sondern ein (wie wir heute sagen würden) »Stärken-Schwächen-Profil«: »Steht auch in vielen Fällen das Versagen an der Gemeinschaft im Vordergrund, so wird es doch wieder in anderen Fällen kompensiert durch besondere Originalität des Denkens und Erlebens, die oft auch zu besonderen Leistungen im späteren Leben führen« (ebd., S. 9). Gleichzeitig bemerkt Asperger auch sehr treffend die sprachlichen Probleme, die seine jungen Patienten aufweisen. Um die Gemeinsamkeiten seiner Patienten im Gebrauch der Sprache zu beschreiben, führt er folgende Unterscheidung ein: Neben der Funktion von Sprache »sachliche Inhalte mitzuteilen«, kommt einer anderen, weniger bewussten Funktion »mindestens die gleiche Wichtigkeit zu«: dass sie »nämlich Träger von Ausdruckserscheinungen sei« (ebd., S. 42). Während die erste Kommunikationsebene von seinen Patienten überdurchschnittlich gut beherrscht wird, bereitet ihnen die zweite Ebene erhebliche Probleme. Dabei entlehnt Asperger den Begriff der »Ausdruckserscheinung« dem seinerzeit vielgelesenen Philosophen und Psychologen Ludwig Klages2 (Klages, 1936). Die sinnhafte Bedeutung der Ausdruckserscheinungen beschreibt Asperger wie folgt: »Die Ausdruckserscheinungen eines Menschen sind es, die uns sein Wesen erschließen. Der Eindruck, den diese Erscheinungen auf uns machen, läßt uns ein Bild der uns gegenübertretenden Persönlichkeit« (Asperger, 1944, S. 42) entstehen. Ausdruckserscheinungen umfassen all diejenigen Aspekte und Funktionen von Sprache, die beim Sprechen durch Haltung, Gestik, Mimik, Tonfall und Situationsbezogenheit transportiert werden, aber nicht explizit zur Sprache kommen.
»Alle Affekte drücken sich vor allem durch Ausdruckserscheinungen aus; wie die miteinander redenden Menschen zueinander stehen, in Über- oder Unterordnung, in Sympathie oder Antipathie – das spricht untrüglich aus dem Ton ihrer Worte – selbst wenn der Inhalt der Worte trügt; wes Geistes Kind einer ist, das drückt sich untrüglich in dieser Seite der Sprache aus – wer zu hören versteht, dem entlarvt sich der Mensch durch seine Rede; was Lüge und was Wahrheit, was ›tönendes Erz und klingende Schelle‹ und was wesenhaftes Sein sei, das erfahren wir vor allem aus jenen Ausdruckserscheinungen.« (ebd., S. 42)
Es kann (etwas freier) ergänzt werden, dass der Bereich der Ausdruckserscheinungen die mimische und gestische Kommunikation umfasst, das Verwenden und Verstehen von Tonfall- und Lautstärkemustern beim Sprechen, das Verwenden und Verstehen von Sprechpausen, von nonverbalen Lautäußerungen, prosodischen Markierungen und Veränderungen der Sprechgeschwindigkeit. Auch die Organisation des Sprecherwechsels ist abhängig von der Art der Bezogenheit der Kommunikationspartner aufeinander. Zudem sind diejenigen emotionalen und sozialen Botschaften mitgemeint, die in der spezifischen Wortwahl, im Satzbau und im Sprachstil verborgen sind. Viele Botschaften »zwischen den Zeilen« erschließen sich auch nur aus der spezifischen Situation, in der sie gesprochen werden, und nur demjenigen Hörer, der Situation und Aussage zu einer Bedeutung synthetisieren kann. Zuletzt sei hier noch das Verstehen sinnbildlicher Sprache, also übertragener Bedeutungen, und ironischer Bemerkungen genannt.
Aus heutiger Sicht wird schnell klar, dass es sich hier um Phänomene handelt, mit denen sich auch die Sprachpragmatik beschäftigt – und die Asperger offenkundig für einen Kernaspekt der »autistischen Psychopathie« hält. Umso erstaunlicher ist es, dass jene – bezogen auf ASS – erst mit der ICD-11, also mehr als 75 Jahre später, Eingang in die internationalen Klassifikationssysteme fanden (vgl. ▸ Kap. 2.3). In methodologischer Hinsicht interessant ist, dass Asperger bereits darauf hinweist, dass Ausdruckserscheinungen einem experimentellen Zugang nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind:
»Dieser Weg von den Ausdruckserscheinungen zum Wesen verzichtet bewußt auf ein von vornherein gegebenes System. Er geht bewußt vom Individuum aus, sucht seine Persönlichkeit in ihrer Einmaligkeit zu begreifen, sucht die gesetzmäßige Entsprechung von Außen und Innen, von körperlicher Konstitution und seelischem Wesen, von Motorik, Mimik, Gestik, von vegetativen Erscheinungen (an denen das Seelische sich ›abspielt‹), von Sprachmodulation und Redeweise – und charakterlichen Gegebenheiten zu finden. So wie wir an dem uns gegenübertretenden Menschen einfach das zu deuten und uns daraus ein Bild zu machen versuchen, was sich an ihm ›ausdrückt‹, so verzichten wir auch bewußt darauf, ihn in eine künstlich herbeigeführte Testsituation zu bringen, in eine stereotype Testmaschinerie einzuspannen, welche mit dem, was ihm im alltäglichen Leben begegnet, nichts zu tun hat.« (ebd., S. 7)
Die bis heute bestehenden Schwierigkeiten, Auffälligkeiten in der Sprachpragmatik experimentell nachzuweisen, dürften genau mit diesem, von Asperger beschriebenen Phänomen zusammenhängen (vgl. ▸ Kap. 2.1).
Asperger macht auch einen weiteren Punkt deutlich, der im vorliegenden Buch mehrfach herauszustellen sein wird: dass nämlich in der neurotypischen Sprache die allermeisten pragmatischen Phänomene unbewusst »mitlaufen« und nicht als bewusster Kommunikationsakt vollzogen werden. Asperger schreibt – bezogen auf nicht-autistische Kommunikationspartner –, dass »vieles von diesen Gegebenheiten gar nicht intellektuell verstanden, sondern nur als Eindruck gefühlsmäßig empfunden wird« (ebd., S. 43). Man macht sich nicht bewusst, dass man mit dem Vorgesetzten anders spricht als mit dem Untergebenen, es »passiert« einfach. Erst dann, wenn die lange Reihe unbewusster Erwartungen nicht erfüllt wird, rückt die Pragmatik in den Bereich des Bewusstseins – und selbst das oft nur diffus als das Gefühl, dass irgendetwas in der Kommunikation (oder gar in der Beziehung) nicht stimmt.
Die Unterscheidung zwischen Sprache als Träger sachlicher Information und als Ausdruckserscheinung dient nun – wie schon angedeutet – dazu, die Besonderheiten und Defizite seiner Patienten im Verwenden und Verstehen von Sprache als Ausdruckserscheinung zu verdeutlichen. Er kontrastiert die Probleme seiner Patienten beim Verstehen und Anwenden von Sprache als Ausdruckserscheinung mit der teilweise herausragenden Fähigkeit »zur begrifflichen Erfassung der Welt«. Dieses Ungleichgewicht zwischen sehr gutem Umgang mit dem begrifflichen Aspekt der Sprache auf der einen Seite und ausgeprägten Defiziten im Bereich der konkreten Anwendung und situativen Einbettung von Sprache in die Gesamtkommunikation auf der anderen Seite, kann man bis heute bei hochfunktionalen, autistischen Patienten als sehr häufiges Muster wiedererkennen.
Dass – und in welcher Weise – die Sprache für Asperger auch diagnostisch mit im Zentrum steht, macht er in der folgenden Passage deutlich:
»Immer kommt uns bei den Autistischen Psychopathen, wenn wir genau darauf achten, die Sprache abartig3 vor – ihre Erkenntnis ist uns daher diagnostisch besonders wichtig. Bei den einzelnen Fällen gibt es sehr verschiedene Arten von Anders-sein: einmal ist die Stimme auffallend leise und fern, vornehm-näselnd, dann wieder schrill, krähend, unangepaßt laut, daß es einem förmlich im Ohr wehtut; einmal geht sie monoton dahin, ohne Hebung und Senkung – auch nicht am Ende des Satzes, des Gedankens –, ist ein leiernder Singsang; oder aber die Sprache ist übertrieben moduliert, wirkt wie eine schlechte Deklamation, wird mit übertriebenem Pathos vorgetragen. So viele Möglichkeiten es da auch gibt, gemeinsam ist in allen Fällen: die Sprache wirkt auch auf den naiven Zuhörer unnatürlich, wie eine Karikatur, zu Spott herausfordernd. Und noch eins: sie richtet sich nicht an einen Angesprochenen, sondern ist gleichsam in den leeren Raum hineingeredet (...)« (ebd., S. 43)
Der bereits bei Ssucharewa benannte, besondere Umgang mit Worten und in der Wortwahl wird auch von Asperger beobachtet und herausgearbeitet. Er schreibt seinen Patienten ein »besonders schöpferisches Verhältnis zur Sprache« (ebd., S. 44) zu und die Verwendung von »neugebildeten oder wenigstens umgeformten Ausdrücken, die oft besonders treffsicher und bezeichnend, oft freilich auch recht abwegig sind« (ebd., S. 44). Auch diese Beobachtung trifft gut auf viele unserer Sprechstundenpatienten zu und spiegelt sich auch in literaturwissenschaftlichen Analysen von Texten autistischer Autoren (vgl. ▸ Kap. 9). Beispielhaft zitiert Asperger einen »6 – 7 Jahren alten Knaben«, der als Unterschied zwischen Stiege (Treppe, A. R.) und Leiter angibt: »Die Leiter geht so spitz und die Stiege so schlangenringelich« (ebd., S. 46). Die Wortneuschöpfung »schlangenringelich« könnte dabei gut einem der im Literaturkapitel vorgestellten Texte entstammen.
Es wird deutlich, dass viele der sprachlichen Charakteristika von autistischen Menschen, mit denen wir uns heute – und auch im vorliegenden Buch – beschäftigen, bereits in den Erstbeschreibungen autistischer Zustandsbilder beschrieben und – zumindest bei Kanner und Asperger – auch reflektierend in einen theoretischen Rahmen eingebettet wurden.
2.2 Autistische Störungen und Sprachentwicklungsstörung in der ICD-10
Die Beobachtungen von Ssucharewa, Kanner und Asperger (▸ Kap. 2.1) waren bahnbrechend für die Einordung autistischer Symptomatik als eigenständiger Phänotyp, im Gegensatz zu Konzepten wie das der kindlichen Psychosen. Erst in den 1970er Jahren wurden diese Beobachtungen weiter konkretisiert, und vor allem wurde der von Kanner beschriebene Frühkindliche Autismus unter dem Schlüssel 299.0 der ICD-9 (International Classification of Diseases, Vorläufer der ICD-10) als »Infantiler Autismus« klassifiziert (WHO, 1986). Allerdings war dies immer noch der Diagnosegruppe 299, »typische Psychosen des Kindesalters« zugeordnet (AWMF, 2016b). Die Forschung der Arbeitsgruppe um Sir Michael Rutter wies dann klar in die Richtung, dass Autismus in den folgenden Jahren zunehmend als eigenständige Diagnose mit einer, im Vergleich zu Psychosen, deutlich unterschiedlichen Ätiologie und Nosologie betrachtet wurde (Rutter, 1972). Schließlich fanden Anfang der 1990er Jahre die autistischen Störungen (differenziert in Frükindlichen Autismus, Atypischen Autismus und Asperger-Syndrom) Eingang in die ICD-10 als wichtigste Gruppe der Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen im Kapitel F84 (WHO, Version 2019 [1990]) (BfArM, ICD-10-GM, 2025). Dabei steht der Begriff tiefgreifend als Gegenpol zum Begriff umschrieben. Dies wird durch die Stellung der diagnostischen Kategorien im in Deutschland verwendeten Multiaxialen Klassifikationsschema (Remschmidt et al., 2017) betont: Während die Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen die Klassifikation auf der ersten Achse die klinisch-psychiatrischen Syndrome eröffnen, werden die umschriebenen Entwicklungsstörungen auf der zweiten Achse behandelt. Die Sprachentwicklungsstörungen werden demnach in der ICD-10 zusammen mit den Störungen schulischer Fertigkeiten und der Motorik unter den Ziffern F80–F83 klassifiziert und bilden als umschriebene Entwicklungsstörungen die zweite Achse des Multiaxialen Klassifikationsschemas (Remschmidt et al., 2017). Entwicklungsstörungen (ES) des Sprechens und der Sprache (F80.0 bis F80.2) werden nach ICD-10 dann diagnostiziert, wenn sprachliche Defizite nicht besser durch eine allgemeine kognitive Entwicklungsstörung im Sinne einer weit unterdurchschnittlichen Intelligenz (IQ < 70) erklärbar sind. Die genaueren diagnostischen Kriterien für die Sprachentwicklungsstörungen werden in ▸ Kap. 4 dieses Buches weiter ausgeführt.
Letztlich jedoch erfüllen alle Entwicklungsstörungen die gleichen allgemeinen Merkmale, im Sinne eines Frühbeginns (im Kleinkindalter bis spätestens Grundschulalter) in Verbindung mit Problemen bei der Bewältigung altersspezifischer Aufgaben sowie einem stetigen Verlauf ohne krankheitstypische Remissionen oder Rückfälle (Rutter, 2011). Darüber hinaus spielen abweichende Funktionen in den neuronalen Netzwerken, die eng mit der biologischen Reifung des zentralen Nervensystems zusammenhängen, die Hauptrolle in der Ätiologie.
Umschriebene Entwicklungsstörungen können im Multiaxialen Klassifikationsschema auf der zweiten Achse als Zusatzmerkmal, ergänzend zu den auf der ersten Achse kodierten Syndromen, verschlüsselt werden und somit könnten sie prinzipiell auch zusammen mit Autismus diagnostiziert werden. Allerdings stellen die Sprachdefizite auch ein eigenständiges Merkmal im zweiten Symptombereich der Qualitativen Auffälligkeiten der Kommunikation bei der Beschreibung der diagnostischen Kriterien des Frühkindlichen Autismus dar, sodass die Kodierung sprachlicher Defizite auf der zweiten Achse eigentlich dann vorgesehen sein sollte, wenn diese als Störung der expressiven und/oder rezeptiven Sprachentwicklung in deutlichem Missverhältnis zu den kognitiven Fähigkeiten eines Kindes stehen (was allerdings zu unterschiedlicher Handhabung zwischen Klinikern führen kann). In Bezug auf sprachliche Eigenschaften bei Frühkindlichem Autismus (F84.0) wird beschrieben: Eine »Verspätung oder vollständige Störung der Entwicklung der gesprochenen Sprache« (nicht kompensiert durch non-verbale Kommunikation) und/oder eine »relative Unfähigkeit, einen sprachlichen Kontakt zu beginnen oder aufrechtzuhalten« (im Sinne eines Defizits des gegenseitigen Kommunikationsaustausches) sowie auch eine (spezifisch für Autismus) »stereotype, repetitive Verwendung der Sprache oder idiosynkratischerGebrauch von Worten oder Phrasen« (Remschmidt et al., 2017). Diese Charakteristika entfallen bei der Beschreibung des Asperger