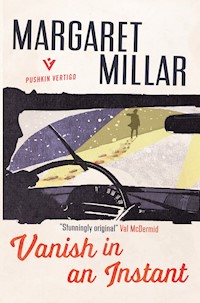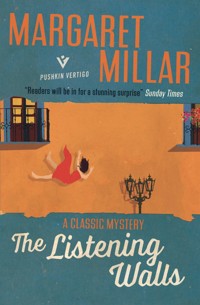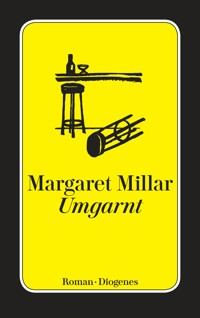7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die achtjährige Annamay ist die kleine Prinzessin, der ihr Vater einen ›Palast‹ unten am Fluß baut. Dort begegnet sie so geheimnisvollen Gestalten wie Mr. Cassandra, der nur mit einem weißen Laken bekleidet als ›Prophet‹ herumläuft. Eines Tages verschwindet Annamay. Nach Monaten werden ihre Gebeine gefunden, trotzdem behauptet ihre zehnjährige Cousine Dru, sie sei noch am Leben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Banshee, die Todesfee
Roman
Aus dem Amerikanischen von Renate Orth-Guttmann
Diogenes
Für Carol und Ralph Sipper
{7}1
Die Prinzessin hopste, begleitet von ihrem Hofstaat, über den Gartenweg. Der größere der beiden Paladine hatte dichtes schwarzes Haar und kam angeblich aus Neufundland, aber das hatte sich nie so recht nachweisen lassen. Der andere war ein Deutscher mit braunem Haar. Beide waren ihr treu und von Herzen zugetan (auch wenn sie häufig dazu tendierten, undurchführbar oder unnötig erscheinende Befehle zu ignorieren), und beide konnten gut zuhören. Neufs dicker, seidiger Bauch bot ein weiches Kissen für das Haupt der Prinzessin, wenn sie unter der Eiche zu liegen und den Würmchen zuzusehen wünschte, die sich an den Zweigspitzen drehten und wendeten wie Trapezkünstler im Zirkus. Auch Schäf machte sich sehr nützlich; er zog die königlichen Rollschuhe über die Zufahrt und leckte Blut von aufgeschürften Knien und Ellbogen, wodurch es der Prinzessin erspart blieb, ins Haus zu gehen und sich einem großen Getue auszusetzen. Schäf machte es bestimmt genausogut wie Mrs. Chisholm, die Haushälterin, mit ihren Waschlappen, ihrer Seife und ihren alkoholgetränkten Wattebäuschen. Außerdem war Schäfs Zunge sehr sanft und brannte nicht.
Natürlich war Mrs. Chisholms Argwohn immer wach. »Also das sieht mir doch ganz so aus, als ob da jemand schon wieder hingefallen ist.«
{8}»Mir tut nichts weh«, sagte Annamay – kein Geständnis, aber auch keine direkte Lüge.
»So war’s und nicht anders, da wett ich einen Dollar gegen einen Dreierweck. Und du hast dich wieder mal von einem dieser Köter beschlabbern lassen. Irgendwann stirbst du noch an so einer ekligen Krankheit, die durch Hundespucke übertragen wird.«
Mrs. Chisholm verlor häufig Punkte durch Übertreibung, indem sie so heftig auf den Ball eindrosch, daß er in einem anderen Court landete und der Sieg an den Gegner ging.
»Wenn ich deine Mutter wär, würd ich Proben von Hundespucke an ein Labor schicken und auf schädliche Keime untersuchen lassen. Vielleicht schick ich sie selber mal ein.«
»Machst du nicht, Chizzy.«
»Und warum nicht, bitte schön?«
»Weil’s einen Haufen Geld kosten kann. Die berechnen dir vielleicht jeden Keim einzeln. Wenn sie nun ’ne Million finden und jeder einen Cent kostet?«
Chizzy überschlug rasch den Betrag und trat würdig den Rückzug an. »Dann würd ich die Rechnung deinem Vater schicken.«
Die Prinzessin zog weiter, durch den Setzlingsgarten, vorbei am Geräteschuppen und am Kugelfisch-Teich, zu dem eigens für sie entworfenen Schloß. Zuerst war es ihr riesig vorgekommen, doch mit jedem Jahr war es kleiner geworden, und jetzt hatte Annamay, wenn ihre Paladine mit hinein durften, kaum Platz, um Freunde zu bewirten und sich um ihre Lieblingskinder zu kümmern.
Beide brauchten fachkundige Pflege. Marietta hatte die Hälfte ihres Haars verloren, und zwar nicht durch eine {9}eklige Krankheit, sondern durch Neuf, der schließlich das meiste davon im Gemüsegarten wieder herausgewürgt hatte, zusammen mit einem von Luella Lus Glasaugen. Luella Lus Auge – das wunderbarerweise unversehrt geblieben war – wurde sichergestellt, gereinigt und wieder angeklebt, saß aber nun, während das andere Auge sich bewegte, starr in seiner Höhle, und jetzt sah Luella Lu immer ganz rätselhaft aus, als könne sie Dinge erblicken, die andere nicht sahen. Ein reuiger Neuf schleppte sie, gleichsam als Wiedergutmachung, oft im Maul herum, und bei Hofe trug man ihm nichts nach.
Es gab nicht viele Prinzessinnen, die ohne Hauspersonal auskamen, aber Annamay schaffte es. Sie putzte und kochte, sie bewirtete ihre Freunde, Chizzy und ihre Eltern und deren Freund Benjamin, der das Schloß entworfen hatte. Sie reichte Brote mit Erdnußbutter und Orangensaft. An solchen Tagen wurden Neuf und Schäf vor die Tür gesetzt, damit Platz für die Gäste war. Dann standen sie draußen und sahen vorwurfsvoll sabbernd durchs Fenster. Die Hunde machten sich zwar nichts aus Broten mit Erdnußbutter, hatten aber ihre Grundsätze und fanden es entschieden ungehörig, daß sie aus dem Schloß verbannt wurden, nur damit irgendwelche Eindringlinge es gemütlicher hatten.
Manchmal zog die Prinzessin, verkleidet als Bürgerliche in Shorts und T-Shirt, auf Abenteuer aus. Diese Ausflüge begannen meist am Bach unterhalb der Avocadopflanzung. Während die Hunde Avocados mit Stumpf und Stiel fraßen, fing Annamay hier Kaulquappen und Wasserläufer. Sie pflückte Hahnenfuß in der Farbe ihrer Haare und die Blüten des Immergrüns in der Farbe ihrer Augen und übte Sprünge von Ufer zu Ufer.
{10}In einem ihrer Geschichtenbücher war ein kleiner Junge einem Wasserlauf stromabwärts nachgegangen, weil er wußte, daß dieser früher oder später in die zivilisierte Welt führen würde. Was sich auch bestätigte – nicht nur für den kleinen Jungen, der sich verirrt hatte, sondern auch für Annamay, die am Swimmingpool der Cunninghams landete.
Mr. Cunningham lag pudelnackt auf einem Badetuch. Annamay hatte noch nie einen nackten Mann gesehen und fand das ganze Drum und Dran ausgesprochen interessant. Da schnappte Mr. Cunningham sich ein Handtuch und wickelte es sich um die Taille.
»Was denkst du dir eigentlich bei dieser Anschleicherei, du verdrehtes Balg?«
»Ich bin nicht geschlichen«, sagte Annamay. »Ich bin dem Wasser stromabwärts nachgegangen, auf der Suche nach der zivilisierten Welt.«
»Da bist du an der falschen Adresse, ist das klar?«
Mr. Cunningham reckte sich, gähnte und kratzte sich die rosaglänzende Kopfhaut. Annamay überlegte, ob er wohl mit den Haaren an der falschen Stelle zur Welt gekommen und damit – in Chizzys Ausdrucksweise – einer der kleinen Ausrutscher des lieben Gottes war.
»Hier lauert hinter jedem Baum ein Wilder«, setzte er hinzu.
»Ich seh keinen.«
»Wenn du sie sehen könntest, brauchten sie ja nicht zu lauern.«
»Wer ist es denn, Lieber?« rief Mr. Cunninghams Mutter vom Haus her. Sie hörte sich richtig betrunken an. Kein Wunder. Chizzy sagte, daß sie eine durstige Seele war. »Wer ist es denn, Peter?«
{11}»Die kleine Hyatt.«
»Was sucht sie hier?«
»Die zivilisierte Welt.«
»Wie eigenartig.«
»Such ich gar nicht«, sagte Annamay. »Ich hab nur die Geschichte von dem verirrten Jungen ausprobiert, der stromabwärts geht und auf die zivilisierte Welt stößt.«
»Probier’s demnächst mal stromaufwärts«, sagte Mr. Cunningham.
Manchmal bekam die Prinzessin überraschenden Besuch, wie den bärtigen Mann mit dem Tamburin auf dem Rücken. Er stahl Avocados und kam zum Schloß, um nachzusehen, ob dort vielleicht ein Zwerg wohnte.
Die Hunde bellten ihn vehement an, aber weil ihr Wedeln ebenso vehement war, bekam der Mann es erst dann mit der Angst zu tun, als Chizzy keifend und besenschwingend über den Weg heransauste. Es gab kein Geschöpf auf dieser Erde, das keine Angst vor Chizzy – mit oder ohne Besen – gehabt hätte, denn sie besaß, wie Annamays Vater Howard sagte, eine Stimme, die Glas zum Bersten bringen konnte. Die Aussicht auf ein so erfreuliches Ereignis veranlaßte Annamay, sich noch mehrere Tage nach dieser Feststellung an Chizzys Fersen zu heften. Doch wurde kein Glas zum Bersten gebracht, außer von Annamay selbst, als sie beim Abwaschen half.
In derselben Woche kam der Mann mit dem Bart noch einmal, aber er ging nicht direkt in die Pflanzung oder zum Schloß, wo man ihn vom Haus aus hätte sehen können. Er blieb unten am Bach, zog die Schuhe aus und ließ das Wasser über die Füße laufen. Da das auch eine Lieblingsbeschäftigung von Annamay und Neuf und Schäf war, ließ es sich fast nicht vermeiden, daß sie sich alle trafen.
{12}Pfoten und Füße baumelten einträchtig im Wasser.
»Was ist das Ding auf deinem Rücken?«
»Ein Tamburin.«
»Warum?«
»Weil es als Tamburin gedacht ist.«
»Ich meine, warum trägst du es mit dir rum? Macht es Musik? Mußt du Stunden nehmen und üben?«
»Stunden nehmen und üben? Ach wo. Und es macht auch keine Musik. Es macht Lärm, wenn man es schüttelt. Ein bißchen, wenn man es sachte schüttelt, und viel Lärm, wenn man es zünftig schüttelt.«
Er war fast so zottig wie Neuf mit seinem langen Kinnbart, dem Schnauzer und den dicken, buschigen Brauen.
»Warum willst du lärmen?«
»Um auf mich aufmerksam zu machen.«
Dafür hatte Annamay kein Verständnis. Das Maß an Aufmerksamkeit, das ihr Eltern und Verwandte und Chizzy und die Lehrer in der Schule entgegenbrachten, lag gerade an der Grenze des Erträglichen. »Machst du gern auf dich aufmerksam?«
»Es gehört zu meinem System, bringt mir mein Publikum. Dann prophezeie ich irgendwas Unheimliches, und die Leute denken, ich bin verrückt, und geben mir Geld, damit ich weggehe, weil ich ihnen nicht geheuer bin.«
»Wie beim Kammerjäger.«
»Etwas in der Art.«
»Wie heißt du?«
»Du kannst mich Grandpa nennen.«
»Geht nicht, ich hab schon zwei Grandpas, einen hier und einen in Long Island. Da muß ich dich schon anders nennen. So, wie du heißt, zum Beispiel.«
»Okay. Wie wär’s mit Mr. Cassandra?«
{13}»Heißt du so? Ehrlich?«
»So ähnlich. Es ist mein übersinnlicher Name. Jeder Mensch hat viele Namen. Sie kommen und gehen wie Ebbe und Flut. Am Montag heiße ich Harold.«
Annamay wurde es ungemütlich, und sie zog die Turnschuhe wieder an. Auf dieses Zeichen hin standen die Hunde auf. Neuf schüttelte den Kopf, so daß der Geifer meterweit in alle Richtungen flog.
»Siehst du?« sagte der Mann. »Mein System funktioniert sogar bei Kindern und Hunden.«
In der Avocadopflanzung wurde zweimal geerntet. Im Winter reiften die Fuertes, während ihre glänzend-glatte Haut noch grün war. Im Sommer kamen die Hass, die eine rauhe schwarze Schale hatten und deren Fruchtfleisch sich streichen ließ wie Butter. Annamay begriff nicht, wieso die Leute lachten, wenn ihr Vater von ihnen als Eier mit Noppenüberzug sprach, und als sie es in der Schule erzählte, nagte die Lehrerin an ihrer Unterlippe, als wollte sie sich das Lächeln verbeißen.
Der Sommer brachte die meisten Besucher, nicht nur, weil die Früchte dann saftiger waren, sondern weil es auf dem Highway zwischen San Diego und San Francisco mehr Tramper gab. Die Tramper hatten oft Hunger, und sie kamen, um heruntergefallene Avocados aufzulesen oder gar die Früchte direkt vom Baum zu pflücken. Annamay setzte ihren Gästen nie Avocados vor, sie schmeckten wie die Hautcreme, fand sie, die ihre Mutter auf dem Ankleidetisch stehen hatte.
Eine Tramperfrau war offenbar Annamays Ansicht, denn sie schien sich weit mehr für das Schloß als für die Avocados zu interessieren. Während ihr Begleiter sich Rucksack und Taschen vollstopfte, ging die Frau lächelnd {14}um das Schloß herum und faßte es an. Annamay hatte in der Schule und von ihrer Cousine Dru gelernt, wie das mit den Babys war, sie wußte also, daß in der Frau, die sich gar nicht beruhigen konnte, ein Baby wuchs. »Himmel, schau dir das an, Phil. Richtiges elektrisches Licht, und ein ganz echter Grill. Möchte wissen, ob hier wirklich ein Kind wohnt.«
»Nein«, sagte Phil. »Wahrscheinlich ist es eine Spielhütte für irgendein verwöhntes Balg.«
Annamay trat vor die Tür und verkündete mit königlicher Hoheit, sie sei kein verwöhntes Balg, sondern eine Prinzessin.
»Was du nicht sagst«, meinte der Mann. Er war blaß und sehr dünn, wahrscheinlich hatte er eine dieser ekligen Krankheiten, mit denen Chizzy sich so gut auskannte. Aber er hatte ein nettes Lächeln und auf dem Unterarm ein Herz eintätowiert. »Und wo ist deine Krone?«
»Eine Krone trägt eine Prinzessin nur zu festlichen Anlässen.«
»Na, für mich ist es ein festlicher Anlaß. Ich hab was zu essen.«
Die Frau lachte und sagte: »Zieh sie nicht auf, Phil. Sie ist ein Püppchen, ein richtiges Püppchen.«
Wenn man an die haarlose Marietta und an Luella Lus angeleimtes Auge und zerbissene Arme und Beine dachte, war das ein zweifelhaftes Kompliment. Aber die Stimme der Frau klang nach Bewunderung, und Annamay errötete bescheiden. »Ach was.«
»Hey, hast du was dagegen, wenn wir von deinen Avocados nehmen?«
»Habt ihr doch schon.«
»Helle bist du also auch. Na schön, macht’s dir was aus, wenn wir uns noch ein paar nehmen?«
{15}»Mir macht’s nichts.«
»Dank dir schön.«
»Aber Chizzy schon. Wegen der Wurzelfäule.«
Diese Warnung hätte unter Umständen wenig gefruchtet, wenn nicht plötzlich wie aufs Stichwort Chizzy aufgetaucht wäre. Sie kam, eine Hacke in der Hand, hinter dem Geräteschuppen hervor und schrie Zeter und Mordio. Chizzys Stimme ließ die Vögel aus den Bäumen aufflattern und vertrieb die Katzen vom Erdhörnchenbau, und das junge Paar entfloh den Hügel hinunter. Unten fiel die Frau hin und schrie auf, und der junge Mann mußte sie aufheben und über den Bach tragen. Sehr kräftig war er ja ohnehin nicht, und er schwankte unter der Last seines Rucksacks mit Avocados und seiner Frau mit dem Kind im Bauch.
»Sind wir reich, Chizzy?«
»Reicher als manche, nicht so reich wie andere.«
»Warum lassen wir die Leute nicht ruhig kommen und Avocados essen?«
»Darum.«
»Ich hasse Darums.«
»Darums müssen sein.«
»Warum?«
»Darum«, sagte Chizzy und machte ein zufriedenes Gesicht. Dann erklärte sie zum etwa fünfzigsten Mal die Sache mit der Wurzelfäule und daß Fremde, die in die Pflanzung kamen, den Pilz vielleicht an den Schuhen hatten und dann alle Bäume krank werden und sterben würden.
»Könnte die Frau ihrem Baby Wurzelfäule geben?«
»Ja, und dir auch, wenn du nicht aufhörst, mit Fremden zu reden. Wo sind die Hunde? Ich denke, die sollen dich beschützen.«
{16}»Ich hab ihnen befohlen, den Müllmann zu jagen.«
Chizzy wischte sich mit der Schürze das Gesicht und brachte einen verzweiflungsvollen kleinen Laut hervor, der sich anhörte wie ein Fink im Unterholz. »Ich will froh sein, wenn der Sommer um ist und du wieder in die Schule kommst. Immer die Sorge um dich und das ewige Hinterhergehetze, das ist zu viel für eine Frau in meinem Alter.«
»Wie alt bist du?«
»Älter als manche, nicht so alt wie andere.«
Die Hunde tauchten wieder auf, zweifach zufrieden, weil sie einem königlichen Befehl gefolgt waren und zugleich die Gegend von einem Schurken gesäubert hatten, der Müll stahl.
»Was hab ich dir wegen der Fremden gesagt?«
»Immer dasselbe.«
»Ich hab dir sogar das Gedicht gemacht. Hat mich fast zwei ganze Abende gekostet. Wetten, daß du’s nicht mehr kannst?«
»Doch kann ich’s.«
»Gut, dann sag’s auf, aber wortwörtlich.«
Es war ein sehr schlechtes Gedicht mit verblüffenden Reimen und Rhythmen, aber Chizzy war unheimlich stolz darauf und hörte es für ihr Leben gern.
Mit Fremden reden tut man nicht,
und lächeln sie dir auch zu,
auf Autofahrten leist Verzicht,
und sei’s nur ne Meile, das ist tabu.
Nicht Geld noch braune Plätzchen nimm,
auch nicht hausgebacken und fein,
an Geld kleben Bazillen schlimm,
und in den Plätzchen können Rasierklingen sein.
{17}Lauf haste was kannste davon,
sonst ist vielleicht der heut’ge Tag dein letzter schon.
Annamay sagte das Gedicht auf und machte nur zwei Fehler dabei. Chizzy tupfte sich die vor Stolz feuchten Augen mit ihrem Schürzenzipfel.
»Als Gedicht ist’s ja nicht berühmt«, sagte sie abschätzig, »aber es hat so was Gewisses. Wer’s einmal gehört hat, der vergißt es nie.« Dann deklamierte sie mit tiefer Weltuntergangsstimme die letzten Zeilen:
Lauf haste was kannste davon,
sonst ist vielleicht der heut’ge Tag dein letzter schon.
»Und wenn ich mir das Bein gebrochen hab und mit dem schweren Gips nicht laufen kann?«
»Du hast dir kein Bein gebrochen.«
»Oder vielleicht einen Knöchel verstaucht.«
Sie hatte kein Bein gebrochen und keinen Knöchel verstaucht, sie lief nicht davon, es war kein Fremder da.
Annamays liebster Besuch war Benjamin York, der – vielleicht weil er das Schloß entworfen hatte – restlos im Königspielen aufging. Er nannte sich Herzog von York und verbeugte sich immer tief, wenn er das Schloß betrat, um der Prinzessin zu zeigen, wie sehr sie von ihren getreuen Untertanen geschätzt wurde. Er blieb oft zum Nachmittagstee oder zu einer spannenden Runde Mensch-ärgere-dich-nicht oder Schiffeversenken. Dabei verlor er so oft, daß Annamay schließlich Verdacht schöpfte.
{18}»Du schummelst, Benjie.«
»Schummeln, Euer Hoheit? Wer würde schummeln, um zu verlieren? Man schummelt, um zu gewinnen.«
»Du nicht.«
»Dieser Vorwurf trifft mich fürwahr tief, und ich meine, eine Entschuldigung wäre hier angebracht.«
»Scheibenhonig.«
»Das sagt man nicht.«
»Meine Cousine Dru sagt es immerfort.«
»Deine Cousine Dru hört es immerfort. Du nicht.«
»Was ist so schlimm daran? Ich könnte gradsogut Tannenhonig oder Blütenhonig sagen.«
»Dann sag Tannenhonig oder Blütenhonig.«
»Für mich hört sich Scheibenhonig richtiger an.«
»Für alle anderen hört es sich entschieden unrichtiger an«, sagte Ben. »Also verkneif’s dir, Kleines, sonst kriegst du von Chizzy was auf den königlichen Po.«
»Sie sagt es auch.«
Schließlich kam es zu einem Kompromiß. Gegen eine Schachtel gebrannte Mandeln versprach Annamay hoch und heilig – »Oder ich will tot umfallen!« –, in Zukunft statt Scheibenhonig Blütenhonig zu sagen.
Sie wollte nie tot umfallen, Benjie war kein Fremder, in den gebrannten Mandeln waren keine Rasierklingen.
Selbstverständlich mußte über die Ereignisse der Woche ihrer Cousine Dru Bericht erstattet werden. Es wurde nicht gern gesehen, daß sie bei Dru übernachtete, weil sich Drus Mutter – laut Chizzy – benahm wie eine Wilde und schon beim dritten Ehemann angelangt war. Aber tagsüber waren Besuche erlaubt.
{19}Die beiden kleinen Mädchen schaukelten in Drus Patio und aßen Schokoladewaffeln. Wohl als Folge des wilden Benehmens ihrer Mutter war Dru sehr weltgewandt. Annamays Begegnung mit Mr. Cunningham im Adamskostüm wurde von ihr als langweilige Allerweltsgeschichte abgetan.
»Was bist du doch noch für ein Kind«, sagte Dru. »Aber das verwächst sich mit der Zeit. Vielleicht.«
Größeren Eindruck machte die Geschichte von dem Mann mit dem Tamburin und seiner Idee, daß die Leute an den verschiedenen Wochentagen jeweils anders heißen sollten. Die beiden machten eine Liste von Namen mit den Anfangsbuchstaben der Wochentage. Misty für Montag, Dolly für Dienstag, Mandy, Daisy, Francesca, Sandra und Sunny.
Auch der Mann mit dem tätowierten Herzen auf dem Arm und die Frau mit dem Baby im Bauch interessierten Dru. Annamays Berichterstattung nahm sie allerdings eher skeptisch auf. »Woher weißt du, daß sie ein Baby im Bauch hatte? Hat sie’s dir erzählt?«
»Nein. Aber sie war dick.«
»Viele Leute sind dick. Nicht alle dicken Leute erwarten ein Baby. Ich wette, du weißt nicht mal, wo die Babys herkommen.«
»Weiß ich wohl. Der Mann pflanzt den Samen in die Frau.«
»Wie denn?«
»Na, vielleicht gibt er ihn ihr wie eine Pille und ein Glas Wasser dazu, damit sie ihn schlucken kann.«
»Gott, was bist du blöd. Eine Frau hat doch noch andere Öffnungen als den Mund.«
»Du meinst, sie kriegt … so eine Art Einlauf?«
{20}»Dumme Trine. Nicht diese Öffnung, die andere. Verstehst du jetzt?«
»Klar«, sagte Annamay, die Drus Geduld nicht weiter strapazieren mochte. Dru zwickte gern, wenn sie böse war, und Annamay hielt es für angezeigt, auf ein ganz anderes Thema überzugehen.
»Chizzy sagt, wir sollen nie mit Fremden reden.«
»Ganz großer Scheibenhonig«, sagte Dru schroff. »Ich bin jetzt zehn. In ein, zwei Jahren brauch ich einen festen Freund, und wie soll ich den finden, wenn ich nicht mit Fremden rede? Du bist in diesem dummen Alter, wo du wahrscheinlich noch gar nicht dran denkst, dir einen festen Freund anzuschaffen.«
»Brauch ich auch nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil ich Benjie heirate, wenn ich groß bin.«
»Herrjemine, glaubst du etwa, der wartet auf dich? Vicki sagt, der hat überall in der Stadt seine Weiber gehortet.«
»Was heißt ›gehortet‹?«
Es sah Dru nicht ähnlich, Unsicherheiten zuzugeben. »Daß sie Schlange stehn, um ihn zu heiraten, das heißt es. Irgendwann wird er schwach und, hast du nicht gesehen, ist er verheiratet wie alle anderen auch, sagt Vicki. Vicki kennt sich aus mit dem Heiraten. Also wenn du keine alte Jungfer werden willst, fängst du besser an, mit Fremden zu reden.«
»Kann ich nicht.«
»Warum nicht?«
Die einzig passende Antwort war Chizzys Gedicht. Annamay deklamierte es mit entsprechenden Gesten.
»Mit Fremden reden tut man nicht.« Annamay wackelte {21}mahnend mit dem Zeigefinger. »Und lächeln sie dir auch zu.« Sie lächelte tückisch.
Dru geriet in Rage. »Hör auf mit dem albernen Getue und sag einfach das Gedicht auf.«
Mit Fremden reden tut man nicht,
und lächeln sie dir auch zu,
auf Autofahrten leist Verzicht,
und sei’s nur ne Meile, das ist tabu.
Nicht Geld noch braune Plätzchen nimm,
auch nicht hausgebacken und fein,
am Geld kleben Bazillen schlimm,
und in den Plätzchen können Rasierklingen sein.
Lauf haste was kannste davon,
sonst ist vielleicht der heut’ge Tag dein letzter schon.
»Von braunen Plätzchen mit Rasierklingen drin hab ich mein Lebtag noch nicht gehört«, sagte Dru so böse, daß Annamay außer Reichweite möglicher Kniffe rückte. »Meine Väter rasieren sich alle elektrisch. Kannst du dir ein braunes Plätzchen vorstellen, in das ein Elektrorasierer paßt? Chizzy redet immer solchen Scheibenhonig.«
»Lauf haste was kannste davon«, wiederholte Annamay in Chizzys Weltuntergangsstimme. »Sonst ist der heut’ge Tag vielleicht dein letzter schon.«
Es gab keine braunen Plätzchen mit Rasierklingen, kein Geld, an dem Bazillen klebten, keinen Fremden mit Auto.
{22}2
Die Polizei kam und ging, kam wieder und ging wieder, den ganzen Sommer lang. Und im Spätherbst war die Beerdigung.
Der kleine Sarg war mit Kamelien und weißer Heide bedeckt, dazwischen lagen Kornblumensträuße, denn kornblumenblau waren die Augen der Prinzessin gewesen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf den vorderen Bänken saßen links Freunde und Anverwandte, rechts die Nachbarn und Howard Hyatts Geschäftsfreunde, dahinter mitfühlende Fremde, Sensationslüsterne, Leute, die die lange Suchaktion in der Presse verfolgt hatten. Ganz hinten saßen außerdem etliche Trauergäste, denen es darum ging, notfalls schnell ins Freie zu kommen: Mrs. Cunningham mit ihrem Sohn Peter zu ihrer Rechten, Ben York zu ihrer Linken. Er hatte nicht nur das Schloß der Prinzessin, sondern auch das Haus der Hyatts entworfen und hätte als Freund der Familie eigentlich vorn sitzen müssen. Aber er hatte Angst davor, in aller Öffentlichkeit die Fassung zu verlieren, wie es ihm oft genug privat passiert war.
Peters Motive waren anderer Art. Er hatte seiner Mutter, ehe sie aus dem Haus gegangen waren, nur zwei doppelte Martinis genehmigt und sich gedacht, daß sie es damit durchstehen würde. Aber immer noch mehr Leute {23}strömten in die Kirche, und die Musik spielte immer weiter, und Mrs. Cunningham wurde zappelig. Die Finger ringelten sich auf ihrem Schoß wie fette rosa Würmer, die versuchten, aus ihren juwelenbesetzten Halsbändern herauszukommen.
»Was meinst du, Peter, mein Lieber, ob ich wohl mal eben ein Minütchen rausgehen könnte und –«
»Nein. Schließlich war es deine Idee, daß wir herkommen.«
»Die Musik deprimiert mich. Ich brauche zwei Valium.«
»Nein.«
»Nicht mal eins?«
»Nein. Und die Musik ist in Ordnung. Ravel. Pavane für eine tote Prinzessin.«
»Was ist eine Pavane?«
»Ein Tanz.«
»Ein Tanz? Wie eigenartig, sich für so was zu entscheiden.«
»Nicht, wenn einem nach Tanzen ist.«
»Das war eine frechdachsige Bemerkung, Peter.«
»Häßlich«, sagte Peter. »Böse. Geschmacklos und ordinär. Aber frechdachsig? Finde ich nicht. Tu mir den Gefallen und versuche, das Wort nicht zu benutzen, wenn du von mir sprichst, Alte, ja? Es klingt irgendwie neckisch, und was ich mache, ist nie neckisch.«
»Manchmal schon.«
»Nie. Comprenez?«
»Natürlich comprenez ich.« Sie warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder der Musik zu.
»Man erwartet Bach oder Mozart. Pavane für eine tote {24}Prinzessin? Lachhaft. Sie war eine kleine Schnüfflerin. Weißt du noch, wie –«
»Ja.«
»Und du glaubst nicht, daß so was vielleicht mehrmals vorgekommen ist? Daß sie irgendwann tatsächlich was gesehen hat?«
»Nein.«
»Ich brauch wirklich ein Valium, Peter, mein Lieber. Bitte.«
»Nein.«
»Eines Tages wirst du das bereuen, Peter. Eines Tages sitzt du bei meiner Beerdigung, und dann wirst du es bereuen.«
»Vielleicht auch nicht.«
»Ich habe großen Kummer. Und Schmerzen«, sagte Mrs. Cunningham. »Und ich fange an zu hyperventilieren.«
Benjamin, der auf der anderen Seite von ihr saß, sah ihren Busen unter Schichten kastanienbrauner Seide wogen. Die goldenen Löckchen, die um ihren Hut aus kastanienfarbenem Satin herum baumelten wie Christbaumschmuck, fingen an zu zittern, und die Silberreifen an ihren Armen klirrten wie Gefangene in ihren Ketten.
Gefangene, dachte Benjamin.
Es gab keinen Gefangenen. Niemand war verhaftet oder auch nur längere Zeit festgehalten worden, wenngleich man Hunderte verhört hatte, alle, die in der Gegend wohnten, dort arbeiteten oder regelmäßig hinkamen, um Post oder Zeitungen zu bringen, Zähler abzulesen, Wasserenthärtungsanlagen zu warten, Kosmetika oder religiöse Erbauung an den Mann oder die Frau zu bringen, Wanderarbeiter, aktenkundige Sittenstrolche, die in der {25}Stadt wohnten oder gelegentlich dort Station machten, sogar einen selbsternannten Heiligen, der behauptete, nur in der Vergangenheit und in der Zukunft zu leben. Nach einer Kostprobe von Verpflegung und Unterkunft im Bezirksgefängnis räumte er ein, daß er nichts von der Zukunft wußte, sich an die Vergangenheit nur bruchstückhaft erinnerte und die Gegenwart lieber draußen als drinnen verbrachte. Er verlegte sich wieder aufs Tamburinschlagen und Schnorren am Strand, und der Tod der kleinen Prinzessin blieb ein Rätsel.
Ihre Eltern, Kay und Howard Hyatt, saßen mit Howards Vater auf der ersten Bank. Es war der alte Herr, der auf einer offiziellen Beerdigung bestanden hatte. So hatte denn Kay, die die Tiefe seiner Trauer nachvollziehen konnte, zugelassen, daß man die Knöchlein in die blaue Daunendecke vom Bett des Kindes einwickelte und in den Sarg legte.
Die Knochen wogen sieben Pfund. Benjamin war bei Kay gewesen, als man es ihr mitteilte, und da hatte er sie zum letzten Mal weinen sehen.
Sie schluchzte an seiner Schulter. »Lieber Gott, so viel hat sie gewogen, als sie zur Welt kam.«
Auch Ben hatte geweint. Sieben Pfund bei der Geburt, sieben Pfund bei der Beerdigung. Es war ein blödsinniger Zufall, aber irgendwie hatte es auch seine Richtigkeit, als schlösse sich damit ein Kreis.
Die gefesselten Würmer auf Mrs. Cunninghams Schoß versuchten noch immer, sich freizukämpfen.
»Ich fang an zu flimmern, Peter«, sagte sie. »Fühl meinen Puls, wenn du mir nicht glaubst. Kammerflimmern kann sehr gefährlich sein.«
{26}»Dann hör auf damit.«
»Ich mache das doch nicht absichtlich. Ich kann nicht dagegen an. Ich hatte schon immer diese Tendenz …«
»Verschon mich mit deinen Tendenzen«, sagte Peter.
»Warum bist du so grausam zu mir, Peter? Ich hyperventiliere, und ich habe Herzkammerflimmern, und du gönnst mir nicht mal ein Valium. Ich könnte auch grausam sein, wenn ich wollte.«
»Versuch’s doch.«
»Du denkst, daß ich von gewissen Dingen keine Ahnung habe. Aber da irrst du dich. Wenn ich wollte, könnte ich davon erzählen. Ich hätte eine Menge zu erzählen.«
»Nur zu.«
»Ich tu’s natürlich nicht. Ich bin keiner Grausamkeit fähig. Das steckt einfach nicht in mir drin.«
»Was in dir drin steckt«, sagte Peter, »ist ein Schnapsquantum, mit dem man einen Tanker flottmachen könnte, und ein Pillenarsenal, an dem eine ganze Walschule ersticken würde.«
»So darfst du nicht mit deiner Mutter sprechen. Kein Sohn sollte so mit seiner Mutter sprechen.«
»Ich könnte ja mal eine neue Mode einführen.«
»Du hast mir vor dem Weggehen nur einen klitzekleinen Drink bewilligt.«
»Zwei.«
»Die waren aber ziemlich dünn.«
»Es waren Doppelte.«
»Mußt du ständig widersprechen?«
»Nein«, sagte Peter. »Nur wenn du lügst.«
Benjamin wandte den Kopf in ihre Richtung und machte »Pst«. Nicht laut, aber direkt in Mrs. Cunninghams linkes Ohr.
{27}Sie zuckte zurück, als habe er sie mit Giftgas angeblasen, und packte ihren Sohn am Arm. »Peter, der Mann hat ›Pst‹ zu mir gesagt.«
»Warum hältst du dich dann nicht daran?«
»Ich finde es sehr ungehörig von einem Fremden, so etwas zu mir zu sagen, besonders wenn ich Kammerflimmern habe.«
»Vielleicht weiß er nicht, daß du Kammerflimmern hast. Laß ihn deinen Puls fühlen. Übrigens ist es kein Fremder.«
»Ich hab ihn noch nie zu Gesicht bekommen. Es muß einer von deinen Freunden sein.«
Peter hob eine sorgsam gezupfte Braue. »Nein. Nein, das glaube ich nicht.«
Benjamin war durch einige gesellschaftliche Anlässe flüchtig mit den Cunninghams bekannt. Mutter und Sohn traten stets zusammen auf, beide elegant und ziemlich förmlich gekleidet, Peter in dunklem Anzug mit Weste oder im Smoking, Mrs. Cunningham in Samt, Seide und Brokat, juwelenbehängt, parfümduftend und kunstvoll frisiert. Ihre Ankunft erregte gewöhnlich Aufsehen. Peter war mit seinen fünfzig Jahren, tief gebräunt und mit silbergrauer Perücke, ein gutaussehender Mann, und Mrs. Cunningham zeigte noch Spuren früherer Schönheit. Peter blieb bei solchen Gelegenheiten stets unverändert, während Mrs. Cunningham offenbar von einer Welle innerlicher Erdstöße und Nachbeben heimgesucht wurde, die ihre Frisur auflösten, Haarnadeln zum Rutschen brachten und goldene Löckchen hilflos an grauen Haarwurzeln baumeln ließen. Sie schwankte und klammerte sich haltsuchend an andere Gäste (»Entschuldigen Sie vielmals, wenn ich diese schreckliche Migräne habe, wird mir {28}immer ganz schwindlig.«), sie stieß gegen Möbel, ließ ihr Glas fallen und kleckerte sich Essen aufs Kleid. (»Wie ungeschickt von mir, ich habe nämlich meine Kontaktlinsen verloren.«), und sie ging früh, schwer auf den Arm ihres Sohnes gestützt. Peter wirkte nie verlegen oder ärgerlich, nur leicht belustigt, als habe er eine Statistenrolle in einem besonders laienhaft dargebotenen Theaterstück gespielt.
»Wenn es nicht einer deiner Freunde ist«, sagte Mrs. Cunningham, »und auch kein Bekannter von mir, wer ist es dann?«
»Er ist Architekt.«
»Brauchen wir denn einen Architekten?«
»Nein.«
»Dann brauch ich doch auch nicht auf ihn zu hören, wenn er ›Pst‹ zu mir sagt, oder?«
»Nein. Aber auf mich solltest du hören. Halt den Mund.«
Die Musik verstummte, und Pfarrer Michael Dunlop hob an zu sprechen. Ausbildung und jahrelange Erfahrung schienen vergessen. Dies war nicht die Stimme, mit der er bei den Sonntagspredigten lehrte, mahnte, den Geist erhob oder die Seele in Angst und Schrecken versetzte. Diese Stimme war unsicher und so leise, daß sie auf den hinteren Bänken kaum zu verstehen war. Er hatte Hunderte von Trauergottesdiensten gehalten, aber da waren die Hingeschiedenen alt oder krank gewesen, hatten bei einem Unfall oder durch eigene Hand das Leben verloren. Annamay Rebecca Hyatt war acht Jahre alt gewesen und hatte nach dem Urteilsspruch der Jury durch fremde Hand den Tod gefunden.
Er war zornig und ratlos. Er zweifelte an seinem {29}Glauben und der Weisheit Gottes, der Kompetenz der Polizei, an den Motiven und der Wahrhaftigkeit seiner Zuhörer. Er legte Pausen zwischen den Sätzen ein, fast als erwarte er, jemand stehe dann auf und bekenne, er habe das Verbrechen begangen oder zumindest Beweismaterial zurückgehalten.
»Und so geben wir denn in Deine gütige Hand die Seele dieses lieben Kindes, Annamay Rebecca Hyatt, das vor acht Jahren an eben diesem Altar getauft wurde.«
Wieder unterbrach er sich. Husten, Schluchzen, Schniefen – aber kein Geständnis. Er hätte gern angeklagt, hätte mit dem Zorn Gottes, mit Höllenfeuer und ewiger Verdammnis gedroht. Aber er glaubte nicht an die Hölle, und er hatte weder die Macht noch das Recht zu drohen, hatte keinen Grund zu der Annahme, es sei ein Mörder oder der Freund eines Mörders unter seinen Zuhörern. Dennoch hatte er das fast unabweisbare Gefühl, daß es so war: Einer unter euch hat etwas getan, weiß etwas, und bei Gott, ich möchte euch entreißen, was es ist …
Seine Frau Lorna, die an ihrem Stammplatz am Gang in der mittleren Reihe saß, übermittelte ihm ihren Spezialblick, der signalisierte, daß er Fehler machte, daß er Dinge sagte, die er hätte weglassen müssen, und andere wegließ, die man von ihm erwartete. Lorna war eine gute Christin und eine noch bessere Kritikerin. Sie hörte aufmerksam zu, um ihm hinterher sagen zu können, welche Fehler er in Ausdruck, Inhalt und Auftreten machte. Lorna war immer gern bereit, anderen – ganz besonders ihm – dabei zu helfen, ein besserer Mensch zu werden.
Das würde sie ihm später alles vorsetzen, wahrscheinlich kurz vor dem Abendessen, wenn er seinen Tiefpunkt hatte und Lorna – vielleicht nicht zufällig – am {30}lebendigsten war. »Was nützt die ganze Predigt, Michael, wenn dich nicht jeder versteht?«… »Du, das klang aber mächtig emotional. Gefühle kannst du dir nicht leisten, du bist schließlich Pfarrer.«… »Und diese langen Pausen, als ob du auf einen Augenkontakt aus wärst. So Was darf man nicht, das ist gegen die Regel. Warum machst du es also?«
Ja, warum, dachte er.
Lorna würde kein Verständnis dafür haben, daß er nach einem Mörder oder dem Freund eines Mörders gesucht hatte. Sie würde ihre Regel befragen und feststellen, daß dieser Fall nicht vorgesehen war.
Lorna besaß eine wertvolle Regelsammlung, die anderen Menschen unbekannt und unzugänglich war. Sie zog diese Sammlung häufig zu Rate, wie einen guten Freund, und fand darin Perlen der Weisheit, die genau ihren eigenen Ansichten entsprachen. Viele Leute wunderten sich, wenn sie von der Regel sprach, und glaubten, sie meine irgendeine religiöse Regel. In gewissem Sinne stimmte das sogar. Die Regelsammlung war Lornas Bibel.
Bestimmt standen in Lornas Regelsammlung unter »Mörder« zahlreiche Querverweise im Stichwortverzeichnis.
Mörder: Kontakt vermeiden mit; Bezugnahme auf; Suche nach …
Inzwischen hatte er wohl so ziemlich gegen alle Regeln in Lornas Sammlung verstoßen, aber es kümmerte ihn nicht mehr. Er machte Pausen zwischen den Sätzen, seine Stimme schwankte vor Bewegung, und er stellte Augenkontakt mit Annamays Vater, Howard Hyatt, her. Sie waren der gleiche Jahrgang, siebenunddreißig Jahre alt, {31}und waren auf dasselbe College gegangen. Schon damals bewegten sie sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen. Howard war Präsident des Studentenrates und studierte Wirtschaftskunde, und nach dem Abschluß war er in die Investmentfirma seines Vaters eingetreten, die er übernahm, als dieser in den Ruhestand trat. Kurzum, Howard war ein Erfolg.
Das Stichwort »Erfolg« nahm in Lornas Regelsammlung breiten Raum ein.
Erfolg: Zeugt Verbrechen; Chancen eines Erfolgreichen, ins Himmelreich zu kommen, gleich Null; Erfolgsstreben ist die Wurzel allen Übels; Erfolg und Geld sind die Götzen dieser Welt … etceterapepe.
Grenzen waren dieser Flut lediglich durch Lornas Gedächtnis und Phantasie gesetzt. Indessen waren er und Howard ungeachtet des Erfolgs Freunde geblieben. Howard kam zehn-, zwölfmal im Jahr zur Kirche, schickte seine Tochter Annamay zum Kindergottesdienst und spendete großzügig für den Bauverein. Und zu Michael kam Howard nach Annamays Verschwinden, nicht um sich trösten zu lassen – das war unmöglich –, sondern weil er nach einer Erklärung dafür suchte, warum Gott so etwas hatte geschehen lassen. Michael wußte es nicht. Er gab ein paar abgedroschene Phrasen von sich, erklärte, Gott schreibe gerade auch auf krummen Linien, aber er war nicht überzeugt und vermochte nicht zu überzeugen. Es gab keine Erklärung.