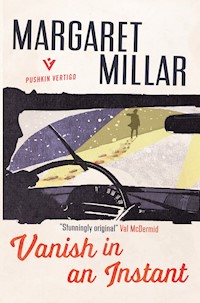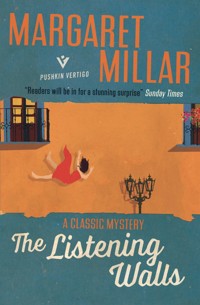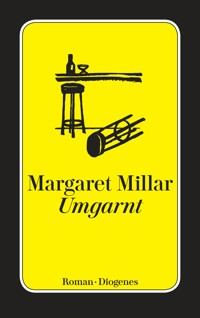7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rose French – ein Stummfilmstar, dessen Stern mit rasender Geschwindigkeit sank, als der Tonfilm aufkam. Sie selbst schwelgt in alten Erinnerungen und wartet seit Jahren tagtäglich auf ›den‹ erlösenden Anruf, der ihr ›die‹ große Filmrolle verschaffen wird, die man ihr versprochen hat. Natürlich glaubt ihr niemand – bis sie eines Tages verkündet, sie sei engagiert. Am nächsten Tag findet man ihre Leiche …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Letzter Auftritt von Rose
Roman
Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl
Diogenes
{5}1
Rose hatte mal wieder eine Krise. Jeder in der Pension wußte es. Dazu gehörte kein großes Wahrnehmungsvermögen, denn Rose durchlebte ihre Krisen, so wie sie alles andere tat: lautstark, voller Hingabe und mit feinem Gespür für Knalleffekte und stilistische Feinheiten. Samstag abend beim Essen erzählte sie mehrere lustige Anekdoten, und als keiner so laut lachte, wie sie das erwartete, wurde sie ausfallend und zog sich auf ihr Zimmer zurück.
Mitten in der Nacht beschloß sie, ein paar alte Folksongs zu singen, und als Mrs. Henderson, die Bewohnerin des Nachbarzimmers, durch heftiges An-die-Wand-Hämmern Einspruch dagegen erhob, hämmerte sie so kräftig zurück, daß ein Stück Putz aus der Wand fiel. Rose war wütend auf Mrs. Henderson, der sie die Schuld für das Loch in der Wand gab, und meldete den Vorfall unverzüglich Mrs. Cushman, der Wirtin.
Aus dem Schlaf gerissen, bedachte Mrs. Cushman zunächst die Uhr und dann Rose mit einem bekümmerten Blick. »Herrgott noch mal, Rose, es ist zu früh zum Aufstehen. Es ist erst drei.«
»Ich war noch nicht im Bett.«
»Dann sollten Sie lieber …«
»Ich kann nicht schlafen. Wie denn auch, wenn diese Verrückte die ganze Nacht an die Wand hämmert? Ein Loch {6}hat sie geschlagen, so groß wir Ihr Kopf. Ich habe große Lust auszuziehen.«
»Warum tun Sie’s dann nicht?«
»Bei Gott, ich tu’s.«
Sie verbrachte die nächsten Stunden damit, ihre Siebensachen zusammenzupacken; dabei nahm sie dann und wann ein Schlückchen Wein, um bei Kräften zu bleiben. Zur Frühstückszeit war sie bester Laune. Sie packte alle ihre Kleider wieder aus und räumte sie in den Schrank, sie kaschierte das Loch in der Wand mit einem Kalender, und sie verzieh Mrs. Henderson vor aller Ohren ihre unmöglichen Manieren, ihre miese Art und ihr mangelndes Musikverständnis. Aus irgendeinem Grund sprach Mrs. Henderson nicht auf diesen Akt der Nächstenliebe an; zur Mittagszeit war sie mit Sack und Pack ausgezogen, so daß das Zimmer neben Rose nun schon zum dritten Mal in ebenso vielen Monaten frei wurde.
Rose begriff nicht, wie man so zickig sein konnte, und das sagte sie Mrs. Cushman auch.
»Seien Sie froh, daß Sie die los sind. Wir können alle froh sein.«
»Wenigstens hat sie ihre Miete bezahlt.«
»Geld. Was ist schon Geld?«
Mrs. Cushmans pausbackiges Gesicht bekam etwas Scharfkantiges. »Geld ist zufälligerweise das, wovon ich lebe.«
»Früher hab ich das Zeug nur so rausgeschmissen. Gott, das waren Zeiten!«
»Zu dumm, daß Sie nicht ein bißchen was in meine Richtung geschmissen haben. Oder besser gesagt, zu dumm, daß Sie heute –«
Aber Rose war der trüben Gegenwart enthoben. Sie legte {7}sich auf dem Bett zurück, wobei sie darauf achtete, sich an der Flasche unter dem Kissen nicht den Kopf zu stoßen, und starrte verträumt an die Decke und in die Vergangenheit. »Hab ich Ihnen eigentlich schon mal von der Party erzählt, die ich gegeben habe, kurz nachdem Anguish in die Kinos kam? Da waren bestimmt vierhundert Leute da, und wissen Sie was? Ich habe kein Aas gekannt.«
»Letztes Mal waren’s noch dreihundert.«
»Zahlen waren noch nie meine starke Seite.«
»Rose!«
»Wenn’s anders wäre, wär ich heute Millionärin.« Ihr Tonfall verriet Stolz und nur eine Spur von Bedauern. »Gott, was hab ich das Zeug rausgeschmissen. Ein echtes Naturtalent.«
»Rose«, sagte Mrs. Cushman, »Sie süffeln wieder.«
Rose erhob sich. Sie wirkte trotz ihrer geringen Größe sehr würde- und eindrucksvoll. »Was für eine gemeine, niederträchtige Unterstellung.«
»Und wenn schon. Es stimmt jedenfalls.«
»Ich schwöre, ich schwöre bei –«
»Ich würd’s Ihnen nicht glauben, und wenn Sie bis zum Hals in Bibeln vergraben wären. Sie süffeln wieder, und ich rufe jetzt Frank an.«
Rose war verunsichert, obwohl sie versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. »Na und? Rufen Sie ihn ruhig an.«
»Vielleicht kriegt der Sie wieder hingebogen, so wie beim letzten Mal.«
»Hingebogen, hingebogen«, schnaubte Rose. »Man könnte meinen, ich wär ein verbeultes Stück Blech, und dieser grobe, herzlose junge Schnösel kann …«
»Nun kommen Sie schon von Ihrem hohen Roß runter, das zieht bei mir nicht.«
{8}Rose sah sich, Unterstützung suchend, im Zimmer um. Die Wände waren vom Boden bis zur Decke mit Fotos von ihr tapeziert – lächelnd, schmollend, kokett, ausgelassen; in historischen Kostümen und Badeanzügen; Standfotos und Szenenfotos; Rose, wie sie geküßt, gewürgt, gerettet und den Löwen vorgeworfen wurde; wie sie sich eine Zigarette anzündete, einem Kavalier zuprostete, eine Polka tanzte. Eine Vielfalt von Roses, allesamt umwerfend und nicht im geringsten wie ein verbeultes Stück Blech.
»Sie können Frank gar nicht anrufen«, sagte sie schließlich. »Heute ist Sonntag, da hat er frei.«
»Zu Hause erreiche ich ihn schon.«
»Das Ganze ist entwürdigend, demütigend. Ich weigere mich, mit ihm zu reden. Ich schließe mich ein. Ich werfe Sachen nach ihm!«
»Nur zu, aber dann wird er das Schmetterlingsnetz kommen lassen.«
Der Ausdruck erschreckte Rose. Sie kam sich dabei wie ein gefangener Schmetterling vor, der in sinnlosem Kampf mit den zarten Flügeln schlägt.
»Das traut er sich nicht«, sagte sie kalt.
»Und ob er sich traut, wenn es sein muß. Also seien Sie hübsch brav zu ihm, ja?«
»Ich finde die ganze Geschichte absolut widerwärtig.«
»Aber Sie mögen Frank doch.«
»Er ist ein Stinker«, sagte Rose. »Lassen Sie mich in Frieden.«
In Frieden gelassen, schloß sie die Tür ab, holte die Weinflasche unter dem Kopfkissen hervor, goß sich ein Glas voll und sog genießerisch das Bukett ein. Der Wein roch ein wenig nach Ketchup, aber das machte Rose nichts aus, und als er ausgetrunken war, ging es ihr besser. Sie zog {9}ihr bestes Seidenkleid an, kämmte sorgfältig ihr kurzes Haar und legte etwas Make-up auf. Als sie im Spiegel die Ergebnisse ihrer Bemühungen begutachtete, kam sie zu dem Schluß, daß sie noch recht gut aussah, wenn man bedachte, daß sie zweiundfünfzig Jahre eines wechselvollen Lebens hinter sich hatte. Sie hatte ein ziemliches Allerweltsgesicht, was – wie sie selbst ohne weiteres einräumte – zu ihrem früheren Erfolg beigetragen hatte: Den Frauen war es leichtgefallen, sich mit ihr zu identifizieren, und den Männern, sich vorzustellen, sie wäre für sie zu haben.
Mit Männern war sie stets besser ausgekommen als mit Frauen, und ihre Eitelkeit war immer noch so ausgeprägt, daß sie für jeden Mann möglichst gut aussehen wollte. Ehe Frank kam, versprühte sie ein wenig Eau de Cologne im Zimmer, versteckte die leere Weinflasche in ihrem Sekretär und faßte, das Bild des Schmetterlingsnetzes im Hinterkopf, den feierlichen Entschluß, sich von ihrer besten Seite zu zeigen.
»Sie lieber Junge«, gurrte Rose. »Wie reizend von Ihnen, daß Sie an Ihrem freien Tag eine alte Frau besuchen.«
Frank war keineswegs überrascht von dieser Herzlichkeit. Er kannte Rose seit über einem Jahr, seit dem Tag, an dem Mrs. Cushman sie in leicht betrunkenem und überaus streitsüchtigem Zustand in die psychosoziale Beratungsstelle gebracht hatte, wo Frank als Therapeut arbeitete. Seither hatte er oft mit Rose geredet und jedesmal den beunruhigenden Eindruck zurückbehalten, daß nicht Rose schlecht an die Realität, sondern die Realität schlecht an Rose angepaßt war.
Frank war siebenundzwanzig. Er hatte eine Frau, zwei {10}Söhne, eine Schwiegermutter, einen Cockerspaniel, eine rotgetigerte Katze und sehr wenig Geld. Sein Beruf fraß nicht nur ihn, sondern auch seine Frau Miriam auf. Abgesehen vom Geld bestand sein Hauptproblem darin, daß er nachts nie rechtzeitig ins Bett kam, denn er besprach seine Fälle gern mit Miriam, und so wurde es normalerweise ein Uhr, bis sie sich zurückzogen. Infolgedessen sah Frank immer ein wenig verschlafen aus. Das hatte seine Vorteile: Die meisten Menschen fühlten sich in seiner Gegenwart entspannt und erzählten ihm mehr, als sie eigentlich wollten, denn er wirkte so unaufmerksam, daß sie gar nicht auf den Gedanken kamen, er stecke seine Nase in ihre Geheimnisse. Rose war eine Ausnahme. Sie ließ sich nicht so leicht hinters Licht führen, und Frank war – aufgrund von Versuch und Irrtum – dahintergekommen, daß man mit Rose am besten fertig wurde, wenn man ihr gegenüber vollkommen aufrichtig war. Er hatte großen Respekt vor ihr und war der festen Überzeugung, daß sie weder ein »Fall« noch eine echte Alkoholikerin war, sondern eine Frau, die in die Jahre kam und einen Job und neue Interessen brauchte.
»Es ist ganz reizend von Ihnen«, wiederholte Rose, »daß Sie an Ihrem freien Tag so lieb an mich denken.«
»Mrs. Cushman hat mich angerufen.«
»Diese alte Schlampe, wenn Sie den Ausdruck verzeihen. Was hat sie über mich gesagt?«
»Bloß, daß Sie ein bißchen Stunk machen.« Frank setzte sich in den gepolsterten Schaukelstuhl am Fenster. »Stimmt das?«
Über diese absurde Frage mußte Rose herzlich lachen. »Mein lieber Junge, es ist mir noch nie im Leben besser gegangen. Es ist bloß so, daß die alte Schlampe es nicht ertragen kann, wenn sich jemand amüsiert – so ist das.«
{11}Wie so viele von Roses Bemerkungen enthielt auch diese so viel Wahres, daß Frank versucht war, ihr laut recht zu geben.
»Sie hat mir gesagt, Sie hätten die Hausgemeinschaft gestört«, sagte Frank. »Stimmt das?«
»Ich habe überhaupt niemanden gestört. Ich habe bloß gesungen. Darf man jetzt nicht mal mehr singen? Mein Gott, man könnte meinen, wir wären hier in Rußland und nicht in Kalifornien.« Seit sechs Monaten machte Rose für alle Übel dieser Welt zu gleichen Teilen die Russen, Mrs. Cushman und die psychosoziale Beratungsstelle verantwortlich. »Schreiben Sie sich auf, was ich heute sage?«
»Nein.«
»Auch nicht hinterher, wenn Sie wieder zu Hause sind?«
»Nein. Wir unterhalten uns bloß in aller Freundschaft. Sagen Sie, wann haben Sie denn den Rappel gekriegt?«
Rose schwieg einen Moment. »Das ist kein Rappel. Jedenfalls noch nicht.«
»Meinen Sie, es wird noch einer?«
»Vielleicht. Ich weiß nicht.«
»Versuchen wir’s zu verhindern, so wie beim letzten Mal.«
»Wir?« Rose hob die Augenbrauen. »Ich war noch nie auf jemanden angewiesen. Ich bin immer allein zurechtgekommen. Ich habe in meinem Leben drei Ehemänner versorgt und nie auch nur einen Cent von ihnen genommen. Ich bin jemand, der gibt, nicht jemand, der nimmt.«
»Was bedrückt Sie, Rose?«
»Nichts.«
»Was ist passiert? Was war diesmal der Auslöser?«
»Das geht Sie nichts an. Vergessen Sie nicht, ich bin auf niemanden angewiesen. Ich brauche keine Hilfe oder milde {12}Gaben. Ich erwarte jetzt jeden Tag einen Anruf vom Besetzungsbüro.«
»Und bis dahin wollen Sie herumsitzen und trinken?«
»Das ist meine Sache.«
»Sie sind ganz schön stur heute, Rose.«
»Dabei wollte ich eigentlich charmant sein«, sagte Rose, »aber Sie bringen mich jedesmal auf die Palme. Würden Sie wirklich das Schmetterlingsnetz kommen lassen?«
Frank mußte unwillkürlich lächeln. »Sie brauchen keins.«
»Die alte Schlampe hat gesagt, Sie würden das Schmetterlingsnetz kommen lassen, wenn ich nicht charmant bin. Ich könnte so charmant sein wie der Teufel, wenn ich wollte.«
»Das glaube ich Ihnen aufs Wort.«
»Es ist nur so – was soll ich mich abstrampeln? Sie wissen zuviel über mich.«
»Wenn’s bloß so wäre«, sagte Frank. Seine Akte über Rose umfaßte mehr als hundert Seiten, aber es war unmöglich, Dichtung und Wahrheit auseinanderzuhalten. Über manches, wie etwa ihre drei Ehemänner, äußerte sie sich mit vernichtendem Freimut; über anderes, wie etwa ihre Angehörigen, weigerte sie sich zu reden – ja, sie schien sie vergessen zu haben.
»Wissen Sie, Rose, ich habe alle Ihre Filme gesehen. Ich finde, Sie sind eine großartige Schauspielerin.«
»Sie machen wohl Witze. Ich war eine Schmierenkomödiantin.«
»Sie waren großartig.«
»Bleiben Sie mir bloß mit Ihrer fiesen Therapie vom Leibe. Sie wollen mir bloß Honig ums Maul schmieren mit Ihrem Geschwafel.«
Teils stimmte es, teils war es Geschwafel; manchmal {13}verschlang sie es und manchmal spuckte sie es aus wie ein schmollendes Kind.
»Haben Sie irgendwas im Zimmer versteckt?« fragte Frank.
»Jetzt nicht mehr. Ich hab’s getrunken.«
»Haben Sie Geld?«
»Ein bißchen. Wenn ich wollte, könnte ich eine richtig schöne Sause machen, wenn es das ist, was Sie wissen wollten.«
»Ich hoffe, Sie tun es nicht.«
Rose lachte. »Das hoffe ich auch.«
»Halten Sie noch ein Weilchen durch, ja? Ich versuche immer noch, Ihnen einen Job zu verschaffen. Ich habe ein paar neue Möglichkeiten aufgetan.«
»In so einer Kleinstadt habe ich doch keine Chance. Hier kennt mich jeder. Wenn ich bloß wieder in den Süden gehen und dort meine Runde machen könnte.«
»Süden« bedeutete für Rose nur eins, nämlich Hollywood. Die Stadt lag nur 160 Kilometer entfernt, aber Rose kamen sie häufig wie Lichtjahre vor. Wenn sie Samstag abends die stille Hauptstraße von La Mesa entlangging, bekam sie heftiges Heimweh nach den Lichtern auf dem Strip, den großen Geschäften und dem Wilshire Boulevard und dem Menschengewimmel von Hollywood and Vine. In La Mesa konnte sie überall das Meer sehen, ganz gleich, wohin sie ging. Mit dem Meer konnte Rose nichts anfangen; es war kalt und gefährlich, und es roch nach Fisch.
»Was macht das Canastaspiel?« fragte Frank.
»Versuchen Sie nicht, das Thema zu wechseln. Sie glauben also, ich käme auf keinen grünen Zweig, wenn ich nach Hollywood ginge, das glauben Sie doch.«
{14}»Hier geht’s Ihnen wahrscheinlich besser.«
»Quatsch. Quatsch.«
»Hören Sie auf, das böse Mädchen zu spielen, Rose. Das paßt nicht zu Ihnen.«
»Quatsch.« Sie stolzierte zum Fenster und sah durch die rosa Gardine hinaus. Da war schon wieder dieses blöde Meer und grinste sie an. »Warum sind Sie überhaupt gekommen?«
»Um Sie aufzuheitern.«
»Sie heitern mich aber nicht auf«, sagte Rose kalt. »Sie deprimieren mich total. Total.«
»Dann gehe ich wieder.«
»Nur zu, gehen Sie.«
»Warum kommen Sie nicht mit? Kommen Sie mit zu mir nach Hause und essen Sie mit Miriam und mir.«
»Das geht nicht.«
»Versuchen Sie’s.«
»Es geht nicht. Ich erwarte einen Anruf.«
Er nahm sie beim Wort.
Als er nach unten ging, fand er Mrs. Cushman an der Haustür postiert. Mrs. Cushman besaß eine große Genußfähigkeit für ferne Katastrophen wie Wirbelstürme in Florida oder Zugunglücke in der New York Central Station, aber kleine Ärgernisse zu Hause erhöhten ihren Blutdruck.
»Berappelt sich Rose wieder?«
»Hoffentlich«, sagte Frank. »Ich bin mir nicht sicher.«
»Du meine Güte, das sollten Sie aber sein.«
Mrs. Cushman, die sich nie irgendeiner Sache sicher war, konnte diese Schwäche bei anderen, zumal bei jemandem von der Beratungsstelle, nicht ertragen. Die Lokalzeitung hatte im vergangenen Jahr ausführlich über die {15}Beratungsstelle berichtet, und Mrs. Cushman hatte irgendwie den Eindruck gewonnen, man sei dort allwissend und unfehlbar. Frank mußte sie leider enttäuschen.
»Ich denke schon, daß Rose sich wieder berappelt«, sagte er. »Sie dürfen ihren Zustand nicht überdramatisieren. Im Vergleich zu den meisten Leuten, mit denen ich es zu tun habe, ist Rose geradezu ein leuchtendes Beispiel.«
»Also, ein leuchtendes Beispiel finde ich sie nun nicht gerade. So manches Mal habe ich schon den Tag bedauert, an dem ich die Tür hier aufgemacht habe; und da stand sie, und ich hab sie gleich erkannt. Rose French – ich hab’s laut gesagt, einfach so – Rose French. Damals hätte ich mir nicht träumen lassen …«
»Ich versuche gerade, ihr einen Job zu besorgen.«
»Ha! An dem Tag, wo Sie ihr einen Job besorgen und sie ihn behält, an dem Tag lasse ich mich umtaufen.«
Das lieferte Frank ein gutes Stichwort für den Abgang, und er nutzte es.
Ehe er in seinen alten Chevrolet einstieg, schaute er zu Roses Fenster empor. Hinter der rosa Gardine sah er ihren kleinen, reglosen Schatten. Er hob den Arm und winkte, aber der Schatten rührte sich nicht.
Als er nach Hause kam, hatte er Rose schon fast wieder vergessen. Miriam hatte ein Strandpicknick geplant, und die beiden Jungen standen, wie zwei Marinesoldaten mit der Ausrüstung für den Tag bepackt, zusammen mit dem Cockerspaniel auf den Verandastufen. Die rotgetigerte Katze saß in sich gekehrt auf dem Geländer und bedachte die ganze Hektik mit Verachtung. Die Eigenständigkeit der Katze erinnerte ihn an Rose.
An diesem Abend sprachen er und Miriam eine geschlagene Stunde über Rose, aber sie kamen lediglich zu dem {16}Schluß, daß Rose einen zu sperrigen Charakter hatte, um sich in eine kleine Welt hineinzwängen zu lassen.
Er rechnete damit, eine ganze Weile nichts von Rose zu hören. Wenn sie sich betrank, würde sie ihn nicht um Hilfe bitten, und wenn sie nüchtern blieb, würde sie keine brauchen. Aber am nächsten Tag um drei rief sie ihn in seinem Büro an. Sie war gut aufgelegt.
»Frankie? Ich bin’s, Rose.«
»Hallo, Rose. Wie geht’s Ihnen?«
»Könnte gar nicht besser gehen. Ich gehe weg von hier.«
»Ach!«
»Verschonen Sie mich bloß mit Ihrem Ach!, Sie Sauertopf. Ich habe gute Nachrichten, und alles, was Ihnen dazu einfällt, ist Ach!«
»Was denn für Nachrichten?«
»Ich habe einen Job. Ich hab Ihnen ja gesagt, ich brauche keine Hilfe, stimmt’s?«
»Ja, das stimmt. Was ist das denn für ein Job?«
»Nichts Weltbewegendes, aber es macht bestimmt Spaß. Und ich kriege Geld dafür. Gott, was hat die alte Schlampe gestaunt, als ich ihr die rückständige Miete gegeben habe. Sie hätte fast zu heulen angefangen.«
»Man hat Sie im voraus bezahlt?«
»Vorschuß. Ich werde so eine Art Haushälterin.«
Frank lachte.
»Was ist denn daran so komisch?« fragte Rose argwöhnisch. »Sie glauben wohl, ich kann keinen Haushalt führen. Ich habe das schon ein dutzendmal gemacht. Alles, was man dabei zu tun hat, ist, die Dienstboten herumzukommandieren.«
»Gibt es denn da Dienstboten?«
{17}»Natürlich gibt es da Dienstboten«, sagte Rose, als hätte sie sich niemals dazu herabgelassen, eine Stelle in einem Haus anzunehmen, in dem es keine gab. »Egal, jedenfalls habe ich gedacht, ich rufe Sie an und sage auf Wiedersehn und danke schön. Ich denke, ich habe Ihnen einiges zu verdanken. Behauptet jedenfalls die alte Schlampe, obwohl ich partout nicht weiß, was.«
»Sie verdanken mir gar nichts«, sagte Frank. »Lassen Sie einfach ab und an von sich hören.«
Nach kurzem Schweigen meinte Rose: »Na ja, Briefeschreiben und so was ist nicht gerade meine Stärke.«
»Schreiben Sie einfach Ihren Namen auf eine Postkarte, damit wir wissen, daß es Ihnen gutgeht.«
»Klar. Doch, ich denke, das schaffe ich.«
»Auf Wiedersehen, Rose, und viel Glück.«
»Auf Wiedersehen, Frank.« Erneutes Schweigen. »Wissen Sie, was? Jetzt, wo ich Sie nicht mehr ertragen muß, finde ich, daß Sie eigentlich ein ganz netter Kerl sind.«
Sie legte auf, ehe er antworten konnte.
Die Postkarte kam mit der nächsten Morgenpost. Das Mitteilungsfeld zeigte lediglich eine ungelenk mit dem Bleistift gezeichnete Rose.
Die Postkarte gefiel ihm. Den ganzen Tag über mußte er immer wieder daran denken, und er steckte sie ein, um sie Miriam zu zeigen, wenn er abends zum Essen nach Hause kam.
Miriam empfing ihn an der Tür. Sie hatte die Abendzeitung in der Hand, und ihr Gesicht wirkte blaß und versteinert, wie immer, wenn sie versuchte, ihre Gefühle vor den Kindern nicht zu zeigen.
»Rose ist tot«, sagte sie und drückte die Stirn fest an seine Schulter.
{18}2
Gefunden wurde sie von Ortega, dem jungen Gärtner des Pearceschen Anwesens, das an irgendwelche Sommergäste aus San Francisco vermietet worden war. Ortega ging Dienstag früh in den Garten, um an der kahlen Stelle zwischen dem Patio und der Garage einen Korb Rittersporne auszupflanzen. Rose lag mit dem Gesicht nach unten neben dem Lilienteich. Hinter ihr war ein kleiner weißer Segeltuchstuhl umgestürzt, und knapp außer Reichweite ihrer Hand lag ein ramponierter, über und über mit Etikettenresten beklebter Wildlederkoffer.
Mit weiteren Beobachtungen hielt sich Ortega nicht auf. Er ließ den Korb mit den Ritterspornen fallen und rannte, leise und verstört wimmernd, zum Haus zurück.
Willett Goodfield saß am Tisch in der Eßecke, deren Fenster nach Osten auf die Berge hinausgingen. Die Morgenzeitung lag aufgeschlagen vor ihm, obwohl er sie nicht las. Er hatte die Angewohnheit, die Zeitung vor sich hinzulegen, falls seine Frau Ethel unerwarteterweise zum Frühstück auftauchte; dann konnte er draufstarren und ihr so auf subtile Weise zu verstehen geben, daß er es vorzog, morgens zunächst einmal allein zu sein, bis er sich auf den neuen Tag eingestellt hatte. Dieses Sich-Einstellen wurde auch nicht gerade einfacher. Da waren Geldprobleme, da war die Sorge um seine Mutter, und da waren die chronischen {19}Rückenschmerzen, die Willett als Nierensteine diagnostizierte, wenn er deprimiert war, und als Einbildung, wenn er’s nicht war. Da war die Inflation, seine neue Brücke, die nicht richtig paßte, die exorbitante Miete für dieses Haus, das er gezwungenermaßen für den Sommer gemietet hatte, und die Batterie des Lincoln, die ständig ihren Geist aufgab.
Willett war rosig und korpulent. Er sah aus wie ein Bankier oder ein Anwalt. Tatsächlich aber hatte er – abgesehen von gelegentlichen fruchtlosen Besuchen in der Puppenfabrik, die sein Vater aufgebaut hatte und die seither die ganze Familie ernährte – in seinen fünfunddreißig Jahren noch keinen Handschlag getan. Als sein Vater starb, waren alle Geschäftsanteile an seine Mutter Olive übergegangen. Olive machte einen kurzen, glorreichen Versuch, die Geschäftsfrau zu spielen, verlor dann das Interesse und widmete sich wieder ihrem Hobby, der Begonienzucht. Willett verehrte seine Mutter und begleitete ihre Begonien höchstpersönlich zu sämtlichen Blumenausstellungen, wenn Olive verhindert war. Seit einigen Jahren war Olive schwer krank. Sie sprach häufig von ihrem bevorstehenden Tod, aber nicht etwa um Aufmerksamkeit oder Mitleid zu erregen, sondern um ihre Kinder mit der nüchternen Tatsache vertraut zu machen.
Mutter, dachte Willett und mußte blinzeln, um die Tränen zurückzuhalten.
Ortega kam ins Zimmer gefegt, seine schweren Arbeitsstiefel krachten über den gewachsten Estrich.
»Sir, Sir«, sagte Ortega, »da liegt eine Tote, Sir, o mein Gott.«
»Sie sollten sich angewöhnen zu klopfen, ehe Sie …«
»Eine arme alte Frau – mein Gott, Sir, kommen Sie schnell.«
{20}Vor lauter Aufregung grinste Ortega breit, und sein Gesicht hatte die Farbe reifer Limonen.
Ortega gehörte zum Inventar – seine Dienste waren in der Miete inbegriffen –, und Willett hatte noch nie mit ihm geredet oder ihn sonderlich beachtet.
»Eine Tote, sagen Sie? Tja.« Willett räusperte sich. »Tja, äh, ich werde mich sofort um die Angelegenheit kümmern.«
Er erhob sich und warf einen Blick auf die Tür zur Halle, und zwar in der leisen Hoffnung, daß Ethel auftauchte: Dann könnte sie Ortega begleiten, während er, Willett, die Polizei anrief. Das hätte mehr Autorität.
Ethel tauchte nicht auf. Schwer atmend vor Verärgerung – nicht Anstrengung –, folgte Willett Ortega ums Haus herum zum Lilienteich und zu Rose.
Mit zusammengekniffenen Augen, um kein allzu klares oder lebhaftes Bild von der Sachlage zu gewinnen, warf Willett einen kurzen Blick auf die Frauenleiche und kehrte dann ins Haus zurück, um die Polizei anzurufen. Er zitterte am ganzen Leib, und sein Rücken schmerzte heftig.
Nach einer Weile kam Ethel in einem langen seidenen Morgenrock die Treppe herabgeschwebt.
»Ich habe vom Fenster aus zugesehen«, sagte sie.
»Das war mir eine große Hilfe.«
»Was hätte ich denn tun sollen?«
Sie setzte sich an den Stahlrohrtisch mit der Glasplatte und betrachtete, das Kinn in die Hand gestützt, die blaue Silhouette der Berge. Sie hatte eine breite, milchweiße Stirn und dunkle, tiefliegende Augen, wodurch sie stets so wirkte, als gingen ihr bedeutende Gedanken durch den Kopf. In Wahrheit machte sie sich über kaum etwas {21}Gedanken: Sie hatte Angst davor. Wenn sie sprach, dann sprach sie leise, und wenn sie etwas fragte, senkte sie die Stimme am Ende des Satzes, als erwarte oder verdiene sie keine Antwort. »Sehen die Berge morgens nicht hübsch aus.«
»Berge. Ich habe was anderes im Kopf als Berge.«
»Was regst du dich so auf.« Sie griff langsam nach dem Zigarettenkästchen, das mitten auf dem Tisch stand. Alle ihre Bewegungen waren langsam und anmutig; sie wirkte, als bewege sie sich unter Wasser. Ethel schwebte in und aus Zimmern, Treppen hinauf und Treppen hinunter. Ihre Hand schwebte nach einer Zigarette und schwebte dann wieder an ihre blassen, vollen Lippen. Sie war am ganzen Leibe blaß, als hätte das Wasser ihre Farbe vollständig ausgewaschen. »Was regst du dich so auf. Es wird schon alles in Ordnung kommen, oder.«
»Du hast keine Gefühle.«
»Na, es stimmt doch.«
»Ja, alles wird einfach bestens!« brüllte er.
»Du weckst noch deine Mutter auf«, sagte Ethel ganz sanft.
Willetts Gesicht verfärbte sich purpurn wie eine reife Pflaume, und seine pummeligen kleinen Hände ballten sich zu Fäusten. »Paß auf, was du sagst.«
»Was hab ich denn gesagt.«
Es klingelte an der Haustür, und Ethel machte eine winzige Bewegung, als wollte sie öffnen gehen.
»Ich mache auf«, sagte Willett. »Geh du nach oben und sieh nach, ob ihr nichts fehlt.«
»Sie schläft. Ich habe beim Herunterkommen nachgesehen. Gestern abend hat sie doch soviel Schlafmittel genommen, nicht wahr.«
{22}»Geh nach oben und bleib bei ihr.«
»Ich kann doch nicht einfach herumsitzen und ihr beim Schlafen zusehen.«
»Aber du kannst von der Bildfläche verschwinden, oder?«
Es klingelte erneut. »Vielleicht wollen sie mir ein paar Fragen stellen.«
»Ethel.«
»Na schön, aber großen Spaß macht das nicht, jemandem beim Schlafen zuzusehen. Ich hätte nichts dagegen, Fragen zu beantworten.«
»Es gibt überhaupt keinen Grund, warum sie mit dir sprechen sollten.«
»Wieso nicht. Ich wohne schließlich hier.«
»Herrgott noch mal, Ethel, widersprich mir nicht dauernd!«
»Wer widerspricht denn hier«, sagte Ethel. Aber sie ging nach oben. Wenn Willett fluchte, dann bedeutete das, er war mit seinem Latein am Ende, und man ging ihm besser aus dem Weg. Armer Willett. Wenn sie ihn bloß nicht so hassen würde. Das würde ihnen beiden das Leben leichter machen.
Sie öffnete die Tür zu Olives Zimmer, sah, daß die alte Dame noch schlief, und ging in ihr eigenes Zimmer. Dort machte sie es sich auf dem gepolsterten Fensterplatz gemütlich und betrachtete die Leute, die unten im Patio und auf dem Rasen umherliefen oder sich in kleinen nervösen Gruppen am Lilienteich herumdrückten. Mit der Verbreitung der Neuigkeit nahm die Menge noch zu. Mittlerweile mußten es schon über fünfzig Menschen sein, aber Ethel erkannte nur drei von ihnen: Ortega in angeregtem Gespräch mit einem Polizisten, Willett, der sich mit einem {23}Taschentuch die Stirn wischte, und Ada Murphy, das Mädchen, das gerade mit einer großen Tüte Lebensmittel, die sie mit beiden Armen umklammerte, aus der Stadt zurückgekehrt war.
Sie wirkten alle ziemlich albern, dennoch beneidete Ethel sie. Sie hatte große Lust, sich Willett zu widersetzen, nach unten zu gehen und sich unter die Menge zu mischen, sich ein wenig zu unterhalten, viel zuzuhören und jenes Erregtheits- und Kameradschaftsgefühl mitzuerleben, das ein plötzlicher Tod bei den Lebenden hervorruft. Aber sie brachte nicht die Energie auf, sich zu rühren, bis die alte Dame ihre Namen rief.
»Ethel?«
»Komme schon.« Sie ging durch den Flur und öffnete die Zimmertür.
Die Augen der alten Dame waren offen und funkelten wie zwei Glasmurmeln zwischen den Kissen. Ihre Stimme war vom Schlaf noch belegt. »Haben sie sie schon gefunden?«
»Ja.«
»Haben sie herausgefunden, wer es ist?«
»Ich weiß nicht. Willett erlaubt nicht, daß ich unten bleibe.«
»Ich hoffe, es kommt alles in Ordnung.«
»Willett sagt, ja.«
»Ich habe Hunger.«
»Ich mache dir Frühstück. Murphy hat Eier geholt.«
Die alte Dame drehte sich auf die Seite und hustete in die Kissen. »Ich habe einen bösen Traum gehabt, einen richtig schlimmen Traum, aber jetzt geht es mir wieder ganz gut.«
{24}Für die ganz Jungen bedeutete der Name Rose French nichts. Bei den Älteren – bei Captain Greer, Willett und dem Fotografen der Lokalzeitung – rief er eine gewisse Nostalgie und Trauer hervor. Rose gehörte zur guten alten Zeit, und die gute alte Zeit war dahin.
Unter den Gaffern wurde gemunkelt, daß Rose überfallen, ertränkt, erwürgt, erschossen worden sei; doch als Greer sie umdrehte, fand er außer den Abschürfungen an ihrer Nase und ihrer Stirn, die vom Sturz auf die Steinplatten herrührten, keinerlei Anzeichen von Gewaltanwendung. Die dunklen Verfärbungen an Hals und Kopf waren keine Prellungen, wie er Willett versicherte, sondern bei natürlichen Todesfällen übliche Erscheinungen. Rose freilich sah nicht normal aus. Ihr Mund war geöffnet, der Kiefer schlaff, und ihre Wangen waren eingefallen und grau wie Kitt.
Die Identifizierung erfolgte weder sofort, noch war sie eindeutig. Niemand sagte beim ersten Blick auf sie: »Das ist ja Rose French.« Unter dem Leichnam fand Greer ihre Handtasche, und in der befanden sich ein paar Briefe, ein Scheckheft der Bank of America, ein Führerschein, der vor sieben Jahren abgelaufen war, ein religiöser Traktat und ein halbes Dutzend Postkarten, die sämtlich an Mr. Frank Clyde, 321 Montecito Street, La Mesa, adressiert waren. Auf keiner von ihnen stand ein Text. Aus den Postkarten zog Greer nur einen Schluß: daß Rose nicht mit ihrem Tod gerechnet hatte. Seiner Meinung nach schlossen die Karten plus die Tatsache, daß der Koffer für eine Reise gepackt war – er enthielt mehrere Garnituren Kleidung, Zahnbürste, Aspirintabletten, Kamm und eine sorgfältig in ein Korsett gewickelte Flasche Bourbon –, einen Selbstmord aus. Rose hatte offensichtlich verreisen {25}wollen. Vielleicht hatte sie eine Abkürzung zum Bahnhof genommen, der nur einen halben Kilometer entfernt lag, und eine Pause eingelegt, als sie auf diesen hübschen kleinen Garten gestoßen war.
»Warum ausgerechnet hier?« fragte Willett in einem fort. »Warum in meinem Garten? Da sind überall Schilder: Betreten verboten.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine Frau wie Miss French groß auf Schilder achtet.« Greer hatte Willett auf Anhieb nicht leiden können, und es freute ihn nicht wenig, daß Rose sich von allen zur Verfügung stehenden Gärten ausgerechnet Willetts ausgesucht hatte.
Greer war ein großer, wortkarger Mann, dessen Gesicht kein Mensch im Gedächtnis behielt. Das Auffälligste an ihm war der breitkrempige Stetson, den er Jahr für Jahr, sommers wie winters, trug. Diese Hüte waren in La Mesa nicht unüblich. Ziemlich viele Männer trugen sie – Ärzte, Geschäftsleute, Makler –, um damit zu demonstrieren, daß sie außerhalb der Stadt auf einer Ranch lebten und ein halbes Dutzend Zitronenbäume, ein paar Avocados und ein Pferd besaßen. Greer trug seinen, weil er bequem war, die Augen vor der Sonne schützte und Leute wie Willett dazu brachte, ihn als Provinzler zu unterschätzen.
»Das mindeste, was Sie tun könnten, ist, die ganzen Leute hier wegzuschicken.« Willett hatte blutunterlaufene Augen, und hinter den Ohren tröpfelten ihm kleine Schweißrinnsale hinunter und sickerten in seinen gestärkten weißen Kragen. Er wirkte, als würde ihm, wie einer sonnengereiften Tomate, gleich die Haut aufplatzen. »Meine Mutter ist sehr krank. Sie verträgt keine Aufregungen. Schicken Sie die ganzen Leute hier weg.«
{26}»Würde ich ja gerne, wenn ich ein paar Divisionen Marineinfanteristen hätte«, sagte Greer.
»Eigentlich müßten Sie doch eine gewisse Autorität haben.«
»Die Autorität habe ich schon, aber nicht genug Mitarbeiter. Es ist unmöglich, die Leute fernzuhalten, wenn es um Brände, Unfälle, Morde –«
»Morde! Großer Gott, Sie wollen doch nicht etwa andeuten, daß diese Frau ermordet wurde?«
»Ich weiß es schlicht und einfach nicht. Ich bin kein Arzt.«
»Aber das wäre ja schrecklich, ganz schrecklich. Meine Mutter ist sehr krank. Dergleichen könnte leicht …«
»Mr. Goodfield, warum gehen Sie nicht wieder ins Haus? Wir sprechen später miteinander.«
Es wurde Mittag, bis die Menge sich endgültig zerstreut hatte und nur Ortega übrigblieb, um den Schaden zu begutachten. Der Rasen war mit Zigarettenkippen und Kaugummipapier übersät; im Teich trieben Orangenschalen; das Chrysanthemenbeet war vollkommen zertrampelt, und der Korb mit den Ritterspornen war umgedreht worden und der Länge nach gesplittert, als hätte ihn jemand Schweres als Podest benutzt, um einen besseren Blick auf Rose zu haben.
Ortega quälte sich mit Selbstvorwürfen. Er war unachtsam gewesen – es war die falsche Zeit zum Auspflanzen von Ritterspornen –, er hätte den Abend oder einen Wolkentag abwarten müssen. Aber nein, er hatte nicht gewartet, und nun hatte er seine Unachtsamkeit mit der Auffindung einer Toten, einem Heidenschrecken und dem Ruin der Chrysanthemen büßen müssen.
Sein Bild in der Abendzeitung trug nur wenig dazu bei, {27}ihn zu trösten. Auf dem Foto grinste er (aus schierer Nervosität), und seine Familie und seine Freunde sagten ihm, es sehe abscheulich aus, daß er so grinste, wo doch gerade eine Frau ums Leben gekommen sei.
{28}3
Von Rose erschienen zwei Bilder in der Zeitung. Das eine hatte Frank schon einmal an der Wand ihres Zimmers gesehen: ein glamouröses Standfoto aus der Zeit, als Rose ungefähr vierzig war. Das andere zeigte eine Szene aus einem frühen Film, in der Rose tugendhaft den Avancen eines öligen jungen Mannes widerstand, bei dem es sich laut Bildlegende um Dwight Hamman, den zweiten ihrer fünf Ehemänner, handelte; Frank gegenüber hatte Rose nur drei Ehemänner erwähnt; die anderen beiden waren eine Überraschung.
Eine noch größere Überraschung aber erlebte er, als er den Bericht über ihren Tod las. Nach den Schätzungen der Polizei war Rose am Montag gegen Mittag gestorben.
Er rief sofort Greer an, und nach dem Essen fuhr er zu dem weißen Steingebäude, das die Polizei und das Stadtgefängnis beherbergte. Das zum Gebäude gehörende Grundstück wurde von einer Truppe Freiwilliger in Schuß gehalten, die sich hauptsächlich aus gerade einsitzenden kleinen Dieben, Säufern und Herumtreibern zusammensetzte. Frank kannte sehr viele von ihnen, besonders die Wiederholungstäter. Manche waren an sein Büro verwiesen worden; andere hatte er bei den Treffen der Anonymen Alkoholiker kennengelernt, die einmal die Woche im Gefängnis stattfanden und an denen Frank manchmal zu Informationszwecken teilnahm.
{29}Frank kannte Greer seit zwei Jahren. Zwischen den beiden Männern bestanden erhebliche Meinungsunterschiede in prinzipiellen und technischen Fragen, aber sie gingen einigermaßen freundlich miteinander um. Frank war der Ansicht, daß Greer ein gerechter, wenn auch nicht sehr heller Bursche war, und Greer gab bereitwillig zu, daß die Beratungsstelle ab und zu durchaus Sinnvolles leistete – wie bescheiden und kurzlebig auch immer.
Greers Büro war ein großer quadratischer Raum mit blendend hellen Leuchtstoffröhren, die jedem eine Gefängnisblässe verliehen.
»Nehmen Sie Platz«, sagte Greer.
»Danke.«
Greer setzte sich ebenfalls und rieb sich die Augen. »Ich kriege Kopfweh von den verdammten Lampen. Und erzählen Sie mir bloß nicht, das wäre psychosomatisch.«
»Keine Sorge.«
»Ihr Psychoheinis seid schon ein komischer Verein. Da fällt zum Beispiel einer in einen offenen Kanalschacht. Liegt das etwa daran, daß er eine neue Brille braucht? Nein. Daran, daß er an irgendein Weib denkt und nicht aufpaßt, wo er hintritt? Nein. Er fällt rein, weil ihn seine alte Dame abgelehnt hat oder irgend so was.«
»Wir wollen uns nicht streiten«, sagte Frank. Wie er wußte, war Greer empfindlich, was dieses Thema anging, denn er hatte ein Zwölffingerdarmgeschwür.
»Herrgott, demnächst werdet ihr noch versuchen, den Tod zu kurieren, indem ihr jeden auf die Couch legt.«
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen, Greer.«
»Ich mache mir nie Sorgen«, sagte Greer und strich sich dabei in einem unbewußten Versuch, die Sorgenfalten zu glätten, über die Stirn. »Komische Geschichte, das mit {30}Rose French. Heute morgen habe ich noch gedacht, ich hätte alles geklärt.«
»Und jetzt?«
»Jetzt ergibt’s keinen Sinn.« Greer zog eine Pfeife aus der Tasche und steckte sie sich in den Mundwinkel. Er zündete sie nicht an, denn sie enthielt keinen Tabak. Sie diente ihm als Requisit, auf dem er kauen, mit dem er auf den Schreibtisch klopfen, sich am Hals kratzen oder seinen Äußerungen Nachdruck verleihen konnte. »Haben Sie Miss French gut gekannt?«
»So gut, wie sie es zuließ. Ich weiß von ihr nur das, was sie mir von sich aus erzählt hat.«
»Am Telefon haben Sie erwähnt, Sie hätten sie kürzlich besucht.«
»Ja, Sonntag am späten Vormittag, in ihrer Pension. Die Wirtin, eine Mrs. Cushman, hatte mich angerufen und gesagt, daß Rose ein bißchen verrückt spielt, da bin ich hingefahren, um zu versuchen, sie wieder hinzubiegen.«
»Sie sind ja ein richtiger kleiner Pfadfinder.«
»Anderen zu helfen hilft mir. Es ist das gleiche Prinzip wie bei den Anonymen Alkoholikern. Indem sie anderen helfen, nüchtern zu bleiben, bleiben sie selbst nüchtern.«
»Jedenfalls manche.«
»Ganz recht, manche.«
»Sie haben Rose also wieder hingebogen?«
»Nein, ich bin überhaupt nicht an sie herangekommen. Sie wollte nichts herauslassen.«
»Und dann?«
»Dann bin ich mit Miriam und den Kindern an den Strand gefahren.«
»Und das ist alles, was Sie mir erzählen wollten?«
»Nicht ganz«, sagte Frank. »Montag nachmittag um drei {31}Uhr hat Rose mich angerufen und mir gesagt, sie hätte einen Job und würde von hier weggehen.«
»Das kann nicht sein.«
»Es war aber so.«
»Es kann nicht so gewesen sein«, sagte Greer. »Um diese Zeit war sie schon mindestens drei Stunden tot.«
»Dann hat sich eben jemand geirrt.«
»Ja, Sie vielleicht.«
»Vielleicht, aber das glaube ich nicht. Sehen Sie sich mal das hier an.« Er zog die Karte hervor, die Rose ihm geschickt hatte, und legte sie auf den Schreibtisch. »Sie ist abends um halb sieben abgestempelt worden.«
Greer klopfte mit der Pfeife auf die Karte. »Warum das Bild und nichts Geschriebenes?«
»Einer von Roses kleinen Scherzen. Als sie mir gesagt hat, sie geht weg, um einen Job anzunehmen, habe ich sie gebeten, mit uns in Kontakt zu bleiben, damit wir wissen, daß es ihr gutgeht.«
»Was war das denn für ein Job?«
»Ein Job als Haushälterin. Hat sie jedenfalls erzählt.«
»Haben Sie ihr nicht geglaubt?«
»Gestern schon. Heute weiß ich nicht, was ich glauben soll. Vielleicht war das gestern nachmittag am Telefon gar nicht Rose. Ich bin kein Spezialist für Stimmen, aber es klang jedenfalls wie sie, und manches, was sie gesagt hat, war typisch Rose. Und wenn es nicht Rose war, wer war es dann?«
»Eine gute Freundin, eine Frau, die sie sehr gut kannte und außerdem von der Verbindung mit Ihnen wußte.«
»Aber was für einen Sinn sollte ein solcher Anruf haben?«
»Da kann ich auch nur raten«, meinte Greer. »Rose war {32}schon tot, und die Frau wollte nicht, daß das bekannt wird. Vielleicht wollte sie lediglich die Todeszeit verschleiern, vielleicht sollte Rose aber auch gar nicht gefunden werden, sondern spurlos verschwinden.«
»Warum hat sie mich dann angerufen?«
»Ihr habt die Angewohnheit, eure Patienten im Auge zu behalten. Wenn Rose plötzlich die Stadt verlassen hätte, ohne Sie zu verständigen, hätten Sie sie vielleicht suchen lassen.«
»Aber es wurde gar nicht der Versuch gemacht, die Leiche zu verstecken. Sie wurde bei jemandem im Garten gefunden, wo sie nicht zu übersehen war.«
»Das weiß ich auch«, meinte Greer brummig. »Verdammt komischer Fall, das Ganze. Wenn’s um Geld ginge, ließe sich ja vielleicht ein Grund für den ganzen Mumpitz finden. Aber da ist kein Geld, jedenfalls soviel ich weiß. Rose hatte ein Sparkonto mit einem Dollar drauf, ihr Girokonto war nach dem Stand vom letzten Samstag überzogen, und das einzige Schmuckstück, das sie noch nicht versetzt oder verkauft hatte, war der Ehering, den sie trug, ein schlichter Goldring mit den Initialen RF, HD.«
»Den Ring kenne ich. Er stammt aus ihrer ersten Ehe; da war sie sechzehn.«
Greer schwieg eine Zeitlang und kerbte dabei mit dem Mundstück seiner Pfeife Buchstaben in die vor ihm liegende Löschunterlage. Von Franks Platz aus sahen sie wie die Initialen RF und HD aus.
»Wer hat die Autopsie vorgenommen?« fragte Frank.
»Severn.«
»Der hat Ahnung.«
»Natürlich hat der Ahnung«, blaffte Greer gereizt. »Die Frau ist gestern gegen Mittag an einem Herzanfall {33}gestorben. Das Herz war schwer geschädigt und auf das Anderthalbfache des normalen Volumens vergrößert.«
»Ein Mord ist also ausgeschlossen?«
»Wäre ausgeschlossen, wenn man sie tot im Bett gefunden hätte. Aber so« – er breitete die Hände aus –, »so weiß ich es einfach nicht. Es wäre ein Kinderspiel, jemand mit einem Herzschaden umzubringen – ein Schock, ein weiches Kissen aufs Gesicht –, es gibt da jede Menge Möglichkeiten nachzuhelfen. Die Frage ist nur, hat tatsächlich jemand nachgeholfen?«
»Soweit ich weiß, hatte sie in den letzten Jahren weder richtige Freunde noch Feinde.«
»Und davor?«
»Muß sie von beidem Hunderte gehabt haben. Sie war aggressiv; Freundschaften zu schließen fiel ihr ebenso leicht, wie Freunde fallenzulassen. Seit kurzem hat sie viel Wert auf ihre Unabhängigkeit gelegt. Wenn sie hier überhaupt so etwas wie Freunde hatte, dann noch am ehesten Miriam und mich – und vielleicht ihre Wirtin, Blanche Cushman.«
»Mrs. Cushman hat heute nachmittag die Leiche identifiziert. Sie hat mächtig geweint und geheult, aber ich hatte nicht den Eindruck, daß sie allzu bekümmert war.«
»Rose hat ihr ab und zu Ärger gemacht. Wenn Rose getrunken hatte, konnte sie ziemlich laut werden.«
»War sie eine Säuferin?«
»Ich glaube nicht. Allerdings bin ich da vielleicht ein bißchen voreingenommen. Ich mochte Rose. Sie hat mich umgekehrt nicht besonders gemocht. Sie hat mir oft Schnüffelei und so weiter vorgeworfen.«
»Inwieweit hat sie Ihnen vertraut?«
»Nur insoweit, als es ihr in den Kram paßte. Ich hatte {34}zum Beispiel keine Ahnung, daß sie herzkrank war. Sie hat nie von ihrer Gesundheit, ihrem Alter oder ihrer Familie gesprochen. Sie hat ganz offen über drei von ihren fünf Ehemännern geredet, aber von den anderen beiden habe ich erst heute abend aus der Zeitung erfahren.«
»Es waren tatsächlich fünf. Ich habe einen von den Jungs beauftragt, sich bei der Werbeabteilung ihres früheren Studios zu erkundigen. Von dreien hat sie sich scheiden lassen, einer ist bei einem Segelunglück ums Leben gekommen, und einer hat Selbstmord begangen.«
»Arme Rose.«
»Das hängt ganz vom Standpunkt ab«, sagte Greer scharf. Das Telefon auf seinem Schreibtisch schnarrte, und er beugte sich mit einem Unmutslaut vor und nahm den Hörer ab. »Greer am Apparat.«
»Greer?«
»Ganz recht.«
»Hier ist Malgradi. Ich bin unten im Institut.«
»Haben Sie sie wieder hergerichtet?«
»Na sicher. Deswegen rufe ich auch an. Ich habe hier einen Mann im Büro, der sie sehen will.«
»Was für einen Mann?«
»Behauptet, er wäre ihr Ehemann. Ich hab sie ziemlich hübsch hingekriegt, aber ich dachte, ich kläre das lieber mit Ihnen, ehe ich jemanden zu ihr lasse.«
»Wie heißt er?«
»Dalloway, Haley Dalloway. Meinen Sie, ich soll ihn reinlassen?«
»Halten Sie ihn hin, bis ich da bin. Ich mache mich gleich auf die Socken.«
»Ich habe noch nicht gegessen.«
»Ich bringe Ihnen eine Tüte Popcorn mit.« Greer legte {35}den Hörer auf und wandte sich an Frank. »Dalloway ist aufgetaucht, ihr erster Mann. Wollen Sie mitkommen und ihn kennenlernen?«
»Nicht unbedingt.«
»Kommen Sie trotzdem mit. Ich möchte, daß Sie sich Rose mal ansehen.«
Frank verlagerte sein Gewicht, so daß der Stuhl protestierend quietschte. Der Laut klang fast menschlich.
»Das gehört nicht zu meinen Aufgaben.«
»Sobald sie tot sind, seid ihr fertig mit ihnen, wie? Was ist los, Frank, haben Sie Schiß vor netten, harmlosen, alten Toten?«
»Ich habe in der Hinsicht keinerlei Erfahrung.«
»Es gibt immer ein erstes Mal.«
»Außerdem habe ich Miriam versprochen, daß ich mit ihr ins Kino gehe.«
»Ich rufe sie an und sage ihr, daß es später wird«, meinte Greer. »Wie ist die Nummer?«
»Bemühen Sie sich nicht.«
»Wie ist die Nummer?«
»23664.«
Greer rief Miriam an, während Frank ans Fenster trat und durch das Eisengitter auf die Lichter der Stadt hinausblickte. Selbst von hier aus konnte er Miriams klare, feste Stimme hören, die nur allzu deutlich aus dem Hörer drang. Von einem Kinobesuch höre sie zum ersten Mal, und außerdem wasche sie sich gerade die Haare.
Als Greer auflegte, wirkte er sehr zufrieden mit sich. »Ein bißchen mehr hätten Sie sich schon anstrengen können, Frank.«
»Miriams einziger Fehler ist die Angewohnheit, die Wahrheit wie eine Schubkarre vor sich herzuschieben.«
{36}»Nette Art, einen auf die Schippe zu nehmen. Sind Sie soweit?«
»Ich denke schon.«
Greer lachte. »Sie werden’s überleben. Falls Ihnen komisch wird, gibt Malgradi Ihnen ein paar Gläschen Formalin.«