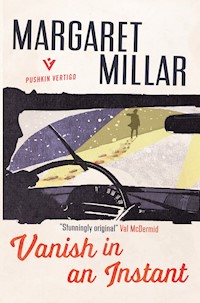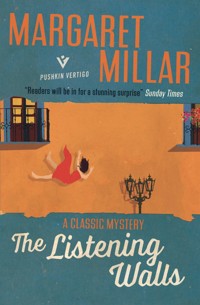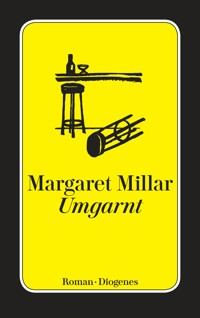7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nymphen gehören ins Meer, sonst richten sie Unheil an. Mit dem rätselhaften Verschwinden von Cleo fängt es auch schon an. Die irrwitzigen Verwicklungen, in die ein schwuler Lehrer, eine korrekte Schulleiterin, ein vorbestrafter Freak und auch der leichtlebige Neffe des attraktiven, naiv-zurückgebliebenen, von seinem Bruder überbeschützten Mädchens verstrickt werden, enden mit Mord und Verderben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Nymphen gehören ins Meer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Otto Bayer
Diogenes
{5}Für Eleanor McKay Van Cott
{9}I Kind
{11}1
Das Mädchen fiel auf, noch ehe es die Kanzlei betrat. Es war ein stürmischer Tag, und außer ihrem Gesicht war alles in Bewegung. Der Mantel flatterte ihr um die Beine wie die Flügel eines gefangenen Vogels, und ihr langes blondes Haar schien sich eigenmächtig zu Knoten verschlingen zu wollen. Das Schild über der Tür – SMEDLER, DOWNS, CASTLEBERG, MACFEE, POWELL, ANWÄLTE – wand und drehte sich, als ob die Herren Partner miteinander balgten.
Charity Nelson, Mr. Smedlers Chefsekretärin, setzte sich in der Mittagspause immer an den Empfang, denn da sie abnehmen wollte, mochte sie von Essen erst gar nichts hören und sehen.
Die Eingangstür ging auf, und der Wind wehte das Mädchen herein. Sie machte den Eindruck, als wüßte sie nicht, wie ihr geschah. Sie war sehr dünn, und das lenkte Charitys Gedanken sofort auf Essen und ließ sie schmerzliche kleine Stiche in der Magengegend fühlen.
Sie fragte gereizt: »Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Der kleine Käfig gefällt mir.«
»Kleiner Käfig?«
»Der da draußen – hinten am Haus.«
»Das ist Mr. Smedlers Privataufzug. Er führt direkt in sein Privatbüro.«
{12}»Ob er mich mal darin mitfahren läßt?«
»Nein.«
»Nicht ein einziges Mal?«
»Höchstens wenn Sie eine Klientin wären.«
Das Mädchen sah nicht gerade nach Klientin aus, nach einer zahlenden jedenfalls nicht. Sie war recht hübsch mit ihren hohen Wangenknochen und den großen braunen Augen, die so strahlend und ausdruckslos waren wie Glas.
»Möchten Sie zu Mr. Smedler?« fragte Charity.
»Weiß ich nicht.«
Sie setzte sich ans Eckfenster und nahm eine Illustrierte zur Hand, ließ diese aber ungeöffnet und, wie Charity feststellte, verkehrtherum auf dem Schoß liegen.
»Wissen Sie genau, daß Sie ins richtige Haus gekommen sind?« fragte Charity.
»Ja. Ich habe ein Taxi genommen. Der Fahrer wußte genau, wohin er fahren mußte.«
»Ich will ja nicht wissen, wie Sie hierhergekommen sind. Ich wollte nur wissen, ob Sie für Ihr Hiersein einen bestimmten Grund haben. Sie wissen doch sicher, daß dies eine Anwaltskanzlei ist?«
»Ich falle Ihnen lästig, ja? Mein Bruder Hilton sagt immer, ich soll andern Leuten nicht lästigfallen, aber was soll ich machen, wenn ich nicht weiß, womit ich ihnen lästigfalle?«
»Möchten Sie vielleicht einen Termin bei einem unserer Anwälte haben?«
»Ich denke, ich bleib hier nur mal ein bißchen sitzen und schaue mich um.«
»Hier sind alle zum Mittagessen.«
»Macht nichts«, sagte das Mädchen. »Ich hab’s nicht eilig.«
{13}Um fünf vor halb zwei kamen die ersten vom Mittagessen zurück: zwei Stenotypistinnen, ein Registrator, Mr. MacFee mit einem Klienten, Mr. Powell und seine Sekretärin, ein Juniorpartner und die Empfangsdame, die, wie Charity erbittert vermerkte, wohlgesättigt und zufrieden aussah.
Das Mädchen ließ die erste Gefühlsregung erkennen. Plötzlich sprang sie auf und ließ die Illustrierte zu Boden fallen.
»Das ist er«, sagte sie. »Das ist der, mit dem ich sprechen will, der mit der Brille. Er sieht so nett aus. Wie heißt er?«
»Tom Aragon. Wie ist Ihr Name?«
»Cleo.«
»Cleo und –?«
»Jasper, genau wie mein Bruder Hilton. Cleo Jasper. Ein fürchterlich häßlicher Name, finden Sie nicht auch?«
»Ich will mal nachfragen, ob Mr. Aragon Zeit für Sie hat.« Zu Aragon sagte sie über die Gegensprechanlage: »Hier ist irgendein junges Mädchen, das Sie sprechen will, weil Sie so nett aussehen. Können Sie das verstehen?«
»Und ob. Herein mit ihr.«
»Die kommen Sie lieber selbst hier abholen, Junior. Wie sie aussieht, findet die nicht mal aus einem nassen Papiersack heraus.«
Aragon teilte sein Büro mit einem andern Juniorpartner der Kanzlei. Es war so möbliert, als würden dort nie Klienten erwartet, und es kamen auch wirklich selten welche. Aragons Aufgaben bestanden überwiegend aus Laufarbeit für die Seniorpartner, vor allem Smedler, dessen Fälle oft mit reichen Frauen zu tun hatten. Cleo Jasper war noch nicht ganz eine Frau, und reich sah sie auch nicht aus. Der geradlehnige Stuhl, auf dem sie Platz nahm, schien ihr {14}angemessener als die übertrieben dicken Lederpolster, mit denen Smedler sich umgeben hatte. Ihre Kleidung war sonderbar kindlich – ein marineblauer Jumper über einer weißen Bluse, weiße Kniestrümpfe und ein Paar Schuhe, die aussahen wie die Mary Janes aus einer früheren Epoche. Sie hatte keine Handtasche bei sich, aber eine der Taschen in ihrem Jumper war so ausgebeult, als ob sie darin ein Portemonnaie hätte.
»Womit kann ich Ihnen dienen, Miss Jasper?«
»Ich war noch nie bei einem Rechtsanwalt. Sie sehen so nett aus – darum hab ich Sie ausgesucht.«
»Das ist sicher ein ebenso stichhaltiger Grund wie jeder andere«, meinte Aragon. »Wofür brauchen Sie einen Anwalt?«
»Ich will wissen, was ich für Rechte habe. Ich habe einen neuen Freund, der sagt, ich habe Rechte.«
»Wer sagt denn, daß Sie keine hätten?«
»Keiner so direkt. Aber ich kann nie tun, was ich möchte, und was andere Leute tun.«
»Zum Beispiel?«
»Wählen. Ich will ja gar nicht unbedingt wählen, denn von Präsidenten und so was verstehe ich ja doch nichts, aber ich hab nicht mal gewußt, daß ich könnte.«
»Wie alt sind Sie?«
»Zweiundzwanzig. Mein neuer Freund sagt, ich hätte schon vor vier Jahren wählen können, aber keiner hat es mir gesagt.«
»Wurde dieses Thema nicht in Ihrer Schule behandelt?«
»Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich hab manchmal so verschwommene Momente. Hilton sagt, wählen dürfen nur zurechnungsfähige Leute, die keine verschwommenen Momente haben.«
{15}»Sind Sie amerikanische Staatsbürgerin?«
»Ich bin hier geboren, direkt hier in Santa Felicia.« Das Mädchen zog die Stirn kraus. »Das war schrecklich. Hilton und Frieda, seine Frau, reden oft davon, wie schrecklich es war.«
»Warum?«
»Weil meine Mutter gestorben ist. Sie war zu alt für ein Baby, aber dann hat sie doch eins gekriegt, und das bin ich. Hilton sagt, sie wäre beinahe ins Buch der Rekorde gekommen, weil sie schon achtundvierzig war. Hilton war schon erwachsen und verheiratet, als ich kam. Aber bei Hilton und Frieda wohne ich erst, seit ich acht bin. Davor war ich bei meiner Großmutter. Die war sehr nett, aber sie ist gestorben. Hilton sagt, die Sorgen um mich haben sie verschlissen. Sie hat mir viel Geld vermacht. Aber das kann ich nie ausgeben.«
»Warum nicht?«
»Ich bin außergewöhnlich.«
»Aha.«
»Da staunen Sie, was?«
»Nicht sehr. Jeder Mensch ist auf die eine oder andere Art außergewöhnlich.«
»Sie haben nicht ganz richtig verstanden. Ich bin … Mein neuer Freund hat so viele ulkige Ausdrücke dafür – ich hätte paar Murmeln zuwenig in der Dose, oder nur ein Ruder im Wasser, oder nicht alle Karten im Spiel. Klingt jedenfalls besser, als wenn man so direkt sagt, daß ich … na ja, zurückgeblieben bin.«
Jetzt staunte er wirklich. Äußerlich zeigte sie gar nichts von einem Downschen Syndrom; und sie sprach gut und drückte sich völlig klar aus. Sogar wählen wollte sie. Ob sie nun bloß die Ideen ihres neuen Freundes nachplapperte {16}oder nicht, für ein zurückgebliebenes Mädchen war dieser Wunsch recht ungewöhnlich.
»Mädchen« ist überhaupt verkehrt, dachte er. Sie war eine Frau von zweiundzwanzig Jahren. In dem Punkt konnte man schon eher von zurückgeblieben sprechen. Wenn sie gesagt hätte, sie sei vierzehn oder fünfzehn, hätte er es ihr ohne weiteres abgenommen.
»Können Sie lesen und schreiben?«
»Etwas. Nicht viel.«
»Wie ist das mit Ihrem neuen Freund? Kann er gut lesen und schreiben?«
»Mann, und wie! Er ist doch einer von –« Sie schlug sich so schnell und entschieden die linke Hand vor den Mund, daß es weh getan haben mußte. »Ich soll mit keinem Menschen über ihn reden.«
»Warum nicht?«
»Das würde alles verderben. Er ist mein einziger Freund, außer dem Gärtner und Zia, seinem Hund. Zia ist ein Basset. Mögen Sie Bassets?«
»Ja.«
»Ich liebe Bassets.«
»Um auf Ihren neuen Freund zurückzukommen …«
»Nein, nein! Ich darf wirklich nicht.«
»Nun gut. Dann reden wir vom Wählen. Ich glaube, dafür ist wirklich nur erforderlich, daß Sie amerikanische Staatsbürgerin und mindestens achtzehn Jahre alt sind, nicht unter Polizeiaufsicht stehen und in keiner psychiatrischen Anstalt untergebracht sind, und daß Sie eine dahingehende eidesstattliche Erklärung unterschreiben. Natürlich wird erwartet, daß Sie die eidesstattliche Erklärung lesen können, bevor Sie unterschreiben.«
»Das könnte ich ja vorher üben, nicht?«
{17}»Natürlich.«
Ihre Lippen begannen sich zu bewegen, als ob sie schon stumm übte. Sie hatte einen kleinen, wohlgeformten Mund mit einer ausgeprägten Falte zwischen Oberlippe und Nase. Es heißt, eine starke Betonung dieser Gesichtspartie sei ein Zeichen für festen Charakter. Aragon betrachtete das schüchterne, unterentwickelte Mädchen, das vor ihm saß, und fand, daß es sich dabei um einen Irrtum handeln mußte.
Endlich sagte sie: »Erzählen Sie mir etwas von meinen anderen Rechten.«
»Von welchen?«
»Angenommen, ich möchte mal einfach in einen Bus steigen und wegfahren … einfach irgendwohin, nach Chicago oder so. Dürfte ich das?«
»Hängt davon ab, ob Sie genug Geld haben und sich imstande fühlen, sich in so einer großen Stadt zurechtzufinden. Es wäre jedenfalls nicht verkehrt, darüber erst einmal mit Ihrem Bruder und seiner Frau zu sprechen.«
»Nichts zu holen.«
»Warum nicht?«
»Die würden mich nicht lassen. Ich war noch nie irgendwo, außer letzte Ostern. Ich und noch ein paar andere Schüler von Holbrook Hall haben da auf einem Schiff eine Kreuzfahrt nach Catalina mitgemacht – auf der Jacht von Donny Whitfields Vater.«
Holbrook Hall war in ganz Südkalifornien bekannt als Schule für den gestörten und störenden Nachwuchs reicher Leute. In den teureren Magazinen wurde es als »Einrichtung, die den besonderen Bedürfnissen außergewöhnlicher Jugendlicher und junger Erwachsener entgegenkommt« angepriesen.
{18}»Wie lange sind Sie schon in Holbrook Hall, Cleo?«
Sie errötete leicht. »Sie haben mich Cleo genannt. Das ist nett. So nennen mich nämlich meine Freunde.«
»Also, seit wann?«
»Schon immer.«
»Na, na, Cleo.«
»Ein Jahr, vielleicht länger. Davor hatte ich immer eine Gouvernante. Und Hilton und Frieda haben mir auch alles mögliche beigebracht. Er ist richtig klug, und sie war früher mal Lehrerin. Ted geht aufs College. Das ist ihr Sohn. Er trinkt und raucht Pot und … na ja, lauter solche Sachen. Stellen Sie sich vor, das ist mein Neffe, und dabei ist er nur ein Jahr jünger als ich! Den Leuten sagt er immer, daß ich ein Schwachkopf bin und seine Eltern mich in einem Waisenhaus aufgelesen haben.«
»Sie wollen also fort von Ted und Ihrem Bruder und Ihrer Schwägerin?«
»Hauptsächlich will ich nur wissen, was ich für Rechte habe.«
»Können Sie über irgendwelches Geld verfügen?«
»Ich habe ein paar Kundenkreditkarten. Aber wenn ich damit was mache, was Hilton nicht recht ist, läßt er sie bestimmt sperren. Das sagt jedenfalls mein neuer Freund.«
»Ihr neuer Freund scheint ja über Ihre Angelegenheiten einiges zum besten zu geben.«
»O Gott, ja! Manches davon verstehe ich gar nicht. Wenn er zum Beispiel sagt, daß wir alle in einem Käfig sitzen und daraus ausbrechen müssen. Ich hab mir schon gedacht, wenn ich in diesen Käfig, der draußen an Ihrem Haus rauf- und runterfährt, mal rein- und von allein wieder rauskann, verstehe ich vielleicht, was er meint.«
»Können Sie ihn nicht einfach fragen?«
{19}»Ich soll doch immer versuchen, Dinge selbst herauszubekommen. Er sagt, ich bin nicht so dumm, wie ich mich anstelle. Das verstehe ich übrigens auch nicht, und dabei geb ich mir Mühe. Ich geb mir richtig, richtig Mühe.«
»Das glaube ich gern«, sagte Aragon. Cleos neuer Freund schien sie, aus was für Beweggründen auch immer, mit Dingen zu füttern, die sie nicht verdauen konnte. »Was rät Ihr Freund Ihnen sonst noch?«
»Er meint, ich soll mal etwas Geld von meinem Sparkonto nehmen und für irgend etwas ausgeben, was ich gern möchte, ohne Hilton zu fragen.«
»Könnten Sie das?«
»Ich denke schon. Wenn ich nicht solche Angst hätte.«
»Hat Ihr Freund schon einmal angedeutet, daß Sie ihm etwas von diesem Geld leihen könnten?«
»O nein! Er haßt Geld. Er sagt, Geld ist schlecht – er hat es nur anders ausgedrückt.«
»›Denn Habsucht ist die Wurzel allen Übels.‹ Hat er das gesagt?«
»Ja!« Sie machte ein hocherfreutes Gesicht. »Sie kennen ihn also auch?«
»Nein. Wir lesen nur anscheinend dieselben Bücher. Der Satz ist aus der Bibel.«
»So was steht wirklich in der Bibel über Geld?«
»Unter anderm.«
»Dann ist es sicher wahr. Aber komisch ist das schon, denn Hilton ist sehr christlich, und dabei arbeitet er die ganze Zeit, um noch mehr Geld zu verdienen.«
»Das tun viele Leute.«
»Hilton zitiert oft aus der Bibel. Ted sagt, das ist alles große –, er hat ein schlimmes Wort dafür gebraucht. Ted kennt mehr schlimme Wörter als jeder andere auf der {20}Welt, außer Donny Whitfield in der Schule. Donny kann so schmutzig reden, daß ihn fast keiner versteht. Und dick ist er! Wenn wir in der Schule unsern freien Nachmittag haben, kriegt jeder von uns fünf Dollar, die wir ausgeben dürfen, und Donny gibt alles für Eiscreme aus. Seine freien Nachmittage sind gar nicht richtig frei, denn er muß immer einen Berater bei sich haben, der aufpaßt, daß er sich keinen Ärger einhandelt. Er ist ein schlimmer Junge. Warum gibt es eigentlich gute Jungen und schlimme Jungen?«
»Das weiß wohl niemand, Cleo.«
»Man soll doch meinen, wenn der liebe Gott sich schon damit abgibt, Jungen zu machen, dann würde er doch wenigstens nur gute machen.«
Charity Nelson, Mr. Smedlers Sekretärin, steckte den Kopf durch die Tür. Als sie sah, daß das Mädchen noch immer da war, zog sie die Augenbrauen so hoch, daß sie fast unter ihrer orangefarbenen Perücke verschwanden.
»Mr. Smedler möchte Sie sprechen, Junior.«
»Sagen Sie ihm, ich hab eine Klientin hier.«
»Das hab ich ihm schon gesagt. Er glaubt’s nur nicht.«
»Sagen Sie’s ihm noch mal.«
»Sie spielen mit dem Feuer, Junior. Smedler hat ein hartes Wochenende hinter sich.«
Nachdem Charity die Tür wieder zu hatte, sagte das Mädchen: »Diese Frau mag mich nicht.«
»Miss Nelson mag überhaupt nicht viele Leute.«
»Ich gehe jetzt auch besser.« Sie sah sich unbehaglich nach der Tür um, als ob sie fürchtete, Charity könne sich dahinter versteckt halten. »Ich hab Sie schon viel zu lange aufgehalten.«
»Nur eine Viertelstunde.«
{21}»Hilton sagt, es kommt auf jede Sekunde an. Er sagt, ein Augenblick kommt nie wieder. Was das nur wieder heißt? Es muß etwas heißen, sonst würde Hilton es nicht sagen.«
»Was hat Sie gerade in diese Kanzlei geführt?«
»Nichts. Das heißt, ich komme hier jeden Tag auf dem Weg nach Holbrook Hall vorbei. Meist fahren mich Frieda und Hilton, aber manchmal auch Ted, wenn er vom College zu Hause ist. Das ist immer gruslig, aber es macht Spaß. Jedenfalls hab ich da den kleinen Käfig rauf- und runterfahren gesehen und wäre so gern mal mitgefahren und … und …«
Sie war ins Stammeln geraten, und er verstand nicht mehr, was sie sagte. Er wartete geduldig, bis sie sich beruhigt hatte. Was sie auf einmal so erregt hatte, wußte er nicht. Vielleicht das viele Reden, vielleicht die Erinnerung an die grusligen Fahrten mit Ted, oder es war etwas, das tiefer saß und nicht zu erklären war.
Sie preßte die Fäuste von beiden Seiten gegen den Mund, wie um ihn unter ihre Gewalt zu bringen. »Und ich wollte auch mal einen Anwalt nach meinen Rechten fragen. Ich hab gedacht, wenn ich herkomme, darf ich mal in dem kleinen Käfig fahren.«
»Das geht heute leider nicht.«
»Ein andermal?«
»Vielleicht.«
»Aus ›vielleicht‹ wird nie was«, sagte sie. »Jedenfalls nicht, wenn’s was Schönes ist.«
»Aus diesem doch.«
Sie stand auf und zog das Portemonnaie aus der Tasche ihres Jumpers. »Ich bezahle gleich.« Sie leerte den Inhalt des Portemonnaies auf den Tisch: drei Dollarnoten, zwei Fünfundzwanzig- und ein Fünfcentstück. »Hoffentlich {22}reicht das. Ich mußte nämlich das Taxi bezahlen, das mich hergebracht hat, und mehr ist von dem Geld für den freien Nachmittag nicht mehr übrig.«
»Sagen wir, ich bekomme einen Dollar. Es ist ja Ihr erster Besuch, und viel habe ich nicht für Sie tun können.«
»Sie haben es jedenfalls versucht«, sagte sie nachsichtig, »und Sie sehen nett aus.«
»Soll ich Ihnen ein Taxi besorgen?«
»Nein, danke, ich kann laufen. Ich glaube, ich gehe mal ins Museum. Die Schule sieht es gern, wenn wir an unserm freien Nachmittag ins Museum gehen. Die meinen, wir lernen da was. Wie weit ist das von hier?«
»Zwei, drei Kilometer. Kennen Sie den Weg?«
»Na klar. Ich war doch schon hunderttausendmal da …«
Er sah ihr aus dem Fenster nach, als sie das Gebäude verließ. Das Museum befand sich im Norden. Sie wandte sich raschen und sicheren Schrittes nach Süden.
{23}2
Der Tisch war lang und aus dunklem Nußbaumholz, kunstvoll gedrechselt im georgianischen Stil und für ein vornehmes englisches Speisezimmer gedacht. Aber Hilton saß an seinem Kopfende wie ein Kapitän, der seine Mannschaft unterwies, wie sie durch schwere See – sprich Steuern, Demokraten, Inflation, nicht ganz durchgebratenes Lamm und schlechte Manieren – zu manövrieren habe.
Die Mannschaft hörte ihm jedoch nicht sehr aufmerksam zu. Frieda, seine Frau, hatte eine Fernsehprogrammzeitschrift mit an den Tisch gebracht und überflog die Abendprogramme. Sie war eine hübsche Frau, die zur Rundlichkeit neigte und ein zänkisches Lächeln aufzusetzen pflegte, wenn sie sich ärgerte und es nicht zugeben wollte. Dieses Lächeln erschien des öfteren beim Essen, denn sie empfand es als himmelschreiende Ungerechtigkeit, daß Hilton offenbar essen konnte, was ihm in die Quere kam, ohne je ein Gramm zuzunehmen, während sie selbst an einem Schokoladeneclair nicht einmal vorbeigehen konnte, ohne gleich ein Pfund mehr auf den Rippen zu haben.
Die übrige Mannschaft war ebenso unaufmerksam. Lisa, die Collegestudentin, die allabendlich das Essen servierte, weil die Köchin sich weigerte, nach sieben Uhr noch zu arbeiten, bewegte sich mit rhythmischem {24}Wiegeschritt herein und hinaus und dahin und dorthin, als ob sie ein unsichtbares Radio im Ohr stecken hätte. Ihre hautengen Jeans und das ebenso hautenge T-Shirt wurden halb von einem bestickten weißen Schürzchen bedeckt – es war das Äußerste an Uniform, was Frieda bei ihr durchsetzen konnte. Sie war in Cleos Alter, aber außer einem gelegentlichen Achselzucken oder Augenrollen, wenn Hilton sie besonders langweilte, wechselten die beiden kaum einmal etwas Persönliches miteinander.
Cleo hatte den Kopf auf die linke Hand gestützt und hielt den Blick unverwandt auf den Teller vor sich gerichtet.
Frieda war mittlerweile ganz auf die Gesellschaft des Fernsehers angewiesen. Hilton war oft geschäftlich unterwegs, und selbst wenn er zu Hause war, bewegten die Gespräche sich auf Cleos Niveau, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlte. Dadurch fühlte sich Frieda ihrerseits ausgeschlossen.
»Nimm bitte den Ellbogen vom Tisch, Cleo«, sagte Hilton. »Und iß deine Suppe wie ein wohlerzogenes Mädchen.«
»Kann ich nicht. Da sind so komische Sachen drin, wie Muschelschalen.«
»Es sind Muschelschalen. Das ist eine Bouillabaisse.«
»Knochen auch.«
»Und?«
»Der Gärtner gibt nicht mal seinem Hund Knochen. Er sagt, die können ihm Löcher in die Därme machen.«
»Ich finde dieses Thema für ein Tischgespräch nicht sehr geeignet. Nun iß schön deine Suppe. Die Köchin kocht eine ausgezeichnete Bouillabaisse. Wer nichts verkommen läßt, leidet nie Not.«
»Ach, du lieber Himmel!« sagte Frieda. »Laß die Suppe {25}stehen, wenn du sie nicht magst … und nun erzähl uns mal, was du heute gemacht hast.«
»Ich war im Museum.«
»Du warst den ganzen Nachmittag fort.«
»Ich hab ja auch Unmengen Bilder gesehen.«
»Bist du auch Leuten begegnet?«
»Da waren Unmengen Leute.«
»Ich meine, hast du mit jemandem gesprochen?«
»Nur einmal.«
»Mit einem Mann oder einer Frau?«
»Einem Mann.«
»Cleo, Liebes, wir wollen ja nicht neugierig sein«, sagte Hilton, »aber worüber hast du dich denn mit diesem Mann unterhalten?«
»Ich hab ihn nach der Damentoilette gefragt. Er hat mir gesagt, wo sie ist, und dann noch ›Schönen Tag‹ gesagt, und ich auch.«
Es war einen Augenblick still, dann sagte Hilton mit besorgter Stimme: »Ich dachte, das Museum sei montags geschlossen.«
Das Mädchen saß blaß und stumm da und starrte auf die Gräten und Muschelschalen auf dem Teller, bis Lisa kam und ihn abtrug.
Ein Zucken spielte um Hiltons rechten Augenwinkel und ließ das Lid auf- und niedergehen. Es sah aus wie ein scheeles Zwinkern. »Du weißt natürlich, wie wichtig es ist, uns die Wahrheit zu sagen, nicht wahr, Cleo?«
»Ich war im Museum. Da waren Unmengen Bilder. Und ich habe Unmengen Leute gesehen …«
»Ich habe dich sehr, sehr gern, Cleo. Dein Wohl wurde mir anvertraut. Ich muß wissen, wohin du gehst und welchen Umgang du pflegst.«
{26}»Ich besuche Holbrook Hall. In Holbrook Hall habe ich jede Menge Umgang.«
»Laß das Mädchen jetzt mal in Frieden«, sagte Frieda energisch. »Sie hat offensichtlich wieder mal Mattscheibe. Da können wir nicht erwarten, daß sie sich wie ein normaler Mensch benimmt.«
»Ich bin eben außergewöhnlich«, sagte Cleo.
»Gewiß bist du das, meine Liebe. Und es ist nicht deine Schuld, daß du anders bist. Alle Menschen sind verschieden. Sieh dir Lisa an. Sie ist auch anders als andere.«
»Inwiefern?« fragte Lisa, indem sie die Soßenschale auf den Tisch stellte, dabei einen Tropfen verschüttete und mit dem Zeigefinger aufwischte.
»Du trägst furchtbar enge Hosen«, sagte Cleo. »Ich weiß gar nicht, wie du damit aufs … na, du weißt schon, auf die Toilette gehen kannst, wenn du es eilig hast.«
»Nichts als Übung.«
Hilton schwieg finster vor sich hin. Er hatte schon seit einiger Zeit das Gefühl, daß ihm die Dinge aus der Hand glitten, daß er keine Gewalt mehr über Cleo oder Frieda oder das Personal hatte. Selbst Zia, der Hund des Gärtners, nahm ihn gar nicht mehr zur Kenntnis, wenn er morgens die Zufahrt hinunterging, um die Zeitung zu holen.
Schlechte Manieren, Steuern, Kriminalität, Demokraten und ungeeignete Tischgespräche, wohin man blickte. Er war erst fünfundvierzig Jahre alt und hätte am liebsten die Welt angehalten, um auszusteigen.
»Ich wäre auch lieber anders mit engen Hosen«, sagte Cleo.
Hilton seufzte und verteilte die mageren Grillhähnchen, die ihn an Cleo erinnerten, und den wilden Reis, der nur Gras aus Minnesota war, und den Spargel, den er haßte.
{27}»Warum kann ich nicht anders sein und enge Hosen tragen? Warum nicht?«
»Streite bitte nicht mit mir, Cleo.«
»Warum kann ich nicht …«
»Weil solche Kleidung nicht zu dir paßt.«
»Warum nicht?«
»Es sind Fremde im Haus. Wir wollen doch unsere privaten Probleme nicht vor …«
»Ich werd’s sagen. Ich werd’s jedem sagen.«
»Es wird dir niemand zuhören.«
»O doch. Ich habe nämlich Rechte.«
Hilton aß sein mageres kleines Grillhähnchen, das ihn an Cleo erinnerte, und den wilden Reis, der wirklich nur Gras war, und den Spargel, den er haßte. Seine Hände bebten.
»Ich habe Rechte«, sagte das Mädchen noch einmal leise.
Im Laufe des Abends kam Ted für die Semesterferien vom College nach Hause. Er hatte so rechtzeitig zu kommen gehofft, daß er sein Glück einmal bei Lisa versuchen konnte, aber sie war schon fort, und so ging er allein in sein Zimmer hinauf. Er drehte sich einen Joint mit etwas Pot, das er von einem Dozenten gekauft hatte. Der hatte es angeblich aus Djakarta eingeschmuggelt, wahrscheinlich war es aber bei irgendwem im Hausgärtchen gewachsen. Er zündete sich den Joint trotzdem an, zog sich bis auf die Shorts aus und legte sich aufs Bett.
Er war ein gutaussehender junger Mann, groß und kräftig gebaut wie sein Vater. Das lange braune Haar reichte ihm fast bis auf die Schultern, obwohl Hilton ihn immer wieder dazu anhielt, es sich schneiden zu lassen. Er trug {28}einen Bart, den seine Eltern noch nicht gesehen hatten und über den sie bestimmt meckern würden. Aber nach den ersten paar Zügen war ihm das egal.
Er hatte den Joint halb zu Ende geraucht, als es an seine Tür klopfte.
»Wer ist da?«
»Ich. Laß mich mal rein.«
Er öffnete die Tür, und Cleo kam ins Zimmer. Sie trug ein nicht ganz durchsichtiges rosa Nachthemd.
»He, geh dir mal was überziehen«, sagte Ted zur Begrüßung. »Der Alte kriegt einen Schlag. Er hält mich sowieso für einen Wüstling.«
»Bist du einer?«
»Klar.«
»Was tun Wüstlinge?«
»Herr im Himmel, hör auf damit, ja?«
»Du rauchst schon wieder dieses komische Zeug, nicht? Ich hab’s auf dem ganzen Korridor bis hier gerochen.«
»Und?«
»Laß mich mal ziehen.«
»Warum?«
»Donny Whitfield sagt, da wird einem richtig scharf. Ich will, daß mir mal scharf wird.«
»Na ja, du brauchst wenigstens keine Angst zu haben, daß es deinem Gehirn schadet.«
Sie nahm einen Zug und blies den Rauch sofort wieder aus, dann setzte sie sich aufs Bett. »Mir wird nicht scharf.«
»Du mußt inhalieren und den Rauch in der Lunge behalten. So.«
»Gut.« Sie unternahm einen neuen Versuch. »Dein Bart sieht fürchterlich aus.«
»Danke.«
{29}»Darf ich ihn mal anfassen?«
»Wenn du’s so nötig hast, nur zu.«
Sie faßte seinen Bart an, ganz sanft. »Oh, ist der weich! Wie ein Häschen.«
»Ja, das bin ich auch. Playboy-Häschen des Jahres. So, und jetzt trag deinen Arsch wieder in dein Zimmer zurück.«
»Wie du wieder schmutzig redest!« sagte sie. »Laß mich noch mal ziehen.«
»Nur wenn du versprichst, daß du danach gleich gehst.«
»Versprochen.«
Sie inhalierte den Rauch und hielt ihn ein paar Sekunden in ihren Lungen fest. »Ich glaube, jetzt wird mir langsam scharf. Aber ich weiß es nicht genau – mir war noch nie scharf.«
»Du hast versprochen, zu gehen.«
»Gleich. Ich hab dich ja noch gar nicht fragen können, was ich dich fragen wollte.«
»Schieß los.«
»Meinst du, ich würde gut aussehen in so engen Hosen, wie Lisa sie trägt?«
»Woher soll ich denn das wissen?«
»Ich kann dir ja mal meine Figur zeigen.«
»He, Moment mal! Um Himmels willen, laß …«
Aber sie hatte schon das rosa Nachthemd ausgezogen und stand splitternackt, blaß und bibbernd vor ihm, als ob ihr kalt wäre. Aber ihr war nicht kalt.
Ted schloß die Augen.
»Ted, schläfst du?«
»Ja.«
»Du hast mich nicht mal angeguckt.«
»Ich hab genug gesehen.«
{30}»Also, und was meinst du?«
»Was soll ich wozu meinen?«
»Mann, du mußt manchmal genauso verschwommene Momente haben wie ich. Du hast überhaupt nicht achtgegeben. Ich hatte dich was gefragt.«
Er setzte sich auf dem Bett auf. Der Schweiß lief ihm den Nacken hinunter.
»Hast du einen verschwommenen Moment, Ted?«
»Ja.«
»Du schläfst aber nicht, Ted, oder?«
»Nein.«
»Du hast mich noch nicht angesehen.«
»Ich hab genug gesehen.«
»Mir gefällt’s hier bei dir so gut, Ted, weißt du das? Es ist so gemütlich. Gefällt es dir auch?«
»Ja.«
Sie setzte sich neben ihn aufs Bett. Ihre Schenkel berührten sich, und er fühlte das Zittern ihres Körpers und ihren warmen Atem in seinem Nacken.
»Cleo, hör mal … es ist besser, du …«
»Jetzt hab ich vergessen, was ich dich fragen wollte, und dabei war es furchtbar wichtig. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Meinst du, ich sollte so enge Hosen tragen wie Lisa?«
»Jetzt nicht«, antwortete er flüsternd. »Im Moment nicht.«
»Dir ist richtig scharf, nicht wahr, Ted?«
»Leg dich hin.«
»Und wenn ich nicht mag?«
»Du magst.«
Er schob eine Hand zwischen ihre Beine. Sie stieß einen kleinen Quietscher aus und ließ sich aufs Bett fallen.
{31}Hilton war vom Geräusch eines Autos aufgewacht. Er dachte, es müsse ein Nachbar sein, denn Ted war nicht vor morgen früh zu erwarten, und seine Ankunft war gewöhnlich vom Brüllen der Stereoanlage und Reifenquietschen begleitet.
Hilton lag lange da und lauschte den Geräuschen der Nacht, denen, die er haßte: Friedas Schnarchen im Zimmer nebenan und Zias Gebell hinter einer streunenden Katze her; und dem einen, das er liebte: dem Gesang der Spottdrossel, der zu jeder Tages- und Nachtzeit einsetzen konnte. Tagsüber war es sozusagen ein Potpourri aller Geräusche aus der Nachbarschaft, Gurren und Schnarren und Quaken und Kreischen, aber des Nachts war es meist ein reines, klares Pfeifen, immer und immer wieder die gleiche Melodie, wie ein Impressionist, der sein wahres Ich erst zeigt, wenn das Publikum gegangen ist.
Es gab auch noch andere Geräusche: ein Heimchen im Rosenstrauch vor Hiltons Zimmer und das Grollen und Gurgeln des Hungers in seinem Magen. Er stand auf, zog Morgenmantel und Slipper an und ging auf den Flur, um in die Küche hinunterzugehen und etwas Milch und ein paar Cracker zu sich zu nehmen. Ehe er an die Treppe kam, sah er Licht unter Teds Zimmertür am anderen Ende des Flurs.
Hilton blieb stehen und lauschte. Normalerweise war Teds Anwesenheit mit Lärm irgendwelcher Art verbunden, aber heute war nichts zu hören, nicht einmal leise Radiomusik. Er dachte, Frieda oder die Zugehfrau habe das Licht angelassen, nachdem sie das Zimmer für Ted saubergemacht hatte.
Er machte die Tür auf. Zwei Menschen lagen auf dem Bett, die Körper so ineinander verschlungen, daß sie {32}aussahen wie einer, ein Monstrum mit zwei Köpfen. Es war nicht das erstemal, daß Ted ein Mädchen heimlich mit aufs Zimmer geschmuggelt hatte, und Hilton hatte schon angefangen, die Tür wieder zu schließen, als er sah, daß es Cleo war.
Ein Schrei bildete sich in seiner Kehle, gefror, schmolz und rann zurück in seine Brust. Die Körper trennten sich und wurden zwei.
»Allmächtiger«, sagte Ted, indem er sich auf dem Bett aufsetzte.
»Zieh dich an«, sagte sein Vater, »und mach, daß du rauskommst.«
»Du meine Güte, ist das ein Empfang daheim.«
»Zieh deinen Morgenmantel an, Cleo.«
»Ich hab keinen Morgenmantel«, sagte Cleo, »nur das rosa Nachthemd, das Frieda mir zum Geburtstag geschenkt hat.«
»Hier.« Hilton zog seinen Morgenmantel aus und deckte sie damit zu.
»Bist du böse auf mich, Hilton?«
»Nein.«
»Hand aufs Herz und schwöre …«
»Sei bitte still.«
»Er ist böse auf mich«, sagte Ted. »Ich bin der Schurke.«
»Du bist ein Dreckskerl«, sagte Hilton. »Und ich möchte, daß du noch diese Nacht das Haus verläßt.«
»Ich bin den ganzen Tag gefahren. Ich bin müde.«
»Nicht zu müde, wie ich sehe. Voran jetzt. Und komm mir nicht mehr in dieses Haus, nie mehr.«
»Herrgott noch mal, wie find ich denn das?« rief Ted. »Diese verrückte Gans kommt hier nackt zu mir rein und wirft sich mir an den Hals und …«
{33}»Halt den Mund. Mach, daß du rauskommst, und betritt dieses Haus nicht mehr. Nie mehr!«
»Das ist verrückt, sag ich dir.«
»Cleo, geh in dein Zimmer. Ich möchte mit dir reden.«
»Du bist böse auf mich«, sagte das Mädchen. »Ich hab’s gewußt, ich hab’s einfach gewußt. Und ich bin nicht nackt hier reingekommen. Ich hatte mein Nachthemd an und hab’s ausgezogen, um Ted meine Figur zu zeigen, damit er mir sagen kann, wie er sie findet.«
»Das Urteil scheint günstig ausgefallen zu sein.« Hilton ging auf den Korridor, und wenig später folgte ihm das Mädchen, das rosa Nachthemd hinter sich her schleifend wie ein schlechtes Gewissen.
In dem blau und weiß gestrichenen Zimmer, dessen Möblierung seit Cleos Kindheit nicht mehr verändert worden war, setzte Cleo sich in einen weißen Schaukelstuhl aus Korb, der bei jeder Bewegung, die sie machte, quietschte und knarrte. Hilton stand mit dem Rücken zu ihr, das Gesicht zur Wand, deren Tapete Cleo sich selbst hatte aussuchen dürfen: ein Gewimmel weißer Blüten, grüner Blätter und blauäugiger Kätzchen.
»Hör auf damit«, sagte er. »Hör auf zu schaukeln.«
»Du bist böse auf mich.«
»Ich bin nur enttäuscht.«
»Das ist dasselbe.«
»Nein.«
»Geht Ted jetzt fort?«
»Ja.«
»Für immer und ewig?«
»Er wird nicht mehr in diesem Haus wohnen.« Seine Stimme bebte. »Tut es dir leid, was du getan hast?«
»Wahrscheinlich. Wenn du es willst.«
{34}»Ja, ich will, daß es dir leid tut.«
»Gut. Dann tut es mir leid.«
Er wußte, daß er ebensogut mit einem der blauäugigen Kätzchen an der Wand hätte reden können, aber er konnte nicht aufhören, es zu versuchen. »Ich liebe dich, Cleo. Das weißt du doch, ja?«
»Klar. Du sagst es mir ja dauernd.«
»Liebst du mich dafür auch?«
»Klar.«
»Nein, du liebst mich nicht«, sagte er in heiserem Flüsterton. »Du liebst nichts und niemanden.«
»O doch. Ich liebe Zia und Eiscremehörnchen und Fernsehen und Blumen und Erdbeeren …«
»Und wo komme ich auf dieser Liste – irgendwo zwischen Eiscremehörnchen und Erdbeeren?«
Sie hatte wieder zu schaukeln angefangen, sehr schnell, als versuchte sie, seine Worte hinter sich zu lassen und die sonderbaren kleinen Laute zu ersticken, die aus ihrem Mund kamen. Es waren die Laute ihrer verschwommenen Momente. Nach einer Weile würden sie wieder aufhören.
»Antworte mir, Cleo. An welcher Stelle komme ich?«
»Am liebsten muß ich Zia haben«, sagte sie langsam, »denn er ist nie böse auf mich, und wenn ich mit ihm spreche, hört er mir immer zu, als wäre ich ein richtiger Mensch.«
Er drehte sich um und packte die Lehne ihres Schaukelstuhls, damit das Knarren aufhörte. »Du bist ein richtiger Mensch, Cleo.«
»Nicht wie die andern. Du hast gesagt, ich liebe nichts und niemanden. Richtige Menschen lieben etwas.«
»So hatte ich das nicht gemeint. Entschuldige. Es tut mir sehr leid.«
{35}»Schon gut.«
»Cleo.« Er ließ sich neben ihr auf die Knie sinken und begann, ihr übers Haar zu streicheln. »Versprich mir etwas. Du darfst dich nie von einem andern Mann berühren lassen. Versprichst du mir das?«
»Klar«, sagte sie. Er roch so gut, besser noch als Ted.
Am Morgen war Teds BMW fort, und daß er überhaupt dagewesen und wieder fortgefahren war, verriet nur noch ein Paar Skier, die er vom Dachgepäckträger abgenommen und neben die Einfahrt geworfen hatte.
Die Skisaison war vorbei.
Kaum wurde es draußen hell, da hörte man aus dem Frühstückszimmer Streiten. Laute Worte, leise Worte und wieder laute, je nachdem wer sprach, Frieda oder Hilton.
Cleo starrte an die Decke und lauschte. Frieda konnte so gut schreien, daß jedes Wort klar zu verstehen war: Ted sei ebenso ihr Sohn wie Hiltons … Hilton habe kein Recht, ihn so herzlos hinauszuwerfen, seinen eigenen Sohn … Ted sei ja nicht einmal schuld gewesen, sondern sie, dieses verdammte Gör, das verdorben sei bis in die Knochen … Sie wisse Recht nicht von Unrecht zu unterscheiden und habe auch nicht die Absicht, es zu lernen … Hilton habe sie so verdorben, er lasse sich von ihr um den kleinen Finger wickeln und gegen seinen eigenen Sohn aufwiegeln … Und wenn sie jetzt ein Kind bekomme? … Diese verdammten Schwachsinnigen sollte man allesamt sterilisieren …
Cleo hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu, doch die Geräusche drangen durch das offene Fenster herein, kamen durch die Ritzen in den Fußbodenbrettern und {36}