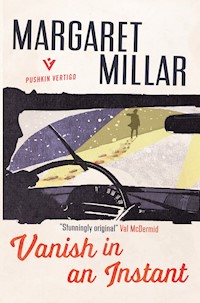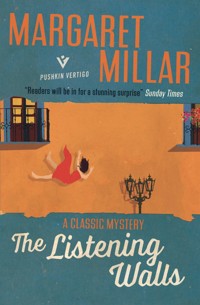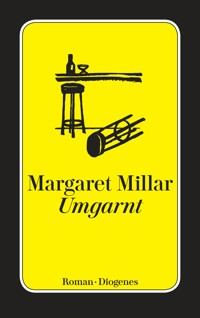7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Robert Osborne ist Farmer in Kalifornien - jung, wohlhabend und glücklich verheiratet. Eines Abends verläßt er sein Haus und kehrt nicht zurück. Alle Nachforschungen bleiben erfolglos; lediglich ein Messer, Osbornes toter Hund und Blutspuren werden gefunden. Seine Frau Devon ist überzeugt, daß Osborne einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Osbornes Mutter dagegen weigert sich, an den Tod zu glauben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Von hier an wird’s gefährlich
Roman
Aus dem Amerikanischen von Fritz Güttinger
Diogenes
{5}1
In Devons Traum suchte man wieder das Reservoir nach Robert ab. Es war fast wie damals, als es zum erstenmal geschah, als der mexikanische Polizeibeamte, Valenzuela, seinen Leuten Anweisungen gab und die jungen Taucher in ihren Gummianzügen umherstanden, das Atmungsgerät auf den Rücken geschnallt.
Im Traum sah Devon vom Herrschaftshaus her stumm und hilflos zu. In Wirklichkeit war sie damals hinausgegangen, um sich bei Estivar, dem Gutsverwalter, zu beschweren. »Warum sucht man ihn da drin?« »Man muß überall suchen, Mrs. Osborne.« »Das Wasser ist doch so schmutzig. Robert hält sehr auf Sauberkeit.« »Jawohl.« »Er wäre nie in so schmutziges Wasser gestiegen.« »Vielleicht hatte er nicht mehr viel dazu zu sagen, Mrs. Osborne.«
Das Wasser, das nur zur Bewässerung diente, war zu trüb, als daß die Taucher viel hätten ausrichten können, und schließlich machte sich die Polizei mit einem großen Bagger und Sieb ans Werk. Stundenlang suchten sie den Grund ab, fanden aber bloß verrostete Maschinenteile, alte Autoreifen, Holztrümmer und das verschlammte Skelett eines Neugeborenen. Dieser Fund hatte dem Polizisten, Valenzuela, mehr zugesetzt, als wenn man ein Dutzend {6}männliche Leichen zutage gefördert hätte. Hat ein Mann, mag sein Ende noch so grausig sein, nicht meistens etwas auf dem Kerbholz, so daß ihm recht geschah? Doch dieses Kind, das arme Wurm – »verflucht noch mal«, sagte Valenzuela, schlug ein Kreuz und nahm das Häuflein Gebeine in einer Schuhschachtel mit.
Geweckt wurde Devon, als Dulzura an die Schlafzimmertür klopfte.
»Mrs. Osborne? Sind Sie wach?« Die Tür ging eine Handbreit auf. »Zeit zum Aufstehen. Das Frühstück ist auf dem Herd.«
»Es ist noch früh«, erwiderte Devon. »Erst halb sieben.«
»Aber heute ist doch der bewußte Tag. Haben Sie’s vergessen?«
»Nein.« Wohl kaum. Sie hatte ja den Antrag selber unterschrieben, während der Rechtsanwalt zuschaute, offensichtlich erleichtert, daß sie endlich eingewilligt hatte.
Dulzuras wulstige Finger zitterten am Türknauf. »Ich habe Angst. Alle werden sie mich anstarren.«
»Sie brauchen bloß die Wahrheit zu sagen.«
»Wie kann ich nach so langer Zeit noch sicher sein, was wahr ist? Und wenn ich eine Unwahrheit sage, nachdem ich auf die Bibel vereidigt worden bin, wird man mich ins Gefängnis stecken, sagt Estivar.«
»Das war nicht ernst gemeint.«
»Er machte aber ein ernstes Gesicht dazu.«
»Man wird Sie nicht ins Gefängnis stecken«, erklärte Devon. »In zehn Minuten bin ich unten.«
Sie blieb jedoch ruhig liegen und hörte zu, wie Dulzura die Treppe hinunterstapfte und der Wind in einem fort {7}ums Haus nuschelte, als wolle er hinein. Die Herbstnacht war warm gewesen. Devons kurze braune Haare waren feucht, und das Nachthemd klebte ihr am Körper, als sei sie selber aus dem Reservoir gefischt und zum Trocknen aufs Bett gelegt worden, eine halb ertrunkene Melusine.
Daß Dulzura etwas anderes als die Wahrheit sagen würde, stand nicht zu befürchten; schließlich war die Sache ja einfach genug: Nach dem Abendessen war Robert hinausgegangen, um seinen Hund zu suchen, und hatte unterwegs einen Abstecher in die Küche gemacht, um Dulzura zum Geburtstag zu gratulieren; er machte eine neckische Bemerkung, wie groß sie nachgerade geworden sei, und ging dann zur Hintertür hinaus, zur Garage hinüber.
Roberts Wagen stand immer noch da, mit zurückgeklapptem Verdeck, und der Zündschlüssel steckte. Estivar meinte, es sei nicht ratsam, den Schlüssel stecken zu lassen, es sei eine allzu große Versuchung für die mexikanischen Saisonarbeiter, die im Frühling kamen, um die Zitronen zu pflücken, im Sommer, um die Tomaten versandbereit zu machen, und im Herbst, um die Melonen einzubringen. Noch nie war indessen ein Versuch gemacht worden, das Auto zu entwenden. Vielleicht hatte Estivar die Leute bei der Ankunft eindringlich davor gewarnt, vielleicht fanden sie aber auch, es hafte ein Fluch an einem solchen Wagen. Wie immer es sich damit verhielt, er war jedenfalls noch da, verstaubt und unberührt.
Der Schwall der Saisonarbeiter, die kamen und gingen, stand unter der Einwirkung der Sonne wie Ebbe und Flut unter der des Mondes. Jetzt war Oktober, wo es am {8}meisten zu tun gab, und die Schlafbaracke war voll belegt. Devon hatte persönlich keine Beziehung zu den Saisonarbeitern. Englisch konnten sie nicht, und Estivar hatte es ihr ausgeredet, sich mit ihnen in ihrem Schulspanisch verständigen zu wollen. Sie hatte keine Ahnung, wie sie hießen und wo sie herkamen. Klein und ausgehungert, wuselten sie wie Nagetiere im Gelände umher. »Das müssen Mexikaner gewesen sein, die schwarz über die Grenze gekommen sind«, sagte einer der Polizeibeamten. »Haben ihn wahrscheinlich ausgeraubt und ermordet und irgendwo verscharrt.« – »Leute, die schwarz über die Grenze kommen, beschäftigen wir nicht«, widersprach Estivar scharf.
Devon stieg aus dem Bett und trat ans Fenster, um die Vorhänge auseinanderzuschlagen. Sie war schon lange aus dem ehelichen Schlafzimmer in die kleinste Kammer im zweiten Stock gezogen. Ein kleines Zimmer war weniger einsam, leichter auszufüllen. Dieses ging nach Süden und bot eine weite Aussicht auf das Flußtal und, in der Ferne, die ausgedörrten Berge von Tijuana, wo die Bretterbuden und die Kuppel der Kathedrale dieselbe Farbe aufwiesen wie der Senf, den man auf dem Rennplatz und beim Stierkampf zu den Wurstbrötchen bekam. Am vorteilhaftesten wirkte Tijuana nachts, wenn es nur noch ein Büschel funkelnder Lichter am Horizont war, oder dann frühmorgens, wenn die Kuppel der Kathedrale rosarot erglühte und die Bretterbuden noch im Dunkel lagen.
Da das Fenster offenstand, konnte Devon hören, wie in der Küche unten das Telefon schrillte und Dulzura es abnahm, mit ebenso schriller Stimme, da ihr dieses Ding nie {9}recht geheuer vorkam. Kurz danach stand sie wieder, vernehmlich schnaufend, unter der Tür.
»Es ist seine Mutter; sie behauptet, es sei wichtig.«
»Sagen Sie ihr, ich werde zurückrufen.«
»Sie hat es aber nicht gern, wenn man sie warten läßt.«
Allerdings, dachte Devon, Roberts Mutter wartete nicht gern. Und doch hatte sie wie alle andern gewartet – auf ein Klingeln an der Haustür, ein Telefon, ein Auto auf der Zufahrt, Schritte im Flur; sie hatte auf einen Brief gewartet, ein Telegramm, eine Postkarte, eine Mitteilung, überbracht von einem Bekannten oder auch einem Unbekannten.
»Sagen Sie ihr, ich werde zurückrufen«, erklärte Devon.
Vom Fenster aus konnte sie auch die Reihen der Tamarisken sehen, die als Windschutz angepflanzt worden waren, und damit nicht allzuviel Sand ins Reservoir geweht werde. Auf der Ostseite lag das ausgetrocknete Flußbett, und gegen Westen dehnten sich die bereits abgeernteten Tomatenfelder aus, auf denen es von Vögeln wimmelte. Überall stießen sie zwischen die Stauden nieder, flatterten im allmählich gelb werdenden Laub umher, pickten die verfaulenden Überreste von Früchten an und suchten auf dem Boden nach Samenkörnern und Insekten. Estivar konnte sie alle benennen. Er bezeichnete sie mit ihren mexikanischen Namen, so daß sie Devon wildfremd und exotisch vorkamen, bis sie eines Tages entdeckte, daß manche ihr von zu Hause her wohlvertraut waren. Der chupamirto war ganz einfach ein Kolibri, die cardelina war eine Goldammer, die golondrina eine Schwalbe.
Anderseits gab es Dinge, die vertraute Namen hatten, ihr aber keineswegs vertraut vorkamen. Regen bedeutete {10}für Devon, die an der Ostküste geboren und aufgewachsen war, höchstens etwas, das einem ein Picknick oder einen Ausflug in den Zoo verdarb, nicht etwas, das in kostbaren Millimetern gemessen wurde. Und ein Fluß war für sie immer etwas gewesen, das dauernd da war, wie der Hudson oder der Delaware oder der Potomac. Der Fluß hingegen, den sie jetzt vor Augen hatte, war fast das ganze Jahr hindurch völlig trocken, nur zuweilen verwandelte er sich in ein tobendes Wildwasser, das einen ganzen Lastwagen mitreißen konnte. Brücken gab es nur wenige. Es wurde vorausgesetzt, bei heftigem Regen seien die Leute vernünftig genug, um zu Hause zu bleiben oder sich an die Hauptstraße zu halten; und wenn es nicht regnete, konnte man jederzeit durchs Flußbett fahren oder gehen, ohne Straßenzoll oder Unterhaltskosten.
Dem jenseitigen Flußufer entlang verlief die Grenze der benachbarten Ranch, die Leo Bishop gehörte. Als Robert sie vor anderthalb Jahren als jungverheiratete Frau mitgebracht hatte, war Leo Bishop der erste Nachbar gewesen, den sie kennenlernte. Robert hatte sie gebeten, besonders nett zu ihm zu sein, da er im Winter zuvor unter tragischen Umständen seine Frau verloren habe. Devon hatte sich Mühe gegeben, aber es kam immer noch vor, daß er so fremd auf sie wirkte wie die mexikanischen Arbeiter.
Sie duschte und begann sich anzuziehen. Was sie heute tragen sollte, hing schon seit einer Woche bereit. Sie war nach San Diego hineingefahren, um sich mit Roberts Mutter zu treffen, und diese hatte das Kostüm für sie ausgesucht, etwas in Braun, eine Spur heller als ihr Haar und eine Spur dunkler als ihre sonnverbrannte Haut. Sie fand, sie {11}wirke darin, als sei sie mit dem Stoff zusammen eingefärbt worden, erhob jedoch keinen Einspruch. Braun eignete sich so gut wie irgendeine Farbe für eine junge Frau, die im Begriff war, an einem sonnigen Herbsttag zur Witwe zu werden.
Sie begab sich über die Hintertreppe in die Küche hinunter.
Dulzura stand am Herd, rührte mit der Linken in der Bratpfanne und fächelte sich mit der Rechten Luft zu. Sie war noch nicht dreißig, doch ihr Alter war, wie auch das Taburett, auf dem sie saß, durch Fettpolster gut getarnt.
Ohne sich umzuwenden, sagte sie: »Ich mache Rührei zum chorizo.«
»Danke, ich nehme bloß Orangensaft und Kaffee.«
»Mr. Osborne war ganz versessen auf chorizo, er hatte wirklich einen mexikanischen Geschmack. Sie sollten wenigstens das Rührei versuchen. Schauen Sie nur, wie gut es aussieht.«
Devon bedachte die mit Paprika vermengte gelbe Masse mit einem flüchtigen Blick und wandte sich ab. »Es sieht sehr gut aus.«
»Aber Sie wollen keins.«
»Heute morgen nicht.«
»Schade, Mrs. Osborne, dann muß ich alles selber aufessen.«
Dulzura war eine von Estivars sogenannten Kusinen. Er hatte deren in rauhen Mengen. Wenn sie Englisch konnten, behauptete er, sie gehörten zu dem in San Diego oder Los Angeles ansässigen Zweig der Familie; sprachen sie nur Spanisch, gehörten sie zu dem Zweig in Sonora oder {12}Sinaloa oder Jalisco oder Chihuahua, welches Wort ihm gerade am besten gefiel. Zu den Zeiten, wo am meisten Arbeitskräfte benötigt wurden, zogen Estivars Kusinen wie Besatzungstruppen in das Tal ein. Sie bepflanzten, beackerten und bewässerten es; sie pflückten, sortierten und verpackten. Dann waren sie auf einmal wieder verschwunden, als ob der solchermaßen ausgebeutete Boden die Arbeiterinnen wie Dünger verschluckt hätte.
Dulzura kratzte die Eier aus der Pfanne in einen Suppenteller. »Seine Mutter am Telefon – sie sagte, ich solle Strümpfe anziehen. Dabei habe ich doch nur das Paar, das ich mir für die Hochzeit meines Bruders aufhebe.«
»Sie können sie doch sicher mehr als einmal tragen.«
»Nicht, wenn ich zum Schwören hinknien muß.«
»Niemand kniet in einem Gerichtssaal.« Devon war zwar noch nie in einem Gerichtssaal gewesen, wollte sich aber keine Blöße geben. »Die Frauen werden Strümpfe anhaben und alle Männer Jacke und Krawatte.«
»Selbst Estivar und Mr. Bishop?«
»Gewiß.«
Das Telefon begann wieder zu klingeln, und Devon begab sich durch den Flur ins Studierzimmer, wo sich ein zweiter Anschluß befand.
Das Studierzimmer hatte Robert sich eingerichtet. Wie den Wagen in der Garage hatte man es lange unangetastet gelassen. Es gab Devon jedesmal einen Stich, wenn sie nur an der geschlossenen Tür vorbeimußte. Jetzt sah das Zimmer anders aus. Sobald dieser Termin einmal feststand, hatte Devon angefangen, Roberts Sachen in Pappschachteln zu verpacken, um diese auf dem Estrich {13}unterzubringen – seine Tennisschläger und die Preise, die er gewonnen hatte, seine Silbermünzensammlung, die Landkarten der Gegenden, wo er hatte hinreisen wollen, die Bücher, die er zu lesen gedachte.
Devon waren bei dieser Beschäftigung die Tränen übers Gesicht gelaufen, so sehr, daß auch Dulzura in Tränen ausbrach, bis sie wie zwei irische Klageweiber drauflosheulten. Nachdem sie sich ausgeweint hatten und Devon aus ihren verquollenen Augen wieder sehen konnte, nahm sie einen Filzstift und schrieb mit Großbuchstaben HEILSARMEE auf die Schachteln. Estivar war eben daran, die letzten auf den Flur hinauszutragen, als Roberts Mutter unversehens, wie das gelegentlich vorkam, aus der Stadt eintraf.
Devon gewärtigte, Vorhaltungen wegen der Schachteln zu hören; statt dessen anerbot sich Mrs. Osborne ruhig, die Schachteln selber der Heilsarmee zu überbringen. Sie war Estivar sogar dabei behilflich, sie im Kofferraum und auf dem Rücksitz ihres Wagens zu verstauen. Einen halben Kopf größer als Estivar und fast ebenso kräftig, ging sie ihm tüchtig zur Hand, ohne ein Wort zu verlieren, als hätten sie dergleichen schon oft miteinander erledigt. Sie saß bereits am Steuer, zur Abfahrt bereit, als sie sich nach Devon umwandte und in ihrem sanften, aber doch bestimmten Ton sagte: »Robert hatte immer vor, sein Studierzimmer aufzuräumen. Er wird sich freuen, daß wir ihm die Mühe abgenommen haben.«
Devon zog die Studierzimmertür zu und nahm den Hörer ab. »Ja?«
»Warum hast du mich nicht angerufen, Devon?«
»Es eilte ja nicht; es ist noch früh.«
{14}»Wem sagst du das. Ich habe die ganze Nacht auf die Uhr geschaut.«
»Schade, daß du nicht schlafen konntest.«
»Ich wollte gar nicht«, erklärte Mrs. Osborne. »Ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen, ob das richtig ist, was wir vorhaben.«
»Es muß geschehen. Ford und die andern Rechtsanwälte haben es dir doch gesagt.«
»Man muß nicht unbedingt alles glauben, was einem gesagt wird.«
»Ford hat doch Erfahrung in solchen Sachen.«
»In juristischen, gewiß. Doch was Robert anbetrifft, habe ich die Erfahrung. Was du heute vorhast, ist falsch. Du hättest dich weigern sollen, den Antrag zu unterzeichnen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Du könntest Ford anrufen und ihm sagen, er solle den Termin verschieben, du möchtest noch Bedenkzeit.«
»Ich habe ein ganzes Jahr Bedenkzeit gehabt. Nichts hat sich geändert.«
»Es könnte aber doch etwas eintreten, was die Sache ändert. Jeden Tag könnte das Telefon läuten, oder es könnte an die Tür klopfen, und da steht er dann, ganz wie früher. Vielleicht ist er entführt worden und sitzt irgendwo jenseits der Grenze in Gewahrsam. Oder er hat seinerzeit einen Schlag auf den Kopf erhalten und leidet seither an Gedächtnisschwund. Oder –«
Devon hielt den Hörer vom Ohr weg. Sie wollte nichts mehr wissen von all den Möglichkeiten, die sich Mrs. Osborne in langen Nächten ausgedacht und im Laufe der Tage in allen Einzelheiten ausgemalt hatte.
{15}»Devon? Devon.« Es war beinahe ein gellender Schrei, jedenfalls soweit sich Mrs. Osborne, wenn sie nicht allein war, einen solchen gestattete. »Hörst du eigentlich zu?«
»Die Sitzung ist auf heute anberaumt. Ich kann das nicht rückgängig machen und würde es auch nicht tun, selbst wenn es möglich wäre.«
»Wenn nun aber –«
»Es wird kein Klopfen an der Tür geben, und kein Telefon wird klingeln. Es wird überhaupt nichts mehr geben.«
»Das ist grausam, Devon, grausam, die Hoffnung eines Menschen so zunichte zu machen.«
»Noch grausamer wäre es, dich in der Hoffnung auf etwas zu bestärken, das ganz und gar ausgeschlossen ist.«
»Ganz und gar ausgeschlossen? Das ist hart. Nicht einmal Ford sagt das so hart. Jeden Tag geschehen Wunder. Denk nur an die Organverpflanzungen, die überall vorgenommen werden. Stell dir vor, Robert wird aufgefunden, wie er im Sterben liegt, und man gibt sein Herz einem andern. Das wäre doch besser als gar nichts, wie? Sein Herz würde wenigstens weiterleben, nicht?«
Und so weiter, und so fort. Das ganze Jahr hindurch hatte Mrs. Osborne immer wieder dasselbe vorgebracht. Sie nahm sich schon gar nicht mehr die Mühe, es als etwas Neues auszugeben, indem sie da und dort ein anderes Wort brauchte.
Zwei Uhren an entgegengesetzten Enden des Hauses begannen zu schlagen: die Standuhr im Wohnzimmer, und in der Küche die Kuckucksuhr, die an der Wand über dem Herd hing. Dulzura behauptete, die Uhr sei ein Geschenk ihres Mannes, doch niemand glaubte ihr, daß sie je einen {16}hatte, geschweige denn einen, der ihr Geschenke machte. Die Standuhr gehörte Mrs. Osborne. Untendran war der Text eingeschnitzt, der mit ihrem Glockenspiel einherging:
Bedenk, o Mensch,
Die Zeit vergeht.
Nur der Glaube
An Gott besteht.
Als Mrs. Osborne in die Stadt zog, um das Haus auf der Ranch ihrem Sohn und seiner Frau zu überlassen, hatte sie ihren antiken Schreibtisch aus Kirschbaumholz, das Mahagoniklavier, das silberne Teeservice und ihre Sammlung englischen Porzellans mitgenommen, doch die Standuhr hatte sie stehenlassen. Sie glaubte nicht mehr an Gott und wollte nicht daran gemahnt werden, daß die Zeit vergeht.
Sieben Uhr.
Die Mexikaner kamen aus der Baracke und aus dem Schuppen, der als Kantine diente. Rasch und ohne Lärm stiegen sie auf den Lastwagen, der sie draußen auf dem Feld an den entsprechenden Orten absetzen sollte. Es gab in ihrem Leben nicht viel mehr als harte Arbeit und die Mahlzeiten, die diese Arbeit ermöglichten.
Die Mittagspause verbrachten sie auf den Bänken, die Estivars Söhne beim Reservoir aufgestellt hatten, und verzehrten dort im Schatten der Tamarisken ihr Essen. Um fünf Uhr gab es dann in der Kantine Tortillas und Bohnen, und um neun Uhr dreißig wurden in der Schlafbaracke die Lichter gelöscht. Die Zeit verging, Gott sei Dank.
Agnes Osborne redete immer noch. Als Devon wieder {17}hinhörte, hatte sich Mrs. Osborne inzwischen damit abgefunden, daß die Sitzung wie vorgesehen abgehalten werde, mit Beginn um zehn Uhr. »Es ist wohl am besten, wir treffen uns direkt im Gerichtssaal, da können wir uns nicht verpassen. Weißt du noch, welche Nummer?«
»Fünf.«
»Kommst du mit deinem eigenen Wagen?«
»Leo Bishop hat mich eingeladen, mit ihm zu fahren.«
»Und du hast zugesagt?«
»Gewiß.«
»Ruf lieber an und sag ihm, du hättest es dir anders überlegt. Das geht doch nicht, daß du mit Leo Bishop ins Gerede kommst, und ausgerechnet heute.«
»Es besteht kein Anlaß zu Gerede.«
»Wenn du zu aufgeregt bist, um selber zu fahren, komm doch mit Estivar im Kastenwagen. Ach ja, sieh zu, daß Dulzura Strümpfe trägt, nicht?«
»Warum? Dulzura steht doch nicht vor Gericht. Es wird nicht über uns Gericht gehalten.«
»Tu nicht so naiv«, sagte Mrs. Osborne schroff. »Selbstverständlich wird über uns Gericht gehalten, über uns alle. Ford hat die Sache natürlich nicht an die große Glocke gehängt, aber es mußten Zeugen vorgeladen werden, mit bestimmter Angabe von Ort und Zeit der Verhandlung, es konnte also kein Geheimnis bleiben. Ein Dokument unterschreiben ist eines, aber etwas ganz anderes ist es, vor Gericht aufzutreten und diese Schreckenstage in aller Öffentlichkeit nochmals zu erleben. Doch du hast es so gewollt, du bist schließlich Roberts Frau.«
»Nicht seine Frau«, sagte Devon, »ich bin seine Witwe.«
{18}2
Nur langsam kamen die beiden Autos auf dem Fahrweg vorwärts, wobei die Staubwolken hinter ihnen wie Rauchsignale emporstiegen.
Voran fuhr Estivar mit dem Kastenwagen. Der Mann war jetzt nahezu fünfzig, hatte aber immer noch dichtes, dunkles Haar, und aus einiger Entfernung wirkte sein behender, drahtiger Körper wie der eines Schuljungen. Er hatte sich in den einzigen Anzug gestürzt, den er besaß, einen dunkelblauen Gabardineanzug, den er sonst nur beim jährlichen Bankett der Landwirtevereinigung trug und zu Besprechungen mit der Einwanderungsbehörde, wenn von seinen Leuten welche wegen illegalen Grenzübertritts aufgegriffen worden waren.
Der blaue Anzug, von dem er hoffte, er verleihe ihm ein gediegenes, einwandfreies Aussehen, verriet lediglich, daß es ihm bei dieser neuesten Wendung der Dinge nicht ganz wohl war in seiner Haut. Eine amtliche Bestätigung von Robert Osbornes Tod sollte seiner Meinung nach nicht vor Gericht, sondern in der Kirche stattfinden, mit salbungsvollen Worten der Andacht, gesprochen von fahlgesichtigen Priestern.
Estivar hatte seine Frau, Ysobel, mitgenommen, um innerlich einen Halt zu haben, und weil sie ohnehin nicht {19}hatte zu Hause bleiben wollen. Sie war eine mestiza, ein Halbblut, mit den hervorstehenden, bronzefarbenen Backenknochen und dem leeren Blick der Indianerfrauen, dem doch nichts entgeht. Bolzengerade saß sie da, ohne sich durch die holperige Fahrt im geringsten aus der Haltung bringen zu lassen.
Hinter Ysobel saß Dulzura seitwärts auf ihrem Platz, die Beine steif ausgestreckt, damit ihre Strümpfe am Knie nicht ausgebeult würden. Sie trug ein riesiges Kleid, auf dem winzige Pferdchen den Saum entlang und über die Taschen galoppierten. Dieses Kleid hatte sie für einen Wochenendausflug zu den Rennen in Agua Caliente gekauft, war aber von dem jungen Mann, der sie eingeladen hatte, versetzt worden. Was sie dabei erbitterte, war lediglich der Gedanke an das Geld, das sie möglicherweise gewonnen hätte.
»Fünfhundert Pesos vielleicht«, sagte sie laut vor sich hin. »Das sind vierzig Dollar.«
Neben Dulzura saß Lum Wing, ein älterer Chinese, der für die Arbeiter kochte, jedoch nicht mit ihnen verkehrte. Er traf bloß gleichzeitig ein, mit einem Handkoffer, in dem sich seine Kleidung befand, und einem Kästchen, das seine Messer, den Schleifstein und ein Schachspiel enthielt; und wenn die Arbeiter abreisten, reiste auch er wieder ab, allerdings nicht mit ihnen zusammen oder auch nur in derselben Richtung, wenn es sich vermeiden ließ.
Lum Wing lutschte am Stiel einer kalten Maiskolbenpfeife und fragte sich, was man eigentlich von ihm wollte. Ein Uniformierter hatte ihm einen Zettel überreicht und ihm eingeschärft, er solle ja nicht versäumen, sich {20}einzufinden, sonst könne er etwas erleben. Beim Gedanken an gewisse Vorkommnisse, von denen er wohl allein wußte, schwante ihm, er werde vermutlich im Gefängnis landen. Und wenn ein guter Koch im Gefängnis landete, hatte niemand es eilig, ihn zu entlassen, soviel war ihm aus Erfahrung bekannt. Verängstigt, wie er war, hatte er den ganzen Morgen Luft geschluckt, die ihm von Zeit zu Zeit laut aufstieß.
Ysobel wandte sich auf spanisch an ihren Mann. »Sag ihm doch, er soll dieses widerliche Rülpsen unterlassen.«
»Da kann er nichts für.«
»Glaubst du, ihm fehlt was?«
»Nein.«
»Mir kommt er heute gelber vor als sonst. Vielleicht ist es was Ansteckendes. Mir ist auch nicht ganz gut.«
»Mir auch nicht«, bemerkte Dulzura. »Ich finde, wir sollten in Boca de Rio haltmachen und etwas Stärkendes zu uns nehmen.«
»Das kennt man«, bemerkte Ysobel, »was die unter etwas Stärkendem versteht. Kaffee bestimmt nicht. Das wär ja noch schöner, wenn wir mit einer Betrunkenen im Gericht angetrudelt kämen.«
Estivar trat scharf auf die Bremse und schnauzte die beiden an, den Schnabel zu halten, worauf die Fahrt eine Zeitlang still verlief: an süß duftenden Zitronenpflanzungen vorbei, den Stoppelfeldern, wo der Futterklee gemäht worden war, dem Acker, wo Jaime, Estivars Jüngster, Kürbisse gezogen hatte, um sie in Boca de Rio abzusetzen; man verfertigte dort Laternen daraus für den Abend vor Allerheiligen oder verwendete sie zu Fruchtkuchen.
{21}Jaime war vierzehn. Gegenwärtig lag er hinten im Kastenwagen auf dem Bauch, kaute am rechten Daumennagel und fragte sich, ob seine Mitschüler wohl wüßten, wohin er unterwegs war und was ihm bevorstand. Vielleicht waren sie bereits dabei, es aufzubauschen, und wähnten womöglich, er stehe auf seiten der Polizei. Dergleichen konnte ihn sein Leben lang in Verruf bringen.
Die Kürbisse hatten ihm das eingebrockt. In der letzten Oktoberwoche hatte er einige in der Schule abgegeben, für das Schulfest, und die übrigen hatte er einem Lebensmittelhändler in Boca de Rio geliefert. Am Samstag darauf hatte ihm sein Vater aufgetragen, mit einem der kleinen Traktoren die Stauden unter den Boden zu pflügen. Dabei war in der Südostecke des Ackers das Taschenmesser zum Vorschein gekommen. Es war ein elegantes kleines Messer mit einem doppelten Handgriff, der sich wie Schmetterlingsflügel auseinanderklappen ließ, worauf dazwischen die Klinge hervorkam. Ein Freund von Jaime besaß ein solches Schmetterlingsmesser. Wenn man den Dreh raushatte und fleißig übte, konnte man es fast so schnell zücken wie ein Stellmesser, das aber verboten war.
Jaime freute sich über seinen Fund, bis ihm das braun verkrustete Scharnier auffiel. Da legte er das Messer sorgfältig wieder hin, wischte sich die Hände an den Hosen ab und machte seinem Vater Meldung.
Südlich von Boca de Rio mündete die Landstraße in die Chaussee ein, die San Diego und Tijuana verbindet. Die beiden Städte, für Auge und Ohr so unähnlich, waren geographisch und wirtschaftlich miteinander verbunden, zwei {22}Stiefschwestern vergleichbar, die unter demselben Dach wohnen müssen, obwohl sie wenig miteinander gemein haben.
In kürzester Frist kam Estivar mit seinem Kastenwagen im dichten Verkehr außer Sicht, zumal Leo Bishop in der langsamen Spur folgte. Er hielt das Lenkrad mit beiden Händen so fest umklammert, daß die Knöchel fast aus der Haut traten. Ein großer, schlaksiger Mann Anfang Vierzig, hatte er etwas Verstörtes und Geknicktes an sich, als werde alles, was er sich an Lebensregeln angeeignet hatte, eins nach dem andern auf den Kopf gestellt.
Während es bei Dulzura die Fettpolster waren, die sie älter erscheinen ließen, wirkte Leo älter, weil er jahrelang Wind und Wetter ausgesetzt gewesen war. Seine roten Haare waren gebleicht und nur noch sandfarben, über die Backenknochen und den Nasenrücken hin zogen sich Narben vom Sonnenbrand. Er hatte hellgrüne Augen, die er zusammenkniff, um sie vor dem Licht zu schützen, so daß dann, wenn er in den Schatten trat und die Gesichtsmuskeln sich entspannten, in den Augenwinkeln feine weiße Krakeln erschienen, wo die ultravioletten Strahlen nicht hingekommen waren. Diese Krakeln verliehen seinem Gesichtsausdruck etwas Verkniffenes, so daß es Mexikaner gab, die leise von mal ojo, dem bösen Blick, und azar, Unheil, sprachen.
Nachdem seine Frau im Fluß ertrunken war, wurde noch mehr über ihn gemunkelt, er hatte Scherereien mit den Arbeitern, Maschinen erlitten Pannen, Frost vernichtete die Grapefruitblüte und zog die Dattelpalmen in Mitleidenschaft … mal ojo … demonios del muerte. Er hatte {23}Estivar im Verdacht, die Leute in ihrem Aberglauben zu bestärken, erwähnte aber Devon gegenüber nie etwas davon.
»Devon.«
»Ja?«
»Du hast es bald hinter dir.«
Sie schien nicht ganz überzeugt. »Wie spät ist es?«
»Zehn nach neun.«
»Ford meinte, heute werde noch nichts entschieden. Selbst wenn er es schafft, alle Zeugen zu befragen, dauert es immer noch eine Weile, bis der Richter das Material gesichtet hat und das Urteil fällt. Vielleicht noch eine ganze Woche. Es kommt darauf an, wieviel er sonst noch zu tun hat.«
»Deine Rolle dabei hast du dann jedenfalls hinter dir.«
Sie wußte nicht genau, welche Rolle ihr zugedacht war. Der Rechtsanwalt hatte sie angewiesen, nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch von sich aus Auskunft zu geben, wann immer es ihr tunlich scheine – persönliche Einzelheiten ihres Zusammenlebens mit Robert, die geeignet wären, zu zeigen, was für ein Mensch er gewesen war. »Damit man sich ein Bild von ihm machen kann, wie er leibt und lebt«, hatte Ford gesagt. Er hatte sich der unpassenden Ausdrucksweise wegen nicht entschuldigt, offenbar wollte er sie auf die Probe stellen, um zu sehen, ob sie vor Gericht die Fassung bewahren werde.
Die Straße war westwärts auf die Bucht von San Diego zu abgebogen. Gemächlich zogen Segelboote wie große Kohlweißlinge über die Wasserfläche. Dazwischen lag ein schmaler Sandstrand, feucht vom auflaufenden Wasser und von der Sonne überglitzert.
{24}»Laß mich lieber ein Stück vor dem Gerichtsgebäude aussteigen«, sagte Devon. »Mrs. Osborne findet, man sollte uns nicht zusammen sehen.«
»Warum nicht?«
»Es könnte Gerede geben.«
»Macht das etwas aus?«
»Ihr schon.«
Eine Weile fuhren sie dahin, ohne etwas zu sagen. In der Bucht wurden die Segelboote von Kriegsschiffen abgelöst, die Kohlweißlinge von stahlgrauen Wasserkäfern mit grimmigen Fühlern und befremdlichen Aufbauten.
»Wenn du das einmal hinter dir hast«, sagte Leo, »brauchst du dich nicht mehr so sehr um Agnes Osbornes Meinung zu kümmern. Sie ist dann nur noch deine ehemalige Schwiegermutter. Morgen, übermorgen, nächste Woche bist du wieder selbständig.«
Leise wiederholte sie das Wort, und es gefiel ihr. ›Witwe‹ tönte nach Verlust und Kummer; ›selbständig‹ dagegen wies auf die Zukunft hin. »Und was tut man, wenn man selbständig ist, Leo?« fragte sie.
»Man trifft Entscheidungen.«
Für Devon war es ein Jahr ohne Entscheidungen gewesen, ein Jahr, wo alles von andern für sie entschieden wurde. Sie hatte die Rechnungen beglichen, die Estivar ihr vorlegte, die Dokumente mit ihrem Namenszug versehen, die Ford, ihr Rechtsanwalt, ihr unterbreitete, die Fragen beantwortet, die ihr von Valenzuela, dem Polizisten, gestellt wurden, sie hatte gegessen, was Dulzura hinstellte, hatte angezogen, was Agnes Osborne für gut befand.
Bald hatte sie nun das Jahr endgültig hinter sich und {25}konnte wieder selbst Entschlüsse fassen. Dann wollte sie nichts mehr wissen von braunen Kammgarnkostümen und von chorizo mit Rührei, unter Paprika begraben; Valenzuela war gar nicht mehr bei der Polizei; wenn die Erbschaftssache erledigt war, brauchte sie Ford nicht mehr; vielleicht verkaufte sie die Ranch, und dann gehörte auch Estivar der Vergangenheit an.
Ysobel beugte sich nach vorn, um den Tacho ins Auge zu fassen. »Wir machen also ein Rennen mit«, sagte sie schnippisch. »Das ist mir neu, daß auf der Chaussee Rennen abgehalten werden.«
»Höchstgeschwindigkeit ist hundert«, erklärte Estivar. »Ich muß mich nach dem übrigen Verkehr richten.«
»Man könnte meinen, wir seien unterwegs zu einem Fest, so eilig, wie du es hast. Mr. Bishop fährt vernünftiger. Er ist kilometerweit hinter uns zurück, und weshalb eigentlich nicht? Schließlich winkt uns kein Preis am Ziel.«
Estivar, bisher in verdrießlicher Stimmung, lachte plötzlich laut auf. »Da könntest du dich getäuscht haben.«
»Pst! Wir sind nicht allein.«
Ihre Besorgnis galt nicht Jaime, der zumeist überhaupt nichts zu hören schien, auch nicht Lum Wing, dessen Spanischkenntnisse ihres Wissens aus ein paar unflätigen Wörtern und einigen selten verwendeten Floskeln wie buenos días bestanden.
»Paß auf, was du sagst, wenn Dulzura zugegen ist«, setzte Ysobel hinzu. »Sie ist von Natur aus eine Quasselstrippe.«
Dulzura sperrte vor Verwunderung Mund und Nase auf. {26}Sie war gar keine Quasselstrippe, weder von Natur aus noch sonstwie. Wem hätte sie denn an einem so gottverlassenen Ort etwas anvertrauen sollen, was die Betreffenden nicht bereits wußten? Sie fragte sich, was das für ein Preis sein könnte, der Mr. Bishop winkte, wieviel er betrug, und ob sie wohl die junge Mrs. Osborne danach fragen sollte.
»Die kleine Señora«, sagte Ysobel noch leiser. »Ist das der Preis, den du meinst?«
»Was denn sonst?«
»Sie würde ihn nie heiraten. Er ist zu alt.«
»Gerade überschwemmt mit Anträgen wird sie nicht.«
»Noch nicht. Rechtlich ist sie noch eine verheiratete Frau, und gebildete Leute sind da sehr vorsichtig. Warte bloß, von morgen an stehen die Männer Schlange um sie, und zwar junge Männer. Aber sie wird sich nichts daraus machen. Sie wird die Ranch verkaufen und wieder in die Stadt ziehen.«
»Woher willst du das wissen?«
»Ich habe gestern nacht davon geträumt. Farbig. Als ich bei der Wahrsagerin in Boca de Rio war, sagte sie mir, ich solle besonders auf die farbigen Träume achten, die guten und die bösen, die erfüllten sich immer … Hast du auch schon farbig geträumt, Estivar?«
»Nein.«
»Ach, ist ja egal. Die kleine Señora wird jedenfalls die Ranch verkaufen und in ihre Heimat zurückkehren.«
»Und ich?«
»Der neue Besitzer wird sich glücklich schätzen, einen Gutsverwalter mit fünfundzwanzigjähriger Erfahrung übernehmen zu können.«
{27}»Kam das auch in deinem Traum vor, das mit dem neuen Besitzer?«