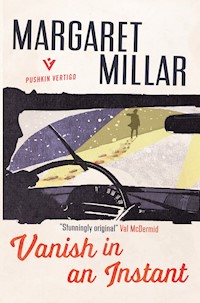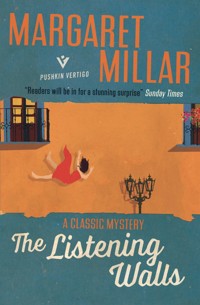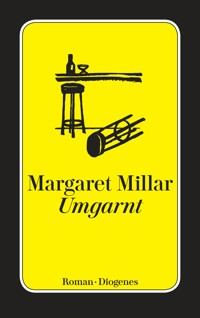7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein unscheinbares Päckchen, von einem Unbekannten abgegeben, schreckt Lucille, die glückliche zweite Frau des Arztes Andrew Morrow, aus ihrer zufriedenen Existenz. Was hat das Päckchen mit dem blutigen Mord an Andrews erster Frau zu tun? Mit unerbittlicher Akribie zerpflückt Margaret Millar familiäre Harmonie und Nächstenliebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Das eiserne Tor
Roman
Aus dem Amerikanischen von Karin Reese und Michel Bodmer
Diogenes
{5}Für Frances MacNaugthon
{7}I Die Jagd
{9}1
Der Traum begann ganz still. Sie und Mildred waren zusammen in einem Zimmer, Mildred hatte sich in einen Sessel gekuschelt und schrieb.
»Was schreibst du da, Mildred?« sagte Lucille. »Du schreibst doch, was schreibst du?«
Langsam, verträumt lächelte Mildred, »nichts, ich bin schon fertig, ich bin schon ganz fertig damit«, und sie erhob sich und spazierte durch das Fenster hinaus in den Schnee.
»Du darfst nicht einfach so im Kleid hinauslaufen, Mildred, du wirst dich erkälten.«
»Nein … Ich gehe fort … ich bin ganz fertig damit …«
»Nein, es ist dunkel, es schneit.«
Aber sie setzte ihren Weg fort, unbeirrt, ohne eine Spur zu hinterlassen, ohne einen Schatten zu werfen.
»Mildred, komm zurück! Dein Hinterkopf ist offen.«
»Nein …«
»Du blutest. Du wirst den Park beschmutzen.«
»Ich gehe fort«, kam Mildreds Stimme sanft zurück. »Lebe wohl, Liebste. Lebe wohl, Lucille.«
Sie ging weiter, zwischen den Bäumen hindurch und über die Hügel hinweg. Mit jedem Schritt wurde sie kleiner und kleiner und zugleich deutlicher, als besäßen weder Raum noch Zeit die Macht, ihre Züge zu verwischen. {10}Hin und wieder drehte sie sich um, und immer lächelte sie wie eine kleine Puppe.
»Kleine Puppe!« schrie Lucille. »Kleine Puppe …«
»Fort«, kam die Antwort, kaum mehr als ein Hauch und dennoch so klar. »Lebe wohl – lebe wohl, Liebste …«
In alle Ewigkeit ging sie und blutete und lächelte und wurde deutlicher und deutlicher.
Lucille wachte auf, dem Ersticken nahe, und würgte an dem Grauen vor dem kleinen Ding, das – nicht größer als ein Finger, ein Zündholz, eine Nadel – ihr durch den Kopf schritt.
Sie sprang aus dem Bett und riß die Vorhänge von den Fenstern zurück. Sie schaute hinaus – ja, da war der Park, da waren die Bäume, die Hügel, der spurenlose Schnee. Aber Mildred war seit sechzehn Jahren tot.
Irgendwo in der Ferne läutete eine Kirchenglocke den Sonntagsklang einer Stadt ein. Ihr wurde plötzlich bewußt, wie grotesk es wäre, wenn Andrew hereinkäme und sie gerade so, beim Fenster kauernd, den Schnee nach seiner toten Frau absuchte.
Sie stand auf, wandte sich um und sah sich unverhofft im Spiegel. Sie hatte vergessen, daß der Spiegel da stand, und ganz kurz – ehe sie Zeit fand, eine gefaßte Miene aufzusetzen – schien sie eine Fremde, eine Dame im Spiegel, die nicht mehr jung war, einen blauen Morgenrock trug und ihr volles, rotgoldenes Haar zu zwei dicken Zöpfen geflochten hatte, die zu beiden Seiten ihres Kopfes auf die Schultern herabfielen. Sie hielt inne, um die Fremde eingehender zu betrachten, lächelte schwach, weil es nur ein Spiel war, zugleich ziemlich unsicher, {11}weil, wie Andrew zu sagen pflegte, ein Spiel nie bloß ein Spiel war, irgendein Motiv mußte dahinterstecken.
Vielleicht fühlte sie sich selbst jetzt nach fünfzehn Jahren in diesem Haus noch immer wie eine Fremde, die den Mann einer anderen besuchte, die Kinder einer anderen.
»Ach, Unsinn«, sagte sie laut. Sie trat an den Spiegel heran, die Fremde rührte sich, wuchs und wurde mit ihr selbst identisch. »Kompletter Unsinn!«
Sie sprach in dem Ton, den sie Andrew und den Kindern gegenüber anzuschlagen pflegte, halb ernst, halb spielerisch, aber voll tiefen Verständnisses. Die Trotz-Lächeln-mein-voller-Ernst-Stimme. Ihr Klang war so vertraut, daß automatisch die dazugehörige Miene von ihrem Gesicht Besitz ergriff. Ihre Augen verloren den angestrengten, ängstlichen Blick und wurden wohlwollend und intelligent, ihr voller, gespannter Mund löste sich und eine Augenbraue hob sich ein wenig.
Na also. So bin ich eigentlich. Ich, Lucille Morrow.
Mildred war nicht mehr wichtig, obschon im Wohnzimmer immer noch ein Porträt von ihr hing und sie sich zuweilen in Lucilles Träume einschlich. Eine dicke Puppe aus fetter Seife, dachte Lucille. Etwas Zähes und Teigiges, das einem an den Händen klebenbleibt …
Sie nahm eine Bürste und begann, ihr Haar kräftig durchzubürsten. Mit jedem Zug verblaßte der Traum, verschwamm die Puppe und schmolz.
Die augenblickliche Unsicherheit war überstanden, und was blieb, war ein bewußteres Gefühl des Besitzens. Dies war ihre Hand, ihre Bürste, ihr Haus, ihr Mann, der im Nebenzimmer ein Liedchen pfiff. Nur die Kinder würden immer Mildreds Kinder bleiben. Andrew zuliebe hatte Lucille sich bemüht, sie gern zu haben und zu {12}erreichen, daß die Kinder sie mochten. Trotzdem blieben sie Mildreds Kinder – sie wurde mit ihnen nie so recht warm und war schon froh, wenn sie es zu einer Art Waffenstillstand gebracht hatte.
Aber sie waren ja keine Kinder mehr. Polly wollte diese Woche heiraten. Eines Tages würde auch Martin heiraten, und dann würden sie und Andrew allein im Haus zurückbleiben. Mit Edith natürlich, aber die zählte nicht.
Ihre Hand stockte. Sie hatte das Gefühl, jenseits des Spiegels ihre Zukunft liegen zu sehen – ein weit ausgerollter roter Samtteppich, über dem sich ein Baldachin wölbte.
Sie kleidete sich rasch an und flocht aus ihrem Haar eine Krone um ihren Kopf. Wie eine Königin trat sie hinaus in die Diele, stolz, aber vorsichtig, als müßte sie erst den roten Samtteppich prüfen und die Höhe des Baldachins messen. Sie schritt die Treppe hinunter und genoß das Rascheln ihres Taftmorgenrocks, das ihr mit der geräuschvollen Lautlosigkeit eines ergebenen Kammerdieners folgte.
Oben schlug eine Tür zu, und durch das Treppenhaus schallte Andrews Stimme: »Lucille! Warte mal eben, Lucille!«
Sie blieb auf dem unteren Treppenabsatz stehen.
»Was ist, Andrew?«
»Wo ist mein Schal hingekommen?«
Lucille schluckte ein impulsives »Was für ein Schal« herunter. Sie sagte: »Deine sämtlichen Schals liegen in deiner Kommode.«
»Alle außer dem, den ich tragen will.«
»Natürlich!«
»Was hast du gesagt?«
{13}Lucille schrie beinahe. »Ich sagte, natürlich, der, den du tragen willst, ist der, der nicht da ist.«
»Es ist genau umgekehrt«, rief Andrew. »Der, den ich tragen will, ist der …«
»Schon gut«, sagte Lucille lächelnd. »Wie sieht er aus?«
»Blau. Dunkelblau mit kleinen grauen Dingern drauf.« Er erschien oben an der Treppe und gestikulierte. »Du weißt schon, so kleine graue Dinger.«
Er war ein großer, schlanker grauhaariger Mann in den Endvierzigern und hatte dieselben flinken, lebhaften Bewegungen, die auch seine Schwester Edith und seinen Sohn Martin auszeichneten. Sein Gesicht war schmal, beinahe zart, aber er hatte große, warme, braune Augen, die seinem Gesicht etwas Wehrloses gaben und ihm gelegentlich Schwierigkeiten mit seinen weiblichen Patienten bereiteten. Wie so viele wirklich gutmütige Männer übertrieb auch er, wenn er zornig wirken wollte. Er warf seiner Frau einen stockfinsteren Blick hinunter.
»Den hat mir voriges Jahr irgend jemand zu Weihnachten geschenkt«, sagte er.
»Nämlich ich«, konterte Lucille heiter. »Und er ist nicht blau, sondern schwarz. Hast du unterm Bett nachgesehen?«
»Ja.«
»Was soll das, Andrew? Warum mußt du immer erst unter die Betten schauen, wenn du irgend etwas suchst?«
»Das ist doch logisch. All der Platz unter den Betten. Lucille, komm doch mal eben rauf und …«
»Nein«, sagte Lucille, »wenn ich raufkomme und ihn finde, wirst du nur noch wütender.«
»Ich verspreche, daß ich es nicht werde.«
»Nein.« Sie drehte sich gelassen wieder um, schritt {14}weiter und warf ihm über die Schulter noch zu: »Versuch’s im Zedernschrank im Flur.«
Ohne Andrews laute Mißfallenskundgebungen weiter zu beachten, ging sie ins Speisezimmer.
Edith und Polly saßen schon beim Frühstück. Mit den raschen verächtlichen Bewegungen eines Menschen, der jede Art von Nahrungsaufnahme als ein notwendiges Übel betrachtet, das man so schnell wie möglich hinter sich bringen muß, bestrich Edith eben einen Toast mit Butter. Polly hatte eine Tasse Kaffee vor sich stehen, rauchte und schaute gedankenverloren aus dem Fenster.
»Guten Morgen, Edith«, sagte Lucille. Sie beugte sich über Ediths Stuhl, und die Wangen der beiden Frauen berührten sich kurz. Das war ein langjähriger Brauch. Sie mochten einander auf eine trockene, zweckmäßige Art, denn sie hatten dasselbe Alter und interessierten sich für dieselbe Sache, Andrew.
»Guten Morgen, Polly.«
»Morgen«, sagte Polly, ohne ihren Blick vom Fenster zu wenden.
»Guten Morgen«, sagte Edith. »Gut geschlafen?«
»Bestens.«
»Kann ich von mir nicht behaupten.« Ihre Stimme war so hoch und schrill, daß man ständig befürchten mußte, sie werde im nächsten Augenblick in schiere Hysterie überschlagen oder wie eine Violinensaite mit einem Todeslaut zerspringen. Lucille hatte den Eindruck, als klettere die Stimme von Jahr zu Jahr höher, als werde die Saite immer straffer gespannt, so daß am Ende selbst die alltäglichste Bemerkung mit einem dünnen, gefährlichen Obligato dargebracht wurde.
»Was schreit ihr denn da herum?« sagte Edith. »Wenn {15}du frischen Toast willst, brauchst du nur zu klingeln. Annie hat noch welchen in der Küche. Manchmal habe ich das Gefühl, als brülle Andrew nur, weil es ihm Spaß macht.«
Lucille setzte sich, lächelte und entfaltete ihre Serviette. »Mag sein.«
»In der Klinik trieft er vor stillem Charme. Kaum ist er zu Hause, fängt er an zu jaulen, genau, richtig jaulen tut er.«
»Es geht um irgendeinen Schal, den er nicht finden kann«, sagte Lucille.
Sie fühlte sich plötzlich seltsam glücklich und zufrieden. Sie hätte am liebsten laut herausgelacht, es kitzelte sie förmlich in der Kehle, und sie mußte es herunterschlucken. Sie konnte Edith oder Polly nicht erklären, daß ihr nach Lachen zumute war, weil dieser Raum warm war und hell, weil es draußen angefangen hatte zu schneien, weil Andrew irgend etwas nicht finden konnte und unter dem Bett gesucht hatte …
Sie betrachtete Edith und Polly und liebte sie einen kurzen Augenblick lang von ganzem Herzen, weil sie mit sich selbst so zufrieden war und mit dem schönen stillen Leben, das sie sich aus dem Nichts geschaffen hatte. Ich liebe euch, ihr Guten, ihr Lieben, ich kann mir leisten, euch zu lieben, weil ich alles habe, was ich brauche, und weil ihr mir nichts davon fortnehmen könnt.
»Andrew findet nie, was er sucht«, sagte Edith. »Und wenn er mit der Nase davorsteht, sieht er es immer noch nicht. Wahrscheinlich ist das bei ihm psychologisch.«
In Polly regte sich etwas. »Was ist?« sagte sie. »Du willst doch nicht behaupten …«
»Sachen finden«, sagte Edith. »Freud hätte {16}wahrscheinlich gesagt, daß man nur das findet, was man auch wirklich sucht. Manche Menschen haben ein beneidenswertes Talent, Geld zu finden. Da gibt’s jemanden in New York … Polly, wenn du die Güte hättest, dich anständig hinzusetzen.«
»Wozu?« sagte Polly.
»Du flegelst dich da herum, als hättest du eine Rückgratverkrümmung.«
»Ich flegle mich nicht herum, ich bin entspannt.«
»Bei Tisch hat man sich nicht zu entspannen.«
»Okay«, sagte Polly ohne Groll und rappelte sich hoch. Einen Augenblick lang saß sie aufrecht da, dann stützte sie die Ellbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hände. Ihr langes, schwarzes Haar schlang sich seidig um ihre Handgelenke.
»Wirklich«, stöhnte Edith in liebevoller Verzweiflung.
Lucille schwieg. Die Zeiten, in denen sie sich noch um die Erziehung ihrer Stiefkinder bemüht hatte, waren längst vorbei, und wenn sie sich über eines von ihnen noch so sehr ärgerte, so besaß sie immer noch ausreichend Selbstdisziplin, sich eines Kommentars zu enthalten. Sie hatte immer versucht, gerecht zu sein, und wenn es zwischen Vater und Kindern zu Meinungsverschiedenheiten kam, hatte sie sich oft gezwungen, die Partei der Kinder zu ergreifen. Aber trotz all ihres Bemühens waren sie ihr gegenüber kühl und zurückhaltend geblieben.
Vielleicht liegt es nur daran, daß sie in einem schwierigen Alter waren, als ich Andrew heiratete, dachte Lucille. Polly war erst zehn und Martin zwölf, und sie hatten beide sehr an Mildred gehangen.
Mildred, dachte Lucille, und sie stellte fest, daß sich {17}das Lachen in ihrer Kehle aufgelöst hatte wie die Bläschen in abgestandenem Sprudel.
»Obwohl ich selbst mich nie entspanne«, sagte Edith, und ihr Rückgrat schien noch eine Idee steifer zu werden, »habe ich nichts dagegen, wenn andere einmal alle viere von sich strecken, aber alles zu seiner Zeit. Es kommt ganz auf den Charakter an, ob man sich das leisten kann oder nicht.«
»Mildred«, sagte Lucille, »Mildred hatte einen sehr entspannten Charakter.«
Sie hatte den Namen seit Jahren nicht mehr laut ausgesprochen, sie hatte ihn auch jetzt nicht aussprechen wollen, aber sie zwang sich dazu. Ihre kurze Seligkeit war verflogen, und es war, als hätte der Raum sie geblufft und verraten und als müsse sie jetzt aus Rache eine Leiche hineinschleudern.
»Ja, das hatte sie«, sagte Edith kurz. »Obwohl ich meine, daß ein Taktgefühl dir …«
»Ja, ich weiß«, sagte Lucille verwirrt; sie fühlte Pollys harten, kalten Bick auf sich ruhen. »Es tut mir sehr leid.«
»Ausgerechnet heute«, sagte Edith.
»Es tut mir leid, Edith.«
»Das will ich meinen. Heute wollen wir ja nun wirklich nicht an traurige Dinge erinnert werden. Schließlich wollen wir auf Mr. Frome einen guten Eindruck machen.«
»Leutnant Frome«, sagte Polly. »Und um den guten Eindruck brauchst du nicht besorgt zu sein. Den habe ich vor Wochen gemacht.«
»Trotzdem, Kind, wir sind immerhin deine Familie.«
»Er heiratet aber nicht dich.«
Edith errötete und sagte spitz: »Es ist mir durchaus bewußt, daß er nicht mich heiratet und daß das auch {18}sonst nie einer getan hat, falls du etwa darauf hinaus wolltest.«
»Bitte!« sagte Polly, erhob sich und drückte ihrer Tante einen schnellen Kuß auf die Wange. »Das hab’ ich nicht gemeint, du Dummerchen. Ich meine nur, ich kann kein Theater vertragen, und Giles auch nicht. Heute ist genauso ein Tag wie jeder andere. Giles würde im Erdboden versinken, wenn er das Gefühl hätte, irgend jemanden zu inkommodieren, indem er heute hierherkommt.«
»Dann ist er zu sensibel«, sagte Edith streng.
»Das weiß ich. Deshalb bin ich froh, daß er mich hat. Ich bin’s nicht.« Sie legte ihren Arm um die Schulter ihrer Tante und flüsterte ihr ins Ohr: »Ein Segen, daß ich nicht sensibel bin, wie hätte ich dein ewiges Kritteln sonst so lange ertragen können?«
»Kritteln?« Edith war sprachlos. »Wirklich, Polly! Als würde ich je so etwas Schäbiges tun wie kritteln!«
»Und ob du krittelst«, sagte Polly lachend. »Und Reden schwingst du!«
»I wo, nie! So eine Unverschämtheit …«
»Gib’s zu, gib’s zu, sonst kitzele ich dich.«
»Oh! Jetzt setz dich sofort hin und benimm dich!« Edith glättete ihre zerzausten Haare und Gefühle. »Du und deine Scherze. Du bist schlimmer als Martin. Als hätte ich je Reden geschwungen. Hab’ ich das, Lucille?«
»Nie«, sagte Lucille lächelnd.
»Siehst du, Polly!«
Aber sobald Lucille ins Gespräch gezogen wurde, schlug Pollys Stimmung um. Ihr Gesicht wurde ausdruckslos, kalt fixierten ihre Augen Lucille, und Lucille las darin: »Siehst du, wie gut wir hier ohne dich auskommen? So hast du uns seit Jahren alles verdorben.«
{19}»Ich halte nichts von großen Reden«, sagte Edith. »Meiner Meinung nach ist die Zunge ein stark überbewertetes Organ.«
»Nicht wahr?« sagte Polly abwesend und zog sich zum Fenster zurück. Ihre eckigen Schultern hoben sich scharf gegen das Licht ab.
Lucille sah zu ihr hinüber und staunte wieder, wie sehr Polly sich vom Rest der Familie unterschied. Sie hatte etwas Geballtes und Kompromißloses und Eigensinniges, das sich sogar in ihrem Körperbau ausdrückte. Sie war ziemlich klein, und obschon sie schlank war, hatte sie etwas Robustes und Zähes an sich. Sie vergeudete ihre Energie nicht unüberlegt und ziellos wie Martin und Edith. Sie bewegte sich mit einer Art träger Zweckmäßigkeit, machte fast alles gut und fühlte sich überall zu Hause.
Ihre Züge waren weich und rund wie die ihrer Mutter, und sie war, wie diese, im Grunde ihres Wesens ein friedlich in sich ruhender Mensch. Während häusliches Glück und materielle Sicherheit Mildreds innere Ruhe jedoch noch vertieft hatten, hatte sich Pollys Ruhe durch ihren jahrelangen unerbittlichen Haß gegen ihre Stiefmutter verzerrt und verhärtet.
Vielleicht wäre ich mit Martin allein glücklich geworden, dachte Lucille. Er ist ein Mann und umgänglicher. Aber Polly – Polly hatte schon als Zehnjährige einen vollkommen erwachsenen Eindruck gemacht. Sie hat mir mißtraut, wie eine erwachsene Frau einer anderen Frau mißtraut, deren Haus sie teilen muß.
Edith hatte ihren Kaffee ausgetrunken, und ihre langen, dünnen Finger trommelten ruhelos auf dem Tisch. Sie hatte eine Sache abgeschlossen, nämlich das Frühstück, {20}und mußte unverzüglich mit einer anderen anfangen. Ob die Tätigkeit ihre eigene war oder die eines anderen, spielte keine Rolle. Sie war immer in Betrieb und trieb andere an.
»Andrew soll sich ein bißchen beeilen«, sagte sie. »Martin kann ohnehin nie pünktlich sein. Ich glaube, ich geh’ am besten mal rauf und schau’, was da los ist.«
»Hat Zeit«, sagte Polly. »Giles’ Urlaub fängt offiziell erst heute mittag an, und mehr als eine Stunde brauchen wir nicht bis zum Camp.«
»Warum Andrew und Martin unbedingt mit dir rausfahren wollen, weiß ich auch nicht«, sagte Edith.
»Sie wollen ihn erst einmal in Augenschein nehmen«, sagte Polly, »und wenn er ihren Vorstellungen nicht entspricht, können sie die Leiche irgendwo loswerden und mich wieder nach Hause bringen, flennend, aber intakt.«
Edith versuchte entsetzt dreinzuschaun. »Ich bin sicher, daß Andrew nichts Derartiges im Sinn haben könnte.«
»Ich habe doch nur Spaß gemacht, Tantchen.«
»Merkwürdige Späße!«
»Aber was sie, glaube ich, hauptsächlich damit bezwecken, ist, mir Giles gegenüber durch eine Art männliche Solidarität das Rückgrat zu stärken. ›Keine Mätzchen, Frome, sonst …‹ ›Und daß du unsere kleine Polly gut behandelst‹ – in dem Stil.«
»Ich finde das eher rührend«, sagte Edith.
»Nicht wahr? Und vollkommen überflüssig. Sie wissen beide ganz genau, daß ich Giles – nachdem ich mich einmal für ihn entschieden habe – auch dann heiraten würde, wenn die ganze Welt unterginge.« Sie warf einen kurzen Blick zu Lucille hinüber.
{21}»Nur gut, wenn du weißt, was du willst«, sagte Lucille ruhig. »Man soll sich ohnehin nie in anderer Leute Ehen mischen.«
Das Mädchen errötete und wandte sich wieder ab.
»Von der ganzen Heiraterei wird überhaupt viel zuviel Aufsehen gemacht«, sagte Edith. »Als ich ein junges Mädchen war, habe ich natürlich auch meine Erfahrungen mit Mondenschein und Rosen gemacht, aber am Ende stellte sich fast immer heraus, daß die Rosen billige Kreppapierware aus dem Ausverkauf waren und der Mondenschein auch nicht mehr taugte als eine normale Straßenlaterne, nur daß man weniger sah.« Sie lächelte Pollys Rücken zärtlich zu. »Aber das ist dir wahrscheinlich nichts Neues.«
»Kaum«, sagte Polly. »Aber ich habe Kurzschlüsse. Giles ist mein schönster Kurzschluß.«
»Ich bin wirklich sehr gespannt auf ihn«, sagte Edith, und ihre Stimme klang gebrochen. »Kaum zu glauben, daß du schon eine heiratsfähige junge Dame bist. Dabei scheinst du gestern noch …«
»Daß du wegen mir sentimental wirst, hätte ich nie gedacht!«
»Ich und sentimental«, sagte Edith und schob mit einem energischen Ruck ihren Stuhl zurück. »So, und jetzt werde ich unserem guten Andrew Beine machen. Am Ende demontiert er das ganze Haus auf der Suche nach seinem albernen Schal.«
Sie verließ in einer Wolke von Wohlgerüchen und Seidengeraschel den Raum.
Allein mit ihrer Stiefmutter trat Polly wieder an den Tisch und schenkte sich noch einen Kaffee ein.
Weil Lucille sie verlegen machte, konzentrierte sie {22}ihren Blick auf die Gegenstände auf dem Frühstückstisch, prüfte und schätzte sie, als wäre sie an einer Auktion – die silberne Kaffeekanne, unter der ein Petroleumflämmchen brannte, die roten Tassen auf den weißen Tellerchen, die Reste von Ediths Frühstück, zwei Stück Toast, die im Toastständer lehnten, ein kahles und unerschütterliches gekochtes Ei in einem roten Schälchen und einen Zipfel von Lucilles blauem Morgenrockärmel.
»Wie schön, daß Giles Urlaub bekommen hat«, sagte Lucille höflich.
Polly schaute nicht auf. »Sehr schön, ja.«
»Drei Wochen, oder?«
»Ja.«
»Und am Freitag wollt ihr heiraten – noch fünf Tage.«
»Wir müssen noch auf die Papiere warten. Dann gehen wir aufs Standesamt, sehen, daß wir den ganzen Hokuspokus schnell hinter uns bringen, und weg sind wir.«
»Wo soll’s denn hingehen?«
Polly zog die Schultern hoch. »Irgendwohin. Das ist nicht wichtig.«
»Nein, wahrscheinlich nicht«, sagte Lucille, und dann schwiegen sie wieder.
Im Flur hörte man eilige Schritte und Gelächter, und ein paar Sekunden später kam Martin ins Speisezimmer geplatzt. Sein Haar war zerzaust und seine Krawatte noch nicht gebunden, aber er hatte die Selbstsicherheit und lächelnde Arroganz eines Mannes, der es früh und leicht zu etwas gebracht hat. Er hatte sich als Kind eine Rückgratverletzung zugezogen, und sein Gang wirkte zuweilen steif und gequält; aber davon sprach er nie, und wenn sich hinter dem Lächeln, das er der Umwelt {23}darbot, ein kompliziertes und bitteres Innenleben verbarg, ließ er sich nichts anmerken.
Er sah seinem Vater so ähnlich, daß Lucilles Lippen unwillkürlich ein Lächeln annahmen und ihre Augen so sanft wurden wie die einer Liebenden, sobald sie ihn sah.
»Edith hat mich gerade die Treppe hinuntergeworfen«, sagte Martin belustigt. »Was soll diese Hetze? Es ist halb zehn, und das Treffen der Großen Vier ist erst für 12 Uhr mittag anberaumt.«
Er zog einen Stuhl vor, setzte sich und fuhr mit den Händen über sein Haar, um es zu glätten. Im Verlauf dieser Aktion stieß er eine Kaffeetasse um und verfehlte Pollys Kopf mit seinen Ellbogen um Haaresbreite.
»Giles wird bestimmt nicht gerade begeistert von dir sein, Martin«, sagte Polly strafend. »Du bist zu wild.«
»Giles wird sogar sehr begeistert von mir sein. Ich werde ihm einen Haufen gute Tips geben. Ich werde ihm alles sagen, was ein junger Mann in seiner Lage wissen muß.«
»Er ist neunundzwanzig, Herzchen. Ein Jahr älter als du.«
»Aber absolut unerfahren.«
Polly schnitt ihm ein Gesicht.
Bisher hatte Martin Lucille nicht einmal angesehen, aber sie wußte, daß dieses Übersehen nicht gezielt war wie bei Polly.
Sie wollte nicht auf sich aufmerksam machen, indem sie sich einmischte, deshalb beobachtete sie die beiden schweigend, verdrängte Mildred und zog stolze Genugtuung aus der Tatsache, daß die beiden Andrews Kinder waren und so hübsch und so dunkel und so klug. Martin war Feuilletonchef bei der Toronto Review und sehr jung {24}für seinen Posten. Polly hatte in Soziologie promoviert und vier Jahre in verschiedenen Wohlfahrtseinrichtungen gearbeitet, wo sie von Entbindungen bis zu kriminalistischen Ermittlungen alles gemacht hatte.
»Ist das mein Ei?« fragte Martin und wies dabei auf das rote Schälchen.
»Eier kann man nicht besitzen«, sagte Polly. »Unpersönlich wie sie sind.«
»Ich schon.«
»Nimm es nicht«, sagte Lucille lachend. »Es ist nicht mehr warm. Annie kocht dir ein frisches.«
Aber Martin hatte die Kappe bereits abgeschlagen und nahm sich einen mürben Toast aus dem Ständer. Lucille schenkte ihm Kaffee ein und erhob sich. Sie wäre gern noch sitzen geblieben, wie sie es sonntags eigentlich immer tat, aber sie wußte, daß sie nur stören würde. Martin und Polly diskutierten schon heftig über die Frage, wie Martin sich Giles gegenüber zu benehmen oder nicht zu benehmen hätte.
»Keine Frotzeleien«, sagte Polly. »Und hüte dich, ihm auf die Schulter zu schlagen oder ihn zu fragen, was sein Ausgehstöckchen zu bedeuten hat. Das fragen ihn alle, und es ist sehr peinlich, weil er es nicht weiß. Und vor allem …«
Leise zog Lucille hinter sich die Tür zu.
Sie blieb in der Diele einen Augenblick stehen, unsicher bezüglich ihrer Identität und Lage, unschlüssig, was sie tun oder wohin sie gehen solle. Sie erlebte eine Schrecksekunde der Erkenntnis.
Wie oft habe ich hier schon gestanden, dachte sie. Allein in einem Flur, und alle Türen verschlossen vor mir, vor einer Fremden, einer Landstreicherin.
{25}Sie hatte eine kurze Vision ihrer selbst, den Körper vornübergebeugt in einer Haltung von Verstohlenheit, einem Dieb vergleichbar, der auf Zehenspitzen an einem schlafenden Polizisten vorbeischleicht.
Dann hörte sie im ersten Stock Ediths zornig tremolierende Fistelstimme: »Du hast dir bestimmt Fieber geholt, Andrew!« Und plötzlich war alles wieder normal, der Polizist wachte auf, der Dieb wurde gefaßt und ordnungsgemäß hinter Schloß und Riegel gebracht; und Lucilles Gedanken legten sich gestempelt und abgeheftet ad acta.
»Meine liebe Edith« – Auch Andrew hatte die Stimme erhoben. Er klang nervös und gereizt. Er will nicht, daß Polly heiratet, dachte Lucille. Für ihn ist sie immer noch ein kleines Mädchen. – »Wie kann man sich ein Fieber holen?«
»Du weißt ganz genau, was ich meine«, sagte Edith. »Du hast dich erkältet, es ist doch wirklich der Gipfel an Unvernunft, ohne Mantel in den Schnee hinauszustürzen, nur …«
»Meine liebe Edith, ich stürze nicht in den Schnee hinaus. Ich werde die Würde in Person sein und in einem geschlossenen und geheizten Wagen fahren, vorausgesetzt …«
»Du weißt ganz genau …«
»… vorausgesetzt, man läßt mir wenigstens die Zeit, mich in Ruhe anzukleiden.«
»Gut, dann hol dir eine doppelseitige Lungenentzündung.«
»Himmel!« sagte Andrew, und eine Tür schlug zu.
Lucille schritt durch den Flur und dachte lächelnd an Edith. Arme Edith, zu gern beschwört sie große {26}Katastrophen herauf, um die Kassandra spielen zu können … Ich könnte das Menü entwerfen und eine Einkaufsliste für morgen aufstellen. – Und wenn Giles nun gegen irgend etwas allergisch ist –?
Sie trat in den mit Bücherwänden gesäumten kleinen Raum, den Andrew seine Höhle nannte. Die Sonne hatte diesen Teil des Hauses noch nicht erreicht, und der Raum war dämmrig und roch nach unbenutzten Büchern.
Sie machte eine Tischlampe an, nahm Block und Bleistift und ließ sich in Andrews Sessel nieder. Sie begann, die Menüs für die kommende Woche zu planen, wobei es zugleich das Budget und Annies Grenzen im Bezug auf die Küche zu berücksichtigen galt. Hummer, falls es welchen gab, und ein Brathuhn. Pilze, oder vielleicht eine Aubergine.
Sie beugte sich über den Block und zog die Stirn kraus. Sie wollte, daß für Giles alles vollkommen war, nicht weil er Giles war und Polly heiraten wollte, sondern weil sie Lucille war. Sie hatte jene raffinierte, aber absolute Eitelkeit, die sich oft hinter edleren Bezeichnungen verbirgt – hinter Hingabe, Selbstlosigkeit, Generosität. Und sie hatte sich in die hintersten Kammern ihres Hirns zurückgezogen – ein blindes, taubes und hungriges kleines Biest, das immer indirekt mittels einer Schnur gefüttert werden mußte.
Während sie plante, malte sie zerstreut kleine Figuren auf den Deckel des Blocks. Ganz von ferne, durch ein Meer von Hummern und Krabben, hörte sie Edith rufen: »Lucille, wo, um Himmels willen, steckst du?«
»Hier. In der Höhle.«
Edith kam durch die Tür gestürzt und machte ein Gesicht, als gälte es, einen Orkan niederzublasen.
{27}»Ich glaube, Andrew hat sich eine Erkältung geholt«, sagte sie und rang tragisch die Hände. »Ausgerechnet heute! Er hat einen feuerroten Kopf!«
»Aufregung«, sagte Lucille. Edith rauchte, und die Blässe ihres von fahlen Rauchschwaden umwehten Gesichts erinnerte Lucille an Austern.
»Austern«, sagte sie.
Edith zog verwundert eine Augenbraue hoch. »Austern kann ich nicht ausstehen. Es sei denn, sie sind mit irgend etwas überbacken.«
»Ja.«
»Ich finde die Farbe von den Dingern so gräßlich.«
»Ich auch«, sagte Lucille ruhig und notierte sich Austern auf ihrer Liste.
»Aber wieso rede ich jetzt eigentlich von Austern?« sagte Edith leicht indigniert. »Ich komme wegen Andrew. Ich finde, er sollte vernünftig sein und heute zu Haus bleiben.«
»Ach, laß ihn in Ruhe, Edith.« Angesichts der leicht rötlichen Verfärbung im Gesicht ihrer Schwägerin fügte sie schnell hinzu: »Andrew mag nicht bemuttert werden. Das Beste, was wir beide heute machen können, ist, uns zurückhalten. Laß die drei nur machen. In gewisser Weise ist es ihr Tag, da dürfen wir uns nicht einmischen. Im Augenblick sind wir – sind wir Außenseiter.«
Edith machte ein Gesicht, als habe sie dem einiges entgegenzuhalten, dann fuhren ihre Schultern plötzlich herum, und sie ließ sich auf der Schreibtischkante nieder.
»Du bist so vernünftig, Lucille«, sagte sie beinahe vorwurfsvoll. »Ich möchte wissen, wie du das machst. Du kannst dich offenbar in jeden hineinversetzen und tust immer genau das Richtige. Wirklich phänomenal.«
{28}»Ich habe reichlich Gelegenheit gehabt, das zu lernen.« Sie lehnte sich zufrieden lächelnd zurück und strich sich leicht übers Haar. Das kleine Biest hatte etwas zwischen die Zähne bekommen und vorübergehend aufgehört zu nagen.
Kurz darauf verließ Edith den Raum, und Lucille wartete geduldig darauf, daß Andrew kommen und ihr auf Wiedersehen sagen würde. Aber er kam nicht.
Er hat dich vergessen.
Na ja, ist doch ganz natürlich. Er ist mit seinen Kindern zusammen. Es ist ihr Tag. Das habe ich ja selbst gesagt.
Aber er hat dich vergessen.
Na ja, wenn schon. Schließlich bin ich keine Braut mit feuchten Augen mehr …
Sie erhob sich, trat ans Fenster und wartete darauf, daß sie einen Blick von ihm erhaschen konnte, wenn er das Haus verließ. Sie sah die drei die Auffahrt hinuntergehen, eng aneinandergeschmiegt, Arm in Arm. Wie sie durch den aufstäubenden Schnee davongingen, schienen sie ein kompaktes Ganzes, unteilbar und unverletzbar.
Während sie ihnen nachsah, schob sich wie ein eifersüchtiges altes Weib eine dicke schwarze Wolke vor die Sonne.
Lucille stand da und hätte am liebsten »Andrew« gerufen – »Andrew, komm zurück!«, wie sie in ihrem Traum Mildred nachgerufen hatte.
Aber kein Ton kam über ihre Lippen, und sie ging nach einer Weile zu ihrem Sessel zurück, zündete sich eine Zigarette an und beugte sich wieder über ihren Notizblock.
Sie besah sich die Bildchen, die sie auf den Deckel gemalt hatte. Es waren Frauengesichter, die Gesichter von {29}dicken albernen Puppenfrauen. Verschmitzt und affektiert lächelten sie zu ihr hoch, schüttelten ihre gezierten Löckchen und flatterten mit den Wimpern.
Unbeteiligt, fast geistesabwesend, brannte sie ihnen mit ihrer Zigarette die Augen aus.
{30}2
Gegen Mittag am Sonntag, dem 5. Dezember, entgleiste etwa zwanzig Meilen vor Toronto der Montreal Flier. Die Ursache des Unglücks blieb unbekannt, doch ließen die ersten Radioberichte durchblicken, daß es sich womöglich um Sabotage handelte, denn der Unglücksort war eine steile Uferböschung, und die Zahl der Todesopfer und Verletzten war groß. Freiwillige Ärzte und Schwestern wurden gebeten, nach Castleton zu kommen, wo sich das nächste Krankenhaus befand.
Edith hörte die Nachricht im Radio, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen. Schließlich lebte man in einer Zeit, in der Unglücksfälle und Katastrophen an der Tagesordnung waren – aufregen konnte man sich wirklich nur, wenn man persönlich betroffen war.
»Freiwillige Ärzte und Schwestern werden gebeten, sich unverzüglich im Krankenhaus Castleton zu melden, King’s Highway Nummer …«
Sie erhob sich gähnend und stellte das Radio ab, als Lucille ins Zimmer trat.
»Was war das?« fragte Lucille.
»Irgendein Zugunglück.«
»Oh. Das Essen steht auf dem Tisch. Hat heute morgen jemand für Andrew angerufen?«
»Zwei Leute.« Vor Jahren hatte Edith das Amt {31}übernommen, sonntags morgens für Andrew ans Telefon zu gehen. Sie sagte wehmütig: »Erinnerst du dich noch, wie das früher war, als ich fast den ganzen Tag am Telefon verbrachte?«
»Es ist doch vernünftig, daß Andrew sich nicht mehr derartig abhetzt«, sagte Lucille. »Sein Assistent kommt sehr gut allein zurecht.«
»Trotzdem, ich fand es spannend, alle Hände voll zu tun zu haben.«
»Andrew nicht.« Sie lächelte, obwohl sie sich ärgerte, daß Edith sie an diese Sache erinnerte. Sie und Edith hatten hinter Andrews Rücken beschlossen, ihn wenigstens teilweise aus dem Berufsleben herauszuziehen. Jetzt, nachdem er nachgegeben hatte, begann Lucille an ihrer eigenen Weisheit zu zweifeln. Gesundheitlich ging es Andrew besser, aber er war launisch geworden.
»Ärzte gönnen sich nie genug Ruhe«, sagte sie, wie um ihre eigenen Zweifel zu entkräften. »Deshalb sterben sie oft so jung.«
»Sprich nicht vom Sterben. Das bringt meinen Verdauungsapparat durcheinander.« Edith wandte sich ab und biß sich auf die Unterlippe. »Dabei muß ich immer an Mildred denken … Entschuldige, aber ich wünschte, du hättest heute morgen nicht das Gespräch auf sie gebracht – und dann noch in Pollys Gegenwart!«
»Es tut mir wirklich leid. Es ist mir herausgerutscht.«
»Du mußt aufpassen, was du sagst. Vielleicht will sie nicht, daß Giles erfährt, wie – wie Mildred gestorben ist.«
»Das hat sie ihm wahrscheinlich längst erzählt.«
»Nein, nein, das glaube ich nicht. Das war zu entsetzlich.« Edith schloß die Augen, und Lucille sah, daß ihre {32}Lider leichengrau waren und die blauen Äderchen wie Schimmelpilze darauf wuchsen.
»All das Blut«, sagte Edith. »All das – Blut. Ich – ehrlich …«
»Edith, bitte nicht.« Lucille streckte die Hand aus und berührte Ediths mageren, bleichen Arm. »Komm, das Essen wartet.«
»Ich bekomme keinen Bissen herunter.«
»Es wird schon gehen.«
»Nein. Mir wird schlecht, wenn ich nur daran zurückdenke …«
»Wir werden ja sehen«, sagte Lucille etwas grimmig.
Sie ging hinaus, und Edith trottete artig wie ein kleiner ungeliebter Geist hintendrein.
Lucille überdachte die Situation und tat, wie immer, was vernünftig war. Die geringste Ermunterung oder auch nur Anteilnahme genügte – und Edith würde ihren Verdruß zu einer handfesten Magenverstimmung oder Migräne ausbauen.
»Kalbsbröschen gibt’s«, sagte Lucille vergnügt.
Sofort hellte sich Ediths Gesicht auf. Obschon sich ihr Gewissen dagegen sträubte, sah sie Mildred aus ihrem Bewußtsein davonschwimmen, und aus dem Blut bildete sich eine wunderschöne, unendlich lange, rosarote Schleppe aus Tüll, die Mildred im Fluß der Zeit hinter sich herzog.
»Ich liebe Kalbsbröschen«, sagte sie.
Sie aß zuviel davon, und Verdauungsstörungen kriegte sie deshalb auch so. Als es halb drei wurde und Andrew und die Kinder immer noch ausblieben, wurde sie nervös. Lucille versuchte, sie zu beruhigen, mit dem Erfolg, daß sie selbst unruhig und ungeduldig wurde.
{33}Um vier machte Lucille im Wohnzimmer Feuer, um die Stimmung zu heben. Aber das Holz war feucht, und die Flämmchen krochen schwach an dem Scheit hoch wie sterbende Finger, die um Hilfe winken.
»Sie müßten längst hier sein«, sagte Edith. »Längst! Was kann denn nur passiert sein!«
»Wahrscheinlich gar nichts«, sagte Lucille, stocherte an dem Scheit herum und wälzte es schließlich auf die andere Seite.
»Ich hab’ dir ja gesagt, daß das Holz nicht brennen wird.«
»Meine liebe Edith«, sagte Lucille, »es brennt aber.«
»Nicht richtig. Ich muß mich über Andrews Rücksichtslosigkeit doch wundern, ich begreif’ das gar nicht. Er weiß doch.«
»Woher sollte Andrew wissen, daß du zuviel essen und dich aufregen würdest?«
»Beherrsch dich, Lucille.«
»Das hätte ich vor zwei Stunden sagen sollen.«
»Es ist eine häßliche Unterstellung«, sagte Edith kalt. »Als wäre ich weniger besorgt um Andrew, wenn ich nicht so viel gegessen hätte, was ich im übrigen nicht habe. Ich finde, du könntest …«
Das Telefon im Flur begann zu klingeln. Die beiden Frauen sahen sich an, aber rührten sich nicht.
»Willst du nicht rangehen, Edith? Es ist doch wahrscheinlich für Andrew.«
Edith hörte nicht.
»Ein Unfall«, flüsterte sie. »Ich weiß es – ein Unfall …«
»Sei nicht kindisch«, sagte Lucille und ging selbst an den Apparat.
{34}Am anderen Ende ließ sich ein näselndes Vermittlungsfräulein vernehmen.
»Ein R-Gespräch aus Castleton für Mrs. Andrew Morrow. Nehmen Sie das Gespräch an?«
»Mrs. Morrow am Apparat. Ja, ich nehme es an.«
»Hier ist der Teilnehmer. Bitte sprechen Sie.«
»Hallo«, sagte Lucille. »Hallo.«
Sie hörte zunächst nichts außer ein paar undefinierbaren Geräuschen im Hintergrund. Dann: »Hallo, Lucille. Hier ist Polly.«
»Was ist passiert?«
»Es hat einen Unfall gegeben.«
»Polly …«
»Nein, nicht wir. Wir sind nur zufällig vorbeigekommen, und Vater und ich bleiben und helfen. Hier gibt’s ein kleines Krankenhaus, von da aus telefoniere ich.«
»Polly, deine Stimme klingt sonderbar.«
»Kann sein. Ich hab’ noch nie ein Zugunglück gesehen. Na ja, ich hab’s eilig. Sie haben nicht genug Ärzte und Schwestern. Nur sag Edith, sie soll sich nicht aufregen. Wiedersehen.«
»Moment – was meint ihr, wann ihr zurückkommt?«
»Sobald sie auf uns verzichten können. Martin und Giles helfen bei der Bergung der Opfer. Wiedersehen.«
»Wiedersehen«, echote Lucille.
Edith zupfte an ihrem Ärmel herum. »Was ist?«
»Nichts Besonderes«, sagte Lucille. »Es hat ein Zugunglück gegeben und Andrew hilft.«
»Wie gräßlich«, sagte Edith, aber das konnte Lucille nicht beeindrucken. Sie sah lächelnd über Ediths Schulter hinweg. Andrew war in Sicherheit, ihre Welt war in {35}Sicherheit. Was scherten sie die Züge der Welt, solange Andrew nicht darin saß.
Sie eilte ins Wohnzimmer zurück, um das Feuer zu schüren … Andrew würde erschöpft nach Haus kommen und sich über ein warmes Feuer und einen steifen Grog freuen.
Aber sosehr sie sich auch bemühte – das Holz wollte nicht brennen. Sie mühte sich wieder auf, schmutzig und abgekämpft. Sie sah sich um, und ihr Blick begegnete Mildreds. Mildred, unversehrt und glücklich und in Öl, unverändert, lästig auch jetzt nach sechzehn Jahren noch, da sie täglich abgestaubt und öfters zum Restaurator geschickt werden mußte, wenn ihre unförmigen weißen Schultern schorfig wurden.
Lucille betrachtete sie verbittert, aber Mildreds weicher, süßer Mund blieb derselbe, ihr Blick, den weder Zeit noch Tränen noch Haß getrübt hatten, starrte in alle Ewigkeit auf ein Stück Wand.
»Allmählich bringe ich alles wieder zusammen«, sagte Edith.
»Was?« fragte Lucille. »Was?«
»Das mit dem Zugunglück damals. Andrew und ich waren praktisch noch Kinder. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber etwas über einen Kilometer von unserem Haus entfernt war der Zug irgendwie entgleist. Und wir liefen natürlich hin, sobald wir davon hörten.«
Ein Redestrom folgte, von dem Lucille nur Bruchstücke mitbekam. »Hunderte von Leichen, ja, Hunderte – wirklich unangenehm für Kinder – Soldaten, die mithalfen, weil damals der andere Krieg im Gange war –«
In der Aufregung verschwanden Ediths Magenbeschwerden, und Lucille bekam Kopfschmerzen.
{36}»Du wirst maßvoller mit den Jahren«, sagte sie spitz. »Letztes Mal war noch von Tausenden von Leichen die Rede.«
»Das ist nicht wahr«, sagte Edith beleidigt. »Mit Zahlen halte ich’s immer sehr genau. Du bist heute nicht dieselbe wie sonst, Lucille, wirklich. Du giftest schon den ganzen Tag.«
»Ich hab’ Kopfschmerzen.«
»Geh rauf und leg dich ein wenig hin. Du bist heute nicht dieselbe«, wiederholte sie.
»Ich mag mich nicht hinlegen«, sagte Lucille und war selbst überrascht, wie kindisch das klang.
Edith und ich sind keine Freunde, dachte sie. Wir vertragen uns und haben Spaß zusammen und verstehen einander, aber wenn sich eine von uns nur ein bißchen gehenließe, würden wir uns die Augen auskratzen wie die Marktweiber.