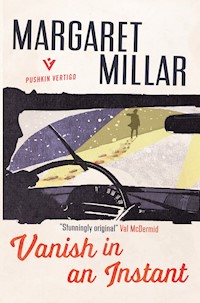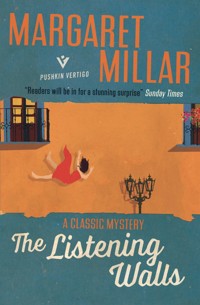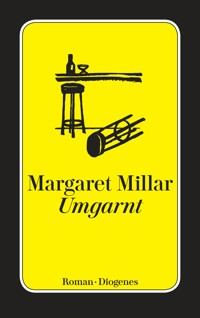7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die arrogante Virginia Barkeley, verdächtig des Mordes an Claude Margolis, schläft im Gefängnis von Arbana ihren Rausch aus. Zu ihrem Glück taucht Earl Loftus auf und gesteht, Margolis umgebracht zu haben. Loftus, ein junger Mann mit einem blutbefleckten Trenchcoat als Beweis seiner Schuld, hat kein eindeutiges Motiv und wenig Freunde; Loftus, so scheint es, ist ein Mann, der nichts zu verlieren hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Stiller Trost
Roman
Aus dem Amerikanischen von Klaus Schomburg
Diogenes
{5}Für meine Lieben, Mill und Linda
{7}1
Schnee und Ruß sprenkelten die betonierten Rollbahnen wie Salz und Pfeffer. Detroit, zwanzig Meilen östlich, war eine Stadt aus Dunst und Lichtern. Arbana, zwanzig Meilen westlich, war überhaupt nicht zu sehen. Dennoch blickte Mrs. Hamilton zuerst nach Westen, als hoffte sie, wundersamerweise, einen Blick auf den kleinen Ort zu erhaschen.
Auf der Zuschauerrampe über dem Flugplatz sah sie die Gesichter von Leuten, die darauf warteten, ein Flugzeug zu besteigen oder jemanden abzuholen, oder die einfach warteten und den Abreisenden zuschauten, weil es das Beste war, was man tun konnte, wenn man selbst nirgendwohin flog. Unter den gleißenden Lichtern ähnelten sich ihre Köpfe wie die Reihen von Wachsgemüse in den Schaufenstern der Lebensmittelgeschäfte zu Hause. Forschend ließ sie den Blick über die Gesichter gleiten, um festzustellen, ob eines davon ihrem Schwiegersohn Paul gehörte. Sie war nicht sicher, ob sie ihn wiedererkennen würde – sie hatte ihn eigentlich nie als Person wahrgenommen, er war einfach Virginias Mann – oder ob er sie wiedererkennen würde.
»Ich habe mich bestimmt nicht verändert«, sagte sie laut und ein wenig scharf.
Ihre Begleiterin drehte sich überrascht zu ihr um. Sie {8}war ein schlankes Mädchen Anfang Zwanzig und ziemlich hübsch, obgleich das blonde Haar und die sehr hellen Augenbrauen sie zerbrechlich und farblos erscheinen ließen. Ihre Augen waren tiefblau und rund, so daß ihr Blick immer etwas Fragendes hatte, wie bei einem Kind, für das alles neu ist. »Haben Sie etwas gesagt, Mrs. Hamilton?«
»Die Menschen verändern sich im Laufe eines Jahres nicht sehr, es sei denn, es war ein schlechtes Jahr. Und ich hatte eigentlich kein schlechtes Jahr, bis dieses – bis jetzt.«
Das Mädchen gab einen mitfühlenden Laut von sich, bei dem sich Mrs. Hamilton innerlich versteifte. Mrs. Hamilton verabscheute Mitgefühl. Im Gegensatz zu ihrer rundlichen, kleinen Statur hatte sie ein lebhaftes und energisches Wesen. Die große schwarze Handtasche fest unter den Arm geklemmt, steuerte sie über das gefegte betonierte Vorfeld auf den Eingang des Flughafengebäudes zu. Als sie die Zuschauerrampe passierte, blickte sie erneut zu den wächsernen Gesichtern empor.
»Ich sehe Paul nicht. Du, Alice?«
»Vielleicht wartet er drinnen«, erwiderte das Mädchen. »Es ist kalt.«
»Ich hatte dir geraten, dir vorsichtshalber einen warmen Mantel zu kaufen.«
»Der Mantel ist warm genug. Nur der Wind nicht.«
»Kalifornier sind verwöhnt. Dabei ist das hier für einen Winter recht mild.« Ihre eigenen Lippen waren jedoch blau angelaufen, und ihre Finger in den weißen Wollhandschuhen waren steif, als ob sie geschient wären. »Ich habe ihn in meinem Telegramm nicht gebeten, mich abzuholen. Nun, wir nehmen ein Taxi nach Arbana. Wie spät ist es?«
{9}»Fast neun.«
»Zu spät. Sie werden mich heute abend wahrscheinlich nicht mehr zu Virginia lassen.«
»Wahrscheinlich nicht.«
»Ich nehme an, die – ich nehme an, sie haben Besuchszeiten wie in einem Krankenhaus.« Sie sprach das Wort sie aus, als habe es einen explosiven Inhalt und müsse mit Vorsicht behandelt werden.
An der Gepäckausgabe hatte sich eine Schlange gebildet, und sie stellten sich hinten an. Mrs. Hamilton, die ein Gefühl für Stimmungen besaß, nahm eine Atmosphäre schal gewordener Erregung und verbrauchter Vorfreude in dem großen Raum wahr.
Das Ende der Reise, dachte sie. Auch sie selbst fühlte sich alt und verbraucht, und das Gefühl erinnerte sie an Virginia: Virginia an Weihnachten, als sie acht Jahre alt war. Wochenlang hatte das Kind von Weihnachten geträumt, und dann war sie am Weihnachtsmorgen aufgewacht, um festzustellen, daß Weihnachten ein Tag wie jeder andere war. Natürlich gab es Geschenke, aber sie waren nicht so groß und aufregend und geheimnisvoll wie die Verpackungen, in denen sie geliefert wurden – und konnten es niemals sein. Am Nachmittag hatte Virginia geweint und sich in ihrem Kummer hin und her gewiegt.
»Ich will mein Weihnachten wiederhaben. Ich will mein Weihnachten!« Mrs. Hamilton wußte jetzt, daß das, was Virginia wiederhaben wollte, die wundervollen Hoffnungen, die ungeöffneten Schachteln, die noch zu Schleifen gebundenen Bänder waren.
Bald, in zwei Wochen, würde wieder Weihnachten sein. Sie fragte sich bitter, ob Virginia ihm nachweinen würde, wenn es vorbei war.
{10}»Sie müssen müde sein«, sagte Alice. »Warum setzen Sie sich nicht und lassen mich in der Schlange warten?«
Die Antwort war knapp und kam ohne Zögern. »Nein, danke. Ich lehne es ab, mich in meinem Alter wie eine alte Dame behandeln zu lassen.«
»Willett sagte, ich solle gut auf Sie aufpassen.«
»Mein Sohn Willett kam schon als alte Jungfer auf die Welt. Ich mache mir keine Illusionen über meine Kinder. Habe nie welche gehabt. Ich weiß, daß Virginia launisch ist. Aber das ist auch alles. Sonst ist sie in Ordnung.« Sie fuhr sich mit einem Taschentuch über die feuchte, bleiche Stirn. Der Raum erschien ihr plötzlich unerträglich heiß, und sie war unerträglich müde, doch sie verspürte den Zwang weiterzureden. »Die Anschuldigung ist lächerlich, ein Irrtum. In einer Kleinstadt wie Arbana ist die Polizei unfähig und wahrscheinlich korrupt. Sie haben einen absurden Fehler gemacht.«
In den vergangenen zwölf Stunden hatte sie ein dutzendmal dieselben Worte gesagt. Durch die Wiederholung hatten sie an Stoßkraft und Geschwindigkeit gewonnen wie ein führerloses Auto, das den Berg hinunter auf einen Zusammenstoß zurollt.
»Warte, bis du sie kennenlernst, Alice. Du wirst selbst sehen.«
»Bestimmt werde ich das.« Doch je mehr Mrs. Hamilton über ihre Tochter sprach, desto undeutlicher wurde Virginia, in einem Gestrüpp von Worten verborgen wie ein unbekanntes Tier.
»Ich habe keine Illusionen«, wiederholte die ältere Frau. »Sie ist launisch, sie kann sogar jähzornig sein, aber sie ist unfähig, absichtlich jemanden zu verletzen.«
Alice murmelte eine nichtssagende, aber beruhigende {11}Antwort. Sie spürte plötzlich, daß sie beobachtet wurde. Sie drehte sich um und blickte über Mrs. Hamiltons Schulter zum Ausgang. In der Nähe der Tür stand ein Mann und sah zu ihr hin. Er war Mitte Dreißig, groß, hatte leicht hängende Schultern, als ob er schon zu lange an einem Schreibtisch arbeitete, und etwas verhärtete Gesichtszüge, als ob ihm das keinen Spaß machte. Er trug einen Tweedmantel zu einem grauen Filzhut und derbe braune englische Straßenschuhe.
»Ich glaube, Ihr Schwiegersohn ist gerade gekommen.«
Mrs. Hamilton drehte sich um und warf einen Blick auf den Mann. »Das ist nicht Paul. Zu gut gekleidet. Paul sieht immer aus wie jemand, der in einer Schlange für einen Teller Suppe ansteht.«
»Er scheint Sie zu kennen, so wie er herüberstarrt.«
»Unsinn. Sei nicht so bescheiden. Er starrt dich an. Du bist ein hübsches Mädchen.«
»Ich finde mich nicht hübsch.«
»Keine Frau findet sich hübsch ohne einen Mann. Trotzdem, ich fand mich immer hübsch. Obwohl ich es nie war.«
Es stimmte. Sie war nie hübsch gewesen, nicht einmal als Mädchen. Der Kopf war zu groß für ihren Körper, was durch das dicke braune Haar noch betont wurde, doch jetzt zeigte es Streifen von Asche wie ein ausbrennendes Grasfeuer. »Du mußt lernen, so zu tun als ob, Alice. Du bist schließlich keine Lehrerin mehr. Du bist eine junge Frau von Welt, du bist auf Reisen, alle möglichen aufregenden Dinge können geschehen. Spürst du das nicht?«
»Nein«, sagte Alice schlicht.
»Nun, versuch’s.«
{12}Der Mann an der Tür war zu einem Entschluß gekommen. Er durchquerte rasch den Raum und zog im Gehen seinen Hut.
»Mrs. Hamilton?«
Mrs. Hamilton sah ihn an, ein leichtes Stirnrunzeln legte die Haut zwischen ihren Augenbrauen in Falten. Die Begegnung, was immer sie bedeuten mochte, entsprach nicht ihren Plänen. Sie hatte weder Zeit noch Energie auf einen Fremden zu verschwenden. Sie klemmte ihre Tasche etwas fester unter den Arm, als ob der Fremde ihr etwas stehlen wolle.
»Ja, ich bin Mrs. Hamilton.«
»Mein Name ist Eric Meecham. Dr. Barkeley schickt mich, um Sie abzuholen.«
»Oh, guten Tag.«
»Guten Tag.« Er hatte eine tiefe Stimme mit einem Anflug von Ungeduld darin.
»Sie sind ein Freund von Paul?«
»Nein.«
»Was dann?«
»Ich bin Anwalt. Ich bin beauftragt, Ihre Tochter zu vertreten.«
»Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben?«
»Dr. Barkeley.«
»In meinem Telegramm wies ich ihn an, bis zu meiner Ankunft zu warten.«
Meecham erwiderte ihr Stirnrunzeln. »Nun, das hat er nicht. Er wollte, daß ich sie sofort aus dem Gefängnis hole.«
»Und? Haben Sie das getan?«
»Nein.«
»Warum nicht? Wenn es am Geld liegt, ich habe …«
{13}»Es liegt nicht am Geld. Sie können sie achtundvierzig Stunden ohne Anklage festhalten. Es sieht so aus, als ob sie das vorhätten.«
»Aber wie können sie ein unschuldiges Mädchen festhalten?«
Meecham griff die Frage so vorsichtig auf, als handele es sich um eine geladene Pistole. »Tatsache ist, sie hat nicht gesagt, sie sei unschuldig.«
»Was – was sagt sie?«
»Nichts. Weder leugnet sie, noch gibt sie irgend etwas zu, nichts, Punkt. Sie ist …« Er suchte nach einem Wort, und von den vielen, die ihm in den Sinn kamen, wählte er das am wenigsten verletzende: »Sie ist ein wenig schwierig.«
»Sie hat Angst, das arme Kind. Wenn sie Angst hat, ist sie immer schwierig.«
»Das kann ich verstehen.« Von der Schlange vor der Gepäckausgabe waren nur noch sie drei übrig. Meecham sah fragend zu Alice und wandte sich dann wieder an Mrs. Hamilton. »Sie sind allein gekommen?«
»Nein. Nein, entschuldigen Sie, ich vergaß, Sie vorzustellen. Alice, das ist Mr. Meecham. Miss Dwyer.«
Meecham nickte. »Guten Tag.«
»Alice ist eine Freundin von mir«, erklärte Mrs. Hamilton.
»Eigentlich bin ich eine bezahlte Begleiterin«, sagte Alice.
»Tatsächlich? Wenn Sie mir die Gepäckscheine geben, hole ich Ihre Sachen und bringe sie nach draußen zu meinem Auto.«
Mrs. Hamilton gab ihm die Scheine. »Es war sehr freundlich von Ihnen, sich diese ganze Mühe zu machen.«
{14}»Gar keine Mühe.« Die Worte waren höflich, klangen aber nicht überzeugend.
Er trug die vier Koffer zum Auto und lud sie in den Kofferraum. Das Auto war neu, aber mit Schlamm bespritzt, und der hintere linke Kotflügel hatte eine Beule.
Die beiden Frauen nahmen auf der Rückbank Platz und Meecham alleine vorn. Niemand sprach während der ersten paar Meilen. Der Verkehr auf dem Highway war lebhaft und die Fahrbahn rutschig vom Schneematsch.
Alice betrachtete die Landschaft, die von den Scheinwerfern beleuchtet wurde. Sie war trostlos und flach und mit grauen Schneeflecken bedeckt. Heimweh überfiel sie, gepaart mit einem Gefühl, das sehr viel stärker und heftiger als Heimweh war. Sie haßte diese Gegend, und sie haßte den Anwalt, weil er zu dieser Gegend gehörte. Er war ebenso unnahbar und abweisend wie die Landschaft und so unfreundlich wie das Wetter.
Mrs. Hamilton schien ihr Gefühl zu teilen. Sie streckte plötzlich ihren Arm aus und tätschelte Alices Hand. Dann straffte sie sich und wandte sich mit ihrer klaren, entschlossenen Stimme an Meecham. »Welche Qualifikationen haben Sie eigentlich für diese Arbeit, Mr. Meecham?«
»Ich habe an der hiesigen Universität mein juristisches Examen gemacht und in der Kanzlei Post & Cranston den Bürogehilfen gespielt, bis sie mich für unentbehrlich hielten und meinen Namen auf eine Tür setzten. War es das, was Sie wissen wollen?«
»Ich will wissen, welche Erfahrung Sie mit Kriminalfällen haben?«
»Ich hatte noch nie mit einem Mordfall zu tun, wenn Sie das meinen«, sagte er freimütig. »Die gibt es normalerweise nicht in dieser Stadt. Kennen Sie Arbana?«
{15}»Ich bin dort gewesen. Ein einziges Mal.«
»Dann wissen Sie, daß es eine Universitätsstadt ist und keine Verbrechensrate wie Detroit hat. Das größte Polizeiproblem ist der Verkehr nach Fußballspielen. Natürlich gibt es einen gewissen Prozentsatz an Autodiebstählen, Raub, Sittlichkeitsvergehen und dergleichen. Aber einen Mord hat es seit zwei Jahren nicht mehr gegeben.«
»Und sie haben meine Tochter verhaftet.«
»Ja.«
»Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Sie brauchten nur einen Blick auf Virginia zu werfen, um zu erkennen, daß sie ein – ein anständiges Mädchen und gut erzogen ist.«
»Auch anständige Mädchen sind schon in Schwierigkeiten geraten.«
Ein kurzes Schweigen trat ein. »Das hört sich an, als ob Sie sie für schuldig hielten.«
»Ich habe mir noch keine Meinung gebildet.«
»Das haben Sie. Ich weiß es.« Mrs. Hamilton beugte sich vor, eine Hand auf der Rücklehne von Meechams Sitz. »Entschuldigen Sie, wenn ich unhöflich klinge«, sagte sie leise, »aber ich bin nicht sicher, ob Sie für diese Arbeit qualifiziert sind.«
»Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich werd’s versuchen.«
»Natürlich werden Sie es versuchen. Wenn Morde in dieser Stadt so selten sind, wie Sie behaupten, wäre es eine ziemliche Auszeichnung für Sie, die Verteidigung zu übernehmen, oder etwa nicht?«
»Schon möglich.«
»Der Gedanke an eine solche Auszeichnung auf Kosten meiner Tochter gefällt mir nicht.«
{16}»Was schlagen Sie vor, daß ich tun soll, Mrs. Hamilton?«
»Sich taktvoll zurückziehen.«
»Ich bin nicht taktvoll«, entgegnete Meecham.
»Ich verstehe. Wir werden das heute abend mit Paul besprechen.«
Sie näherten sich der Stadt. Am Himmel war ein rötlicher Neonschein, und Tankstellen und Hamburgerstände tauchten in kürzeren Abständen am Highway auf.
Mrs. Hamilton ergriff wieder das Wort. »Nicht, daß ich etwas gegen Sie persönlich hätte, Mr. Meecham.«
»Nein.«
»Es ist nur so, daß meine Tochter das Wichtigste in meinem Leben ist. Ich kann kein Risiko eingehen.«
Meecham dachte an ein Dutzend Erwiderungen, sprach aber keine von ihnen aus. Er empfand echtes Mitleid für diese Frau und für jeden, der Virginia Barkeley für das Wichtigste in seinem Leben hielt.
{17}2
Der eine Flügel des Hauses war dunkel, aber aus allen Fenstern des anderen Flügels strömte Licht in goldenen Streifen.
Das Haus war größer, als Meecham erwartet hatte, und sein flaches Dach und die riesigen Fenster paßten nicht zu der winterlichen Umgebung. Es war ein südkalifornisches Haus aus Redwood und Feldstein. Meecham fragte sich, ob Virginia es selbst so entworfen hatte – bewußt, weil es sie an zu Hause erinnerte, oder unbewußt als Symbol ihrer Weigerung, sich an die neue Umgebung anzupassen.
Die Zufahrt zum Haus führte durch einen Patio, der die beiden Flügel voneinander trennte. Auch hier brannten die Lichter. Sie beleuchteten Hängekörbe mit abgestorbenen Pflanzen, schneebedeckte Blumentöpfe und eine in den Boden eingelassene Grillstelle, deren Rand winzige Eiszapfen säumten.
Mrs. Hamilton verdrehte die Augen, als ob sie beim Anblick von Virginias Patio, der für Sommer und Sonne gebaut war und nun verlassen im Winterlicht dalag, in Tränen ausbrechen wollte. Schweigend stieg sie aus dem Auto und ging auf das Haus zu.
Meecham schob erleichtert seinen Hut zurück. »Komische Frau, was?«
»Ich mag sie. Sie ist sehr freundlich zu mir.«
{18}»Ach ja?« Er trat zur Seite, während Alice aus dem Auto stieg. »Sie sind ein bißchen jung für eine bezahlte Begleiterin. Wie lange arbeiten Sie schon für sie?«
»Ungefähr einen Monat.«
»Warum?«
»Warum? Nun …« Sie errötete. »Nun, das ist eine dumme Frage. Ich muß meinen Lebensunterhalt verdienen.«
»Ich wollte damit nur sagen, daß es eine seltsame Art von Job für ein junges Mädchen ist.«
»Ich war früher Lehrerin. Nur lernte ich dabei keine …« geeigneten Männer kennen, waren die Worte, die ihr auf der Zunge lagen, doch statt dessen sagte sie: »Ich verfiel in einen Trott, deshalb beschloß ich, wenigstens ein Jahr lang etwas anderes zu machen.«
Er warf ihr einen verwunderten Blick zu und ging um das Auto herum nach hinten, um den Kofferraum aufzuschließen. Mrs. Hamilton war im Haus verschwunden und hatte die Eingangstür offengelassen.
Meecham stellte die vier Koffer auf die vom Schnee freigeschaufelte Zufahrt und schloß den Kofferraum wieder ab. »Ich nehme an, Sie wissen, auf was Sie sich da einlassen.«
»Ich – ja sicher. Natürlich.«
»Natürlich.« Er machte ein leicht amüsiertes Gesicht. »Sie kennen Virginia vermutlich nicht.«
»Nein. Ich habe jedoch viel über sie erfahren, von ihrem Bruder Willett und von Mrs. Hamilton. Sie scheint eine – nun, eine ziemlich unglückliche Person zu sein.«
»Man muß schon ganz schön unglücklich sein«, sagte Meecham, »um einen Burschen ein halbes Dutzend Mal in den Hals zu stechen. Oder wußten Sie das nicht?«
{19}»Ich wußte es.« Sie wollte sehr überzeugend klingen, wie Mrs. Hamilton, aber ihre Stimme wurde zu einem kleinen gequetschten Flüstern. »Natürlich wußte ich es.«
»Natürlich.«
»Sie sind sehr unfreundlich.«
»Das bin ich, wenn Leute unfreundlich zu mir sind«, sagte Meecham. »Übrigens, ich habe Ihren Namen vergessen, wie war er doch gleich?«
Anstatt zu antworten, ergriff sie zwei von den Koffern und ging auf das Haus zu.
Mrs. Hamilton hörte sie kommen und rief: »Alice? Ich bin hier im Wohnzimmer. Bring Mr. Meecham mit herein. Vielleicht möchte er einen Kaffee.«
Alice sah Meecham, der ihr ins Haus gefolgt war, kalt an. »Wollen Sie einen Kaffee?«
»Nein, danke, Alice.«
»Ich gestatte wildfremden Menschen nicht, mich Alice zu nennen.«
»In Ordnung, Kleine.« Er sah aus, als wolle er lachen, tat es aber nicht. Statt dessen sagte er: »Wir scheinen es falsch miteinander angefangen zu haben.«
»Da wir nichts miteinander vorhaben, was spielt das da schon für eine Rolle?«
»Wie Sie wollen.« Er setzte seinen Hut auf. »Sagen Sie Mrs. Hamilton, daß ich sie morgen früh um halb zehn im Kreisgefängnis erwarte. Sie kann dann Virginia sehen.«
»Könnte sie sie nicht vielleicht heute abend anrufen?«
»Das Mädchen ist im Gefängnis, nicht im Waldorf-Hotel.« Während er zur Tür ging, sagte er über die Schulter: »Gute Nacht, Kleine.«
»Alice?« wiederholte Mrs. Hamilton. »Oh, da bist du ja. Wo ist Mr. Meecham?«
{20}»Er ist gegangen.«
»Vielleicht war ich ein bißchen grob zu ihm, als ich seine Fähigkeiten in Zweifel zog.« Sie stand vor dem Kamin, noch in Hut und Mantel, und rieb ihre Hände aneinander, wie um sich zu wärmen, obwohl kein Feuer brannte. »Ich fürchte, ich habe ihn gegen mich aufgebracht. Ich konnte nicht anders. Ich hatte das Gefühl, daß er eine falsche Einstellung zu Virginia hat.«
Der Raum war sehr groß und farbenprächtig, und die Möbel waren – wie auf einer tropischen Veranda – aus Rattan, Bambus und Glas. Überall wuchsen Pflanzen: Philodendron und Efeu in kupfernen Übertöpfen an den Wänden, Azaleen in Kübeln auf dem Boden und Alpenveilchen, Buntlippen und Usambaraveilchen in Korallensteintöpfen auf dem Kaminsims und auf jedem Wandbrett und jedem Tisch. Die Luft war feucht und roch nach nasser Erde wie ein Feld nach einem Frühjahrsregen.
Der ganze Raum wirkte unvorstellbar schön und zugleich überspannt, als lebte die Person, die ihn bewohnte, in einem Traum.
»Sie liebt Blumen«, sagte Mrs. Hamilton. »Sie ist nicht wie mein Sohn Willett. Er hat sich nie für etwas anderes als Geld interessiert. Virginia ist ganz anders. Schon als Kind ging sie sehr sanft mit Blumen um, auch mit Vögeln und Tieren. Sehr sanft und verständnisvoll …«
»Mrs. Hamilton.«
»… als ob sie Menschen wären und fühlen könnten.«
»Mrs. Hamilton«, wiederholte Alice, und die ältere Frau blinzelte, als ob sie gerade aufwachte. »Warum ist Virginia im Gefängnis? Was hat sie getan?«
Sie war jetzt völlig wach, die Fragen hatten ihren verletzlichen Körper getroffen wie Hagelkörner ein {21}sonnenwarmes Feld Weizen. »Virginia hat nichts getan. Sie wurde irrtümlich verhaftet.«
»Aber warum?«
»Ich habe es dir doch gesagt. Pauls Telegramm an mich war sehr kurz. Ich kenne die Einzelheiten nicht.«
»Sie hätten Mr. Meecham fragen können.«
»Ich höre die Details lieber von jemandem, der mir und Virginia nähersteht.«
Sie will die Wahrheit gar nicht wissen, dachte Alice. Sie will nur ihre Virginia wiederhaben, das sanfte Kind, das Tiere und Blumen liebte.
Eine Frau mittleren Alters mit Hornbrille und in weißer Uniform betrat das Zimmer. In der Hand trug sie eine Tasse Kaffee. Sie hinkte, bewegte sich jedoch sehr rasch, als könne sie die Behinderung damit kaschieren, und auf jeder Wange prangte ein münzgroßer roter Fleck.
»Hier. Das wird dich wärmen.« Sie sprach etwas zu laut, um ihre Verlegenheit wegen des Hinkens zu verbergen.
Mrs. Hamilton nickte dankend. »Carney, dies ist Alice Dwyer. Alice, Mrs. Carnova.«
Die Frau schüttelte kräftig Alices Hand. »Nennen Sie mich Carney. Das tun alle.«
»Carney«, erklärte Mrs. Hamilton, »ist Pauls Arzthelferin und eine alte Freundin von mir.«
»Er rief vor ein paar Minuten aus dem Krankenhaus an. Er ist auf dem Weg.«
»Wir sind alte Freunde, nicht wahr, Carney?«
Die münzförmigen Flecken auf den Wangen der Frau vergrößerten sich. »Gewiß. Und ob wir das sind.«
»Was macht dich dann so nervös?«
»Nervös? Nun, jeder ist hin und wieder mal nervös, {22}nicht wahr? Ich hatte einen arbeitsreichen Tag und bin länger geblieben, um auf dich zu warten und alles für dich vorzubereiten und so weiter. Ich bin müde, das ist alles.«
»Wirklich?«
Die beiden Frauen hatten Alice vergessen. Carney sah auf den Fußboden. Die Röte hatte sich über ihr ganzes Gesicht ausgebreitet bis zu den Spitzen ihrer großen blassen Ohren. »Warum bist du gekommen? Du kannst nichts tun.«
»O doch, ich kann. Und ich werde etwas tun.«
»Du weißt nicht, was los ist.«
»Dann erzähl’s mir.«
»Es ist eine ganz üble Geschichte. Ich wußte, daß sie sich mit Margolis traf. Ich habe sie gewarnt. Ich drohte, dir zu schreiben und dir alles zu erzählen, und daß du kommen und ihr die Hölle heiß machen würdest.«
»Du hast mir nichts erzählt.«
Carney breitete die Arme aus. »Wie hätte ich das können? Sie ist sechsundzwanzig, das ist zu alt, um jemanden mit der Drohung, alles Mama zu erzählen, bei der Stange zu halten.«
»Wußte Paul von diesem – diesem Mann?«
»Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Er sagte nie etwas.« Sie zupfte ein trockenes Blatt von der Yamspflanze, die vom Kaminsims herabwuchs. »Virginia hört nicht mehr auf mich. Sie mag mich nicht.«
»Das ist albern. Sie hing doch immer an dir.«
»Jetzt nicht mehr. Vergangene Woche nannte sie mich einen herumschnüffelnden alten Windhund. Sie behauptet, ich hätte mich nicht um diesen Job beworben, weil Carnova mich in Detroit sitzengelassen hat, sondern weil du mich geschickt hättest, um ihr nachzuspionieren.«
{23}»Das ist lächerlich«, sagte Mrs. Hamilton knapp. »Ich werde morgen mit Virginia reden und dafür sorgen, daß sie sich entschuldigt.«
»Entschuldigt?« explodierte Carney. »Was glaubst du eigentlich, was das hier ist, irgend so ein kleines Spiel? O Gott.« Sie bedeckte ihr Gesicht mit den Händen, halb lachend, halb weinend, und dann begann sie laut und schnell zu hicksen. »Oh – verdammt – oh – verdammt.«
Mrs. Hamilton wandte sich an Alice. »Wir brauchen alle etwas Ruhe. Komm, ich zeige dir dein Zimmer.«
»Ich – zeige – es – ihr.«
»Gut. Geh mit Carney, Alice. Ich bleibe hier und warte auf Paul.«
Alice machte ein verlegenes Gesicht. »Es war mir sehr peinlich, dazustehen und alles mit anzuhören. Über Virginia, meine ich.«
»Ist schon in Ordnung, es war nicht deine Schuld.« Ein Auto kam die Zufahrt herauf und hielt mit quietschenden Bremsen. »Da kommt Paul. Ich will allein mit ihm sprechen, Carney, wenn es dir nichts ausmacht.«
»Warum – sollte – mir – das – etwas – ausmachen?«
»Und um Himmels willen, atme in eine Papiertüte oder etwas Ähnliches. Gute Nacht.«
Als sie gegangen waren, stand Mrs. Hamilton für einen Augenblick in der Mitte des Zimmers und preßte mit geschlossenen Augen die Fingerspitzen an ihre Schläfen. Sie fühlte sich erschöpft, nicht von der schlaflosen Nacht, die sie hinter sich hatte, oder von der Flugreise, sondern von der Anspannung der Ungewißheit und der noch größeren Anstrengung, so zu tun, als ob alles wieder in Ordnung käme, als ob ein Fehler gemacht worden wäre, der leicht wieder zu korrigieren sei.
{24}Sie ging, um Paul die Tür zu öffnen.
Er kam herein und stampfte den Schnee von seinen Stiefeln, ein untersetzter, kräftig gebauter Mann in einem zerknitterten Trenchcoat mit einem feuchten, unförmigen grauen Hut auf dem Kopf. Er sah wie ein rotgesichtiger Bauer aus, der von der abendlichen Arbeit zurückkam und anstelle einer Laterne eine Arzttasche trug.
Er hatte eine gefaltete Zeitung unter dem Arm. Mrs. Hamilton sah auf die Zeitung und wieder weg.
»Hallo, Paul.« Sie schüttelten sich kurz die Hand.
»Ich bin froh, daß du hergekommen bist.« Er hatte eine tiefe, warme Stimme und sprach sehr langsam, jedes Wort vorsichtig abwägend wie eine Verordnung. »Tut mir leid, daß ich dich nicht abholen konnte – Mutter.«
»Du weißt, du brauchst mich nicht Mutter zu nennen, wenn du dich unbehaglich dabei fühlst.«
»Dann lasse ich es.« Er legte Hut und Mantel über den Stuhl und stellte seine Arzttasche obenauf. Aber die Zeitung behielt er in der Hand und rollte sie ganz eng zusammen, als wolle er sie als Waffe benutzen, um eine Fliege totzuschlagen oder um einen ungehorsamen jungen Hund zu bestrafen.
Mrs. Hamilton ließ sich plötzlich schwer auf einen Stuhl fallen, als wäre die Zeitung gegen sie erhoben worden. Das Licht der Rattanlampe traf ihr Gesicht mit der Schärfe einer Ohrfeige. »Was ist das für eine Zeitung, die du da hast?«
»Eines der Detroiter Sensationsblätter.«
»Steht es …?«
»Es steht alles hier drin, ja. Nicht auf der Titelseite.«
»Sind Bilder dabei?«
»Ja.«
{25}»Von Virginia?«
»Eins.«
»Laß mich mal sehen.«
»Es ist nicht sehr schön«, sagte er. »Vielleicht solltest du es dir lieber nicht ansehen.«
»Ich muß es sehen.«
»Na schön.«
Die Bilder nahmen die ganze zweite Seite ein. Es waren insgesamt drei. Eins, mit der Bildunterschrift ›Todeshaus‹, zeigte ein kleines Cottage, dessen Dach dick verschneit und dessen Fenster ganz mit Eis überzogen waren. Das zweite war eine Aufnahme von einem eleganten dunkelhaarigen Mann, der in die Kamera lächelte. Er wurde als Claude Ross Margolis identifiziert, zweiundvierzig, prominenter Bauunternehmer, Opfer tödlicher Messerstiche.
Das dritte Bild zeigte Virginia, obwohl niemand sie darauf erkannt hätte. Sie saß vornübergebeugt auf einer Art Bank, ihre Hände bedeckten das Gesicht, und ein Gewirr schwarzer Haare fiel auf ihre Handgelenke. Sie trug Abendschuhe – an einem fehlte der Absatz –, ein langes locker fallendes Kleid und einen hellen Mantel. Der Mantel, das Kleid und einer der Schuhe wiesen dunkle Flecken auf, die wie Schmutz aussahen. Über dem Bild standen die Worte ›Zum Verhör festgenommen‹, und darunter war Virginias Name angegeben, Mrs. Paul Barkeley, sechsundzwanzig, Arztfrau aus Arbana, angeblich in den Tod von Claude Margolis verwickelt.
Als Mrs. Hamilton schließlich sprach, war ihre Stimme ein dünnes, krächzendes Flüstern: »Ich habe tausend solcher grauenhaften Bilder in meinem Leben gesehen, aber ich hätte nie gedacht, daß sich eines Tages eines davon für mich schrecklich von den anderen unterscheiden würde.«
{26}Sie sah zu Barkeley hoch. Sein Gesichtsausdruck hatte sich nicht verändert, er zeigte keine Reaktion darauf, daß das Mädchen auf dem Bild seine Frau war. Mrs. Hamilton fühlte einen leisen Groll in sich aufsteigen: Es ist ihm gleichgültig – er hätte besser auf Virginia achtgeben sollen – dann wäre das nie passiert. Warum war er nicht bei ihr? Oder warum behielt er sie nicht zu Hause?
Als sie sprach, machte sie keinen Versuch, ihren Groll zu verbergen: »Wo warst du, als es geschah, Paul?«
»Hier zu Hause. Im Bett.«
»Du wußtest, daß sie ausgegangen war.«
»Sie ist in letzter Zeit viel ausgegangen.«
»Hat es dir nichts ausgemacht?«
»Natürlich hat es mir etwas ausgemacht. Leider muß ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich kann es mir nicht leisten, hinter Virginia herzulaufen, um die Scherben einzusammeln.« Er ging zur Einbaubar in der Südecke des Zimmers. »Nimm einen Schlummertrunk mit mir.«
»Nein, danke. Ich – diese Flecken auf ihren Kleidern, ist das Blut?«
»Ja.«
»Wessen Blut?«
»Seins. Margolis’.«
»Woher wissen sie das?«
»Es gibt Labortests, mit denen man feststellen kann, ob es sich um menschliches Blut handelt und welche Blutgruppe es ist.«
»Aha. Nun, jedenfalls bin ich froh, daß es nicht ihres ist.« Sie zögerte, sah auf die Zeitung und wieder weg, als ob sie den Bericht gern selbst lesen würde, jedoch Angst hätte, es zu tun. »Sie wurde nicht verletzt?«
»Nein. Sie war betrunken.«
{27}»Betrunken?«
»Ja.« Er goß etwas Bourbon in ein Glas und fügte Wasser hinzu. Dann hielt er das Glas gegen das Licht, als suche er in einem Reagenzglas nach Mikroben. »Ein Streifenwagen der Polizei griff sie auf. Sie war ungefähr eine Viertelmeile von Margolis’ Cottage entfernt und lief in der Gegend umher. Es schneite stark; sie muß sich verirrt haben.«
»Sie lief nur mit diesem leichten Mantel und den dünnen Schuhen im Schnee herum? O Gott, ich kann es nicht ertragen.«
»Das mußt du«, sagte er ruhig. »Virginia ist auf dich angewiesen.«
»Ich weiß, ich weiß, daß sie das ist. Erzähl mir – den Rest.«
»Da ist nicht viel zu erzählen. Margolis’ Leiche war zu dem Zeitpunkt schon entdeckt worden, weil irgend etwas mit dem Kamin im Cottage nicht in Ordnung war. Es qualmte sehr stark, jemand bemerkte den Rauch, und die Highway-Streife fand den toten Margolis drinnen, erstochen mit seinem eigenen Messer. Er lebte in dem Cottage, das direkt hinter der Stadtgrenze liegt, weil sein eigenes Haus zur Zeit unbewohnt ist. Seine Frau macht Urlaub in Peru.«
»Seine Frau. Er war verheiratet?«
»Ja.«
»Hatten sie – Kinder?«
»Zwei.«
»Betrunken«, flüsterte Mrs. Hamilton. »Und ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Das muß ein Irrtum sein, bestimmt, ganz bestimmt ist es ein Irrtum.«
»Nein. Ich habe sie selbst gesehen. Der Sheriff rief mich {28}gegen drei Uhr heute morgen an und sagte mir, daß sie verhaftet worden sei und weshalb. Ich schickte dir sofort das Telegramm und fuhr dann zum Kreisgefängnis, wohin sie sie gebracht hatten. Sie war immer noch betrunken, erkannte mich nicht einmal. Oder tat jedenfalls so. Wie kann man bei Virginia wissen, was wirklich ist und was nicht?«
»Ich weiß es.«
»Tatsächlich?« Er nippte an seinem Drink. »Der Sheriff und ein paar Hilfssheriffs waren dort und versuchten eine Aussage von ihr zu bekommen. Was ihnen natürlich nicht gelang. Ich sagte ihnen, daß es dumm sei, jemanden in diesem Zustand zu verhören, also ließen sie sie wieder ins Bett gehen.«
»In einer Zelle? Mit Dieben und Prostituierten und …«
»Sie war allein. Die Zelle – das Zimmer, besser gesagt, war sauber. Ich habe es gesehen. Und die Aufseherin, ich glaube, sie nannten sie Hilfssheriff, scheint eine anständige junge Frau zu sein. Die Umgebung ist nicht ganz das, was Virginia gewohnt ist, aber sie leidet nicht. Mach dir darüber keine Sorgen.«
»Du scheinst dir überhaupt keine Sorgen zu machen.«
»Ich habe mir lange Zeit nichts anderes als Sorgen gemacht.« Er zögerte, während er durch den Raum zu ihr hinübersah und sich fragte, wieviel von der Wahrheit sie hören wollte. »Du sollst jetzt ruhig wissen – wenn ich es dir nicht erzähle, wird es Virginia tun –, daß dieses erste Jahr unserer Ehe ein schlimmes Jahr war. Das schlimmste in meinem Leben und in Virginias vielleicht auch.«
Mrs. Hamiltons Gesicht wirkte zerknittert, wie Papier in einer Faust. »Warum hat mir das nie jemand gesagt? Virginia schrieb mir, Carney schrieb. Niemand hat mir {29}etwas erzählt. Ich dachte, alles ginge gut, Virginia sei bei dir zur Ruhe gekommen und glücklich, endlich glücklich. Nun stelle ich fest, daß ich getäuscht worden bin. Sie kam nicht zur Ruhe. Sie trieb sich mit anderen Männern herum, betrank sich, benahm sich wie ein billiges Flittchen. Und jetzt das, diese letzte Schande. Ich weiß einfach nicht, was ich tun, was ich denken soll.«
Er sah die Frage in ihren Augen und wandte sich ab, während er sein Glas wieder gegen das Licht hielt.
»Ich habe getan, was ich konnte, ich habe einen Anwalt engagiert.«
»Ja, aber was für einen? Einen Mann ohne Erfahrung.«
»Er wurde mir empfohlen.«
»Er ist nicht gut genug. Virginia sollte den besten haben.«
»Das sollte sie allerdings«, sagte er trocken. »Leider kann ich mir den besten nicht leisten.«
»Aber ich kann es. Geld spielt keine Rolle.«
»Diese Idee, daß Geld keine Rolle spielt, ist ein wenig altmodisch, fürchte ich.« Er setzte sein leeres Glas ab. »Da ist noch ein anderer Punkt. Wenn Virginia unschuldig ist, wird sie den besten nicht brauchen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, es ist Zeit für mich, ins Bett zu gehen. Ich muß früh raus. Carney hat dir dein Zimmer gezeigt, nehme ich an?«
»Ja.«
»Mach es dir so bequem wie möglich. Das Haus gehört dir«, fügte er mit einem schiefen kleinen Lächeln hinzu. »Mit Hypothek und allem. Gute Nacht, Mrs. Hamilton.«
»Gute Nacht.« Sie zögerte den Bruchteil einer Sekunde, bevor sie hinzufügte »mein Junge.«
{30}Er ging aus dem Zimmer. Sie folgte ihm mit den Augen, die jetzt völlig trocken waren und hart und grau wie Granit.
Rotgesichtiger Bauer, dachte sie gehässig.
{31}3
Im Sommer waren die roten Backsteine des Gerichtsgebäudes mit schmutzigem Efeu bedeckt und im Winter mit schmutzigem Schnee. Das Haus war auf einem großen Platz errichtet worden, der ursprünglich den Mittelpunkt der Stadt bildete. Aber die Stadt hatte sich nach Westen ausgedehnt und das Gerichtsgebäude wie ein häßliches Stiefkind im Osten zurückgelassen, wo es nun zwischen Möbelwarenhäusern, Tankstellen und Bier-und-Sandwich-Cafés ganz auf sich selbst gestellt war.
Auf der anderen Straßenseite, gegenüber vom Haupteingang, befand sich ein Supermarkt. Meecham parkte sein Auto davor. Die Türen des Ladens waren noch geschlossen, obwohl im Inneren bereits Betriebsamkeit zu erkennen war. Zwischen den Regalreihen bewegten sich die Angestellten, schläfrig und apathisch an diesem Wintermorgen, der sich von der Nacht kaum unterschied. Die Straßenlaternen brannten noch, der Himmel war dunkel, die Luft drückend und klamm.
Meecham überquerte die Straße. Er fühlte sich träge und wünschte, er hätte im Bett bleiben können, bis es hell war.
Vor dem Gerichtsgebäude war ein zehn Meter hoher Weihnachtsbaum aufgestellt worden, den vier Insassen des Kreisgefängnisses unter der Aufsicht eines Hilfssheriffs {32}mit bunten Lichtkabeln bespannten. Der Hilfssheriff trug flauschige orangene Ohrenschützer und stampfte rhythmisch mit den Füßen, entweder um sich warm zu halten oder weil es sonst nichts zu tun gab.
Als Meecham näher kam, unterbrachen alle vier Gefangenen ihre Arbeit, um ihn anzugaffen, so wie sie es bei jedem taten, der vorbeikam, denn sie wußten, daß sie viel Zeit und durch eine Verzögerung nichts zu verlieren hatten.
»Ein bißchen Tempo, Jungs, ja?« Der Hilfssheriff klatschte in die Hände. »Was ist los, Joe, bist du gelähmt oder was?«
Joe sah von der Spitze der Leiter herunter, lachte und entblößte dabei seine oberen Zähne, die am Zahnfleischrand golden glänzten. »Wie würde es Ihnen gefallen, jetzt mit einem hübschen Rum-Toddy drinnen zu sitzen, Huggins? Mmm?«
»Das Zeug rühre ich nie an«, erwiderte Huggins. »Morgen, Meecham.«
Meecham nickte. »Morgen.«
»Schon fleißig so früh am Tage?«
»Ganz recht.«
Huggins wies mit dem Daumen auf die Leiter. »Ich für meinen Teil versuche diesen faulen Hunden den Geist der Weihnacht einzuflößen.«
Drei von den Männern lachten. Der vierte spuckte in den Schnee.
Meecham ging ins Haus. Die Dampfheizung war voll aufgedreht worden, und die altmodischen Radiatoren rasselten wie Geister mit ihren Ketten. Meecham schwitzte, und seine Nasenschleimhäute fühlten sich heiß und trocken an, als ob er Feuer eingeatmet hätte.
{33}Der Hauptkorridor roch nach Holz und frischem Wachs, doch als er die Treppe zur Linken hinabstieg, verdrängte ein neuer Geruch die anderen, der Geruch eines Desinfektionsmittels.
Die Tür mit der Aufschrift ›County Sheriff‹ stand offen. Meecham betrat den Vorraum und nahm auf einem der gradlehnigen Stühle Platz, die wie stumme und unbewegliche Gefangene an der Wand aufgereiht waren. Es war niemand zu sehen, obwohl ein Hut und ein Mantel an einem Kleiderständer in der Ecke hingen und der letzte Zentimeter einer Zigarette in einem Aschenbecher auf der zernarbten Holztheke vor sich hin schwelte. Meecham betrachtete die Zigarette, machte aber keine Anstalten, sie auszudrücken.
Plötzlich wurde die Tür zum Privatbüro des Sheriffs aufgerissen, und Cordwink selbst kam heraus. Er war ein großer, spindeldürrer Mann mit grauem, kurz gestutztem Haar, um den Lockenansatz zu verbergen. Auch seine Wimpern kräuselten sich und verliehen seinen kalten Augen einen falschen Anschein von Naivität. Er hatte fünfzig Jahre eines harten Lebens hinter sich, die man ihm aber nicht ansah, außer wenn er müde war oder sich mit seiner Frau wegen Geld oder der Kinder gestritten hatte.
»Was machen Sie denn so früh hier?« fragte Cordwink.
»Ich wollte der erste sein, der Ihnen frohe Weihnachten wünscht.«
»Ihr gescheiten jungen Anwälte, bei euch muß man sich die ganze Zeit kaputtlachen. Bah.« Er blickte finster auf die glimmende Zigarette im Aschenbecher. »Was zum Teufel haben Sie vor, wollen Sie das Haus niederbrennen?«
»Es ist nicht meine …«
{34}»Das ist so ziemlich der einzige Weg, Ihre Klientin hier herauszubekommen.«
»Ach ja?« Meecham zündete sich eine Zigarette an und benutzte das erloschene Streichholz, um die glimmenden Tabakreste im Aschenbecher zu zerdrücken. »Haben Sie irgendwelche neuen Informationen ausgegraben?«
»Sollte ich sie Ihnen verraten?« Cordwink lachte. »Ihr verdammten Anwälte könnt eure Schnüffelarbeit selber machen.«
»Sind wir etwas mißmutig heute morgen, Sheriff?«
»Ich bin in einem miesen Geschäft, ich treffe miese Leute, also bin ich mißmutig. Na und?«
»Dann haben Sie keine Aussage von Mrs. Barkeley.«
»Sicher habe ich eine Aussage bekommen.«
»Zum Beispiel?«
»Zum Beispiel, daß ich ein ungebildeter Spießer bin.«
Meecham grinste.
»Das finden Sie lustig, wie, Meecham?«
»In Maßen.«
»Nun, zufällig habe ich meinen akademischen Grad an der Universität von Wisconsin gemacht, Prüfungsjahrgang ’22.«
»Komisch, ich dachte, Sie hätten in Harvard studiert. Sie reden und handeln wie ein …«
»Ihr gescheiten jungen Anwälte bringt mich noch um«, knurrte er. »Nun, es ist mir gleich, ob sie eine Aussage macht oder nicht. Wir haben sie.«
»Vielleicht.«
»Selbst Sie müßten intelligent genug sein, das zu erkennen. Suchen Sie in Ihren Büchern lieber nach irgendwelchen ausgefallenen Notwehrdetails. Sorgen Sie dafür, daß Sie eine schöne dumme Jury bekommen, dann machen Sie {35}sich über die Bullen lustig, drücken Sie auf die Tränendrüse, zitieren Sie die Bibel – bah! Es macht mich krank. Was für ein Beruf, die Justiz zu behindern.«
»Ich habe die Titelmelodie schon einmal gehört, Sheriff. Schenken wir uns den zweiten Refrain.«
»Sie denken, ich singe falsch, wie?«
»Und ob Sie das tun.«
Cordwink drückte einen Summer auf dem Schaltertisch. »Mit Notwehr werden Sie nicht durchkommen. Das Mädchen hat nicht die geringste Verletzung, keinen Kratzer, keinen Schnitt, keine Prellung.«
»Ich muß nicht beweisen, daß es sich um eine reale und unmittelbar drohende Gefahr für ihre Person handelte, nur daß Mrs. Barkeley die Gefahr so einschätzte und Grund zu dieser Einschätzung hatte.«
»Sie sind noch nicht in der Verhandlung, also hören Sie mit dem Kauderwelsch auf. Es macht mich krank.«
Der Sheriff drückte erneut den Summer, und kurz darauf betrat eine junge Frau in einem grünen Kleid, vergnügt einen Schlüsselring schwingend, den Raum.
Sie zeigte ihre schönen weißen Zähne und begrüßte den Anwalt. »Sie schon wieder, Mr. Meecham.«
»Richtig.«
»Sie sollten wirklich hier einziehen.« Sie wandte ihr Lächeln Cordwink zu. »Habe ich nicht recht, Sheriff?«
»Mehr als Sie denken«, sagte Cordwink. »Wenn es eine Gerechtigkeit gäbe, würde es hier von Anwälten nur so wimmeln.« Er ging auf das Büro zu. »Führen Sie den Gentleman in Mrs. Barkeleys Gemach, Miss Jennings.«
»O.K.« Cordwink knallte seine Tür zu, und Miss Jennings fügte mit einem theatralischen Flüstern hinzu: »Du meine Güte, sind wir heute aber gereizt.«
{36}»Muß das Wetter sein.«
»Wissen Sie, das glaube ich auch, Mr. Meecham. Mir persönlich macht das Wetter nichts aus. Ich bin darüber erhaben. Wenn der Winter kommt, kann der Frühling da fern sein?«
»Da ist was dran.«
»Shakespeare. Ich bewundere Dichtung.«
»Gut, gut.« Er folgte ihr den Flur entlang. »Wie geht’s Mrs. Barkeley?«
»Sie hat gut geschlafen und ausgiebig gefrühstückt. Ich glaube, sie hat ihren Kater überwunden. Es war ein Prachtexemplar.« Sie entriegelte die Tür am Ende des Ganges und hielt sie für Meecham auf, damit er vorausgehen konnte. »Sie hat sich meinen Lippenstift geborgt. Das ist ein gutes Zeichen.«
»Vielleicht. Aber ich weiß nicht wofür.«
»Oh, Sie sind ja bloß zynisch. So viele Leute sind zynisch. Mutter sagt oft zu mir, Mollie, meine Liebe, du kamst lächelnd zur Welt und wirst sie wahrscheinlich lächelnd verlassen.«
Meecham schauderte. »Glückliches Mädchen.«
»Ja, ich habe Glück. Ich kann einfach nicht anders, als die positive Seite zu sehen.«
»Gut für Sie.«
Die Frauenabteilung des Zellenblocks war leer bis auf Virginia. Miss Jennings schloß die Tür auf. »Hier ist wieder dieser Mann, Mrs. Barkeley.«
Virginia saß auf ihrem schmalen Bett und las eine Zeitschrift oder tat zumindest so. Sie trug das gelbe Wollkleid und die braunen Sandalen, die Meecham ihr am vergangenen Nachmittag gebracht hatte, und ihr schwarzes Haar war sorgfältig von der hohen Stirn nach hinten gekämmt. {37}Sie hatte Miss Jennings Lippenstift zu ihrem Vorteil benutzt und den Mund voller und breiter gemalt, als er eigentlich war. Im Licht der einsamen Glühbirne an der Decke wirkte ihre Haut glatt und kalt wie Marmor. Es war Meecham unmöglich zu erraten, was sie empfand oder was hinter ihren schönen, weit auseinander liegenden Augen vor sich ging.
Sie hob den Kopf und bedachte ihn mit einem langen, unfreundlichen Blick, der ihn an Mrs. Hamilton erinnerte, obwohl keine physische Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter zu erkennen war.
»Guten Morgen, Mrs. Barkeley.«
»Warum holen Sie mich hier nicht raus?« sagte sie ausdruckslos.
»Ich bemühe mich.«
Er trat ein, und Miss Jennings schloß die Tür hinter ihm, ohne sie jedoch zu verriegeln. Sie zog sich ans andere Ende des Raumes zurück und setzte sich auf eine Bank in der Nähe des Ausgangs. Sie summte ein paar Takte einer Melodie, ganz zwanglos, um Meecham und Virginia zu zeigen, daß sie nicht die Absicht hatte zu lauschen. I’ll take the high road …
»Sie singt«, sagte Virginia. »Sie pfeift. Sie zitiert Gedichte. Sie ist so fröhlich, daß es mich wahnsinnig macht. Sie müssen mich hier rausholen.«
»Ich bemühe mich.«
»Das sagten Sie schon.«
»Jetzt wiederhole ich es. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich setze?«
»Ich habe nichts dagegen.«
Er setzte sich ans Fußende des Bettes. »Was macht der Kater?«
{38}»Es geht mir wieder gut. Aber hier drin gibt’s Flöhe oder so was. Ich habe überall diese roten Stiche an den Fußgelenken. Haben Sie daran gedacht, das DDT mitzubringen?«
»Sicher.« Er zog die kleine Flasche mit DDT aus seiner Manteltasche und gab sie ihr.
Stirnrunzelnd las sie das Etikett. »Es ist nur zweiprozentig.«
»Ich konnte kein stärkeres bekommen.«
»Das konnten Sie schon.«
»Also gut, aber ich hab’s nicht.«
»Wovor hatten Sie Angst? Daß ich es aus Reue trinken würde?«