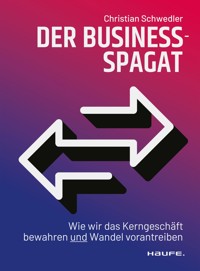19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Worum geht es?
Während unsere Unternehmen noch perfektionieren, kalkulieren und absichern, zieht der globale Wettbewerb vorbei – wagemutiger, hungriger, rebellischer. Christian Schwedler stellt die Management-Welt auf den Kopf: Es ist nicht immer von Vorteil, der „Schlauste“ zu sein. Denn Perfektion und Expertise machen auf Dauer betriebsblind. Unsicherheit ist kein Manko – sie ist die Voraussetzung für Fortschritt. Ungewöhnliche Beispiele zeigen, wie ausgerechnet diejenigen zum Erfolg führen, die wir so gerne belächeln: Die Naiven, die das Undenkbare fragen. Die Draufgänger, die schon mal loslegen. Die Piraten, die Regeln biegen. BE BRAVE stiftet an, echtes Unternehmertum wiederzuentdecken. Mit weniger Excel und mehr Action. Wer die Zukunft gestalten will, muss sie riskieren. Bist du bereit?
„Wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst, wächst der Mut selbst unmögliches zu wagen. Dieses Buch zeigt, wie wir damit über uns hinauswachsen - probieren Sie es aus.“
Frank Dopheide, ehem. MD Handelsblatt, Founder human unlimited
„Unlearning Management. Darum geht es in einer ungewissen Zukunft. Nicht die perfekte Planung wird gewinnen, sondern die Kunst, Unsicherheit zu umarmen."
Holger Volland, CEO brand eins
Vom Punk-Rocker mit Plattenvertrag zum Keynote-Speaker und Business-Pionier:
Christian Schwedler ist Thought-Leader und einer der gefragtesten Top-Speaker zu den Themen Transformation, beidhändige Führung und Ambidextrie. Als Business-Pionier zeigt er namhaften Firmen mutige Wege in die Zukunft, ohne die Brücken zum Altbewährten zu verbrennen. Er steht regelmäßig auf den großen Bühnen der TopKongresse, darüber hinaus unterstützt er als Stratege einen DAX-Konzern beim Wandel von der Maschinenbau-Legacy zur Tech-Company. Sein Studium finanzierte er mit einer Parallelkarriere als Punkrocker mit einem Plattenvertrag bei Universal Music. Nach seinem Diplom war er von 2004 bis 2012 auf einer beruflichen Weltreise mit den Stationen Sydney, London und Santiago de Chile. Heute lebt er in München.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Inhalt
Es ist nicht immer von Vorteil, der »Schlauste« zu sein
Während unsere Unternehmen noch perfektionieren, kalkulieren und absichern, zieht der globale Wettbewerb vorbei – wagemutiger, hungriger, rebellischer. Christian Schwedler stellt die Management-Welt auf den Kopf: Es ist nicht immer von Vorteil, der »Schlauste« zu sein. Denn Perfektion und Expertise achen auf Dauer betriebsblind. Unsicherheit ist kein Manko – sie ist die Voraussetzung für Fortschritt. Ungewöhnliche Beispiele zeigen, wie ausgerechnet diejenigen zu wirtschaftlichen Erfolgen führen, die wir so gerne belächeln:
Die Naiven, die das Undenkbare fragen.Die Draufgänger, die schon mal loslegen.Die Piraten, die Regeln biegen.Dabei entlarvt der Autor die unbewussten Erfolgsmuster dieser Pioniere. BE BRAVE hilft Führungskräften und Unternehmensgestaltern, mutiger und schlagkräftiger nach vorne zu gehen. Mit weniger Excel und mehr Action. Wer die Zukunft gestalten will, muss sie riskieren. Bist du bereit?
BE BRAVE!
Wie Mut und Sorglosigkeit unsere Unternehmen retten
von
Christian Schwedler
VERLAG FRANZ VAHLEN MÜNCHEN
5Inhalt
Check-In Warum dieses Buch unsere Wirtschaft rettet
Du folgst veralteten Glaubenssätzen
3 Entwicklungen, die sofortiges Handeln verlangen
Wieso es mutig ist, dieses Buch zu lesen
1. Akt Wie konnte es nur soweit kommen?
Auch DAX war mal Start-up
Old Economy & Wirtschafts-Viagra
Diese Idee ist nichts für Feiglinge
2. Akt Die Mutigen zeigen uns den Weg
Christoph Kolumbus hatte kein GPS
Die KI Alpha Go gewann, weil sie nichts wusste
David gegen Goliath und die Courage der Aussichtslosen
Apollo 13: Wenn das Handbuch nutzlos wird
Die Golden-Age-Piraten & strategischer Ungehorsam
6
Das Gleichnis des Königs: Führung ohne Dienstwagen
The Queen of Shitty Robots & das Umarmen der Imperfektion
3. Akt Zurück nach Vorne
Die Erfolgsessenz: Schlägt Mut den Masterplan?
Digitaler Sprung oder analoger Bauchklatscher?
Licht im Tunnel: Machen wir was draus!
Check-Out
Ich: Mein Werdegang zwischen Mut & Sorglosigkeit
Du: Deine erste Mutprobe
Zum Autor
Anmerkungen
Mutige Stimmen zu BE BRAVE
7wenn die eingetretenen Wege
nicht mehr zum Ziel führen
ist die Zeit reif
den Status Quo zu hinterfragen
und Glaubenssätze neu zu verhandeln
genau an diesem Punkt stehen wir gerade
BE BRAVE ist eine Einladung
genau das zu tun
kein Fachbuch als vielmehr
Essay und Perspektivwechsel
angefeuert durch eigene Erfahrungen
bestärkt durch Hilferufe Anderer
inspiriert durch Gedankenspiele
und naive Fragen
selten sind Dinge unverrückbar oder
nur in einer Art und Weise zu verstehen
die meisten Verhaltensweisen und Ansichten
sind nur antrainiert
leichtfertig übernommen
eingebrannt durch ständige Wiederholung
um das aufzubrechen
braucht es eine starke Gegenposition
mitunter polarisierend
eine unkonventionelle Idee
9Check-InWarum dieses Buch unsere Wirtschaft rettet
Ein Buch über Mut braucht einen unkonventionellen Beginn. Soviel ist klar. Also starte ich nicht mit den üblichen Heldengeschichten eines Steve Jobs oder Elon Musk. Ich starte mit einer alternativen Gattung wagemutiger Protagonisten aus dem Mittelalter: Marinesoldaten und Piraten. Die eine Gruppe ist
organisiert, fair, demokratisch, modern, fürsorglich, verlässlich und die andere
diktatorisch, unfair, ausbeuterisch, asozial, unzuverlässig.
Sehr wahrscheinlich hast Du gedanklich folgende Zuordnung getroffen: Die erste Aufzählung beschreibt die Marinesoldaten, die zweite die Piraten. Damit bist Du in bester Gesellschaft. In diversen Workshops habe ich dieselbe Fragestellung mit gestandenen Führungskräften durchgeführt. Das Ergebnis war, wenig überraschend, immer gleich. Die Marinesoldaten sind offensichtlich »die Guten«, die Piraten »die Bösen«, stehen sie doch bekanntermaßen für gemeine und brutale Haudegen und Psychopaten, die mit Augenklappe und Holzbein fremde Schiffe 10ausrauben. Sie stehen stellvertretend für Boshaftigkeit, Schmarotzertum und Anarchie, für Aussteiger, die ein etabliertes, faires, rechtmäßiges System anarchisch attackieren, nur um sich zu bereichern und Chaos zu stiften.
Aber ist das wirklich so?
In einem späteren Kapitel schauen wir uns das genauer an. Vielleicht gehen wir hier zu leichtgläubig falschen Narrativen auf den Leim. Vielleicht haben sich stereotype Bilder in uns eingebrannt, die unsere Realität falsch abbilden. Was wäre, wenn die Marinesoldaten in Wirklichkeit die diktatorische, unfaire, ausbeuterische, asoziale und unzuverlässige Gruppe darstellte? … und die Piraten »die Guten« waren? Unvorstellbar, oder? Passt gar nicht in unser Weltbild. Wir werden erkennen, wie ein differenzierterer Blick auf die Piraterie ganz neue Erkenntnisse liefert und unsere Sichtweisen relativiert. Dabei werden wir auch einsehen, dass wir viel zu oft und leichtfertig Glaubenssätzen folgen, die in die Sackgasse führen. Und wir werden sogar sehen, dass Führungskräfte so einiges von Piraten lernen sollten!
Du folgst veralteten Glaubenssätzen
Auch und insbesondere unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt ist gefangen in festgefahrenen Glaubenssätzen, die sich hartnäckig halten. Der größte Irrtum? Dass sich unser dynamisches Umfeld mit genug Planung, Kontrolle und Effizienz bändigen lässt. Die meisten Manager denken immer noch, komplexe Probleme lassen sich durch komplizierte Prozesse lösen. Unsere Organisationen sind somit zu gewaltigen Planungs- und Steuerungsapparaten verkommen. Diese haben ein Ziel: Jedwede Überraschung zu verhindern, jedwede Abweichung von Vorgaben zu unterdrücken und den ganzen Laden präzise auf Spur zu halten. Unsere Business-Welt hat sich in ein Bollwerk gegen Überraschungen verwandelt.
11Wer Fehler macht, wird ausgetauscht.
Wer Fragen stellt, wird misstrauisch beäugt.
Der Mensch wird zur austauschbaren Ressource. Befehle kommen von oben, unten wird ausgeführt. Innovation? Nur, wenn sie vorher fünfmal abgesichert, dreimal genehmigt und in KPIs gepresst wurde. Zahlen haben immer Recht. Was nicht messbar ist, hat keinen Wert. Die rechte Gehirnhälfte haben wir lieber gleich komplett aus dem Business verbannt und somit Intuition, Emotion, Naivität und Kreativität abgeschafft. Die heilige Dreifaltigkeit besteht aus Hierarchie, Controlling und Effizienz. Wer daran rüttelt begeht Gotteslästerung und ist damit längst vom Hofstaat verbannt. Die dazu gehörige »Religion« heißt: Management. Das Gegenteil ist übrigens Unternehmertum. Also dieses unberechenbare, riskante und tollkühne Unterfangen. Das ist Managern ein Dorn im Auge, weil kaum planbar, kaum kontrollierbar, weil fehleranfällig. Alles Störfaktoren, die den geordneten Betriebsablauf belästigen und die prognostizierten Quartalszahlen unterwandern. In etablierten Unternehmen geht Verlässlichkeit grundsätzlich vor Pioniergeist. Doch die Frage ist: Ist das, was uns hierher gebracht hat, auch das, was uns weiterbringt?
12Unternehmer denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen.
13Das effizienzgetriebene Management hat über Jahrzehnte ganz ordentlich funktioniert und damit auch den Glauben an die eigene Unfehlbarkeit ins Unerschütterliche zementiert. Leider gibt es da ein kleines Problem: Unser Umfeld ist inzwischen derart volatil, dynamisch und unberechenbar, dass dieses Vorgehen zunehmend ins Leere läuft. Wenn du ständig alles unter Kontrolle hast, bist du zu langsam. Wenn wir uns ehrlich fragen, wo uns diese Denkschule hingebracht hat, müssen wir sagen: in eine Sackgasse.
Es war einmal …
Es war einmal ein blühendes Land voller Optimismus, Tatendrang und Pioniergeist: unser Land. Als die Engländer die Industrialisierung entfachten, nutzten wir diesen Fortschritt, um zur führenden Industrienation aufzusteigen. Industrie-Giganten wie Volkswagen, Mercedes, Siemens und Bayer wurden geboren, um die uns die Welt beneidete. Der VW-Käfer und die Aspirin-Tablette wurden zu weltweiten Aushängeschildern unserer Schaffenskraft und Genialität.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur Vollgas: Das deutsche Wirtschaftswunder war der Inbegriff von Willenskraft und Courage. MADE IN GERMANY wurde zum Gütesiegel unserer Hochleistungskultur, in der Innovation mit Perfektion verschmolz. Der Titel Export-Weltmeister war da fast unvermeidbar, und wurde im Dauer-Abo eingefahren.
Zeitsprung in die Gegenwart
Zeitsprung in die Gegenwart: Das einst so umtriebige Land ist erstarrt. Schlechte Stimmung überall. Es herrscht allgemeine Zukunftsdepression.
Unsere Wirtschaftsdaten lesen sich wie der Wetterbericht für schlechte Laune:
Exportvolumen? Sinkt.
Innovationskraft? Schrumpft.
14Wagniskapital? Fehlanzeige.
Wirtschaftswachstum? Fällt wieder aus.
Das einzige was wächst, sind der Staat und seine Bürokratie. Bei Volkswagen stottert der Motor, die Bahn ist längst entgleist, bei Bayer herrscht chronischer Kopfschmerz und Thyssenkrupp schmilzt. Im Jahre 2004 war Deutschland in der globalen Wettbewerbsfähigkeit noch auf Platz 6. Und heute? Auf Platz 24 durchgereicht.1 In der Künstlichen Intelligenz (KI), der vermeintlich wichtigsten Zukunftstechnologie überhaupt, sind wir wieder einmal nur Randerscheinung. Die sogenannten KI-Giganten kommen allesamt aus den USA und China. Und man kommt aus dem entsetzten Staunen kaum raus: Als ob wir nicht schon die vorherige Digitalisierungswelle verpasst hätten, die Internet-Riesen um Google, Amazon, Airbnb, Uber, Facebook & Co hervorbrachte. Heißt es nicht »Fehler macht man nur einmal.« Das scheint nicht für unsere Wirtschaft zu gelten. Bei der KI sind wir gerne wieder Zaungast. Auf der Tribüne ist es ja auch bequemer. Lass mal andere auf dem Spielfeld den Dreck fressen, aber auch die Lorbeeren und die Trophäen einsammeln. Unser Aktionsplan: Passivität! Wir nennen das dann »strategische Zurückhaltung«. Das kann nicht ernsthaft unser Anspruch und unsere Zukunftsstrategie sein. Oder etwa doch?
15Stell Dir vor, die Zukunft ist eine riesige Party, und wir stehen nicht auf der Gästeliste.
16Faule Antworten
Was haben wir bislang getan, um das Ruder rumzureißen? Das möchte ich mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer beantworten: »Wenn man in einen falschen Zug einsteigt, nützt es nichts, wenn man im Gang entgegen der Fahrtrichtung läuft.«
Übersetzt heißt das: Wir haben ein wenig am kranken System geschraubt, ein paar agile Methoden hier, ein wenig New Work da, und dann noch ein Führungskräfte-Coaching zu New Leadership. Alles nett gemeint. Doch wir müssen die Fahrtrichtung wechseln. Dafür fehlt uns bislang der Antrieb und die Courage. Und so nehmen Frustration und Verunsicherung weiter zu. Mir ist der Ausspruch eines Top-Managers im Ohr, der auf einem Führungskräfte-Seminar verlautbarte: »Herr Schwedler, wie soll ich denn auch den Tapetenwechsel schaffen, wenn gar keine Wand mehr da ist?« Meine Antwort damals: »Warum tapezieren Sie noch? Das ist 80er-Jahre! Wir müssen grundlegend anders an die Sache ran.« Kleine Kurskorrekturen helfen uns nicht (mehr) weiter. Wir brauchen einen ganz neuen Blick. Auf genau dieses schnelle Umdenken kommt es jetzt an. Ich habe einen Vorschlag mitgebracht, der auf den ersten Blick ziemlich unseriös erscheint. Die Idee ist genauso provokant wie einfach:
17Es ist nicht immer von Vorteil, der »Schlauste« zu sein.
18Es ist nicht immer zielführend, alles zu wissen, alles verstehen zu wollen und sich gründlichst abzusichern. Ganz im Gegenteil: die bemerkenswertesten Durchbrüche in Forschung und Wirtschaft erzielen die Mutigen, die Sorglosen und die Waghalsigen. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Belegen.
Im Alter von 17 Jahren setzte sich der Teenager Michelangelo in den Kopf, heimlich menschliche Leichen zu öffnen und zu studieren. Das war zu der Zeit Blasphemie und mit dem Risiko der Todesstrafe verbunden. Doch nur durch das intensive Studium der menschlichen Anatomie konnte der Ausnahmekünstler diese Meisterwerke in Bild und Skulptur erschaffen. Geniestreiche des radikalen Fortschritts sind meist mit Regelbruch, unkonventionellen Vorstößen und Wagemut verknüpft. Leider haben wir unsere Organisationen dahingehend perfektioniert, eben diese Eigenschaften zu verhindern. Unsere Prozesslandschaften, Compliance und Hierarchien gibt es aus einem Grund: Andersdenken, Risiko und Abweichlertum zu vermeiden.
19Wer nur aufs Navi starrt, wird nie die Überholspur nehmen.
20Christoph Kolumbus' Mission würden wir hierzulande und in heutiger Zeit verbieten:
Vages Reiseziel,
unbekannte Rendite,
ungewisse Rückkehr.
War Kolumbus' Mission »schlau«? War sie vollends durchdrungen und abgesichert? Natürlich nicht. Hätte Kolumbus erst mal ein 500-seitiges Risiko-Assessment geschrieben, wären wir heute noch nicht in Amerika. Manchmal braucht es eben eine kühne Vision, eine Portion Naivität und eine gewisse Trotzhaltung. Jetzt erst recht – so das Motto der Wagemutigen. Wer sich nicht traut, bleibt Zuschauer.
Das gilt genauso für unsere Wirtschaft. Um in der heutigen Dynamik mitzuhalten, ist Risikobereitschaft gefragt. Das bedeutet, eben genau dann anzutreten, wenn der Ausgang nicht vollends bekannt ist. Und genau dann anzutreten, wenn der Erfolg nicht garantiert ist. Wir müssen weniger »erwachsen« agieren, sondern viel mehr wie Kinder: mit Neugierde, Spaß am Entdecken, mit naiven Fragen und vor allem: ohne Angst vorm Scheitern. Die Gründungsväter von Mercedes, Siemens, Bayer & Co agierten genauso. Sie waren keine perfektionistischen Manager, sondern tollkühne Träumer, tatkräftige Tüftler und provokante Pioniere. Diese Eigenschaften haben wir verloren. Wir müssen eingestehen: Ausgerechnet die Tugenden, Arbeitsweisen und Kulturprägungen, die uns einst so stark machten, werden uns zunehmend zum Verhängnis. Denn wir hängen zu einseitig an ihnen fest. Wir folgen veralteten Glaubenssätzen, und merken es nicht mal. Wenn es bei den Christen heißt »die Braven kommen in den Himmel«, dann gilt in hiesigen Managementkreisen: »Die Sorgfältigen, Gewissenhaften und Vorsichtigen kommen in den Himmel.«
Perfektionismus, gründliche Planung, Risikoaversion und Absicherung haben uns im Industriezeitalter gute Dienste geleistet. 21Das war zu einer Zeit, in der Telefone noch eine Wählscheibe hatten. In der heutigen Dynamik und digitalen Welt verhindern sie auf Dauer echte Innovation und Wandel. Die internationale Konkurrenz ist flexibler, angriffslustiger, couragierter. Und vor allem: digitaler. Wir haben es uns zu lange in der Komfortzone traditioneller Geschäftsmodelle bequem gemacht. Diese optimieren wir akribisch und stur weiter. Eine solche Obsession macht uns blind für die eigentliche Frage: Welche Probleme lösen wir eigentlich? Und ist dieses Produkt noch die beste Lösung dafür? Wir versuchen neue Herausforderungen mit alten Erfolgsrezepten zu lösen. Das ist, als würde man das Auto erfinden wollen, indem man die Pferdekutsche optimiert. Unsere Wertschöpfung basiert daher weitgehend auf analogen Technologien aus dem Industriezeitalter: Maschinenbau, Chemie und Elektronik. Wir haben nicht ein Digitalunternehmen in den Top 20 der wertvollsten Unternehmen. SAP ist der einzige Vertreter, der zumindest in internationaler Sichtweite ist.
3 Entwicklungen, die sofortiges Handeln verlangen
Wir können die neuen Technologien, insbesondere die Digitalisierung, nicht länger anderen überlassen. Die Weichen für die Wertschöpfung und Einflussnahme des neuen KI- & High-Tech-Zeitalters werden gerade gestellt. Bislang allerdings eher außerhalb Europas. Im Folgenden drei Gründe, warum das keine gute Idee ist und wir schnell ins Handeln kommen müssen:
Fortschritt, ohne uns?
Heute ist der langsamste Tag deines Lebens. Was wie ein Kalenderspruch klingt, stimmt trotzdem. Durch den exponentiellen Fortschritt schlagen Veränderungen immer schneller ein. In geschichtlichen Maßstäben ist das ein völliges Novum. 22300.000 Jahre lang blieb die Welt des Homo Sapiens von der Geburt bis zum Tod unverändert. Ein Jäger und Sammler der Steinzeit nutzte Speer und Faustkeil so wie Generationen vor und nach ihm. Für einen Handwerker im Hochmittelalter galt dasselbe: Werkzeuge und Alltagsgegenstände sahen für seine Vorfahren weitgehend so aus wie für seine Nachfahren. Erst seit der Industrialisierung bröckelte diese Verlässlichkeit. Zum ersten Mal in der Geschichte erfuhren Menschen eine Veränderung, genannt Fortschritt. Dieser hat sich mittlerweile so beschleunigt, dass wir heute tagtäglich damit konfrontiert werden. Und die Beschleunigung geht weiter. Sehr bald werden wir sehr krasse Entwicklungen erleben. Und wenn ich »krass« sage, meine ich das genauso. Die Schnittstelle Gehirn–Computer ist bereits in der Entwicklung. Die Auswirkungen einer immer stärkeren KI sind nicht ansatzweise verstanden und werden unser (Arbeits-) Leben komplett auf den Kopf stellen. Fortschritt in der Biotechnologie wird uns »gottähnlichen« Einfluss auf das Leben selbst verschaffen. Die Chancen hinter all diesen Entwicklungen sind genauso enorm wie die Gefahren. Welche Rolle wollen wir in diesem »Wahnsinn« spielen? Wenn wir nur vom Spielfeldrand zuschauen und anderen die Entwicklung überlassen, degradieren wir uns automatisch zu Opfern. Und wir müssten dann passiv alles erdulden, was andere für uns entscheiden. Ich bevorzuge hier einen Platz auf dem Spielfeld. Doch leider entwickeln wir derzeit ja nicht mal das Know-How der Spielregeln. Daher die Frage:
Wollen wir da nicht mitwirken?
Multikrisen, uns doch egal?
Viele globale Herausforderungen, allen voran die Klimakrise, scheinen mit derzeitigen Mitteln nicht lösbar. Die Menschheit ist nicht nur auf politische Vereinbarungen, sondern auch auf neue Technologien angewiesen. Eine CO2-freie Stromerzeugung durch Kernfusion wäre eine solche Antwort. Bislang sind die 23technischen Herausforderungen zu komplex. Hier kann uns eine gesteigerte Rechenkraft durch Quantencomputer und KI helfen, die ungelösten Aufgaben zu knacken.
Wollen wir da nicht auch einen Beitrag leisten? Wollen wir keinen Einfluss auf die Art der Lösungsfindung?
Wollen wir da nicht mithelfen?
Neue Wertschöpfung, brauchen wir nicht?
Unsere Produktivität, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Erwerbstätigem, fällt ab. Durch Industrialisierung, Automatisierung und erste Digitalisierung konnte die Produktivität über die Jahrzehnte enorm gesteigert werden. Seit einigen Jahren stagniert diese jedoch.2 Das führt zu Verwirrung und Unverständnis, weil wir uns doch gleichzeitig im exponentiellen Fortschritt befinden. All die technologischen Veränderungen sollten eigentlich eine messbare Auswirkung haben. Dieser Widerspruch wird als Produktivitätsparadoxon bezeichnet. Es gibt eine Menge Erklärungsversuche, die mich allesamt nicht so recht überzeugen, mit einer Ausnahme:
Das BIP misst die Wertschöpfung in Waren und Dienstleistungen anhand der Preise in einem Land. Und weil es sich nach den Preisen richtet, verzerrt es den wahren Zuwachs an Wert. Ein Beispiel: Vor rund 25 Jahren gab es einen PC mit 32 MB Arbeitsspeicher. Heute erhalten wir preisbereinigt für eine ähnliche Summe 32 GB, also 32.000 MB. In das BIP fließt aber der gleiche Wert, also der gleiche Preis ein. Die Leistung hat sich dagegen vertausendfacht. Bei gleichbleibenden Preisen hat sich die Lebensqualität und technologische Leistung über die Jahre extrem verbessert. Im BIP wird das nicht erfasst. Dazu kommt, dass viele Leistungen im Rahmen der Digitalisierung gratis angeboten werden, wie Social Media, Software-Nutzungen, Internet-Services, die allesamt nicht in das BIP einfließen. Insofern sollten wir uns fragen, ob die aktuelle Berechnung über das BIP eine zeitgemäße Messgröße darstellt.
24Abgesehen von der Korrektheit von Messgrößen ist eines offensichtlich: Die weitere Digitalisierung, insbesondere der KI, wird massive Produktivitätssteigerungen und auch der Wertschöpfung mit sich bringen. Laut einer McKinsey-Studie ist mit KI bis 2030 ein zusätzlicher globaler Wertschöpfungsbeitrag in Höhe von 13 Billionen US-Dollar möglich.3
Wollen wir da nicht teilhaben?
Bislang war unsere Antwort auf alle drei Fragen, zumindest was die Taten angeht:
»Nein!«
Wieso es mutig ist, dieses Buch zu lesen
Dieser Essay handelt von Mut und Sorglosigkeit. Und es hat auch mich ein wenig Mut gekostet, so sorglos Tacheles zu sprechen und mich mit unkonventionellen Ideen aus der Deckung zu wagen. Aber ich denke, es ist noch mutiger, es zu lesen. Ich möchte eine Prophezeiung wagen und eine Wette eingehen: Wetten dass … Du nach der Lektüre dieses Essays die Arbeits- und Businesswelt mit anderen Augen siehst. Wenn Du Dich offen und ehrlich und mit ganzem Herz und Verstand auf die Zusammenhänge und Ideen einlässt, wird es Deine Sicht auf Management und Führung verändern. Diese neue »Brille« ist nicht immer bequem, weil sie Dich zum Andersdenken und vor allem zum Andersmachen verleiten wird. Und jeder, der schonmal versucht hat, Bestehendes in Frage zu stellen, weiß: Du wirst nicht nur Freunde gewinnen. Denn echte Erneuerung erschreckt die Trägen, die Ängstlichen, die Systembewahrer. Wenn sie das nicht tut, handelt es sich nicht um echte, wahrhaftige Neuerung. So einfach ist das.
25Was erwartet dich?
BE BRAVE ist ein Aufruf. Eine Zumutung. Eine Erinnerung daran, dass Mut kein Soft Skill ist, sondern eine Überlebensstrategie. Während unsere Unternehmen noch Excel-Tabellen sortieren und Risikobewertungen perfektionieren, rauscht der Fortschritt an uns vorbei – wild, unberechenbar und voller Möglichkeiten. Und ja – das fühlt sich manchmal wie Kontrollverlust an. Dieses Buch ist ein Weckruf, ein Tritt in den Hintern. Es geht um Vision statt Version XY. Es geht um Naivität als Innovationsmotor. Um Führung, die nicht auf Titel, sondern auf Haltung baut. Und um Menschen, die aufhören zu warten, dass irgendjemand das Go gibt.
Wenn Du bereit bist, Dinge loszulassen, zu hinterfragen – und dabei richtig gute neue Ideen zu bauen – dann lies weiter.
Und wenn nicht?
Dann lies erst recht.
Der 1. Akt ist eine schonungslose Abrechnung: Wie konnte es nur soweit kommen? Nur wenn wir mit Herz und Hirn begreifen, dass wir in einer Sackgasse sind, finden wir den Mut und die Motivation umzudrehen.
Der 2. Akt verrät erfolgserprobte Ausfahrten und geheime Hintertüren, wie wir aus der Sackgasse herauskommen. Ungewöhnliche Beispiele aus der älteren Geschichte und überraschende Referenzen aus dem aktuellen Zeitgeschehen zeigen auf, wie ausgerechnet diejenigen zu Erfolg gelangen, die wir so gerne abwerten: die Naiven, die Draufgänger, die Rebellen und die Unbedarften. Dabei entlarven wir die unbewussten Erfolgsmuster dieser Pioniere und stellen sie in den aktuellen Kontext: Konkrete Handlungsempfehlungen geben Führungskräften, Unternehmern und auch Privatpersonen unkonventionelle Leitideen an die Hand.
26Der 3. Akt ist ein Mutmacher der besonderen Art: Warum können wir es schaffen, wieder »zurück nach vorne« zu kommen? Und was müssen wir jetzt dafür tun?
Los geht's
Wir brauchen einen Richtungswechsel, einen Neustart. Lasst uns an den festgefahrenen Glaubenssätzen rütteln und eine frische Perspektive wagen.
Piraten sind nicht alle schlecht.
Und genauso wenig sind es Kräfte, die gegen die bestehenden Konventionen wirken und Mutiges Denken zulassen.
In der Sackgasse hilft nur eins: Umdrehen!
271. AktWie konnte es nur soweit kommen?
Die beiden Gründer Fred und Jo haben eine Vision. Sie wollen die Welt der synthetischen Farbstoffe revolutionieren. Dafür treffen sich die beiden Tüftler jeden Tag in ihrer eigenen Küche. Am kleinen Herd experimentieren sie mit allerlei Rezepturen, Tag für Tag, mit unbändiger Energie. Sie haben kein Venture-Kapital zur Verfügung und müssen alles selbst machen. Da sind echte Macher am Werk, die für ihren Traum des wirtschaftlichen Erfolgs alles geben, bis zur Erschöpfung.
Wer jetzt denkt, hierbei handelt es sich um ein Start-up der Gegenwart, irrt sich. Diese Begebenheit ist über 160 Jahre alt. Die beiden Protagonisten hießen mit vollen Namen Johann Friedrich Weskott und Friedrich Bayer. Wie der zweite Nachname verrät, handelt es sich um die Gründungsgeschichte der Firma BAYER.
Auch DAX war mal Start-up
Wir vergessen oft: Jeder noch so schwerfällige Konzern, jedes global skalierte Machtzentrum mit Compliance-Handbuch hat mal ganz klein angefangen. Mit Herzblut, Mut und einem Plan, 28der eher auf dem Bierdeckel als in der Strategie-Powerpoint stand.
Schauen wir auf eine Ikone der deutschen Ingenieurskunst – ein globales Erfolgsmodell: der Porsche 911. Wie ist der entstanden? Dezidierte Marktanalysen, lange Business-Case Berechnungen, inkrementelle Weiterentwicklung, behutsames Abtasten?
Ferdinand »Ferry« Porsche erklärte die Entstehung des Prototypen so: »Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen.«4
Es hatte mehr mit Pippi Langstrumpfs »ich schaffe mir die Welt, wie sie mir gefällt« zu tun, als mit ausgeklügelter Management-Strategie. Es war Ausdruck von Überzeugung und Ingenieursstolz – das Heft in die eigene Hand nehmen, weil man Unzulänglichkeiten nicht duldet.
Von dieser beseelten und radikalen Schaffenskraft ist heute allerdings nicht mehr viel zu spüren. Unsere Unternehmen haben es sich seit geraumer Zeit bequem eingerichtet in der Komfortzone des Kerngeschäfts, in der Aufrechterhaltung des Status Quo. Mehr vom Gleichen und behutsame Weiterentwicklung gelten bereits als kreative Höchstanstrengung. So gibt es dann den noch flacheren Flachbildschirm und den noch runderen Autoreifen. Absichern und Vorantasten – das sind die goldenen Tugenden des tüchtigen Managements. Klingt ja auch erst einmal vernünftig. Wo ist das Problem, könnte man fragen.
Die Antwort liefern die hiesigen Wirtschaftsdaten. Ein Blick auf die Marktkapitalisierung im internationalen Vergleich ist ernüchternd. Alle vierzig DAX-Konzerne haben zusammen eine geringere Bewertung als die eine Firma Apple oder als die eine Firma Microsoft oder die eine Firma Nvidia (Stand 02/2025). Im Jahr 2007 waren noch sieben deutsche Konzerne in den Top 100 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und aktuell? Nur noch drei – mit Platz 31 (SAP), Platz 73 (Telekom) und Platz 74 29(Siemens), Stand 20255. Die Marktkapitalisierung kann als abgezinster Wert aller geschätzten zukünftigen Ertragsströme verstanden werden. Ich sehe das als die Zukunftswette der Investoren. Im Umkehrschluss heißt das: Die Investoren scheinen uns nicht mehr viel zuzutrauen. Sie glauben nicht an unsere Innovationsstärke, Transformationskraft oder Anpassungsfähigkeit. Sie setzen ihr Geld lieber auf Start-ups und die neuen Tech-Player aus dem Silicon Valley und China.
Selbst in unserer ureigensten Paradedisziplin, der Automobilindustrie, stehen die Zeichen auf Sturm. Erstmals seit den 1980er-Jahren ist Volkswagen in China nicht mehr die Nummer eins beim Absatz, sondern der chinesische Hersteller BYD. Galt der Automotive-Sektor über Jahrzehnte als Wirtschaftsmotor und Erfolgsgarant, sind wir im Zukunftssegment der E-Mobilität eher noch ein Nebendarsteller.
Freundschaftsbuch
Wie konnte es nur soweit kommen? Nähern wir uns einmal aus einem ungewöhnlichen Einfallswinkel: Falls Du noch Zugriff auf Freundschaftsbücher und Poesiealben aus der Kindheit hast: Diese verraten eine Menge. Über Dich. Über uns. Über unser Bildungssystem und unsere Arbeitswelt. Diese Freundschaftsbücher sind ein Tor in die Vergangenheit und Zeitzeugnis unserer mentalen Entwicklung.