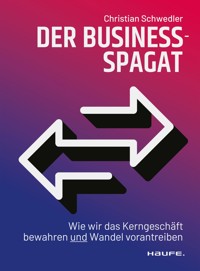
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Transformation beschleunigen, ohne das Kerngeschäft gegen die Wand zu fahren. Organisationen befinden sich zunehmend in einer Zerreißprobe: Sie sollen ihr umsatzstarkes Kerngeschäft effizient managen und nebenher radikal innovativ sein. Das ist wie Überholen und gleichzeitig auf Spur bleiben. Kein Wunder, dass mehr und mehr Manager:innen und Mitarbeitende verunsichert und orientierungslos sind. Ambidextrie-Experte Christian Schwedler verrät, wie dieser Spagat gelingt. Ungewöhnliche Fallbeispiele, praxiserprobte Methoden und Insiderwissen geben Führungskräften und Organisationsgestalter:innen einen klaren Fahrplan an die Hand. Denn eins ist sicher: Die Zukunft gehört denjenigen, die Stabilität & Wandel geschickt vereinen. Inhalte: - Die richtige Balance wird zur Überlebensfrage - Wie Standortbestimmung Orientierung schafft - Beidhändige Teams: Ambidextrie einfach erklärt - Die richtige Organisationsstruktur - Taylors Erbe überwinden: Warum Ambiguitätstoleranz Wunder wirkt - Warum es ohne bestimmte Hierarchieebenen nicht geht - Was Organisationen stark macht - Von den Besten lernen: Diversifikation der Jahrhundert-Champions - "Eierlegende Wollmilchsau": vier neue Führungsrollen - Ambidextrie-Canvas: Framework für die Praxis - Leitbild für die Zukunft: Dein Weg von hier Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte - E-Book direkt online lesen im Browser - Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumCheck-in1 Die Ausgangslage1.1 Orientierung gesucht: Aus dem Tagebuch eines erschöpften Managers1.2 Legacy meets Fantasy: Die richtige Balance wird zur ÜberlebensfrageDie zwei WeltenDie neue HerausforderungInnovator’s Dilemma1.3 Bergwanderung oder Dschungel? Ambidextrie einfach erklärtIst Innovation gleich Innovation?Explore als zeitliche AbfolgeIdeationIncubationScalingNotfall können wir2 Der Team-Spagat: Der richtige Mix zwischen Anpassung und Autonomie2.1 Kontext ist King – Standortbestimmung schafft OrientierungStandortbestimmung WirtschaftsstandortDie Standortbestimmung des Teams2.2 Mehr als Kästchen schieben: Das richtige OrganisationsdesignStrukturelle Ambidextrie als Spin-offKontextuelle AmbidextrieCorporate Start-upAbweichungen von der IdealstrukturExplore stärkenDas ideale Explore-Team2.3 Taylors Erbe überwinden – wie Ambiguitätstoleranz Brücken bautVereinheitlichung der WeltAmbiguitätstoleranz3 Der Organisations-Spagat: Voraussetzungen für Dualitäten schaffen3.1 The Magic Triangle – das Leitmodell für beidhändige OrganisationenAmbitionAutonomyAssetsDas vierte »A«3.2 Essenzielle Stellschrauben: Wie Ambidextrie gestärkt wirdDie FinanzsteuerungPersonalentwicklungKulturelle Dimension3.3 Von den Besten lernen – Diversifikation der Jahrhundert-ChampionsDiversifikationKodak versus FujiKannibalisierung4 Der Führungs-Spagat: Deine Rolle zwischen Management und Leadership4.1 Die eierlegende Wollmilchsau – die Rollen der neuen FührungskraftFührung im ExploitFührung im ExploreLeader als ExotenDie vier RollenFührungsarten in der Ambidextrie4.2 Sowohl-als-auch: Dilemmata und Paradoxa konstruktiv nutzenMaultiereSeiltänzerSowohl-als-auch im wahren Leben5 Dein Weg von hier5.1 How to (inklusive Ambidextrie-Canvas für die Praxis) …Der Ambidextrie-Canvas für die PraxisDer Fahrplan für die ImplementierungDominoCheck-out – Worauf es jetzt ankommtKontaktFeedbackDankeLiteraturtippsAutoreninfoAnmerkungenIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!Buchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buches zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-17381-7
Bestell-Nr. 10975-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-17382-4
Bestell-Nr. 10975-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-17383-1
Bestell-Nr. 10975-0150
Christian Schwedler
Der Business-Spagat
1. Auflage 2024
© 2024 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Claudia Parra Weitzman, Abbildung: bgblue (Getty Images)
Produktmanagement: Bettina Noé
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Check-in
Ein verregneter Donnerstag Vormittag im Ruhrgebiet. Ich lasse mich in den Sessel der Hotellobby sinken, um ein wenig durchzuschnaufen. Es ist gerade Pause.
Ich darf einen Führungskräfte-Workshop zur strategischen Neuausrichtung eines mittelgroßen Unternehmens leiten. Die Stimmung ist angespannt, aber energetisch-ambitioniert, schließlich geht es um nichts weniger als die Überlebensfähigkeit des Unternehmens: Die eigene Branche wird sich in den nächsten Jahren radikal verändern, bestehende Geschäftsmodelle brechen weg. Die Firma braucht dringend eine Kreativ- und Entrepreneur-»Injektion«. Da sind mutige Entscheidungen gefragt. Der Führungskreis sieht sich in einem Dilemma: Die radikalen Veränderungen müssen bei laufendem Kerngeschäft funktionieren, das wiederum im Kosten- und Effizienzdruck gefangen ist.
In der Pause gesellt sich der Bereichsleiter zu mir. Er flüstert mir zu: »Christian, wir kommen kaum noch hinterher. Mir gehen die Ideen aus. Wie soll ich auch den Tapetenwechsel schaffen, wenn gar keine Wand mehr da ist? Dabei sind wir eigentlich gut aufgestellt. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein richtig gutes Management haben.«
Darauf antworte ich: »Ja, und genau das ist das Problem:
Exzellentes Management führt zum Scheitern.«
Der Bereichsleiter schaut mich mit großen Augen an und versteht nicht, was ich damit sagen will. Im weiteren Verlauf des Workshops löse ich das Statement auf. Auch im Verlauf des Buches werde ich die Herleitung und den Hintergrund dieses Statements erläutern.
Wir verlieren den Anschluss
Das soeben beschriebene Dilemma ist kein Einzelfall. Mehr und mehr Führungskräfte sind erschöpft und orientierungslos. Mehr und mehr Manager reiben sich auf in der Zerreißprobe zwischen Tagesgeschäft und Zukunftsgestaltung. Im Rahmen meiner Tätigkeit spreche ich mit sehr vielen Unternehmenslenkern und die geäußerte Beunruhigung ist immer wieder die gleiche: »Wir können kaum mit der Veränderungsdynamik mithalten.« Fast alle merken: The heat is turning up. Der Wettbewerbsdruck nimmt zu. Was sich bislang eher als Bauchgefühl äußerste, wird inzwischen von messbaren Daten belegt:
Alle hiesigen Wirtschaftsindikatoren zeigen nur in eine Richtung: nach unten. Exportvolumen, Wagniskapital, Wirtschaftswachstum, Patentanmeldungen – Hiobsbotschaften, wo man auch hinschaut. Deutschland liegt im »World Competitiveness Ranking 2023« auf dem 22. Platz von 64 Ländern. Vor zehn Jahren waren wir noch auf Platz 6 (2014).1
Bei der Marktkapitalisierung sieht es nicht besser aus. Alle vierzig DAX-Konzerne haben zusammen eine signifikant geringere Bewertung als die eine Firma Apple. Im Jahr 2007 waren noch sieben deutsche Konzerne in den Top 100 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und aktuell? Nur noch zwei – mit Platz 71 und 91.2
Die Marktkapitalisierung kann als abgezinster Wert aller geschätzten zukünftigen Ertragsströme verstanden werden. Ich sehe das als die Zukunftswette der Investoren. Im Umkehrschluss heißt das: Die Investoren scheinen uns nicht mehr viel zuzutrauen. Sie glauben nicht an unsere Innovationsstärke, Transformationskraft oder Anpassungsfähigkeit. Sie setzten ihr Geld lieber auf Start-ups und die neuen Tech-Player aus dem Silicon Valley und China.
Ist das unser Anspruch?
In der Zukunftstechnologie schlechthin – der künstlichen Intelligenz – spielt Europa nur noch eine Nebenrolle. Die sogenannten KI-Giganten kommen allesamt aus den USA und China. Selbst in unserer ureigensten Paradedisziplin, der Automobilindustrie, stehen die Zeichen auf Sturm. Erstmals seit den 1980er-Jahren ist Volkswagen in China nicht mehr die Nummer eins beim Absatz, sondern der chinesischer Hersteller BYD. Galt der Automotive-Sektor über Jahrzehnte als Wirtschaftsmotor und Erfolgsgarant, sind wir im Zukunftssegment der E-Mobilität nur noch eine Randerscheinung.
Wir verlieren den Anschluss.
Stell Dir vor, die Zukunft ist eine große Party, aber wir stehen nicht mehr auf der Gästeliste.
Die meisten Unternehmen kränkeln. Die »Patientenliste« füllt sich. Und auch all die Unternehmen, die sich heute in bester »Gesundheit« wähnen, sollten sich auf turbulente Zeiten einstellen. Die Frage nach einer disruptiven Bedrohung ist nicht ob, sondern nur eine Frage des wann.
Wie sieht es mit einer möglichen »Medikation«, »Therapie« oder »vorbeugenden Heilmitteln« aus? Der große Hoffnungsträger der letzten ein bis zwei Jahrzehnte – die agile Bewegung – ist ins Stocken geraten. In manchen Unternehmen darf man das Wort »agil« kaum noch aussprechen. Nur agile Methodik hilft nicht, das haben wir leidvoll lernen müssen. Der große Umbruch und die spürbare Transformation blieben in den allermeisten Unternehmen bislang aus.
Innovator’s Dilemma
Dabei wurde diese Entwicklung bereits vorausgesagt. Der mittlerweile verstorbene Harvard-Professor Clayton Christensen erkannte das Problem schon vor über 20 Jahren. In seinem Weltbestseller »The Innovator’s Dilemma« prophezeite er das Scheitern der erfolgreichen und etablierten Unternehmen aufgrund ihrer Unfähigkeit, aus der Effizienzfalle des Kerngeschäfts auszubrechen:
»Erfolgreiche Unternehmen, die sich schon bei evolutionären Technologien keine Fehlschläge erlauben können, werden mit der nötigen Fehlerakzeptanz bei disruptiven Technologien niemals zurechtkommen.«3
Ein Niedergang mit Ansage?
Nur Effizienz und Kerngeschäft – das beherrschen die etablierten Unternehmen weitgehend.
Nur radikale Innovation und Agilität – das machen Start-ups und New-Techs sehr erfolgreich.
Die Crux entsteht im Zusammenspiel, in der Gleichzeitigkeit beider Modi. Die Spannung entsteht, wenn etablierte Organisationen beides gleichzeitig beherrschen müssen. Das ist die eigentliche Zerreißprobe: Willkommen im Business-Spagat.
Spagat kommt aus dem Italienischen (spaccare) und bedeutet »spalten«. Auf Wikipedia wird ergänzt: »Im Deutschen wird der Begriff häufig im übertragenen Sinne benutzt, um auszudrücken, dass jemand zwei (meist argumentativ, aber auch räumlich) gegensätzliche Positionen zu überbrücken versucht.«4 Das trifft die Sache ganz gut. Die meisten Manager und Mitarbeitenden stehen zwei gegensätzlichen Polen gegenüber und müssen Brücken zwischen dem Bewahren und dem Umbruch bauen.
Die Farbgebung des Covers in den Farbtönen Rot und Blau ist nicht zufällig gewählt, sondern spielt auf die Blue-Ocean-Strategie von W. Chan Kim und Renée Mauborgne an. Blau werden die Märkte bezeichnet, die keinen oder minimalen Wettbewerb aufweisen, rot die gesättigten Märkte mit hartem Konkurrenzkampf. Die Farbe rot symbolisiert dabei das von blutigen Kämpfen gefärbte Wasser. Die Zerreißprobe heutiger Unternehmen besteht auch aus dem Spagat zwischen dem blauen und roten Ozean.
Die Farbgebung Rot-Blau wird in der Praxis und insbesondere im agilen Kontext auch umgekehrt verwendet: Der robuste, bekannte und etablierte Kontext ist dann blau codiert, und rot der dynamische, unbekannte. Diese Farbcodierung verwende ich in meinen Vorträgen. Das Cover kann auch in diesem Sinne aufgefasst werden.
Navigationshilfe
Business-Spagat steht nicht nur für die Zerreißprobe, sondern ebenso für eine weitere Eigenschaft: Einen Spagat kann nicht jede(r). Ein Spagat ist schwer, aber nicht unmöglich. Mit dem richtigen Training und Know-how können wir uns die Fähigkeit aneignen. Prinzipiell gilt das ebenso für den Business-Spagat. Die grundlegende Fragestellung für das Know-how und »Trainingsprogramm« im Businesskontext lautet:
Wie bringen wir mehr Transformations-PS auf die Straße, ohne das Kerngeschäft gegen die Wand zu fahren?
Man kann die Problemstellung auch so formulieren: Wie können wir mehr Transformations-PS entwickeln trotz der großen »Gravitationskräfte« des etablierten Kerngeschäfts? Das vorliegende Buch will die entsprechende Navigationshilfe bieten. Es besteht aus drei Hauptteilen, welche die drei Betrachtungsebenen repräsentieren: Dein Team, Dein Umfeld, Deine Rolle. Oder als Fragen formuliert:
Wie organisiere und fördere ich das Team (der Team-Spagat, Kapitel 2)?
Inwieweit kann und muss ich das Unternehmensumfeld beeinflussen (der Organisations-Spagat, Kapitel 3)?
Was kann ich selbst tun, um meinen eigenen Business-Spagat zu meistern, sowie meine Organisation zu unterstützen (der Führungs-Spagat, Kapitel 4)?
Das Buch zeigt einen machbaren, realistischen und erprobten Weg auf. Wir brauchen weder ein kompliziertes Theoriegeflecht, das niemand versteht und an der Praxis vorbeigeht, noch brauchen wir einzelne Methoden, die als Tropfen auf den heißen Stein wirken. Wir brauchen weder Aktionismus noch eine oberflächliche Symptombehandlung. Was wir dringend benötigen, ist ein triefgreifender, fundierter Ansatz, der gleichsam umsetzbar und anschlussfähig ist.
Die Hiobsbotschaften und negativen Indikatoren aus der Wirtschaftswelt dürfen uns nicht resignieren lassen. Im Gegenteil, ich sehe das als Ansporn. Fußball-Trainer-Legende Jürgen Klopp würde sagen: »Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vor dem Verlieren.«5
Wer jetzt ein trockenes und kompliziertes Fachbuch erwartet, wird enttäuscht. Ich bin ein Praktiker. Das Buch ist daher kein klassisches Fachbuch mit streng wissenschaftlichem Perfektionsanspruch, sondern eher ein Rat gebendes Plädoyer. Die Inhalte speisen sich aus der Praxis, aus zwanzig Jahren Berufserfahrung, davon zwölf Jahre Strategiearbeit in der Schaltzentrale eines DAX-Konzerns, acht Jahre berufliche Weltreise mit den Stationen Sydney, London und Santiago de Chile, unzählige Führungskräfte-Workshops und Keynotes bei Kunden aus den verschiedensten Branchen und Case Studies anderer Organisationen.
Kurzum, ich bin ein wenig herumgekommen. Ich habe mich ein wenig umgeschaut. Wenn sich in meinen Führungskräfte-Tagungen die Tür schließt und wir unter uns sind, kommen alle Themen auf den Tisch. Da wird Tacheles geredet – und ich habe gut zugehört. Mit diesem Buch gewähre ich Dir einen Einblick in die Erkenntnisse aus den Hinterzimmern und »Kommandobrücken«.
Das Buch ist die Antwort auf die Frage: Wie können wir als Führungskräfte und Organisationsgestalter den Business-Spagat meistern?
Die Zeit drängt. Fangen wir also gleich damit an.
Christian Schwedler, Herbst 2023
Gebrauchshinweise
In diesem Buch habe ich mich für die Du-Anrede entschieden. Das ist keine Respektlosigkeit. Da wir aber Tacheles reden und ans »Eingemachte gehen«, hilft mir die symbolische Nähe der Duz-Form. Zum anderen sind die meisten Organisationen für mein Dafürhalten viel zu »erwachsen« geworden und können ein wenig »jugendliche Frische« ganz gut vertragen. Ein »Du« passt da ganz gut hinein.
Es gibt Bücher, bei denen jedes Kapitel unabhängig gelesen werden kann. Hier sind die Inhalte chronologisch aufgebaut, da sich das Konzept langsam entwickelt.
Spagat-Killer:
Unter diesem Begriff führe ich typische Stolpersteine und Verhinderer auf, die den »Business-Spagat« erschweren oder hemmen.
1 Die Ausgangslage
1.1 Orientierung gesucht: Aus dem Tagebuch eines erschöpften Managers
Wir erhalten einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Stefan, einem Manager in der mittleren Führungsebene eines Konzerns. Er leitet drei Gruppen: Zwei sind im routinierten Tagesgeschäft tätig, ein Team ist für Innovationsprojekte verantwortlich. Die Figuren und die Details sind frei erfunden. Trotzdem mögen die Rahmenbedingungen, Dilemmata und Geschehnisse bekannt erscheinen. Sie sind allesamt von wahren Begebenheiten aus der Praxis inspiriert.
Ein ganz normaler Arbeitstag zum Jahresende:
Stefans Tagebuch
7:47 – Der Controller ruft durch und erinnert mich eindringlich an mein Restbudget, das ich doch bitte bis Jahresende aufbrauchen soll. Ich käme sonst in Rechtfertigungszwang, warum ich den Forecast nicht einhalte.
8:00 – In der Abteilungsrunde greife ich das Budgetthema gleich auf und bitte um Vorschläge zur kurzfristigen Budgetausgabe. Nach einer kurzen Diskussion liegen zwei Vorhaben auf dem Tisch: Die neue Teamleiterin der Innovationsgruppe drängt auf einen aushäusigen Kreativ-Workshop. Claus, ein langjähriger Teamleiter des Kerngeschäfts, würde gern eine Auftragsverlängerung seines externen Lieferanten erwirken, um seine Fehleranalyse der Anlagentechnik abzuschließen. Das Budget gibt nur ein Thema her: Innovation oder Fehlerquote Tagesgeschäft? Ich vertage die Entscheidung. Erstmal Zeit gewinnen.
8:15 – Im Rahmen der Abteilungsrunde stellt ein Mitarbeiter eine neue KI-unterstützte Software vor. Als Pilotprojekt soll diese in der gesamten Abteilung ausgerollt und verprobt werden. Die Kollegen aus dem Kerngeschäft reagieren verhalten ob der Risikoexposition. Sie sind mitten im Effizienzsteigerungsprogramm verstrickt und auf operative Exzellenz getrimmt.
Ich muss bei diesen Veränderungsthemen in Zukunft besser vermitteln und Verständnis schaffen. Die Teamleiter müssen da mehr Offenheit und Flexibilität zeigen. Die Erkenntnisse der letzten Führungskräftetagung scheinen schon wieder verpufft.
9:00 – zurück an meinen Schreibtisch. Rundmail vom Finanzvorstand. Er bittet die Führungsmannschaft um volle Unterstützung für das ausgerufene Effizienzprogramm. Wir müssen dringend die Fehlerquote senken und Kosten sparen.
Das passt ja gar nicht zu meinem digitalen Pilotprojekt. Vielleicht sollte ich in der politischen Großwetterlage ein bisschen mehr auf Stabilität und Sicherheit gehen. Kopf einziehen und nicht auffallen.
10:00 – Meeting mit unserem Controlling. Die Finanzkollegen verlangen eine detaillierte und kalendarisierte Renditeerwartung für das neue Innovationsprojekt. Ich bitte (mal wieder) um Verständnis. Es ist heute noch nicht absehbar, ob und wann das serientauglich wird und wie Kunden darauf reagieren. Warum verstehen die Kollegen nicht, dass wir ganz am Anfang stehen und aktuell in die Experimentierphase gehen? Die Controller bestehen auf Annahmen. Ich muss jetzt ein paar Zahlen liefern.
11:00 – Vorstellungsgespräch: Wir haben noch eine freie Stelle zu besetzen und noch zwei Bewerber in der engen Auswahl: Bewerber A scheint akribisch, sehr verlässlich, gerader Lebenslauf, gutes Unizeugnis. Bewerberin B hat viel erlebt und einen Zickzack-CV. Sie wirkt sehr neugierig, aufgeschlossen und hinterfragt viel. Wir könnten tatsächlich beide Charaktere gebrauchen. Eine Mischung aus beiden Qualitäten wäre ideal, aber am Markt derzeit nicht verfügbar. Muss Gruppenleiter Claus entscheiden, wer besser in sein Team passt.
11:45 – Rücksprache mit der Bereichsleiterin: Es gab eine Ansage vom Entwicklungsvorstand. Wir müssen die Entwicklungszeiten verkürzen. Die chinesischen Mitbewerber bringen die Produkte in 70 Prozent unserer Entwicklungszeit auf den Markt. Das ist jetzt schon Thema im Aufsichtsrat. Ich solle mir mal Gedanken machen, wie wir hier schlanker und schneller werden. Ihr Bekannter habe eine agile Scrum-Beratung. Sie legt mir Nahe, einen seiner agilen Coaches bei mir im Innovationsteam auszuprobieren. So signalisieren wir Veränderungswillen und senden intern die richtige Botschaft.
Ich frage mich, ob das so viel bringt, wenn wir ansonsten keine Rahmenbedingungen verändern und das ganze Unternehmen dem aktuellen Effizienzprogramm verschrieben ist, beiße mir aber auf die Zunge. Werde den agilen Coach mal zum Gespräch einberufen. Damit ist das offene Restbudget dann auch verplant.
12:00 – Mittagspause. Auf dem Weg zur Betriebsgastro treffe ich einen alten Kollegen. Er schimpft über die fehlende Ausrichtung »von oben«: »Alles muss schneller, agiler, aber ohne Fehler und Risiko passieren. Da fehlen die strategischen Leitplanken und die Klarheit. Die C-Level-Etage wirft jegliche Aussteuerung zwischen Tagesgeschäft und Transformation uns über den Zaun.«
Die Stimmung war auch schon mal besser. Der Wind wird rauer, das spürt man an allen Ecken und Kanten.
13:00 – Sitze im Entscheider-Kreis für Investitionen. Die Agenda ist bunt gemischt. Im ersten Agendapunkt wird um Cent-Beträge gefeilscht und die Kostenschraube angezogen. Der nächste Punkt verlangt Risikofreude für ein vielversprechendes aber auch volatiles Vorhaben. Ganz schön anstrengend diese mentale Dynamik. Da soll die Gremiensteuerung mal besser sortieren. Das müsste besser getrennt werden: ein Block für Effizienzthemen und Kerngeschäft und ein Block für Innovation und Neugeschäft.
14:00 bis 18:00 – Führungskräfte-Workshop für die Ziele nächstes Jahr.
Der Kollege aus der Strategie warnt: Wir brauchen neue Umsatztreiber, müssen mehr in die Diversifikation, neue Geschäftsfelder erschließen. Ein anderer Kollege fragt, wie dieser Wandel finanziert werden soll. Im Kerngeschäft sinkt die Marge.
Wir erarbeiten Aufgabenpakete und beschließen ein neues Zusammentreffen in vier Wochen. Gut, dass ich in der Zwischenzeit Urlaub habe. Muss dringend Luft holen. Dieses Jahr war extrem anstrengend. Dieses ständige Aufreiben zwischen Veränderungs- und Effizienzdruck zermürbt. Übrigens auch die Mannschaft. So geht es nicht mehr lange weiter. Wir brauchen neue Ideen und Ansätze, wie dieser Business-Spagat zu meistern ist. Zumindest darüber sind wir uns im Führungskreis einig. Da muss es doch smarte Ansätze geben. Wie machen das denn die anderen?
1.2 Legacy meets Fantasy: Die richtige Balance wird zur Überlebensfrage
Kannst Du Dir einen Sportler vorstellen, der Eishockey-Weltmeister und gleichzeitig Olympiasieger im Eiskunstlauf wird? Oder eine Gewichtheberin, die Ballett tanzt? Ziemlich abwegige Vorstellung. Spitzensport ist heute so anspruchsvoll und spezialisiert, dass nur eine absolute Fokussierung Höchstleistung ermöglicht.
Umso erstaunlicher, dass wir eine derartige Bandbreite und Vielschichtigkeit in unserer Geschäftswelt voraussetzen. Denn Führungskräfte und Manager müssen heute beides meistern: Stabilität und Wandel. Sie sollen ihr Kerngeschäft effizient managen und nebenher radikal innovativ sein. Dieser Spagat des Multitaskings wird durch die jeweiligen Extremedeutlich:
Tagesgeschäft versus Zukunftsgestaltung,
Tradition versus Transformation,
Verlässlichkeit versus Überraschung,
Stammgeschäft versus Disruption.
Diese gegensätzlichen Ausrichtungen erfordern ebenso widersprüchliche Kompetenzen, Mindsets und Arbeitsweisen:
Null-Fehler-Toleranz versus Risikofreude,
Standardisierung versus Individualität,
Operative Exzellenz versus experimentelle Iteration,
Wasserfallmodell versus agile Methoden.
In diesem Spannungsfeld trifft Vergangenheit auf Zukunft und Tradition auf Vision: Legacy meets Fantasy.
Die linke Seite dieser Aufzählungen bezieht sich auf das Tagesgeschäft, also auf das Hier und Heute, ist aber vergangenheitsorientiert: Die Arbeitsformen und Organisationsstrukturen sind die Summe aller in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen. Die Arbeitskultur ist das Ergebnis eines gewachsenen Prozesses. Für die Effizienzmaschinerie des Kerngeschäfts ist diese Legacy in erster Linie ein Erfolgsmodell: Tradition schafft Markenwert und Kundenvertrauen, Routine sorgt für Effizienz, Expertise für Qualität.
Die rechte Seite der Aufzählung zahlt auf die Zukunft ein, auf das Geschäftsmodell und Produktportfolio von (über-)morgen. Hinsichtlich Innovationskraft, Dynamik und Anpassungsfähigkeit werden die soeben skizzierten Legacy-Erfolgskriterien zum Ballast: Hier bremsen gewachsene Strukturen und alte Denkmuster. Agile Innovationsteams müssen eigenständige und neuartige Arbeitsformen finden und sich von organisatorischen Altlasten emanzipieren. Was in dem einen Kontext gut und richtig ist, erweist sich in dem anderen als Belastung.
Dieses Spannungsfeld betrifft uns alle. Um dies ins Bewusstsein zu rufen, frage ich auf Führungskräfte-Workshops zwei simple Fragen zum Einstieg:
Ist Deine Organisation auf ein funktionierendes und profitables Tagesgeschäft angewiesen?
Soll die Organisation auch in Zukunft existieren (oder gar erfolgreich sein)?
In all den Jahren hatte ich nur eine einzige Person, die eine Frage verneinen konnte. Das war der Eigentümer einer kleinen Firma, der sein Business ohne finanzielle Abhängigkeit als Selbstverwirklichung betrieb. Von solchen Einzelfällen abgesehen, befindet sich jede Organisation – ob Start-up, Mittelständler, Konzern, Behörde oder Non-Profit-Institution – in der gleichen Zerreißprobe. Wir bewegen uns permanent in zwei Parallelwelten.
Die zwei Welten
Die erste Welt dreht sich ausschließlich um das bestehende Geschäftsmodell. Wie ein kompliziertes Getriebe aus unzähligen Zahnrädern verrichtet sie gut geölt und streng kontrolliert den täglichen Dienst. Es ist eine vertraute und lang erprobte Umgebung, schließlich sind Arbeitskultur, Organisationsform und die Führungsprinzipien über hundert Jahre alt: Das erste in der Produktion eingesetzte Fließband wurde von Henry Ford eingeführt – das war 1914. Bis heute arbeiten wir weitestgehend nach den gleichen Denkmustern: Arbeitsteilung, Spezialisierung, feste Rollenbeschreibungen, die Trennung von ausführenden und von denkenden Management- und Führungsaufgaben.
Frederick Taylor schuf ein wahres Meisterwerk der Effizienzmaxime, das bis heute die Grundfeste des Managements bildet. Hier gelten harte Fakten. Quartalszahlen sind der Taktgeber und KPIs die Steuerungslogik. Nur was messbar ist, ist sinnvoll. Damit diese Maschinerie reibungslos schnurrt, sind Routine, Null-Fehler-Kultur, Standardisierung und inkrementelle Prozessoptimierung an der Tagesordnung. Es geht eher um Besitzstandswahrung.
Diese Ausrichtung beschreibe ich manchmal als die »süße Welt«, weil hier die »Low-Hanging Fruits« geerntet werden. Das bestehende Geschäftsmodell sorgt für den aktuellen Zahlungsstrom, für die heutige Profitabilität. Nicht umsonst sprechen Ökonomen von der »Cashcow-Phase«. Die entscheidenden Messgrößen und Bewertungsmaßstäbe der Investoren und Kontrollgremien richten sich ausschließlich nach dieser »süßen« Welt: Rendite und Quartalszahlen schauen auf das Ist, nicht auf Zukunftspotenziale. Das hat Nebenwirkungen: Wie bei guter Schokolade sorgt das Erfolgserlebnis guter Quartalszahlen für eine schnelle Endorphin-Ausschüttung – chronisches Suchtpotenzial vorprogrammiert.
Die andere Welt
Kommen wir zur zweiten Welt, in der es abenteuerlicher und unberechenbarer wird. Hier dreht sich alles um die Zukunft. Die zentrale Fragestellung lautet: Was müssen wir heute tun, damit wir (über-)morgen immer noch erfolgreich sind?
Es geht um Innovationskraft, Implementierung neuer Technologien und die Erschließung zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle. Es geht aber nicht nur um technische Aspekte, sondern ebenso um neue Formen der Zusammenarbeit im Kontext von New Work und Co.
Diese zweite Welt darf nicht als kreativer Spielplatz der Selbstverwirklichung missverstanden werden. Ich sehe sie eher als Survival-Programm der Organisation. Im Kontext zunehmenden Wettbewerbsdrucks aus dem Silicon Valley, aus China sowie aus der wachsenden Start-up-Szene gilt es schlichtweg, den Anschluss nicht zu verlieren. Im Kontrast zur ersten Welt wird hier ständig Neuland betreten. Entsprechend gelten hier andere Regeln und Tugenden. Risikofreude, Fehlertoleranz, flachere Hierarchien, Agilität und Experimente sind die geltenden Spielregeln.
In dieser zweiten Welt herrscht erhöhte Ungewissheit, weil Wandel und Veränderung auch Widerstand erzeugen, weil Fehler und Scheitern dazugehören. Es fehlt die unmittelbare Belohnung in Form von kurzfristigen Gewinnen. Der Return-on-Investment liegt in der Zukunft und ist ungewiss. Die gängigen Messsysteme und KPIs decken die Wirkkraft dieser Welt nicht ab. Das Unternehmensradar stoppt quasi an der Grenze zwischen der ersten und zweiten Welt. Dieser Modus ist reine Zukunftssicherung. Für das Hier und Heute hat es keine Relevanz, keine Belohnung und keine Sicherheiten zu bieten. Das macht diese Ausrichtung, insbesondere für gewachsene Organisationen, so unklar und herausfordernd.
Wizard of Oz
Parallelwelten sind spannend. Ich muss dabei an den Literatur- und Filmklassiker »Wizard of Oz« denken, bei dem es verblüffende Ähnlichkeiten zur Unternehmenswelt gibt. Die Geschichte dreht sich um Dorothy, ein kleines Farmermädchen aus Kansas. Eines Tages wird sie von einem Sturm erfasst und samt Haus und Hund in das magische Land Oz katapultiert. Dorothy ist also nicht freiwillig in die Parallelwelt aufgebrochen, sondern wurde durch externe Kräfte dazu gezwungen. Ähnlich ergeht es den meisten Firmen, die selten freiwillig eine Transformation initiieren, sondern durch externe Marktkräfte getrieben werden. Der Wirbelsturm kann als Metapher für Disruption stehen.
Im fremdartigen Neuland angekommen, muss sich Dorothy vortasten, neue Partnerschaften eingehen, unbekannte Herausforderungen bestehen und dabei neue Fähigkeiten entwickeln. »Toto, ich habe das Gefühl, wir befinden uns nicht mehr in Kansas«, ist eines der berühmtesten Zitate des Films und steht für den radikalen Wechsel des Umfelds. Auch das klingt bekannt.
In unserer Businesswelt gibt es allerdings einen entscheidenden Unterschied. Die Heldin Dorothy befindet sich immer eindeutig und längerfristig in einer bestimmten Welt. Sie befindet sich nie zeitgleich in zwei Welten und springt auch nicht kurzzyklisch hin und her. Wenn Dorothy vom Zyklon erfasst wird, landet sie in der Parallelwelt und verbleibt dort für die Dauer des gesamten Abenteuers.
Die neue Herausforderung
Im Businesskontext finden die beiden Welten Kerngeschäft und Zukunftsgestaltung in der Regel zeitgleich statt. Das ist eine enorme Herausforderung, denn ein Unternehmen kann nicht sechs Monate Kerngeschäft betreiben, dieses anschließend für ein halbes Jahr schließen, um währenddessen in Ruhe Innovation zu gestalten.
Die Herausforderung besteht in der Gleichzeitigkeit beider Systeme. Soll ich als Manager nun eine Null-Fehler-Kultur einfordern oder Risikofreude zeigen? In welcher Welt befinde ich mich in diesem Augenblick? Brauchen wir jetzt Routine und Zuverlässigkeit oder Geschwindigkeit und Flexibilität? Das ständige Hin- und Herschalten zwischen den beiden Modi ist kein Selbstläufer. Kein Wunder, dass mehr und mehr Führungskräfte wie Mitarbeitende an ihre Grenzen kommen. Kein Wunder, dass Verunsicherung, Erschöpfung und Orientierungslosigkeit zunehmen.
Die gute Nachricht an dieser Stelle: Es gibt Erfolgskriterien, praxiserprobte Konzepte und Werkzeuge, um diese Zerreißprobe zu meistern. Genau davon handelt dieses Buch.
Wenn ich in Vorträgen oder Workshops die Herausforderung dieser Zerreißprobe aufzeige, gibt es immer einen Teilnehmer, der Folgendes hinterfragt: »Den Spagat zwischen Kerngeschäft und Innovation gab es doch seit Anbeginn des Geschäftstreibens. Das ist weder neu noch besonders.« Ich nicke dann zustimmend. In der Tat ist diese Herausforderung nicht neu, aber sie verschärft sich stetig. Mit einem differenzierteren Blick zeigen sich zwei Haupttreiber für diese Entwicklung: exponentieller Fortschritt und Disruption.
Exponentieller Fortschritt ist vertrackt
Die Allermeisten kennen den Begriff. Die Allerwenigsten bezweifeln die Existenz der steten Fortschrittsbeschleunigung. Trotzdem fällt es uns schwer, die Auswirkungen zu durchdringen. Für eine Prognose blicken wir in die Vergangenheit und extrapolieren linear in die Zukunft. Das passiert automatisch, scheint die mentale Standardeinstellung zu sein. Wenn wir die Machbarkeit neuer Technologien oder Geschäftsmodelle bewerten, unterschätzen wir in der Regel die Dynamik und Geschwindigkeit der Entwicklung. Dagegen sind auch gestandene Topmanager nicht gefeit, ich spreche aus eigener Erfahrung..
Durch die zunehmende Geschwindigkeit erhöht sich der Handlungs- und Entscheidungsdruck in der VUKA-Welt. Um immer mehr Möglichkeiten in immer kürzeren Intervallen auszuschöpfen, müssen wir zwangsläufig immer agiler, kreativer und risikofreudiger werden – alles Arbeitsweisen, die mit der »ersten« Welt, der des Kerngeschäfts, kontrastieren und die Kluft weiter auseinandertreiben.
Fazit: Durch den exponentiellen Fortschritt verschärft sich die Diskrepanz zwischen Kerngeschäft und Neugeschäft.
Verstärkt wird das durch folgenden Zusammenhang: Der technologische Fortschritt verläuft schneller als die Wandlungsfähigkeit der Individuen (Mitarbeitenden). Diese wiederum verläuft schneller als die Wandelbarkeit der Organisationen. Abbildung 1 verdeutlicht, dass durch die exponentielle Wirkung die Kluft zwischen dem technischen Fortschritt und der Organisation im Laufe der Zeit weiter zunimmt.
Abb. 1:
Unterschiedliche Geschwindigkeiten des Fortschritts
6
Disruption als Gamechanger
Innovation ist ein alter Hut. Werkzeuge der Steinzeitmenschen, das Entfachen von Feuer, die Erfindung des Rads – der Homo sapiens war seit jeher ein Innovator. Ebenso kennen wir große Umbrüche aus der Vergangenheit, die ganze Tätigkeitsfelder veränderten: Denken wir an die landwirtschaftliche Revolution oder die Industrialisierung. Die Geschwindigkeit und Radikalität der Verdrängung etablierter Verfahren durch branchenfremde und digitale Mitspieler ist ein erst zwei Jahrzehnte junges Phänomen. Disruption in heutiger Semantik entstand erst mit der Digitalisierung. Wir erinnern uns an die prominentesten Fälle wie Kodak (Analog- versus Digitalkamera), Nokia (klassische Mobiltelefone versus Apples iPhone) oder Blockbuster (Videokassettenverleih versus Netflix-Streaming).
Analog zum exponentiellen Fortschritt spüre ich auch hier eine chronische Unterschätzung der Bedrohung. Wir wissen es, glauben es aber nicht so recht, nach dem Motto: »Das mag andere vielleicht betreffen, aber uns doch nicht!« Ein Beispiel: Es dürfte kein großes Geheimnis sein, dass die Automobilindustrie vor radikalen Umbrüchen steht.
Disruption ist immer dann möglich, wenn voneinander unabhängige Technologien so weit entwickelt sind, dass sie in Kombination miteinander ein völlig neuartiges Kundenerlebnis schaffen können. Erst die Leistungssteigerung der Prozessoren, der Touchscreen und die App-Entwicklung ermöglichten den Technologiesprung zum Smartphone. Das Gleiche gilt für elektrisch angetriebene Flugtaxis: Erst die Fortschritte bei E-Motoren, der KI, der Batterien und des 3-D-Drucks ermöglichen die Herstellung und den wirtschaftlichen Betrieb der neuen E-Jets.
Im Automobilsektor fehlt aktuell nur noch ein Puzzlestein, um eine disruptive Entwicklung auszulösen: die autonome Fahrzeugsteuerung auf Level 5. In dieser letzten Stufe können Fahrzeuge völlig unabhängig von den Insassen fahren, also gänzlich ohne Mitfahrer. Dieser Schritt würde es erlauben, eine App-basierte Buchungsplattform einzuführen. Einmal schnell über das Handy gewischt, und in Minutenschnelle kommt das passende Fahrzeug autonom angefahren. Die Vorteile für Kunden sind immens: Die Anschaffung eines eigenen Autos wird obsolet. Jeder Kunde kann sehr flexibel das passende Fahrzeug für den entsprechenden Anlass buchen, ob einen SUV für den Landausflug, ein Sportcabrio für die Spritztour in der Stadt oder einen Sprinter für den Umzug.
Dieses Geschäftsmodell hat Sprengkraft: Im Durchschnitt benutzen Autobesitzer ihr Fahrzeug weniger als 5 Prozent der Zeit. Wenn autonome Fahrzeuge on demand unterwegs wären, könnte die Auslastung im Idealfall um das Zwanzigfache erhöht werden. Oder andersherum: Man bräuchte viel weniger Autos, nämlich nur noch ein Sechstel.
Weiterhin kommen digitale Plattformen mit dem Risiko daher, in kurzer Zeit ein Monopol zu bilden, sieheGoogle, Uber, Airbnb und Co. Die Wahrscheinlichkeit ist also ziemlich groß, dass ein einziger Player den App-basierten Buchungsdienst als Monopolist betreiben wird. Die autonome Fahrzeugflotte wäre dann nur noch eine Commodity, also eine Handelsware der Einkaufsabteilung. Dieser Monopolist würde dann bestimmen, wer die Fahrzeuge liefern darf. Der Originalhersteller (OEM) würde dann zum Zulieferer für die Plattform werden und den direkten Kontakt zum Kunden verlieren. Ein echter Gamechanger! Und wer, frage ich, ist prädestiniert, eine solche digitale Plattform zu bauen? Die Silicon-Valley-Techies oder die heimischen Firmen? Zufällig arbeiten Google, Amazon und Apple mit Hochdruck an einem Einstieg in den Automobilsektor, zufällig sind sie führend in künstlicher Intelligenz und zufällig sind sie allesamt Digital Natives. Alles kein Geheimnis, oder?
Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass die Volumenhersteller, also die Autofirmen mit hohen Verkaufszahlen, sehr herausfordernden Zeiten entgegensehen. Premiumhersteller haben die bessere Ausgangsposition, da es auch in Zukunft Kunden geben wird, die nicht am Sharing on demand teilnehmen möchten, sondern die in der Lage sind, sich ein eigenes hochwertiges Vehikel zu leisten.
Fazit: Disruption ist ein neuer, zusätzlicher Treiber auf den Handlungsdruck in der neuen Welt. Disruption macht Innovationserfolg zur Überlebensfrage.
Wir erkennen, dass der »Spagat« zwischen den beiden Welten in der zeitlichen Entwicklung und im Trendausblick zunimmt. Wir sind also gut beraten, uns einige »Fitnessübungen« und Taktiken zurechtzulegen, wie wir mit diesem Spagat umgehen.
Abb. 2:
Der Business-Spagat nimmt stetig zu
Innovator’s Dilemma
Ein weiteres Warnsignal sollte uns zu denken geben. Die Lebensspanne von Unternehmen, die Taktung von Neugründungen und Insolvenzen, war noch nie so kurz. Heute ist es keine Überlebensgarantie mehr, die größte Firma mit der längsten Tradition zu sein. In den 1960er-Jahren verbrachte ein Unternehmen durchschnittlich über 60 Jahre im S&P-Index, in dem die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen enthalten sind. Diese Verweildauer hat sich bis heute mehr als halbiert. Weniger als 0,1 Prozent der Firmen in den USA schaffen es, 40 Jahre alt zu werden7. Damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du das Lebensalter der meisten Firmen übertriffst, da sie von neuen Konkurrenten verdrängt werden oder an sich selbst scheitern. Nicht umsonst stellte der Mitgründer von Intel fest: »Nur die Paranoiden überleben.«8
Mittlerweile übertrifft das in Start-ups investierte Wagniskapital bei Weitem die Budgets traditioneller Unternehmen für Forschung und Entwicklung. Das bedeutet, dass der überwiegende Teil an aktuell entstehenden Innovationen durch neue Mitspieler, durch potenzielle Disruptoren realisiert wird. Hinter den verschlossenen Türen der Labore und Werkstätten braut sich eine enorme Innovationskraft zusammen, die früher oder später auf den Markt strömt.
Genau diese Entwicklung haben Businessexperten bereits vor rund zwei Jahrzehnten vorausgesagt. Der Weltbestseller »The Innovator’s Dilemma« von Clayton Christensen aus dem Jahre 1997 sendete Schockwellen durch die Managementkreise. Clayton und viele prominente Mitstreiter konstatierten, Corporates seien mittelfristig nicht in der Lage, disruptivem Innovationsdruck standzuhalten. Seiner Ansicht nach scheitern gewachsene und große Organisationen nicht an mangelnden Ressourcen oder an Expertise, sondern an den folgenden vier Aspekten:
Etablierte Unternehmen sind zu stark vom aktuellen Kundenstamm und Investoren abhängig. Diese sind großteils auf Kurzfristigkeit gepolt: Kunden wollen Lösungen für heutige Probleme und Investoren schielen auf die aktuelle Rendite.
Je größer und gestandener die Organisationen, desto mehr regieren Zahlen. Neue Geschäftsideen lassen sich noch nicht präzise prognostizieren und durchplanen. Es werden zunächst Hypothesen gebildet, die durch iterative Experimente geprüft werden. Die fehlende Prognoseschärfe und Planungssicherheit sind Controllern und klassischen Managern ein Dorn im Auge.
Neue Technologien entsprechen nicht der aktuellen Nachfrage. Disruptive Potenziale starten klein, als Nische, gelten anfänglich als »nerdig« oder seltsam. Oft werden Potenziale nicht erkannt. Das hemmt das Interesse großer Unternehmen. Das Zitat des ehemaligen Microsoft-Chefs Steve Ballmer über das absehbare Scheitern des iPhones ist legendär.
Die Analogie des Containerschiffs als langsames, unflexibles Gefährt beschreibt große Organisationen treffend. Silos, Bürokratie, langsame Entscheidungswege über die Pyramidenstruktur: Wir haben es alle schon zu oft gehört und kennen die Stolpersteine.
Die Überlebensfrage für die großen Organisationen lautet folglich: Hatte Clayton Christensen recht? Ist Corporate Innovation ein Oxymoron? Meine Antwort ist eindeutig: Nein! Aber wir müssen die richtigen Voraussetzungen schaffen.
An dieser Stelle drängt sich eine Schlussfolgerung geradezu auf: Organisationen müssen den Innovations- und Agilitätsmodus radikal verbessern. Die Welt des Kerngeschäfts erscheint nicht als Problemzone. Effizienz, Qualität und Perfektion Made in Germany sind unser Aushängeschild. Ist es dann nicht naheliegend, alle Kraft Richtung der »zweiten Welt« zu verlagern? Alle Kraft voraus Richtung Wandel, Neugeschäft und Innovation?
Warum ist die Titanic gesunken?
Als ich vor einiger Zeit über eben diese Frage brütete, riss mich meine Tochter aus meinen Gedanken. Sie bat mich um Hilfe bei der Recherche für ihr Schulreferat zum Thema »Titanic«. Zuerst war ich ein wenig genervt, weil sie mich unterbrach, doch im Nachhinein erwies sich der kurze thematische Ausflug als interessante Fährte. Warum, fragte ich mich, ist die Titanic gesunken? Was waren die eigentlichen Auslöser für die tragische Kollision mit dem Eisberg? Ich machte drei Aspekte aus:
Die völlige Selbstüberschätzung hinsichtlich der proklamierten Unsinkbarkeit. Ähnliche Überheblichkeiten gibt es übrigens auch in Unternehmen.
Unzulängliche Vorbereitung der Mannschaft: Die Crew war weder mental noch technisch gerüstet für Notfallsituationen. Dass zu wenig Rettungsboote an Bord waren, ist hinlänglich bekannt. Untersuchungen ergaben weiterhin, dass der Ausguck kein Fernglas dabeihatte.9 Vielleicht ist diese Tragödie, die 1.500 Menschen in den Tod riss, auf ein fehlendes Fernglas zurückzuführen? Manchmal sind eben doch die Details entscheidend.
Warnsignale wurden missachtet. Andere Schiffe sendeten Warnungen vor Eisbergen via Funk. Ernst genommen wurden diese nicht. Von der Kommandobrücke hieß es nur: »Kurs halten, volle Fahrt voraus!«
Auch Titanic-Kapitän Edward John Smith befand sich in einem Spagat: Auf der einen Seite war er verpflichtet, Schiff und Passagiere wohlbehalten zum Zielort zu bringen. Es ging um Sicherheit und Stabilität. Auf der anderen Seite war er durch die britische Reederei White Star Line angehalten, ein Zeichen des Fortschritts zu setzen und mit maximaler Geschwindigkeit New York zu erreichen.
Selbstüberschätzung und Ignoranz gegenüber Warnsignalen führten allerdings dazu, Sicherheit und Stabilität komplett zu vernachlässigen. Alles wurde dem Fortschritt untergeordnet. Auf der Kommandobrücke hatte die Balance zwischen Sicherheit und Fortschritt Schlagseite. Die Auswirkungen sind bekannt.
Abb. 3:
Ungleichgewicht zwischen Sicherheit und Fortschritt
Ist diese Erkenntnis auf die Businesswelt übertragbar? Könnte die fein austarierte Balance zwischen Stabilität und Fortschritt der entscheidende Erfolgsfaktor sein? Oder anders gefragt: Kann es, wie auf der Titanic, zu viel Fortschritt und Innovationsfokus geben?
Bauklötze einreißen
Lego hat eine erstaunliche Achterbahnfahrt hinter sich. Jahrzehntelang betrieben die Dänen eine restriktiv-konservative Produktpolitik. Zwischen 1950 und 1990 gab es nur wenige Grundfarben und eine minimalistische Produktentwicklung. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, die Bausteinfarbe grün einzuführen. Sonderteile wie Bäume waren zwar grün, Basisbausteine dagegen nicht. Die strategische Ausrichtung fokussierte die rigorose Qualitätssicherung und Wahrung der Tradition. Berühmt wurde der Ausspruch des Managements: »Over my dead body will Lego ever introduce Star Wars.«10
Ende der 1990er-Jahre sanken die Umsätze, Lego verlor Marktanteile gegenüber neuen Wettbewerbern aus der aufkommenden Gaming-Branche. Als Reaktion änderten die Dänen ihre Ausrichtung radikal: »Creativity above all else« lautete das neue Mantra. Doch Lego schoss dabei über das Ziel hinaus: Die Entwicklungskosten wuchsen exzessiv, viele Produkte waren nicht profitabel. Es ging nur noch um neue Ideen, beinahe als Selbstzweck. Innerhalb weniger Jahre explodierte die Farbpalette, unzählige Sonderteile kamen dazu. Doch die Strategie ging nicht auf: Lego verlor fast 30 Prozent an Umsatz, die laufenden Kosten wurden kaum gedeckt. Zu viel Innovation hatte Lego an den Rand der Insolvenz geführt.
Abb. 4:
Entwicklung der LEGO-Baustein-Farben 1950 bis 2017
11
Die Managementprofessorinnen Wandy Smith und Marianne Lewis nennen dieses Verhalten »Abrissbirne«.12 Damit beschreiben sie das wuchtige Überschwenken von der einen Seite (Tradition, Effizienz) zur anderen (Innovation, Kreativität). Wir kennen dieses Phänomen von Diäten, wenn eine Zeit lang Verzicht geübt wird, um dann mit dem angestauten Heißhunger doppelt zuzuschlagen.
Balance ist alles
Organisationen brauchen immer beides: sowohl Stabilität als auch Wandel, und das in einem fein austarierten Gleichgewicht! Legacy meets Fantasy. Wir dürfen uns nicht zu einseitig in einer Welt einrichten, wir dürfen keine Schlagseite zulassen.
In der Torschlusspanik gen Zukunft ist das Risiko hoch, allzu vehement auf Veränderung und Transformation zu setzten. Das überfordert die Belegschaft und manchmal sogar die Kunden. Zu viele Entscheidungen zugunsten des Fortschritts sind gleichzeitig zu viele Entscheidungen gegen das Kerngeschäft. Ressourcen sind immer endlich. Zu einseitige Ressourcenallokation zugunsten Fortschritt bedeutet Ressourcenrückgang im Tagesgeschäft.
Eine Schlagseite gen Fortschritt und Wandel dürfte eher in Start-ups und kleinen Unternehmen zu finden sein. Große und gewachsene Organisationen haben in der Regel Schlagseite gen Stabilität. Je erfolgreicher ein Unternehmen, desto größer die Beharrungskräfte im Altbekannten und im aktuellen Erfolg. »Erfolgssyndrom« und »Kompetenzfalle« heißt das dann. »Läuft doch prima. Die letzten hundert Jahre hat es doch auch funktioniert. Und dieses Jahr gibt es wieder eine satte Erfolgsprämie.« Wenn ich so etwas höre, schrillen bei mir die Alarmglocken.
Wir müssen verstehen, dass beide Welten gleich wichtig sind und dass es beide braucht. Ein Drahtseiltänzer hält sein Gleichgewicht durch Tausende Mikrobewegungen, durch ein konstantes Nachjustieren. Wir brauchen genau das: die stete Aussteuerung und Ausbalancierung zwischen Effizienz, Perfektion, Routine sowie gleichzeitig Kreativität, Risikobereitschaft, Agilität und Aufbruchstimmung. Wer jetzt seufzt, hat recht. Machen wir uns nichts vor, es wird herausfordernd. Aber mit den richtigen Prinzipien und Werkzeugen kann diese Aufgabe bewältigt werden.
1.3 Bergwanderung oder Dschungel? Ambidextrie einfach erklärt
Die Fähigkeit einer Organisation, das effiziente Kerngeschäft auszuschöpfen und gleichzeitig innovativ und wandlungsfähig zu sein, hat einen Namen: Ambidextrie.





























