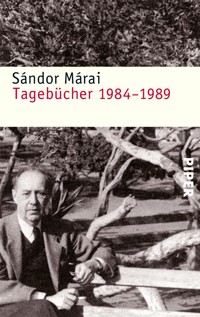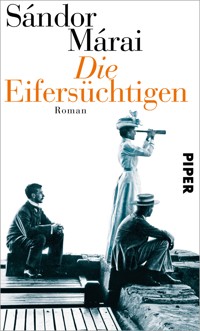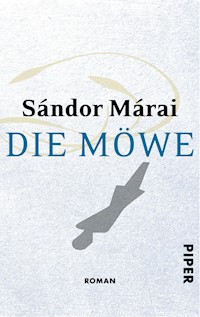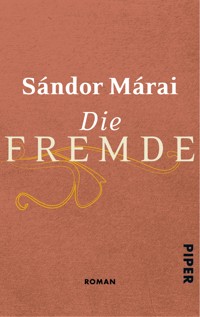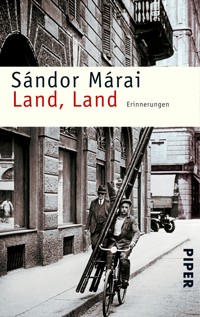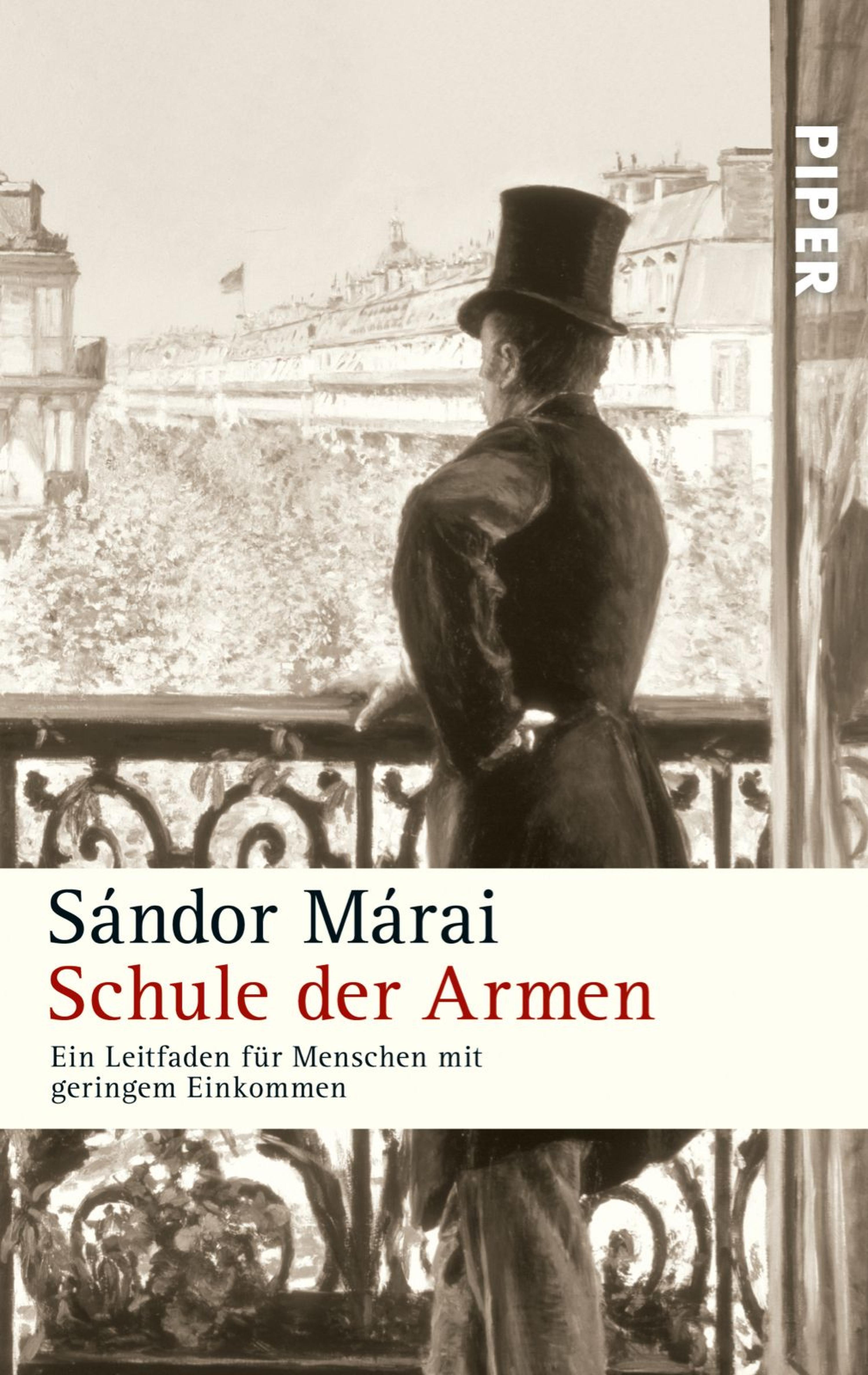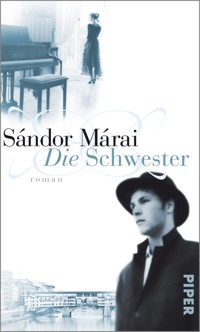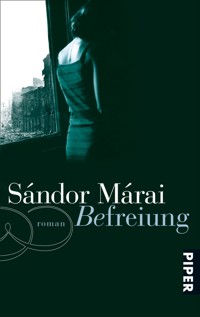
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Budapest, 1944: Zusammen mit den anderen Bewohnern wartet die junge Erzsébet im Keller eines Hauses auf ihre Befreiung. Doch die nimmt einen unerwarteten, tragischen Verlauf.Unerbittlich und mit großer Intensität erzählt Sándor Márai vom Schicksal einer jungen Frau und dem unbedingten Willen nach Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Ungarischen von Christina Kunze Mit einem Nachwort von László F. Földényi
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage Juni 2011
ISBN 978-3-492-95218-7
© Heirs of Sándor Márai Csaba Gaal, Toronto Titel der ungarischen Originalausgabe: »Szabadulás«, Regény Verlag, Budapest 2000
© der deutschsprachigen Ausgabe Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlagkonzept: semper smile, München, nach einem Entwurf von R.M.E.,
Roland Eschlbeck und Kornelia Rumberg
Umschlagmotiv: Hagen Keller (Frau); Corbis (Fenster)
IN DER DRITTEN NACHT nach dem Neujahrstag – am vierundzwanzigsten Tag der Belagerung Budapests – fasste eine junge Frau im Schutzraum eines großen Mietshauses in der Innenstadt den Entschluss, aus dem belagerten Haus zu verschwinden, die zum Kriegsschauplatz umgestaltete Straße zu überqueren und, egal wie und um jeden Preis, in die zugemauerte Nische des Luftschutzkellers im gegenüberliegenden Haus zu gelangen zu dem Mann, der mit fünf weiteren schon die dritte Woche in diesem Versteck bangte. Dieser Mann war der Vater der jungen Frau, den die politische Polizei sogar jetzt, in Zeiten des größten Durcheinanders und der Auflösung, mit besonderem Eifer und peinlicher Genauigkeit suchte.
Die junge Frau war keine »Heldin«, jedenfalls empfand sie sich nicht als eine solche. Schon seit Wochen spürte sie nichts anderes als Müdigkeit, die ihren ganzen Körper erfüllte: eine Müdigkeit, wie man sie nach außergewöhnlichen körperlichen Belastungen verspürt, wenn die Seele glaubt, sie hielte die Anstrengungen noch aus, aber der Körper übergangslos zu revoltieren beginnt, der Magen auf alles, was passiert, mit Übelkeit reagiert, und der Organismus im Ganzen so hilflos ist, als wäre er in ein Bleilaken gewickelt. Zu Zeiten brutaler Hitze und diesiger Sommersglut empfindet der menschliche Körper diese äußerste, widerliche Müdigkeit.
Die Mattigkeit der jungen Frau rührte nicht von irgendwoher; seit Monaten lebte sie heimatlos, ihr Vater hielt sich in Lebensgefahr verborgen. Seit zehn Monaten versteckte sie ihren Vater und andere, Flüchtlinge, Heimatlose, die in dieser sich auflösenden Welt für eine Nacht ein Zuhause, ein Gelegenheitsasyl suchten; und in den allerletzten Wochen war auch sie gezwungen gewesen, sich »gegen das Gesetz« versteckt zu halten, denn in der Universität, wo sie ihr letztes Semester absolvierte, hatte sie dem deutschen Befehl nicht Folge geleistet, war nicht mit ihren Kommilitonen in den Zug gestiegen, der die universitäre Jugend vor den Russen nach Deutschland »rettete«. So galt jetzt auch sie als eine Art Deserteurin und war mit falschen Papieren untergetaucht. Aber das kümmerte sie nicht weiter, so wie auch andere sich um solche Kleinigkeiten nicht mehr sorgten. Die Russen hatten die Vorstädte schon hinter sich gelassen und kämpften jetzt zwischen den Häuserblocks der Innenstadt.
Ihren falschen Papieren zufolge – sie hatte sie von der Tochter einer Reinemachefrau der Universität bekommen – hieß die junge Frau Erzsébet Sós. In den Papieren stand, sie sei dreiundzwanzig Jahre alt und von Beruf Pflegerin im Krankenhaus, und all das hätte für den oberflächlichen Betrachter im Großen und Ganzen der Wirklichkeit entsprechen können. In Wahrheit jedoch stimmte durch irgendeinen gewöhnlichen Zufall nur der Vorname: Die junge Frau hieß tatsächlich Erzsébet. In der Namensgleichheit sah sie ein himmlisches Zeichen, eine günstige Fügung, so hatte sie die in die Unterwäsche gestickten Es nicht durch andere Buchstaben ersetzen müssen, und auch darüber war sie froh, denn zu dieser Zeit besaß sie keine andere Unterwäsche mehr als die, die sie am Leib trug.
Manchmal, in ruhigeren und nüchterneren Augenblicken – denn in den vergangenen Wochen, besonders in den letzten drei, in denen ihr Vater im Keller des nahen Hauses eingemauert war, hatte sie sich gefühlt wie eine Fieberkranke, die nur zu wenigen Zeiten des Tages sachlich urteilen und denken kann – empfand sie diesen Maskenball, ihre persönliche Angelegenheit mit den falschen Papieren, als lächerlich; als lächerliche, unbedeutende, übertriebene Vorsicht und überflüssigen, wichtigtuerischen Diensteifer. Wie alle, die in den vergangenen Monaten, in der Zeit nach der deutschen Besetzung, aus irgendwelchen Gründen zum Untertauchen gezwungen waren, hatte auch Erzsébet alle Kniffe dieser Lebensweise erlernt und zugleich erfahren, dass in einer solchen Situation neben der obligatorischen Vorsicht auch das blinde Schicksal über den Menschen wacht.
Die Leute versteckten sich, monatelang, mit »einwandfreien« Papieren, mit fieberhafter Vorsicht, aber dieselben Leute verließen plötzlich, um fünf Uhr am Nachmittag, aus einer Nervenkrise heraus, ihren Schlupfwinkel, gingen auf die Straße, in ihr Stammcafé oder ins Lichtspieltheater, liefen der Polizei oder den politischen Ermittlern geradewegs in die Arme und wurden tatsächlich gefangen genommen, oder es geschah nichts. Weshalb? Erzsébet ahnte bereits, dass diese Ereignisse nicht einmal der vorsichtigste »Partisan« berechnen konnte.
Außerdem machte sich die Mehrzahl dieser »Partisanen« nur wichtig; unter ihnen waren viele, nach denen niemand ernsthaft suchte, die sich eher nur ein Alibi verschaffen wollten vor sich und der Welt, vor der Zukunft, dass auch sie zu den Verfolgten gehört hatten in jenen gefährlichen Zeiten. Auch Erzsébet wusste, dass sie, was ihre Person betraf, ruhig auf der Straße unterwegs sein durfte. Trotzdem versteckte sie sich; denn allein der Name, den sie trug, war zu jener Zeit ein Reizwort für die Schergen der Macht.
Natürlich nicht der Name von Erzsébet Sós. Der Name des Vaters, dieser im ganzen Land bekannte und geachtete Name, der Name des Wissenschaftlers und Professors, der in den letzten Jahren mit immer zischenderem Hass, mit immer aufrichtigerer Blutrünstigkeit von den hetzerischen Journalisten niedergeschrieben und von den neuen Mächtigen auf ihren politischen Versammlungen angeprangert worden war. Der Name des Vaters, den auch Erzsébet trug, dieser Name, der sogar außerhalb der Landesgrenzen bekannt und geschätzt war, überall, wo die Menschen noch geneigt waren, unparteiisch zu urteilen und wissenschaftlich zu denken: Dieser Name war wirklich nicht dazu geeignet, jetzt offen getragen zu werden.
Erzsébet Sós wusste, dass ihre Person von keiner besonderen Gefahr bedroht war, denn wer kümmerte sich in diesem Durcheinander um ein junges Mädchen? All ihre Schuld bestand nur darin, dass sie sich nicht mit den anderen Studenten nach Deutschland hatte deportieren lassen – und wer wusste das schon? Einige Beamte der Universität, niemand sonst; und diese Leute mussten, wenn sie denn überhaupt noch in Budapest waren, derzeit andere Sorgen haben, als Studentinnen aufzuspüren. Persönlich interessierte Erzsébets Schicksal niemanden.
Aber der Name, der Name des Vaters, war auch jetzt, da die große Stadt schon an allen vier Ecken brannte, da die Russen sich von Straße zu Straße, von Haus zu Haus gegen die sich bereits zurückziehenden eingeschlossenen Deutschen und ungarischen Pfeilkreuzler vorkämpften, noch immer ein Reizwort für die Faschisten. Der Name des Vaters, an dem keine Erinnerung an politisches Handeln haftete, war in den vergangenen Jahren ein Fanfarensignal für jeden Faschisten gewesen. Die Person des Vaters, dieses einsame menschliche Leben, seine Arbeit, diese allen praktischen, alltäglichen Interessen entzogene wissenschaftliche Arbeit erzürnte und reizte seitdem die Kollegen und Politiker, und in der letzten Zeit war sein Name sogar für die Menschen auf der Straße eine Art hetzerischer Begriff.
Warum? Erzsébet hörte viele Diskussionen über diese Frage, las die Artikel und Flugschriften der Gegner, ohne diesen leidenschaftlichen Hetzereien eine bestimmte, klar formulierte Anklage entnehmen zu können. Ein Linker, sagten sie, oder ihre Anklagen waren nationalerer Art: engländerfreundlich, judenfreundlich, von den Juden oder den Engländern bezahlt, paktiert heimlich mit Moskau, hat den ungarischen nationalen Geist, die Wissenschaft verraten. Derlei wurde vorgebracht. Dabei war der Vater in keiner politischen Partei, und seine linksgerichteten Gesinnungsfreunde nahmen ihm seine bedachte Zurückhaltung übel. Der Vater ging auch nicht zu geheimen Versammlungen. Unter seinen Freunden waren zwar Juden, doch viele von ihnen hatten keine persönliche Beziehung zum Judentum und waren in dieser Frage wie in ihren politischen Ansichten anderer Meinung und diskutierten heftig mit dem Wissenschaftler. Trotzdem waren sie Freunde. Und dann waren da die anderen, die den Vater hassten. Sie schrieben und redeten über ihn, als organisierte er tatsächlich Parteien, heimliche Heere, als stünde er in unmittelbarem Kontakt mit den Alliierten, als hätte er das Land verraten und verkauft. Erzsébet wusste, dass diese Beschuldigungen falsch waren.
Der Vater war Astronom, Mathematiker, und ihr schien, noch in der letzten Zeit hätte er sich mehr und intensiver mit den Geheimnissen des Himmels befasst als mit den Ereignissen auf der Erde. Seine Meinung über die Juden war, dass sie Menschen seien wie alle anderen, die man nicht wegen ihrer Herkunft verurteilen und bestrafen dürfe; wie alle Menschen mit Fehlern, und einzig über ihre Fehler könne man urteilen und nicht über ihre Abstammung. Aber jetzt, da die Juden verfolgt wurden wie schädliche Tiere, war er in dieser Frage nicht mehr zurückhaltend; er teilte Heim und Vermögen mit den Verfolgten. Und Erzsébet wusste, dass der Vater geflohenen polnischen und serbischen Studenten sowie französischen Intellektuellen, die die Schrecken des Krieges nach Ungarn getrieben hatten, ebenso geholfen hatte in diesem Land, das seit der Besetzung durch die Deutschen nicht mehr Heimat war, sondern das Jagdgebiet von Verfolgern und Verfolgten.
Der Vater gehörte zu den Verfolgten. Am Tag der Besetzung – Erzsébet wird sich ihr Leben lang an diesen Sonntagmorgen erinnern – suchten ihn schon am frühen Nachmittag die Männer der Gestapo, und als sie ihn weder in der Wohnung noch im Büro fanden, hinterließen sie eine Vorladung, mit Bleistift auf einen Papierschnipsel geschrieben, und befahlen ihm, in einem Hotel in der Innenstadt zu erscheinen. Doch der Vater hatte zu dem Zeitpunkt schon von den Freunden ein Warnsignal bekommen und war mit dem Frühzug aufs Land gefahren.
Auch Erzsébet verließ in den Morgenstunden die Wohnung, weil zu befürchten stand, dass man sie verhören und sie zwingen würde, das Versteck des Vaters zu verraten – über die Verhörmethoden der Nazis und ihrer ungarischen Helfershelfer gingen zu dieser Zeit bereits zuverlässige Nachrichten um. Und dann folgte die Zeit – wie lange eigentlich? Erzsébet zählte: genau zehn Monate, vom neunzehnten März bis zum neunzehnten Januar, zehn Monate, auf Tag und Stunde genau, in denen Erzsébet nicht mehr zu Hause lebte.
Dieses Zuhause, der vertraute Arbeitsplatz des Vaters, wo er seit seiner Verwitwung mit der erwachsenen Tochter still und zurückgezogen gelebt hatte, war in diesen zehn Monaten langsam zerfallen. Zuerst hatten die deutschen Schergen die Zimmer durchsucht, dann hatten unbekannte und rätselhafte Hände Kleider und Gebrauchsgegenstände gestohlen; im Oktober, nach dem Aufstand der Pfeilkreuzler, forschten Diebe mit Armbinden in den erkalteten und verwüsteten Zimmern nach verbliebener Beute, bis im November eine Bombe das Haus und die Wohnung gänzlich zerstört hatte. Erzsébet wusste seit Wochen, was dem Vater noch nicht bekannt war, dass sie kein Zuhause mehr hatten; nur einige Manuskripte waren geblieben, einige Bücher, die ein wohltätiger Helfer in diesen zehn Monaten vorsichtig vor Räubern und Bomben gerettet hatte.
Das Zuhause war eine Ruine, und unter den Trümmern waren alle wertvollen Aufzeichnungen der Arbeit des Vaters verloren gegangen, die Fotografien, Berechnungen, die kostbaren englischen, französischen und deutschen Astronomiefachbücher, Briefe, die Streitschriften ausländischer Kollegen. Alles, was dem Vater im Leben noch wichtig sein konnte. Die Möbel, die alten Familienandenken, Kleider. An all das dachte Erzsébet überhaupt nicht mehr.
Der Vater verließ sich irgendwie auf das Schicksal der Wohnung. In diesen zehn Monaten des Untertauchens hatte er immer zuversichtlich davon gesprochen, dass sie bald in ihr ruhiges Haus in der Innenstadt zurückkehren würden, statt der zerstörten Dinge neue kaufen, dass sie die Aufzeichnungen und Bücher an Ort und Stelle finden würden, denn wer brauchte schon so etwas? So tröstete und ermutigte er sich. Und Erzsébet hatte in diesen zehn Monaten nicht die Kraft, ihm die Wahrheit über das Schicksal der Wohnung zu sagen.
Der Mann, auf dessen Kopf die Faschisten ein geheimes Blutgeld ausgesetzt hatten, den ungarische und deutsche Ermittler landesweit verfolgten, hielt sich in den Monaten des Untertauchens mit beharrlichem Glauben an der Hoffnung fest, dass die Arbeit seines Lebens nicht zerstört war. Er glaubte daran, dass er diese Arbeit eines Tages noch würde fortsetzen können, er glaubte an die Wohnung. Er, der große Wissenschaftler der Wirklichkeit, der auch die Geheimnisse des Himmels nie anders betrachtet hatte denn als Bilanz der Wirklichkeit, sprach manchmal mit abergläubischem Vertrauen von dem Zuhause, in das sie einst zurückkehren würden, Erzsébet und er, der verfolgte Gelehrte. Und Erzsébet wagte nicht, bei den gefährlichen und seltenen Treffen, wenn sie den untergetauchten Vater in einem der immer neuen und stets vertrackteren Gelegenheitsschlupfwinkel aufsuchte, von der Zerstörung zu berichten, die menschliche Hände, duckmäuserische und schäbige Diebe, blutrünstige Fahnder und zuletzt die Bomben ihrem Zuhause angetan hatten.
Vor zehn Monaten – als blickte sie vom jenseitigen Ufer des Lebens zurück, so fern schien diese Zeit –, einige Stunden nach der Flucht des Vaters und vor dem Eintreffen der ersten Gestapo-Knechte, hatte auch Erzsébet die Wohnung verlassen, die sie erst an einem nebligen Novemberabend wiedersah; vor einigen Wochen, als sie die Nachricht erhalten hatte, dass eine Bombe das Haus zerstört hatte. Jetzt gab es keine Wohnung mehr, keinen Arbeitsplatz, keine Aufzeichnungen, keine Bibliothek, nichts. Aber daran dachte sie nur zerstreut.
Zehn Monate. Und dann die vergangenen vierundzwanzig Tage. So viele waren es? Im Keller betrachteten viele den Weihnachtsabend als den Beginn der Belagerung, den Tag, an dem die ersten russischen Panzer am anderen Ufer aufgetaucht waren, auf einem der öffentlichen Plätze von Buda. Dann verschwamm alles im höllischen Stimmengewirr der Belagerung. Zehn Monate, in denen ihr Leben, ihr Schicksal in jeder Woche einen anderen Weg einschlug. Wochen, in denen sie beide, der Vater und Erzsébet, das Keuchen der schnüffelnden Schergen im Nacken gespürt hatten, Tage und Stunden, in denen es beinahe unmöglich war, auch nur für eine Nacht einen neuen Schlupfwinkel zu finden, irgendein Loch, ein Bett, einen Schrank, einen Dachboden oder einen Keller, weil die verängstigten Helfer müde zu werden begannen, weil das Halali der Jagdtreiber aus immer größerer Nähe widerhallte. Zehn Monate so, unter solchen Bedingungen, sind eine lange Zeit.
Erzsébet spürte erst jetzt, was für eine lange Zeit es war. Die Aussichten hatten sich geändert. Auf die wilde Treibjagd der ersten Monate stellte sich übergangsweise eine Art Windstille ein, das Leben schien weniger gefährlich, als wäre das große Treiben schwächer geworden, als wären die Schergen erschöpft. Das politische Klima schien um einen Deut sauberer geworden zu sein, einige ausländische Botschaften, die Schweden, die Schweizer, die Portugiesen und das Büro des päpstlichen Nuntius, wurden nicht müde zu helfen, namenlose Helden erschienen mit dem Abzeichen des Roten Kreuzes auf der Brust, ausländische Kräfte regten sich im Interesse der verfolgten Juden, der Hunderttausenden von Unglücklichen, die in Waggons und Gaskammern zusammengepfercht wurden, im Interesse der deportierten politischen Flüchtlinge. Man lebte in diesen zehn Monaten, und es war, als würde der wilde Sandsturm Samum um einen toben.
Manchmal jedoch ermattete dieser heiße Wind zu einer milderen Brise. Eines Tages verführte die Verfolgten ein unvernünftiges und blindes Vertrauen, schon wagten sie sich wieder hervor, gingen auf die Straße, trafen sich mit anderen, schickten Nachrichten. Der Vater war eines Tages vom Land wieder in die Hauptstadt gekommen: Mit dem Zug war er gefahren, und niemand hatte ihn angesprochen, niemand ihn erkannt oder verraten; er war angekommen, hatte sofort einen Schlafplatz bei einem ehemaligen Studenten gefunden, war gut gelaunt und zuversichtlich, schon verlangte er nach seinen Aufzeichnungen, wollte arbeiten. Mitten im Sommer war das gewesen.
Hunderttausende Juden aus der Provinz waren damals schon deportiert worden, die Budapester Juden und politisch Verfolgten aber sprachen in den mit dem Stern gekennzeichneten Gettohäusern und in den Schlupfwinkeln der Privatwohnungen erregt und hoffnungsvoll von der nahenden Befreiung. Als wäre etwas geschehen: Die Deutschen halten nicht mehr lange durch, die inneren ungarischen Kräfte revoltieren, die obersten geheimen politischen Mächte protestieren, es dauert nicht mehr lange. Und dann plötzlich die Panik.
Was war geschehen? Nichts Besonderes, vielleicht gerade nur, dass nichts geschehen war. Und sie verstanden, dass der nah geglaubte »Wandel«, den sie beinahe schon mit den Händen gegriffen hatten, noch weit entfernt war; Wochen, vielleicht Monate würden vergehen, und jeder Tag, jede Stunde war voll von schrecklichsten Schicksalsaussichten.
Nicht nur sie hatten es verstanden, die Verurteilten und Gejagten. Helfende Hände, die sich ihnen gestern noch gutmütig, bereitwillig oder vorsichtig berechnend entgegengestreckt hatten, erschlafften plötzlich verzagt. Boten gestern noch zehn Menschen den Untergetauchten an, ihnen für eine oder mehrere Nächte ein Dach über dem Kopf zu geben, wusste derselbe Untergetauchte heute in den Abendstunden schon nicht mehr, wo er in der Nacht den Kopf zur Ruhe betten würde. Weshalb? War etwas geschehen? Die Panik, die Verängstigung, eine kriegerische Pseudonachricht, die Botschaft von den »Wunderwaffen«, irgendeine absurde, wahnwitzige Lüge hatte die Menschen verschreckt, und wer gestern noch mit offener Bereitschaft zur Hilfe geeilt war, war heute schon zugeknöpft, eiskalt, stammelte verlegen, ging nicht mehr ans Telefon und öffnete die Tür nicht mehr auf das bekannte Klingelzeichen.
Zehn Monate lang hatte sich jede Woche der Takt dieses sonderbaren Reigens geändert. Wenige waren es nur, die diesen Rhythmus aushielten; wenige, die zäh und still die gefährliche Zwangsarbeit des Helfens auf sich nahmen; und wenige unter den Verfolgten, die keine überflüssigen Fehler begingen, nicht vor einem unerwarteten Hindernis zusammenbrachen, nichts übereilten bei einem der politischen Stimmungswechsel … Der Vater hatte diese Treibjagd ausgehalten.
Niemand, auch Erzsébet nicht, hatte zu hoffen gewagt, dass dieser einsame und linkische Mann mit dem gebrechlichen Körper, dem jedes weltliche Geschäft fremd war, die Monate der Verfolgung und des Untertauchens so zäh, so ausdauernd und mit so starker, nüchterner Umsicht überleben würde. Der Wissenschaftler hatte diese für ihn außergewöhnliche, seinem Körper und Geist fremde Lebensaufgabe mit einem solch praktischen Geschick gelöst, als hätte er sein Leben nicht zwischen abstrakten astronomischen Studien in einem von jedem weltlichen Lärm vakuumdicht verschlossenen Arbeitszimmer verbracht, sondern irgendwo auf einer politischen Laufbahn zwischen kämpferischen und jungen gesellschaftlichen Pionieren. Wortlos, mit stillem Lächeln, geduldig ertrug er die sich ändernden, dann immer erbärmlicheren und unbequemeren Lebenslagen; er passte sich an launische Mitbewohner an, immer hatte er eine Idee für den Augenblick, er wurde nicht müde, wenn Menschen beruhigt werden mussten, wenn man die Seele in den Menschen am Leben erhalten musste, die großspurig waren, aber schnell erschöpften und sich dann in Panikstimmung fahrig benahmen.
Das Nervensystem des Vaters hatte in diesen Monaten nicht versagt. Er konnte lesen, er konnte aber auch ohne Bücher und Gesellschaft oder – was für ihn noch belastender sein musste – sogar in der Gesellschaft von unkultivierten Menschen mit niederer Gesinnung ruhig, aufmerksam und umsichtig bleiben. Sein Name war ein Zeichen, ein gefährlicher und erregter Ruf für die Hetzer.
Was hassten sie eigentlich an ihm? Vielleicht nicht einmal so sehr sein politisches Verhalten – jeder wusste ja, dass er die zeitgenössischen faschistischen Ideen verachtete, die Rassentheorie, den Irrglauben der Macht, der von Hass und gewalttätiger Habgier angefacht wurde, und dass er daran glaubte, dass die Weltmächte, die von den Alliierten in Bewegung gesetzt wurden, die deutsche Kriegsmaschinerie letztendlich besiegen würden – nein, es war eher seine Haltung, die die Kollegen, die auf der Sonnenseite des Lebens herumscharwenzelten, und die Presse zu tödlicher Hetze anstachelte. Dieses Verhalten war unmissverständlich: Sein Schweigen reizte die »rechte Seite« genauso, als hätte er sich offen und lautstark gegen sie gestellt. Denn nichts hatten diese Machtverbände so nötig wie das moralische Ansehen des geistigen Menschen – alles hätten sie ihm gegeben, wenn er mit einem Nicken das blutige Abenteuer gutgeheißen hätte, das sie den Massen, in gefällige Schlagworte von Nation und Rasse verpackt, erstrebenswert machen wollten. Aber gerade dies, die moralische Zustimmung des geistigen Menschen, konnten sie von ihrem Vater nicht bekommen; und deshalb hassten sie ihn. Den Namen hätten sie gebraucht, den berühmten, reinen Namen, den unbescholtenen Namen des Wissenschaftlers; doch dieser Wissenschaftler hatte jahrelang geschwiegen, hatte sein Arbeitszimmer nicht verlassen und war Mitte März verschwunden. Deshalb hassten sie ihn und suchten ihn immer manischer.
Zehn Monate lang. Zehn Monate, in denen Erzsébet den Namen des Vaters nicht tragen durfte. In denen jedes Klingeln eine Bedeutung besaß. In denen sie sich vom Verkauf ihrer bescheidenen Wertgegenstände durchbrachten, zu lächerlichen Preisen – niemand hat so viele überflüssige Kosten wie ein Untergetauchter –, und jeden Tag nahm der wenige Sauerstoff ab, der zu diesem Kellerleben notwendig war. Eine Uhr, ein alter Ring, die Geige des Vaters, und dann – ein schmerzhafteres Opfer – eines der unter schwierigen Umständen geretteten seltenen Bücher: Alles wanderte auf den Schwarzmarkt. Das Untertauchen verzehrte das Geld.
Seit zehn Monaten lebte der Vater so; ohne Lebensmittelkarten, die auf dem Schwarzmarkt sündhaft teuer gekauften Lebensmittel jeden Tag mit anderen Hungernden teilend. Und Erzsébet hatte nicht gewagt, ihm von der absoluten Not zu berichten, die sich bei ihnen in den vergangenen Monaten angekündigt hatte. Kleider, Bücher, Unterwäsche, alles hatte sich bereits zu Lebensmittelpaketen verwandelt, gefüllt mit der für ihre täglichen Lebensbedürfnisse notwendigen Nahrung. Die Hilfsquellen begannen zu versiegen, der Vater wusste übrigens auch nicht – und durfte es auch nie erfahren –, dass Erzsébet in der letzten Zeit gezwungen gewesen war, die geheime Hilfe unterirdischer Bewegungen anzunehmen. Am Tag der Belagerung besaßen sie nichts mehr.
Die Schreckensherrschaft der Pfeilkreuzler-Henkersknechte hatte auch die letzten gutwilligen, mutigeren Freunde verängstigt. Nachts wurde an Wohnungen geklingelt, sie kamen aufgrund von Anzeigen, und an Anzeigen herrschte kein Mangel. Als hätte eine Gesellschaft im Augenblick der äußersten Gefahr den Rest ihrer menschlichen Würde verloren: Massenweise wurde verraten, wurden anonyme Briefe geschrieben, oder man eilte, mit vollem Namen, persönlich, einen Unglücklichen anzuzeigen, der sich im Getümmel dieser amoklaufenden letzten Runde erschöpft in eine Ecke eines der hohlen Schlupfwinkel zurückgezogen hatte.
Es kam der Tag, an dem Erzsébet das Gefühl hatte, sie könnte nicht mehr die Nerven, Kniffe, Ideen und Erfindungen aufbringen, um dieses Tempo zu ertragen. Es kam der Abend, an dem Erzsébet die Nachricht erhielt, man kenne den Schlupfwinkel des Vaters und werde ihn in der Nacht holen gehen. Ein »Kommandobulle«, einer der Mörder, hatte vor seiner Geliebten mit der geplanten nächtlichen Unternehmung geprahlt, einer Studentin – und dieser sonderbare Geist, der den Menschen ihre Handlungen einflüstert, trieb dieses Mädchen, das den Pfeilkreuzlern nahestand, Erzsébet aufzusuchen und ihrer Kommilitonin alles zu verraten.
Dies geschah um sieben Uhr am Abend, zwei Tage vor Weihnachten. Noch jetzt spürt Erzsébet das blanke Entsetzen, das ihren Körper und ihre Seele befiel, als sie die Nachricht hörte. Einen neuen Schlupfwinkel für den Vater suchen, in der Winternacht, in der bombardierten Stadt, wo die meisten schon ihre Wohnungen verlassen hatten und in den Luftschutzkellern schliefen. Den allseits bekannten Vater der Öffentlichkeit der Luftschutzkeller auszusetzen oder ihn in einer leeren, ungeheizten Wohnung verstecken zu müssen, aus der er vor den Bomben nicht in den Keller würde fliehen können – immer würde sie sich an das nervöse Zittern erinnern, das ihr über den Leib lief, als sie diese Nachricht hörte.
Und alle waren schon erschöpft. Anteilnahme, Hilfsbereitschaft, alle besseren menschlichen Gefühle waren in den Menschen bereits versiegt. Alle erwarteten jeden Augenblick den möglichen Tod, die Bombe, die Kanonenkugel oder das schreckliche Abenteuer des Übergangs, die ungewisse Zukunft, den Wandel, dessen Folgen niemand im Voraus abschätzen konnte.
In diesen Weihnachtstagen, den letzten vor der Belagerung, füllte sich die Stadt mit Angst und Gleichgültigkeit. Alle fürchteten sich, alle prüften ihr Gewissen oder zählten bange, mit der knauserigen Sorgfalt eines Geizhalses, ihre »Vorteile«. Die Bewohner der großen Stadt waren zögerlich, als quälte sie das albtraumhafte Bewusstsein der Verantwortung für eine schwere gemeinsame Straftat. Freunde brachen miteinander, Verwandte und Familienmitglieder gingen mit äußerster Wut aufeinander los oder flohen zueinander – alle, wie viele?
Die Bevölkerung von Budapest wurde in diesen Tagen einschließlich der Flüchtlinge auf eineinhalb Millionen menschliche Seelen geschätzt. Die Flüchtlinge, die die Schreckensnachrichten der Nazis vor den Russen aus ihrem Zuhause vertrieben hatten, aus fernen Gehöften in Siebenbürgen, dem Oberland und der Tiefebene – die Nachrichten, dass die Russen die Dörfer und Städte niederbrannten und die Bevölkerung töteten, dass sie nicht einmal bei Neugeborenen Gnade kannten, dass ein Vaterlandsverräter, ein Henker seiner Familie sei, wer nicht vor ihnen fliehe. Propaganda!, sagten viele, aber sie sagten es zähneklappernd. Letztlich wusste niemand etwas Sicheres. Die Russen waren schon ganz nah, nur einige Kilometer entfernt, und noch immer wusste niemand etwas Sicheres. Als läge dichter Dunst zwischen der bekannten Welt und den Russen; wer nach ihnen griff, schien die Hand in Nebel zu strecken.
Aber der Vater musste fliehen. Zwei Tage vor Weihnachten, als der Himmel um Budapest schon rot glühte, als das Heranfliegen der Bomber nicht mehr im Radio angesagt wurde. Das Telefon funktionierte noch, Wasser und Strom gab es noch in der Stadt, ab und an zuckelte eine verdunkelte Straßenbahn durch die aufgerissenen, von Panzerfallen, Maschinengewehrstellungen, fest installierten Kanonen verunzierten Straßen, und Erzsébet machte sich noch einmal auf, zum letzten Mal einen Unterschlupf, einen Winkel zu suchen für den verfolgten und von der nahen Vernichtung bedrohten Vater.
An zwei Türen klopfte sie vergeblich, bei der einen Adresse waren die Freunde schon weggezogen, und hinter der anderen Tür stand das seit einigen Tagen in den Kreisen der Teilnehmer an Untergrundbewegungen wohlbekannte Partisanenquartier leer, eine bombenzerstörte Dreizimmerwohnung im zweiten Stock eines Mietshauses: Niemand antwortete auf das Hämmern an der Tür, und in dem dunklen Toreingang erfuhr Erzsébet von einem flüsternden Unbekannten, die Pfeilkreuzler hätten die Wohnung vor einigen Tagen durchsucht und Freunde und Fremde weggeschafft. Sie trat aus dem Tor und blieb auf der dunklen Straße stehen. Wohin jetzt? Eine Adresse fällt ihr noch ein, eine Adresse in Buda. Und schier rennend macht sie sich auf den Weg zur Kettenbrücke.
Ende der Leseprobe