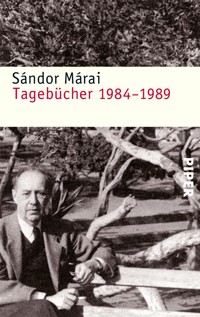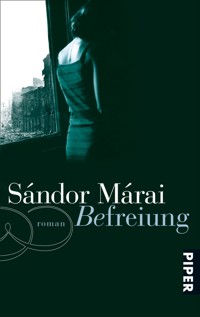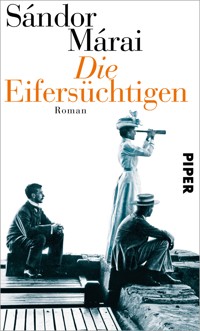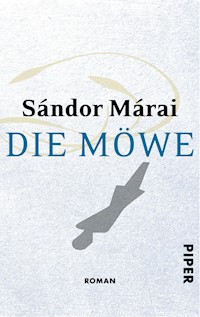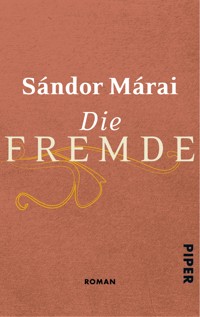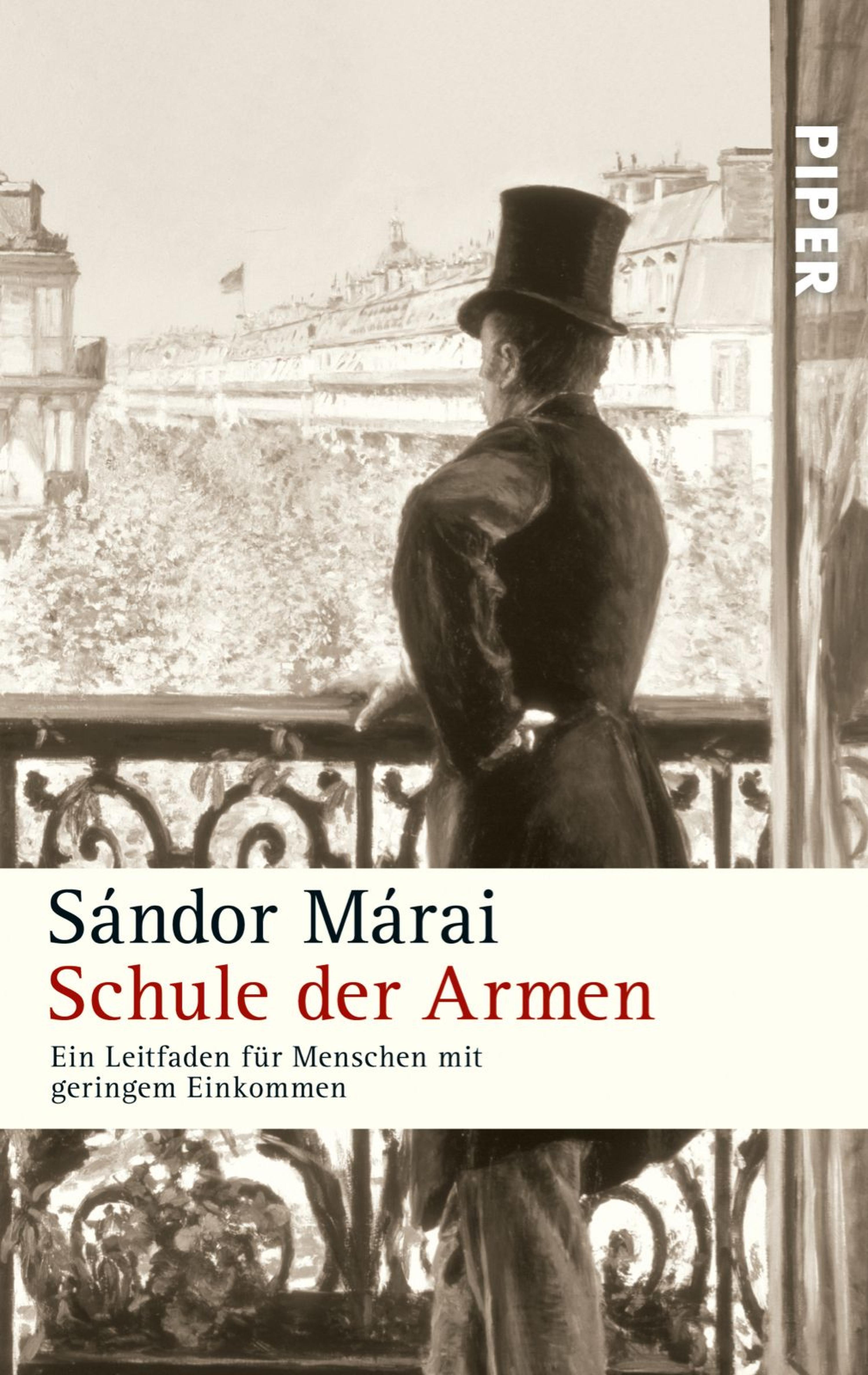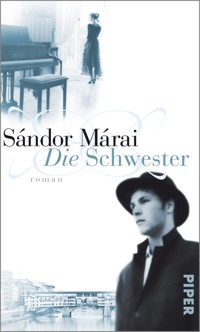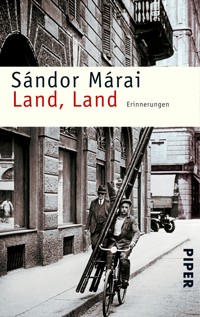
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Glut des Verbrechens brennt alles nieder. Im fernen Exil hat Sandor Marai aufgeschrieben, was er zuletzt in seiner Heimat Ungarn erlebte - von der deutschen Besetzung Ungarns 1944 bis zu seiner Abreise ins lebenslängliche Exil 1948. Das bewegende Zeugnis eines bedeutenden europäischen Literaten. Autorenporträt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Ungarischen von Hans Skirecki
Die Übersetzung wurde gefördert durch den »Translation Found of the Hungarian Book Foundation«, Budapest. Das Buch wurde für die deutsche Ausgabe leicht gekürzt.
Herausgegeben von Siegfried Heinrichs
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
2. Auflage 2004
ISBN 978-3-492-96012-0
© Rechtsnachfolger Sándor Márai, Vörösváry-Weller Publishing Co. Ltd., Toronto
Titel der ungarischen Originalausgabe:
»Föld, Föld! …«, Toronto 1972
Neuausgabe: Akadémiai Kiadó / Helikon Kiadó, Budapest 1991
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2000 Oberbaum Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Büro Hamburg
Stefanie Oberbeck, Isabel Bünermann
Umschlagfoto: Premium / Nonstock
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ERSTER TEIL
Weit weg ist die Welt, mit schrecklicherStimme aus Blei jault der KriegDie Glut des Verbrechens brennt alles niederJuden und Christen, uns EuropäerMit Blut gezeichnet die Türen der HäuserGetötet der, an den zu glauben sich lohnteWofür zu leben sich lohnte ist Schmach nunGestank nach Aas in deinem HausGeschunden die Gläubigen und der GlaubeWeit geöffnet dein Tor, ApokalypseDie Blutschuld kreischt über der WeltMorgen begrab ich, die ich heut küsseMorgen wird sterben, die ich umarmeMorgen verkauft mich, die am Abend mich wiegt …
Weihnachten 1944
DER NAMENSTAG GEHÖRTE IN UNGARN immer zu den heiteren, gastfreundlichen Stammesfesten. Deshalb luden wir auch in diesem Jahr, 1944, der Vorschrift des gregorianischen Kalenders gemäß zum 18. März, dem Sándor-Tag, einige Verwandte ein.
Das Essen war so bescheiden, wie es die Kriegsmisere gebot. Aber Freunde am Plattensee hatten auch in diesem Jahr einige Flaschen eines feurigen, auf vulkanischem Boden gediehenen Bratenweins geschickt. An diesem frischen Vorfrühlingsabend ging es behaglich zu, denn nicht nur die spärlich beschickten Kachelöfen brauchten den Gästen einzuheizen, sondern das übernahm auch das ehrwürdige Getränk. Wir saßen im Eßzimmer des alten Budaer Hauses, in der Wohnung, wo ich seit fast zwei Jahrzehnten lebte.
Es gibt Tage, an denen die Menschen mit sicherem Instinkt so leben, als hätten sie eine Nachricht, eine Botschaft gehört, die sich unmittelbar auf das persönliche Leben bezieht – man weiß nicht, was es ist, aber der Augenblick ist da, man riecht ihn. Einen solchen Geruch hatte das Beisammensein an diesem Namenstag Mitte März 1944. Wir »wußten« nichts Sicheres, aber alle witterten, daß eine wesentliche, entscheidende Veränderung sich anbahnte, ja nahe war.
In dieser Zeit der Woronescher und anderer Kriegstragödien führten die Bewohner dieser verdunkelten, aber relativ heilen Großstadt nicht mehr das gesellige Leben früherer Jahre. Und doch hatte meine Frau an diesem Abend das Namenstagsessen so arrangiert, wie wir in Friedenszeiten Gäste bewirtet hatten: Aus den Tiefen der Schränke hatte sie das Meißner Zwiebelmusterporzellan hervorgesucht, gedeckt wurde mit dem alten Silber, und statt des elektrischen Lichts beleuchteten verschwenderisch Kerzen in zwei französischen Kerzenhaltern die Tafel und die Gäste. Elf Personen saßen um den ovalen Tisch. Diese elf trafen sich nach diesem Abend nie mehr an einem gemeinsamen Tisch. Jetzt ist es auch nicht mehr wahrscheinlich, daß sie sich je wieder zusammensetzen, denn mehrere sind gestorben.
Das vertraulich-ahnungsvolle Flackern des Kerzenlichts beleuchtete die Gesichter, die bürgerliche Runde, die alten Möbel. Ich hatte nie Möbel gekauft; was ich besaß, war als Erbschaft aus den Gütern zweier Familien, aus oberungarischen Haushalten an uns gefallen. Wir hatten keine Kunstschätze, aber auch keinerlei Kaufhausmöbel: Was in den Zimmern stand, hatten Geschmack und Gewohnheit ein wenig altmodischer Menschen ausgewählt.
Die Türen zwischen den Zimmern waren geöffnet. Wenn ich jetzt an dieses von flackernden Kerzenflammen beleuchtete, ahnungsvolle Bild zurückdenke, ist es, als hätten wir oberungarische und Budaer Bürgersprößlinge einmal noch, zum letzten Mal, das Leben unserer Väter nachgespielt. All das, was Kulisse und Requisite des vergangenen Lebens war, wurde an diesem Abend lebendig.
Die Unterhaltung begann lustlos, aber der Wein und der Familienjargon halfen über die anfänglichen Spannungen hinweg. Nach dem Essen blieben wir natürlich sitzen, tranken Wein und Kaffee und plauderten.
Damit kam unabwendbar der Augenblick, daß Gastgeber und Gäste leidenschaftlich zu politisieren anfingen. Dieser Abend war ein besonderer und denkwürdiger, nicht nur wegen dem, was auf ihn folgte – der völlige Untergang einer Lebensform –, sondern auch auf andere Weise: Wieder einmal gab es einen Moment, in dem die Menschen das Verhängnis mit ihren Instinkten wenigstens so ahnen wie mit dem Verstand und ihren Informationen. Die anwesenden Verwandten waren – mit einer Ausnahme – eindeutig nazifeindlich eingestellt. Aber alle fürchteten sich vor dem Kriegsende und rätselten besorgt, wie es mit der unmittelbaren Zukunft stehe, was der frostige Frühling bringen und wie sich die militärische Lage entwickeln werde, was die Ungarn im historischen Umbruch erwarte.
Die meisten waren sich in der Befürchtung einig, Gutes sei nicht zu erwarten. Doch nicht lange, und der nazifreundliche Verwandte wartete mit den Legenden von den »Wunderwaffen« auf. Das Land war damals voll mit diesen Märchen; man sprach von Waffen, die den Gegner »einfrören«, und von Flugzeugen, die so schnell flögen, daß man die Piloten in ihre Sitze eingipsen müsse, damit sie nicht herausfielen. Wir erledigten diese Albernheiten nach Möglichkeit mit einer wegwerfenden Handbewegung.
Nicht mit einer solchen Handbewegung zu erledigen war die Furcht, die Angst vor der Realität: Die Kriegsentscheidung nahte. Als ich sagte, Ungarn müsse die Folgen auf sich nehmen und mit den Deutschen brechen, stimmten mir die meisten Gäste zu, wenn auch lustlos – nicht so der nazifreundliche Verwandte. Er schnaubte los, schlug weinumnebelt auf den Tisch und wiederholte die Leitartikellosungen vom »Durchhalten« und der Bündnistreue. Als ich widersprach, gab er mir eine überraschende Antwort. »Ich bin Nationalsozialist«, rief er. »Du«, und er zeigte auf mich, »kannst das nicht verstehen, weil du begabt bist. Aber ich bin nicht begabt, und deshalb brauche ich den Nationalsozialismus.«
Das große Wort verklang, der sanguinische Verwandte hatte die Wahrheit seines Lebens ausgesprochen und starrte nun erleichtert vor sich hin. Einige lachten; aber es klang säuerlich, irgendwie hatte keiner Lust, richtig zu lachen. Als ich mich besonnen hatte, entgegnete ich, ich mißtraute meiner Begabung, sie sei eine Fähigkeit, die man täglich von neuem beweisen müsse, aber ich wäre auch dann kein Anhänger der nationalsozialistischen Ideen, wenn ich unbegabt wäre, was ja nicht unmöglich sei.
Der Verwandte schüttelte düster den Kopf. »Du kannst das nicht verstehen«, beharrte er und schlug sich an die Brust. »Jetzt geht es um uns, die Unbegabten«, sagte er, und es klang wie das Bekenntnis des Helden aus einem russischen Roman. »Das ist unsere Zeit!«
Hierauf begannen wir befreit zu lachen und sprachen von etwas anderem.
Gegen Mitternacht verabschiedeten sich die Gäste, denn die Straßenbahnen fuhren in der verdunkelten Stadt abends nur noch einige Stunden. Als ich den letzten ins Vorzimmer begleitete, läutete das Telephon. Ich erkannte die Stimme eines Freundes, der dem Ministerpräsidenten nahestand. Er pflegte nachts nicht anzurufen. Deshalb fragte ich argwöhnisch: »Was gibt es?«
»Heute nacht haben die Deutschen Ungarn besetzt.«
Er sagte das so gelassen und selbstverständlich, als handelte es sich um ein gesellschaftliches Ereignis. Er war ein exzellenter, disziplinierter Beamter. Ein Weilchen schwiegen wir, dann fragte ich: »Wo sind sie?«
»Die Deutschen? … Hier, in der Burg. Sie halten gerade Einzug mit ihren Panzern. Ich sehe sie aus dem Fenster.«
»Wo bist du jetzt?«
»Im Ministerium.«
»Kannst du zu mir kommen?«
»Das ist jetzt nicht möglich«, sagte er ruhig. »Sie lassen mich nicht zwischen den Panzern durch. Aber morgen komme ich vielleicht, wenn ich noch nicht festgenommen bin.«
»Gute Nacht«, sagte ich und spürte, wie dumm das war, was ich sagte.
»Gute Nacht«, antwortete er ernst und legte auf. Am Tag darauf nahmen sie ihn noch nicht fest, erst am nächsten, und sie brachten ihn sofort in ein deutsches Internierungslager …
Das Zimmermädchen kam und begann – in weißen Handschuhen, auch das gehörte zur Hausordnung – den Tisch abzuräumen. Ich ging in mein Zimmer und setzte mich an den alten Schreibtisch. Die Stadt vor den Fenstern war still in der Frühlingsnacht. Nur hin und wieder hörte ich einen Panzer auf seinem Weg in die Burg lärmen, darin wohl Gestapomänner, die die Ämter besetzen sollten. Ich hörte den Lärm, rauchte eine Zigarette. Im Zimmer war es angenehm lauwarm. Ich betrachtete die Regale voller Bücher, zerstreut, sechstausend Bände, zusammengetragen aus aller Welt. Da war Mark Aurel, den ich beim Trödler an der Seine erstanden hatte, dann Eckermanns Gespräche mit Goethe, eine alte ungarische Bibelausgabe. Und noch sechstausend andere. Von den Wänden herab blickten mich mein Vater, mein Großvater, verstorbene Verwandte an.
Dem ersten russischen Soldaten begegnete ich einige Monate später, am zweiten Weihnachtsfeiertag 1944. Ein junger Mann, ich glaube, ein Weißrusse; ein typisch slawisches Gesicht mit breiten Backenknochen und blondem Haar, von dem eine Strähne ihm unter der helmartig spitzen Pelzmütze mit dem Sowjetstern ins Gesicht hing. Er kam auf den Hof des dörflichen Gemeindehauses geritten, ein düster dreinschauender, einfacher junger Soldat, richtete die Waffe auf mich und fragte, wer ich sei.
»Ein Schriftsteller«, antwortete ich. Wir standen im Schnee, die Pferde wieherten und keuchten sich dampfend die Müdigkeit aus den Lungen. Wie die russischen Kavalleristen allgemein, war auch dieser Junge ein ausgezeichneter Reiter, der sein Pferd nicht schonte: Im Galopp erhebt sich der russische Reiter nicht aus dem Sattel, sein Oberkörper lastet mit vollem Gewicht auf dem Tier, der Reiter haftet nahezu regungslos am Pferd. Er hatte meine Antwort nicht verstanden und wiederholte die Frage. Deutlicher artikulierend sagte ich: »Pissatel.« Ich konnte nicht Russisch, aber dieses Wort hatte ich mir eingeprägt, denn es hieß, den Schriftstellern täten die Russen nichts. Und in der Tat, der Junge lächelte. Sein junges, stolzes, kindlich zorniges, rotbäckiges Gesicht erhellte sich.
»Choroscho«, sagte er. »Idi domoi.«
Er sprang vom Pferd und eilte zum Gemeindehaus. Ich verstand, daß ich entlassen war und gehen konnte. Die anderen aus der russischen Patrouille beachteten mich nicht. Ich eilte durch den verschneiten Garten und trat auf der Landstraße den Heimweg zu dem dörflichen Haus am Waldrand an, wo ich schon acht Monate wohnte. Das Haus stand in einer Art Niemandsland, inmitten eines großen Gartens, ein Stück ab von der Gemeinde, die halb Dorf, halb Ferienort war. Die acht Monate hatte ich durchweg unter Flüchtlingen und Deserteuren verbracht. Das Quartier am Waldrand erwies sich als glückliche Wahl, die Deutschen ließen sich hier ebensowenig sehen wie die ungarischen Nazis und die Vertreter der neuen Macht, auf Menschenjagd dressierte Pfeilkreuzler.
An der Donau entlang eilte ich in das verlassene Haus zurück. Auf dem Fluß trieben Eisschollen. Zwei Tage vorher hatten die Deutschen unauffällig und geräuschlos die Gemeinde und die ganze Umgebung geräumt. Budapest war an diesem Tag noch nicht völlig von den Russen eingeschlossen. Am Donauknie, bei Esztergom und am gegenüberliegenden Ufer waren heftige Kämpfe im Gange, doch am rechten Flußufer war es relativ still. Manchmal bekamen wir eine Granate ab, manchmal zerschlug eine aus Zerstreutheit oder Versehen abgeworfene Bombe ein Haus im Dorf.
Es ging auf den Abend zu, das Haus lag im Dunkel, Strom gab es seit zwei Tagen und hernach monatelang nicht. Feuerholz hatten wir noch; auch Mehl, fünfzehn Kilo; im Weingarten hatte ich Schmalz vergraben, in zehn Flaschen gegossen; wir hatten auch Seife und Kaffee. Ich besaß noch einen überflüssigen Anzug; auf dem Dachboden, unter einem Balken, steckte in einer flachen Lucky-Strike-Blechbüchse unser restliches Geld, viertausend Pengö; damals reichte es für zwei Monate. Und ich hatte an jenem Tag auch noch Zigaretten.
Meine Leute schliefen schon, ich kochte Kaffee und saß dann bis zum Morgen allein in dem dunklen Zimmer vor dem langsam erlöschenden Ofenfeuer. An diese Nacht entsinne ich mich überdeutlich, klarer und lebendiger als an vielerlei, das danach folgte. Etwas war zu Ende, eine unmögliche Situation hatte sich in einer neuen, ebenso gefährlichen, aber samt und sonders andersartigen Situation aufgelöst. Der russische Soldat, der heute in mein Leben getreten war, war natürlich alles andere als ein rotbäckiger slawischer Junge aus der Wolgagegend. Er war, daran mußte ich denken, nicht nur in mein Leben eingetreten mit allen seinen Folgen, sondern in das Leben ganz Europas. Von Jalta wußten wir noch nichts. Was wir wußten, war eine Tatsache: Die Russen sind hier, die Deutschen sind weg, nicht mehr lange, und der Krieg ist aus – das war es, was ich dem Geschehenen entnahm.
Und noch etwas: daß jetzt eine Frage zu beantworten war. Die Frage konnte ich nicht in Worten ausdrücken, aber an dem Tag, als ein Soldat aus dem Osten in ein dunkles ungarisches Dorf eingeritten war, verstand ich – und der Mensch »versteht« immer nur, was er sieht und betastet – mit der Haut und allen Sinnen, daß dieser junge sowjetische Soldat eine Frage nach Europa mitgebracht hatte.
Sie geisterte da schon, laut und still, seit annähernd dreißig Jahren durch die Welt: Was ist der Kommunismus? Was ist sein Sinn? … Jeder gab, nach der Interessenlage, der Überzeugung, dem politischen Glaubensbekenntnis, der politischen Weltlage, darauf eine andere Antwort. Viele logen, übertrieben. Aber dann sprach ich mit anderen, die nicht logen, und ich las Bücher, die – die Person des Autors belegte es – nicht übertrieben. Jedenfalls lebte ich in einer Atmosphäre, wo der Kommunismus gleich auf die sieben Hauptsünden folgte. Deshalb hielt ich den Augenblick für gekommen, alles jemals über die Russen und die Kommunisten Gehörte zu vergessen. Als ich auf dem verschneiten, düsteren Hof des Gemeindehauses zum erstenmal einem sowjetischen Soldaten begegnete, begann auch in meinem Leben die große Prüfung, die Suche nach der Antwort auf die Frage, die Gegenüberstellung der kommunistischen und der nichtkommunistischen Welt – und zugleich begann diese Prüfung in der westlichen Welt. Eine Kraft war in Europa erschienen, und die Rote Armee war lediglich der militärische Ausdruck dieser Kraft. Was macht diese Kraft aus? … Der Kommunismus? … Die Slawen? … Der Osten?
Menschen tappten mürrisch um das nächtliche Haus, näherten und entfernten sich. Sie sprachen in einer fremden Sprache. Ich saß im dunklen Zimmer und nahm mir vor, so gut wie möglich meinen Verstand von aller Voreingenommenheit zu säubern und die Russen und Kommunisten ohne Resterinnerungen an meine Bücher und Gespräche und ohne das Vorurteil der offiziellen antibolschewistischen Propaganda zu betrachten.
An diesem späten Nachmittag hatte ich persönlich ein Erlebnis, wie es ähnlich sogenannten Geistesarbeitern in Europa vorher erst zweimal zuteil geworden war: im 9.Jahrhundert, als die Araber bis Autun und Poitiers vordrangen, und im 16. Jahrhundert, als die Türken bis Raab und Erlau kamen. Weiter ließ man sie auch damals nicht in Osteuropa. Die Dschingis-Khans, Timur-Lengs und Attilas mit ihren Beute- und Eroberungsfeldzügen waren im europäischen Raum tragische, aber vorübergehende Zwischenspiele, ihre Horden hasteten auf das magische Signal eines asiatischen Stammesunglücks hin eines Tages Hals über Kopf weg aus Europa, nach Hause. Die Araber jedoch traten bereits mit einem weltanschaulichen, rassischen und geistigen Bewußtsein zum Sturm auf eine andere Weltanschauung, Rasse und geistige Bewußtheit, das Christentum, an – und als Karl Martell, der Bastard, sie bei Autun endgültig in die Flucht schlug, ließen sie in Europa nicht nur die Erinnerung an Brandschatzungen zurück, sondern auch die großen Fragen der arabischen Bildung, die eine Antwort verlangten. Sie hatten nicht nur die Astronomie, die Navigation, die Medizin, eine neue Ornamentik und den östlichen Naturatlas mitgebracht, sondern auch ein Zahlensystem, welches das technische Denken ermöglichte, als die komplizierten und schwerfälligen Ziffern des griechisch-römischen Zahlensystems ihm wichen. Sie brachten das Selbstbewußtsein des Hellenismus, das in den dunklen Zellen und verkapselten Seelen der mittelalterlichen Scholastiker kaum noch glomm, als schließlich Gerhard von Cremona wissenschaftliche und literarische Werke von mehreren Dutzend Griechen ins Lateinische übersetzte, darunter fast den kompletten Aristoteles … Auf diese »barbarische«, diese erste große Frage des Ostens fand die christliche Welt eine gute Antwort: nicht allein, bei Autun, mit den Waffen, auch mit der Renaissance und dem Humanismus, die ohne den Anreiz des hellenistischen, des aristotelischen Selbstbewußtseins der arabischen Bildung in der Seele des mittelalterlichen Menschen vielleicht nie erblüht wären.
Die Renaissance war auf jeden Fall eine Antwort auf den ersten großen weltanschaulichen Angriff des Ostens. Auf den zweiten, den des osmanischen Weltbilds und des orientalischen Imperialismus, reagierte die christliche Welt wiederum nicht nur mit Waffengewalt, sondern mit einem großartigen Erneuerungsversuch, der Reformation. Wie aber wird meine, die westliche Welt dem jungen russischen Soldaten antworten, der heute aus dem Osten eintraf und mich, einen namenlosen europäischen Schriftsteller, fragte, wer ich sei?
Ich saß im Dunkel, dem ganz besonderen Dunkel, und lauschte dem Kanonenfeuer, das mit der Eintönigkeit der Maschinen einer Fabrik durch die Nacht dröhnte und alles zerstörte, was für mich, einige Kilometer entfernt, noch vor kurzem Zuhause und Weltbild gewesen war, und ich versuchte mir die Frage auszumalen, die der gesunde, blonde slawische Soldat in seiner chinesischen Steppjacke an meine Welt richten würde. Über die »Antwort« dachte ich nicht nach, ich wußte, solche »Antworten« kann man nicht beschließen. Die Humanisten hatten die Renaissance nicht »beschlossen«, Luther nicht die Reformation … Eine solche Antwort geschieht einfach irgendwie. Ich versuchte mir vorzustellen, was dieser russische Soldat eigentlich von mir wollte.
Natürlich würde er uns die Schweine, den Weizen, das Öl wegnehmen, die Kohle und die Maschinen, daran bestand kein Zweifel. (Damals mutmaßte ich noch nicht, daß er auch Menschen wegbringen würde.) Aber was will er noch außer den Schweinen, dem Weizen und dem Öl? Will er auch meine »Seele«, also meine Persönlichkeit? Es dauerte nicht lange, und diese Frage stellte sich mit allem Nachdruck, nicht nur in meinem Inneren, in der Nacht und in dem einsamen dörflichen Haus. Wir erfuhren, daß er uns dies alles nehmen wollte und obendrein auch noch unsere »Seele«, unsere Persönlichkeit. Als wir das wußten, gewann diese Begegnung über das Schicksal einer Nation hinaus für die gesamte Welt einen anderen Sinn.
Große Reiche verblühen schneller als die Tropenwälder. Die Geschichte steckt voller solcher rätselhafter Mammutskelette, wie es das Seleukidenreich ist, das nubische, das libysche Reich – einige historische Augenblicke lang blühten sie, dann deckte sie spurenlos der Sand zu. Nur ein Wahnsinniger kann glauben, das Schicksal des tausendjährigen Ungarn habe für die Riesenvölker irgendeine Bedeutung. Wenn es ihnen im Wege steht, zertreten sie es, ohne Zorn, gleichmütig; wenn sie es gebrauchen können, für einen Augenblick, nehmen sie es für eine Hilfsfunktion unter Vertrag, wie es gestern die Deutschen taten und morgen die Russen tun werden. Das ist Schicksal, und gegen das Schicksal kann eine kleine Nation sehr wenig ausrichten … Aber die Frage, was dieser junge russische Bolschewik in mein Leben – in das Leben aller, die wir in den Lebensformen der westlichen Bildung erzogen wurden – bringt, muß ohne Vorurteil und Voreingenommenheit beantwortet werden. Ich vermeinte, im Dunkel das fremde, gleichgültige junge Gesicht zu sehen. Es war nicht unsympathisch, aber es war auf unheimliche Weise fremd.
In diesem Augenblick, in dieser Phase des Krieges dachte nicht nur ich mit bangem Interesse an die Russen – ich, ein »bürgerlicher« ungarischer Schriftsteller in einem entlegenen ungarischen Haus. Sicherlich waren auch die Engländer, Franzosen und Amerikaner voller Erwartung und Ungewißheit. Ein großes Volk hatte um den Preis schrecklicher Opfer bei Stalingrad den Gang der Geschichte gewendet, und ich war an diesem Tag einem Menschen begegnet, der diese große Kraft verkörperte. Vielen, auch den Naziverfolgten, brachte der junge Russe eine Art Befreiung, die Rettung vor dem Naziterror. Aber die Freiheit konnte er nicht bringen, er hatte sie selber nicht. Das wußte man damals noch nicht überall.
Zwei Wochen lang kamen sie nur sporadisch, nur einzeln oder zu zweit. Meistens baten sie um etwas: um Wein, etwas Eßbares, manchmal nur um ein Glas Wasser. Als die erste Ängstlichkeit verflogen war, verliefen diese Begegnungen mitunter in menschlichem, wenn auch ein wenig theatralischem Ton. Nach der Klärung der Grundbegriffe des Grüßens und der Kontakte zueinander blieben unsere Möglichkeiten zum Gespräch mangelhaft. Im Haus hielt sich eine junge Frau auf, die in Prag studiert hatte und flüssig Tschechisch sprach. Sie war die Dolmetscherin, die Russen verstanden sie einigermaßen.
Dann kamen sie Tag und Nacht, ohne zu klingeln oder anzuklopfen. In den ersten Tagen und Nächten waren wir überrascht, wenn urplötzlich ein Russe mit seiner Maschinenpistole an unserem Tisch oder Bett stand. Aber auch daran gewöhnten wir uns rasch. Die meisten blieben nicht lange.
Einmal kamen sie zu dritt, zwei Offiziere und ein gewöhnlicher Soldat. Sie kamen gegen Mittag, und ich bemühte mich, sie höflich zu empfangen, wie es sich gehört, denn ich hatte die Erfahrung gemacht, daß eine solche Behandlung die russischen Besucher am wirksamsten zähmte; ich gab ihnen die Hand, bot ihnen Platz an, bewirtete sie mit meinen Zigaretten und aus einer Schnapsflasche und wartete ab. Gute Manieren und Förmlichkeiten konnten die Russen durchaus beeindrukken. Zumeist kamen sie mit Gelärm, nach »Gewehr« und »Hermann«, also Deutschen, suchend, aber ein höfliches Wort, eine gastfreundliche Geste beschwichtigte sie. So auch jetzt: Als ich das Schnapsglas hob, um auf ihr Wohl anzustoßen, standen sie alle drei gleichzeitig auf und erwiderten, das Glas in der Hand, meinen guten Wunsch. Danach setzten wir uns um den altertümlichen Kachelofen und begannen – ganz wie bei einem Manöver die Einquartierten und die Hausbewohner – uns zu unterhalten. Die anderen – meine Frau, ein kleiner Junge, der sich gerade im Haus aufhielt, und die junge Frau, die Tschechisch konnte – saßen zwischen den Gästen. Die Situation war merkwürdig und anders, als nach den Schreckensnachrichten der Flüchtlinge zu erwarten gewesen wäre. Ich schöpfte Hoffnung.
Hoffen konnte man in der ersten Zeit nicht ganz grundlos. Mit den Offizieren und Soldaten des regulären Militärs kamen wir – besonders, wenn sie nicht betrunken waren und sich eine höhere Kommandostelle in der Nähe befand – ohne besondere Schadens- und Zwischenfälle zurecht. Ausnahmen, etwa Plünderer, gab es schon in den ersten Tagen, aber dabei handelte es sich vornehmlich um Diebe, die im Dunkel des Abends herbeihuschten, bewaffnet, es auf Uhren, Schnaps und Parfüm abgesehen hatten und sich mit der Beute sofort verdrückten. Die Diebe hatten sichtlich ein schlechtes Gewissen, sie fürchteten die Strafe ihrer Kommandantur.
Meine drei Besucher saßen manierlich um den Kachelofen. Der ohne Rangabzeichen war ein ausgesprochener Blödian, aber auch er versuchte, sich sittsam zu geben. Sie erzählten, was sie im Zivilleben machten – einer war Zeichner –, und fragten nach meinem Beruf. Dies war mein erstes längeres Gespräch mit Sowjetmenschen, und wieder beobachtete ich, daß der »Schriftsteller« ein magischer Begriff für die Russen war. Als ich sagte, ich sei Schriftsteller, starrten sie mich so respektvoll und aufmerksam an, als wäre ich ein besonderes Wesen. Sie sahen sich um in meiner Stube, deren bescheidenes Mobiliar wahrhaftig nicht vornehm wirkte (das Haus gehörte mir nicht, und ich hatte mich acht Monate zuvor auf Bitten von Freunden hier eingerichtet), und waren sichtlich be eindruckt. Der jüngere Offizier, der Zeichner, sagte, er freue sich sehr über unsere Bekanntschaft, er möge Menschen, wie ich einer sei. Dann wollten sie wissen, ob das Haus mir gehöre. Als ich verneinte, erzählten sie enthusiastisch, wie gut es den sowjetischen Schriftstellern gehe, und beteuerten, in der Sowjetunion hätte ich längst Haus, Garten und Auto. Der ältere Offizier tat sich besonders hervor, ob ich nicht in ein schmuckeres, besseres Haus ziehen wolle, er würde es mir gerne schenken. Ich lehnte lachend ab.
Das alles kam mir kindlich und absonderlich vor; aber eigentlich verstand ich diese Hochachtung vor Schriftstellern nicht. Ich wollte herausfinden, was sie über die russische und die Weltliteratur wußten. Wortreich antworteten sie, »alles«, denn zu Hause, in der Sowjetunion, lese »jeder«. Als ich Näheres wissen wollte, Einzelheiten, nannte der eine Puschkin, der andere Lermontow. Ich beobachtete später wiederholt, daß die meisten diese beiden Namen kannten, vor allem den Puschkins. Als ich Tolstoi und Dostojewski erwähnte, nickten sie, aber ich merkte, daß diese Namen ihnen nichts sagten. Während wir sprachen, machte sich der eine, angetrunkene Offizier an die junge Dolmetscherin heran, aber ein Blick von mir genügte, und er ließ ihre Hand wieder los. Mit vorwurfsvoller Stimme sagte sein Kamerad, der Zeichner, etwas zu ihm. Danach führten sich alle drei wieder korrekt auf. Zum Abschied schüttelten wir uns die Hand, ich begleitete sie zum Gartentor – das es damals noch gab – und stand dort, bis sie in den Schlitten gestiegen waren. Sie waren jung und gut gelaunt, weiß der Himmel, wo sie den Schlitten aufgetrieben hatten, er war grün, und das Geschirr des Pferdes bimmelte wie bei einer Troika, das Bild wirkte wie ein heiterer Stich aus der Zeit der Napoleonischen Feldzüge.
Unter lautem Gebimmel fuhren die Besucher davon, und bevor sie endgültig hinter einer Biegung verschwanden, begannen sie, blindlings in die Luft zielend, eine wilde Schießerei. Halbwüchsige Bengel, dachte ich bei mir, als der Schlitten im stiebenden Schnee verschwand. Ich kehrte ins Haus zurück, und wir besprachen den seltsamen Besuch in aller Ausführlichkeit.
Die Scheu war geringer geworden. Wie es schien, waren die Russen weniger gefährlich als ihr Ruf, in dieser Zuversicht und Hoffnung waren wir uns einig. Über sie hatte Stendhal, als er sich mit Napoleon aus Kiew zurückzog, geschrieben: »Cet océan de barbarie puante.« Wir hofften, die Wirklichkeit sei anders; diese jungen Männer waren ungebildet, aber warum sollten die Soldaten einer östlichen Armee sonderlich gebildet sein? Jedenfalls waren sie gesund, gut gelaunt und unvoreingenommen. Außerdem achteten sie Schriftsteller. Wir dürfen nicht vergessen, sagte ich zu den Meinen, daß sie aus dem Osten kommen, wo schon die Assyrer zur Zeit Hammurabis einen Gott der Schrift hatten, nämlich Nabu … So scherzten wir.
Allmählich interessierte mich, wieso »Schriftsteller« für die Russen ein magischer Begriff war. Eines Vormittags stellte sich ein russischer Stabsoffizier ein, ein Major oder Oberstleutnant, begleitet von mehreren weiteren Offizieren, sie trugen Ledermäntel, hervorragende Stiefel, Pelzhandschuhe, flache Offiziersmützen und auf den Schultern Rangabzeichen mit Goldstreifen. Der Major sprach fließend Deutsch. Sie setzten sich nicht zu uns, sie kamen aus einer Nachbarvilla, wo sie zum Essen eingeladen gewesen waren und gehört hatten, hier lebe ein Schriftsteller, dieses seltene Tier wollten sie sich ansehen. Es war ein kurzer Besuch, aber ein gründlicher. Sie stellten sich im Halbkreis auf, in der Mitte der Major, eine Reitgerte in der Hand, vor der Brust, am Riemen, der Feldstecher – er sah aus wie ein Feldherr aus einem Schulbuch. Er fragte mich, ob ich der Schriftsteller sei, und nahm mich gründlich in Augenschein. Dann gab er einem seiner Offiziere einen Wink, er solle mich photographieren. Auf dem Tisch stand meine Schreibmaschine mit einer begonnenen Seite. Mit harter Stimme, aber höflich fragte er, ob ich auch jetzt arbeite und woran. Ich antwortete, in dieser Lebenslage könne ich literarisch nicht tätig sein, aber ich schriebe mein Tagebuch weiter, wie immer, im Frieden und im Krieg. Er nickte, als verstünde er das vollauf, und begehrte zu wissen, ob ich alles in mein Tagebuch aufnähme, was ich erlebte. Nicht alles, entgegnete ich, nur das, was ich für wesentlich hielte.
»Dann schreiben Sie auf«, sagte er ernst und streng, »daß ein russischer Offizier hier gewesen ist und Ihnen kein Haar gekrümmt hat. Schreiben Sie auch, daß dieser russische Offizier in Jasnaja Poljana das Wohnhaus Tolstois gesehen hat, völlig verwüstet von Soldaten Ihres Landes. Schreiben Sie es auf?« fragte er streng. Ich versprach es ihm. Jetzt erfülle ich mein Versprechen.
Das alles glich nicht dem, was wir erwartet hatten. Es war so anders und überraschend, daß ich mißtrauisch wurde wie ein Verirrter, der im Dunkeln den Wegweiser nicht findet. Was sind das für Menschen? … Denn nach einer Weile kam aus der Nachbarschaft ein Dienstmädchen herüber und erzählte, daß dieselben russischen Offiziere sich dort nach dem Essen liebenswürdig verabschiedet und der Dame des Hauses die Hand geküßt hatten, bevor sie zu uns kamen, um sich einen Schriftsteller anzusehen, und als sie weggingen, schickten sie von der Landstraße den MPi-bewaffneten Kraftfahrer zu ihnen, den Gastgebern, zurück, der den Hausherrn zur sofortigen Herausgabe seiner goldenen Armbanduhr aufforderte. Der Mann bestätigte diese Mitteilung später. »Aber warum haben sie meiner Frau dann die Hand geküßt?« fragte er ratlos. Da begannen wir zu argwöhnen, daß mit den Russen etwas nicht stimme.
Einige Juden, die sich über Monate im Dorf vor den Verfolgungen durch die Deutschen und die ungarischen Pfeilkreuzler versteckt gehalten hatten, wagten sich jetzt heraus. In der Nähe lebte ein alter Mann mit seiner Familie, ehemals Apotheker, ein wohlhabender Bürger, der vor den Pfeilkreuzlern geflüchtet war. Seine weiblichen Angehörigen hatten Angst vor den Russen. Dem ersten Russen, der sich einstellte, erklärte der Alte – ein ehrwürdiger Patriarch mit weißem Bart – feierlich, er sei Jude. Eine überraschende Szene folgte: Der Russe lächelte, nahm die umgehängte Maschinenpistole ab, trat zu dem Alten und küßte ihn nach russischem Brauch rechts und links auf die Wange. Auch er sei Jude, sagte er und drückte dem Alten stumm die Hand.
Dann hängte er sich die MPi wieder um und forderte den alten Mann und seine Angehörigen auf, in die Ecke zu gehen, das Gesicht zur Wand zu drehen und die Arme zu heben. Notgedrungen gehorchten die Leute, und der Russe raubte sie in aller Ruhe aus. Mit der Sachkundigkeit eines professionellen Einbrechers klopfte er die Öfen und Wände ab und öffnete alle Schubkästen, bis er den versteckten Familienschmuck und rund vierzigtausend Pengö Bargeld fand. Er stopfte alles in die Taschen und verschwand.
Sie waren kindlich, manchmal wild, manchmal gereizt und traurig; und immer unberechenbar. Weil ich ohnehin nichts anderes tun konnte, beschloß ich, wieder meinen Beruf auszuüben; nach der ersten Überraschung hielt ich Augen und Ohren offen und schrieb kurz nieder, was ich beobachtete. Kürzlich habe ich meine Notizen überflogen, und ich kann auch jetzt nur sagen, was ich damals öfters bemerkt hatte: daß die Russen »anders« sind und etwas an sich haben, das jemand mit westlicher Erziehung nicht versteht. Dieses »andere« ist nichts, was ich kritisieren oder bewerten oder herabwürdigen möchte. Ich stelle es einfach fest.
Wenn ich einem Westler gegenüberstehe, einem Franzosen, Engländer oder Deutschen, kann ich mir unabhängig von seiner Persönlichkeit ungefähr die Reflexe ersten Grades berechnen, die sich aus der Situation und dem Augenblick ergeben. Die der Russen konnte ich nie berechnen, die Reflexe zweiten und dritten Grades noch viel weniger. Nicht nur ich – und alle im Westen, die ihnen in dieser Zeit begegneten – beobachtete sie so ratlos, sondern auch sie beobachteten uns. Mit scharfem Blick und mit dem Argwohn eines primitiven, instinktsicheren Volkes.
Natürlich wirkte das Zauberwort »Schriftsteller« nicht immer, und ich durfte nicht hoffen, daß die herumlungernden Soldaten der Roten Armee während der Belagerung von Budapest Zeit finden würden, in meinem dörflichen Haus an Literaturseminaren teilzunehmen. Aber immer wieder gab es einen, der respektvoll und andächtig aufhorchte, wenn ich mich vorstellte. Da ich bei diesen nicht ganz ungefährlichen Besuchen einen Schutz benötigte – zumal die Russen sehr argwöhnisch waren und nicht glaubten, daß ich Schriftsteller sei; ein Verdacht, den ich insgeheim schon damals mit ihnen teilte, und heute erst recht! –, mußte ich mich nach irgendeiner Bestätigung meiner kühnen Behauptung umsehen. Und weil einem nirgendwo bestätigt wird, daß man Schriftsteller ist, war ich froh, daß ich in der kleinen Handbibliothek der Hausbesitzer die französische Ausgabe eines meiner Bücher entdeckte. Vorn stand mein Name, hinten wurden weitere Bücher des Verlags angezeigt, darunter ein Roman von Ilja Ehrenburg.
Inzwischen hatte ich die Erfahrung gemacht, daß die Russen im allgemeinen nicht die Wahrheit sagten, wenn sie mit ihrer Belesenheit prahlten, aber auch, daß sie am ehesten vielleicht diesen Ilja Ehrenburg kannten. Später erfuhr ich, daß er damals offiziell für russische Militär- und sonstige Zeitungen schrieb, so daß wohl auch Soldaten seinen Namen gehört hatten, die seine Bücher nicht kannten.
Eines Nachts, schon gegen Morgen, stellte sich ein struppiger, bärtiger, knurriger Russe ein, vielleicht ein Kirgise, jedenfalls ein östlicher Typ; er wollte irgend etwas haben, Wein oder Speck, und als ich es ihm nicht gab, wurde er gereizt und unwirsch, fuchtelte mit der Maschinenpistole und schrie mit drohender Stimme Unverständliches. Eine unangenehme Situation. Ich beschloß, mein letztes Verteidigungsmittel einzusetzen; ich stellte mich vor. Aber er traute mir nicht. »Schriftsteller?« fragte er ungläubig. Ich nahm das französische Buch aus dem Regal, zeigte auf meinen Namen und dann auf mich und bat meine Dolmetscherin zu übersetzen: »Verlaß unser Haus, wie du siehst, hast du dich wirklich zu einem Schriftsteller verirrt. Das Buch habe ich geschrieben, hier steht mein Name. Aber das ist noch gar nichts.« Ich drehte das Buch um. »Schau dir diesen Namen an: Ilja Ehrenburg.« Der bärtige kleine Russe war immer noch mißtrauisch, er beugte sich über die Rückseite des Buches, buchstabierte den Namen und sah mich finster an. »Ehrenburg?«
»Ja«, sagte ich. »Was sagst du nun?«
Er musterte mich. Dann breitete er ergeben die Arme aus, zuckte mit den Schultern und sagte verächtlich: »Propagandist!« Machte kehrt und ging aus der Stube. Ich gaffte ihm offenen Mundes hinterher. Dieser Mann, schien mir, verstand etwas von Literatur und hatte vom Unterschied zwischen Schriftstellern und Propagandisten gehört.
Doch auch solche Begegnungen konnten mich nicht aufklären über das »andere«, das ich den Russen anmerkte und das sie von den Westlern unterschied. Denn diesen Unterschied gab es. Er war nicht so groß wie zu den Hindus oder Chinesen – aber mit Sicherheit antwortet ein deutscher Bauer, ein englischer Monteur, ein französischer Tierarzt oder ein italienischer Anstreicher auf die vorrangigen Lebensfragen verhaltensmäßig anders als ein russischer. Wir beobachteten einander – auch sie, die Russen, uns. Nicht nur in den »besseren Häusern«. Sie achteten nicht nur auf das Zubehör des bourgeoisen Lebens; das interessierte sie auch, aber ebenso aufmerksam widmeten sie sich den Heimstätten der Armen, und man merkte, was sie sahen, war ihnen nicht nur fremd, es verblüffte, überraschte sie auch. Was war das »andere«? War es tatsächlich der »Sowjetmensch«, also ein neuartiges, gezüchtetes, konditioniertes Menschenwesen, das die Welt und den Menschen aus einem anderen Blickwinkel wahrnahm? Oder war es einfach nur der Russe, der – nicht zum erstenmal in seiner Geschichte, aber jetzt anscheinend mit allen Konsequenzen – aus seiner europäischen Heimat herausgetreten war und jetzt ein wenig unsicher und mißtrauisch, aber sehr neugierig in die Welt hineintrat? Ich wußte keine Antwort.
Natürlich nahmen sie das Ferkel mit und das Mehl; aber das war uninteressant und auch nicht typisch. Damals schnappten sie einem auf der Landstraße auch das Fahrrad weg, fuhren eine Weile herum und warfen es fort oder verschenkten es. Schwer zu erklären war auch die Vorliebe für Uhren. Nach denen verlangte es sie geradezu mit Sammlerleidenschaft; manche Russen trugen schon vier oder fünf am Arm, wenn sie die jüngst erbeutete Trophäe anlegten. Im Ersten Weltkrieg hatte ich mehrere russische Kriegsgefangene gekannt – Offiziere, Bauern, Arbeiter –, aber keinen mit so ausgeprägtem Interesse für Uhren. Was war geschehen, warum waren sie so von den Chronometern fasziniert? Ich erinnerte mich an Spengler, der in seinem großen pessimistischen Werk behauptet, die Menschen aus harmonischen, lebendigen Kulturen hätten keinen Sinn für »Rekorde«, also für die auf den Augenblick bemessene Zeit, Chinesen und Griechen fühlten und dächten in großen Zeitperspektiven – das Olympikon als Maßeinheit beweist diese Zeitgleichgültigkeit; wenn eine Kultur in eine Krise gerät, löst die Zivilisation, also das Nützlichkeitsprinzip, in der Seele der Zeitgenossen eine Art Panik aus, und das besorgte Messen der Zeit beginnt. Hat bei den Russen womöglich das Industrialisierungsexperiment dieses Zeitgefühl ausgelöst? Ich wußte wieder keine Antwort. Wahrscheinlicher war, daß es in der Sowjetunion nicht genug Uhrenfabriken gab, der Muschik aber Appetit auf das hübsche Spielzeug bekommen hatte. Oder, noch einfacher, die Uhr war der Wertgegenstand, der sich am leichtesten vertauschen ließ. Da ich von Russen spreche, weiß ich keine eindeutige Antwort.
Ihr Kommen, ihre Besuche, ihr Gehen, alles um sie herum war so unverständlich und unberechenbar. Tage vergingen, bis wir wieder einen Russen zu Gesicht bekamen, dann tauchten sie unerwartet massenweise auf, Autokolonnen rollten durch das Dorf, Pferdewagen, die Männer darauf struppig, wie Zigeuner. Nicht nur der Train zog so durch, auch die Infanterie, verteilt auf unzählige Fuhrwerke, einfache Soldaten, Offiziere, Soldatinnen, Zwölf- oder Dreizehnjährige in Uniform. Feldgeistliche sah ich nicht unter ihnen, möglich, daß ich sie nur nicht erkannte.
Wenn die motorisierten deutschen Truppen kamen, dann immer, als hätten die Krupp-Werke sie losgeschickt; sogar die Gulaschkanonen dampften, als wären Kanonenrohre für sie zweckentfremdet worden. Die Russen hatten alles, was sie zur Kriegsführung benötigten, aber dieses »alles« war anders, nicht so maschinell und perfekt, eher, als hätte sich ein gigantischer, furchterregender, geheimnisvoller östlicher Wanderzirkus auf Reisen begeben, aus weiten Fernen, aus dem fernen Osten, aus Rußland. In Wirklichkeit war dieser Wanderzirkus einer der größten Militärapparate der Welt. Und die ihn führten, taten das unverständlich für Außenstehende, aber ganz ausgezeichnet: Alles war an seinem Platz, alles in diesem scheinbaren Durcheinander funktionierte, alles signalisierten die geheimnisvollen Inspekteure und Kontrolleure innerhalb des großen Apparats einander zur rechten Zeit.
Wie der Apparat intern organisiert war, ließ sich nicht durchschauen. Aber allem Anschein nach vollzog sich in dieser Armee alles nach einem uralten System, in dem sich die Kriegserfahrung Dschingis-Khans, der Tataren, der Goldenen Horde widerspiegelte: wie sie anrückten, wie sie abrückten, wie sie aßen, Brücken bauten, Zelte aufschlugen und urplötzlich, wie auf ein rätselhaftes Signal, wieder verschwanden. So mochten die Urungarn und die Hunnen ihre Feldzüge geführt haben, so mochten die Skythen geritten sein, ohne die Pferde zu schonen, alle vierzig Kilometer – sagt die Wissenschaft – warteten frische Pferde auf die Reiter, die mit dem Messer dem angebundenen Pferd die Schlagader öffneten, in kürzester, mit der Sanduhr gemessener Zeit das Pferdeblut tranken, die Wunde schnell zunähten und weiterritten. Die russischen Soldaten waren auch der Natur näher als die westlichen: Wie die Anführer der Mongolenheere ihre Reiter nach dem Stand des Mondes gegen Angreifer aus dem Osten oder Norden hatten Aufstellung nehmen lassen – weiß der Himmel, was das vor so langer Zeit für eine »Stromlinien«-Kriegstechnik war! –, so wußten offenbar auch ihre jetzigen Nachkommen noch mancherlei über die fördernde oder hemmende Kraft der Natur.
Beweisen kann ich es nicht, aber in den Monaten, als ich Tag und Nacht in nächster Nähe zu ihnen lebte, habe ich eindeutig etwas in dieser Art bemerkt. Das alles war jenes »andere«. Im übrigen waren sie durchtrieben, verschlagen, schlau auf eine spöttische und schadenfrohe Weise; sie freuten sich, wenn sie uns »Westler« hinters Licht führen konnten. Ich hatte damals mit vielen Russen zu tun, manchmal auch später, aber nie ist es passiert, daß ein Russe, der sich etwas auslieh und versprach, das Geliehene – Werkzeug, Bücher, mochten die Dinge noch so wertlos sein – zurückzugeben, sein Versprechen auch hielt. Und wenn wir ihn erinnerten, lachte er uns fröhlich ins Gesicht, na also, ich bin gescheiter als ihr, ich habe euch aufs Glatteis geführt!
Ich erinnere mich an ungewöhnliche Typen. An einen jungen Patrouillenreiter, der im diesigen Abendlicht des Januars an der Donau entlanggaloppiert, und dieser Galopp, dieses mongolische Gesicht kommen aus solcher Ferne, daß ich stehenbleibe und der Erscheinung hinterherschaue. Der Reiter hebt sich sichtlich von den anderen nicht ab, ist keine Persönlichkeit; er ist »der« mongolische Reiter, seit Jahrtausenden zu Pferde in seiner Steppjacke, an der Wolga oder an anderen Flüssen, und ebenso gleichmütig wird er einher galoppieren, wenn man ihn eines Tages zur Patrouille in die Pyrenäen schickt. Er hat keinen Blick für die Umgebung, in seinem Gesicht spiegelt sich erhabene Gleichgültigkeit. Dann wieder kommen zwei Zurückgebliebene vorbei, ich muß an Pat und Patachon denken, der eine dürr und lang, der andere ein Sancho Pansa, dick und untersetzt, sie singen, schneiden Grimassen, als fänden sie sich selber spaßig, und als sie in meine Nähe kommen, johlen sie mir, Eselsgeschrei nachahmend, ins Gesicht, gehen dann achselzuckend weiter, zwei Dorfnarren …
Spielen, Faxen machen, das mochten sie sehr. Auch wie sie spielten, war »anders«, ohne die Bewußtheit des Homo ludens, ohne den verfeinerten Reflex der Commedia dell’arte; ihre improvisierten Spiele hatten etwas Mystisches, Archaisches, Rituelles – und deshalb wirkten sie ein wenig furchterregend, wenn sie zu spielen begannen.
Manchmal besuchten uns Offiziere, mit denen man lange und ernsthaft reden konnte, auch auf deutsch. Ich erkundigte mich natürlich nicht, wie sie in der Heimat lebten, sie hätten es mißverstehen können. Ich bevorzugte das einzige Gesprächsthema, das ich überblicken konnte: die Literatur. Auf meine Fragen antworteten sie zögerlich, manchmal dumm, meistens schlecht unterrichtet, zuweilen aber erstaunlich gescheit. Viele logen, deshalb akzeptierte ich nur Antworten, die belegten, daß der Befragte Bescheid wußte.
Ich wollte herausfinden, was von der riesigen russischen Literatur, die das russische Volk und die gesamte denkende Welt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts so tiefgreifend mobilisiert hatte, hängengeblieben war. Deshalb begnügte ich mich nicht mit der Beteuerung, sie hätten – und diese Antwort kam geradezu mechanisch – »alles« gelesen, sondern ich erkundigte mich nach Einzelheiten. Das brachte sie meistens in Verlegenheit. Die russische kommunistische Propaganda hat der Welt – oder zumindest den gutgläubigen Sympathisanten, die auf sie hereinfallen – eingeredet, die Revolution habe die Bildungsbedürfnisse der Durchschnittsrussen verändert. Ein solcher Wandel wäre natürlich ein großer Erfolg; vielleicht lohnt er keine Revolution, aber eine Revolution kann sich stolz auf diesen Erfolg berufen. Ich verstand nichts von der technischen, strategischen und hierarchischen Struktur der Roten Armee, und ich fühlte mich nicht berechtigt, aus solchen gelegentlichen Begegnungen Schlußfolgerungen auf die psychische Verfassung und das Weltbild des »Sowjetmenschen« zu ziehen. Eine große Revolution, die jahrzehntelang die Menschen nach ihren Ideen und ihrer Praxis erzieht, ist ein zu komplizierter Vorgang, als daß ich das mit meinem damaligen Wissensstand hätte tun dürfen.
Aber von der Literatur hatte ich ein wenig Ahnung, die russische hatte auch mich erzogen und fasziniert, mit Zweifeln und mit Begeisterung erfüllt. Deshalb interessierte es mich, was der »Sowjetmensch« über die Literatur seiner Heimat wußte, denn ich konnte die Antworten kontrollieren. Als wir Puschkin und Lermontow hinter uns hatten – den meisten waren sie nur dem Namen nach bekannt, Titel konnte kaum einer nennen –, tastete ich mich über Tolstoi und Dostojewski zu den russischen Schriftstellern der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart vor. Ich war erstaunt, wie wenig meine Gäste wußten. Auch diejenigen, die nachweislich eine mittlere Schule besucht hatten, begnügten sich mit Majakowski und zu meiner Überraschung mit dem wahrhaftig »bürgerlichen« Tschechow. Den Antworten entnahm ich, daß sie zwar lasen, jedoch oberflächlich und am ehesten das, was man ihnen in den offiziellen Seminaren in die Hand drückte.
Über Dostojewski etwa waren sie sich merklich nicht im klaren. Sie kannten seine Werke, auch die Titel einiger kleinerer, aber Dostojewski gehörte offenbar nicht zu den Lieblingen der sowjetischen Kulturpolitik. Ich habe nie herausgefunden, woran das liegt. Vielleicht an seinem Nationalismus oder seinem Mystizismus oder seiner brisanten Christlichkeit? Ich wage kein Urteil. Jedenfalls lag er nicht auf der Linie der Partei. Über Tolstoi sprachen sie kopfnickend und anerkennend. Und alle wußten strahlend die Werke Tschechows aufzuzählen. Der große »bürgerliche« Schriftsteller des ausgehenden Jahrhunderts war anscheinend genehm und beim sowjetischen Volk beliebt und populär. Kommunistische Literaten erklärten mir später, Tschechow sage der sowjetischen Kulturpolitik zu, weil er mit seiner ironischen Gesellschaftsbetrachtung – wenn auch ungewollt – ein genaues Bild vom »bürgerlichen Rußland« vermittle.
Über Dostojewski jedoch habe ich nie die Wahrheit erfahren. Er gehörte zu den Nationalheiligen, und deshalb gaben sie nicht zu, daß sie eigentlich mit ihm umsprangen wie mit einem geistig unerwünschten Element; wie zu beobachten war, versuchten sie, die sowjetische Jugend von seinem Einfluß fernzuhalten. Tolstoi ließen sie gelten wie ein Denkmal, wie einen steinernen Kutusow. Mich verwunderte, wie spurlos das Wissen von der zweiten Avantgarde russischer Schriftsteller aus der Zeit um die Jahrhundertwende aus dem Bewußtsein der »Sowjetmenschen« verschwunden war. Immerhin hatte die russische Literatur neben Dostojewski und Tolstoi eine zweite Linie aufzuweisen, deren Vertreter weltliterarisch betrachtet keine Genies waren, aber die russische und die ausländische Literatur zu ihrer Zeit mit bedeutenden, wertvollen Werken beschenkten. Natürlich fragte ich nicht kirgisische Reiter, ukrainische Monteure oder sibirische Fallensteller, ob sie jemals von Ossip Dymow, Arkadi Awertschenko, Arzybaschew, Kuprin, Iwan Bunin, Mereschkowski oder Leonid Andrejew gehört hatten – ich fragte vielmehr alle Offiziere, die zu einem Gespräch mit mir bereit waren. Und ich traf keinen einzigen, der die Namen irgendwann gehört hatte, sie murmelten verlegen vor sich hin, und wenn ich auf die Klassiker zu sprechen kam, beteuerten sie erleichtert, die berühmten »Toten Seelen« gelesen zu haben, Gogol zu kennen und von Gontscharow gehört zu haben, auch, daß man bei ihnen den »bürgerlichen« und »westlichen« Turgenjew lese und schätze.
Der große offizielle Schriftsteller war für sie alle natürlich Gorki. Viele kannten Fadejew und Makarenko, fast alle hatten von Ehrenburg gehört. Aber mich überraschte auch, wie schnell diese Zeitgenossen Namen vergessen hatten, die bei uns Schriftstellern und Lesern im Westen Geltung besaßen; keiner meiner Gäste etwa kannte Gladkow, den Verfasser von »Zement« (und so wußten sie auch nicht, wann und wie Gladkow mit anderen Kollegen zusammen bei den Stalinschen Säuberungen in der Versenkung verschwunden war), und noch seltsamer war es, daß sie den Namen des bedeutenden realistischen Schriftstellers Scholochow nur mit halbem Ohr gehört hatten.
Ich will nicht verallgemeinern; ich habe nur mit einem Dutzend Rotarmisten über die russische Literatur gesprochen; bestimmt gibt es in dem Riesenreich viele, die diese große Literatur besser und intimer kennen als meine Besucher. Aber sicher ist auch, daß sich die Literatur eines großen Volkes – dazu noch eine so reiche und tiefe wie die russische – zumindest in Namen und Begriffen im Bewußtsein eines jeden schreib- und lesekundigen Menschen niederschlägt, der die Sprache dieser Literatur spricht. Die Russen achten die Schriftsteller und die Literatur, aber diejenigen, denen ich in diesen Wochen begegnete, hatten erstaunlich wenig gelesen. Alle sprachen sie in andächtigem Ton von der »narodnaja kultura«, der Kultur des Volkes, und von ihrer Nationalkultur, manche sehr aufdringlich, doch ich mußte feststellen, daß sie keine Ahnung hatten, was »Kultur« überhaupt bedeutet. Sie verwechselten die Kultur mit fachlichem, technischem Wissen. Aber der Kulturbegriff faszinierte sie ebenso wie das »Schreiben«.
Ihr Interesse am »Schreiben« läßt sich damit erklären, daß das geschriebene Wort am Anfang eines jeden großen, primitiven menschlichen Unternehmens magische Bedeutung hat. Der Buchstabe fixiert etwas, das in der Seele des primitiven Menschen lediglich ein undeutlicher Wunsch, eine mythische Ahnung ist; und der im Buchstaben fixierte Mythos ist bereits Geschichte, also ein verantwortungsträchtiges Erlebnis. Diese Menschen waren noch weit davon entfernt, im Geschriebenen eine Geistesgymnastik oder – wie in der westlichen Zivilisation – eine Handelsware oder Modebeschäftigung zu sehen. Für die meisten war das geschriebene Wort noch vollauf glaubwürdig. Und was konnte die so andächtig erwähnte »Kultur« diesen im westlichen Sinn zweifellos ungebildeten Menschen bedeuten, deren Geschichte nicht von der Renaissance und der Reformation geprägt war? Es dauerte eine ganze Zeit, bis ich verstand, daß »Kultur« für sie insgeheim und zuinnerst gleichbedeutend war mit dem Begriff »Flucht«. Genaue Vorstellungen hatten sie nicht, aber die Möglichkeit zur Flucht mit Hilfe der Kultur lockte und zog sie an … Flucht wovor? Flucht aus der Freudlosigkeit ihres Lebens.
Wie die ersten Christen ahnten sie, daß nur eine geistige Erlösung sie aus der tiefen, trostlosen Ödnis ihres Termitenlebens retten konnte. Sie wußten noch nicht, wie die Flucht vor sich gehen würde, aber sie schwärmten ihr entgegen wie Insekten dem Licht. Sie wußten noch nicht, daß Kultur etwas anderes ist, als sich die Haare schneiden zu lassen, nicht auf den Fußboden zu spucken oder Grammophonmusik zu hören, aber dieses Mehr, diese Chance faszinierte sie. Deshalb achteten sie den Schriftsteller, den Arzt, jeden, der aus ihrer Sicht in der Sphäre der »Kultur« lebte. Es gibt ein Budapester Bonmot, in dem einige Wahrheit steckt: Stalin hat einen Fehler gemacht, als er Europa die Russen zeigte, und einen weiteren, als er den Russen Europa zeigte. Sicherlich haben die aus Europa heimgekehrten russischen Soldaten das Verlangen nach einem anderen Leben, einer anderen Kultur in das trostlose Dasein der Massen eingebracht (das Schicksal Solschenizyns und von Millionen anderer Heimkehrer zeigt, daß Stalin sich dieser Gefahr bewußt war), aber die harten Drahtverhaue des Systems vermochte dieses Verlangen nicht niederzureißen. Wer das hoffte, irrte sich. Dazu werden wahrscheinlich lange Jahrzehnte und ständige Berührung mit dem Westen nötig sein.
Jeder »literarische« Gedankenaustausch dieser Art und viele ähnliche Begegnungen zeigten mir, daß die rund Vierzigjährigen – die also vor der Revolution acht, zehn Jahre alt waren und noch unter dem Schutz der Familie heranwuchsen – ganz andere Antworten gaben als die zehn Jahre Jüngeren, erzogen in den pädagogischen Ausbildungsstätten der marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Diese unterschieden sich wahrhaftig nur körperlich von der wilden, hemmungslosen Hitlerjugend. Sie waren so gut wie nicht belesen, und ihre Grobheit, ihr zuweilen grausames, seelenloses Verhalten bewies mir, daß in ihren Seelen die Reflexe der ererbten Kultur abgestorben waren. (Eine Generation später forderte eine neue russische Generation mutig und laut von der sowjetischen Führung Realitätsnähe und die Wahrheit statt Lügen – aber diese Generation lag am Ende des Zweiten Weltkriegs noch in den Windeln.) Die Vierzigjährigen hatten die russischen Grundbegriffe der humanistischen Bildung und Kultur noch innerhalb der Familie erlebt: die Solidarität und die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze des Mein und Dein. Unter der Maske der »Bolschewisten« und »Rotarmisten« überlebte also ein sympathisches Phänomen: der russische Mensch.
Gegen Ende der zweiten Woche, als ich mich im Regelwerk für den Umgang mit den Eroberern bereits einigermaßen auskannte, verirrten sich eines Vormittags zwei heruntergekommene Sowjetsoldaten in unser dörfliches Heim. Ich war allein, die Frauen auf der Suche nach Eßwaren und Feuerholz. Die beiden Russen, müde, bewaffnet, bärtig, gezeichnet vom Krieg und Umherstreunen, baten um Wasser; dann setzten sie sich an den lauwarmen Kachelofen und wärmten sich schweigend. Ich saß apathisch bei ihnen und wartete, daß sie wieder gingen. Der eine schlief sofort ein. Der andere begann nach einer Weile zu sprechen, russisch oder ukrainisch; er sah mich nicht an, brummelte in seinen Bart. Ich verstand ihn nicht, aber etwas im Tonfall veranlaßte mich zuzuhören.
Von dem vielen, das ich in diesen Jahren über die Russen – für und gegen die Kommunisten – gelesen habe, ist mir das schöne, leidenschaftliche, ein wenig mystische Buch eines Balten namens Schubart im Gedächtnis geblieben, das »Europa und die Seele des Ostens« heißt. Es erschien während des Krieges im neutralen Ausland. Später hörte ich, dieser baltische Autor – ein Slawophile, aber Gegner der Bolschewiken – sei verschwunden, als die Russen in die baltischen Staaten einmarschierten. In seinem Buch zeichnet er ein ungewöhnliches Porträt von den Slawen. In manchmal etwas schwülstiger Ausdrucksweise sagt er, der westliche Mensch sei noch »prometheisch«, also vom Erlebnis des irdischen Besitzes und vom Herrschaftsdrang unterjocht, der östliche jedoch, und so auch der Russe, »johanneisch«, er glaube an die Erlösung. In den späteren Jahren fiel mir zuweilen eine düster-hochtrabende Feststellung Schubarts ein: »Der Bolschewismus ist das Ultimatum Gottes an die Menschheit.« Das ist ein großes Wort, ein dichterisches und prophetisches. Politiker und Feldherren winken ab, wenn sie solche großen Worte hören. Aber ich, der ich weder Soldat noch Politiker bin, registriere den Widerhall dieser Feststellung in meinem Bewußtsein. Immer wieder habe ich mich damals – und danach – gefragt, wie die Westler auf dieses »Ultimatum« antworten werden.
Als jetzt der verwilderte, bärtige kleine Russe an der Seite seines schnarchenden Gefährten und des Kachelofens sein mürrisches Selbstgespräch führte, fiel mir Schubart ein. Haben die Russen tatsächlich irgendeine Funktion im johanneischen Sinn, und der skeptische Westler ist unfähig dazu, versteht sie nicht, will nichts von ihr wissen? … Ich hörte meinem Besucher zu, verstand kein Wort und verstand irgendwie doch, auch ohne Worte. Wie in einer Erzählung Kosztolányis der bulgarische Schaffner im nächtlichen Schnellzug dem fremden Reisenden – auf bulgarisch, also in einer Sprache, die dieser nicht versteht – die große Tragödie seines Lebens erzählt, bis sich beide in brüderlichem Einverständnis umarmen, so lauschte ich dem Russen, und ich mußte daran denken, wie sehr Wildes Aperçu zutrifft: Die Lebenssituationen imitieren zuweilen die Visionen der Literatur, das, was sich die Schriftsteller ausgedacht haben.
Der mürrische Redefluß des kleinen Russen ließ mich zudem an den russischen Bauern denken, der in »Krieg und Frieden« dem in Gefangenschaft geratenen mächtigen und reichen Herrn Besuchow erklärt, wie einfach und vielleicht nicht ganz hoffnungslos das menschliche Leben eigentlich ist … Auch mein Besucher mochte solche Erklärungen abgeben, er schlug sich an die Brust, sah zur Decke, schüttelte den Kopf, Tränen rannen ihm aus den Augen, er wischte sie mit dem Handrücken weg und redete, redete. Ich hörte wortlos zu. Ich verstand nur, daß er sehr unglücklich war. Deshalb legte ich ihm die Hand auf den Arm, und da sah er mich unter Tränen an, lächelte traurig, als wolle er sich entschuldigen, und winkte ab, als schäme er sich seiner Schwäche.
Da kam die Dolmetscherin nach Hause, unsere Mitbewohnerin. Der Russe weckte seinen schnarchenden Kameraden, und sie gingen ohne Abschied davon, hinaus in den Garten, in den nebligen Januar. Doch als sei ihm noch etwas eingefallen, blieb er in der Tür stehen, wandte sich um und fragte nach meinem Beruf. Als die Dolmetscherin antwortete, sagte er wie der erste russische Soldat, dem ich begegnet war: »Choroscho.« – »Wieso choroscho, wieso ist es gut«, fragte ich, »wenn jemand Schriftsteller ist?«
Er überlegte. Dann antwortete er bedächtig: »Wenn du Schriftsteller bist, kannst du das sagen, was wir denken. Deshalb ist es choroscho.«
Er machte kehrt, sie stapften davon. Er drehte sich nicht um. Die Laufbahn eines Schriftstellers ist gewöhnlich arm an Auszeichnungen. Aber diese Antwort bewahre ich mir auf wie einen ganz besonderen Orden.
In einer nahen Kleinstadt lebten Ungarnserben, ein Teil der Bevölkerung bekannte sich zum griechisch-katholischen Glauben. Das Städtchen war alt und hübsch, ich wanderte in diesen Wochen manchmal hin, um bei einem bekannten Bäcker Brot zu kaufen. Dabei konnte ich interessante Beobachtungen anstellen, wie sich die Russen und die orthodoxen Popen zueinander verhielten.
Ende der Leseprobe