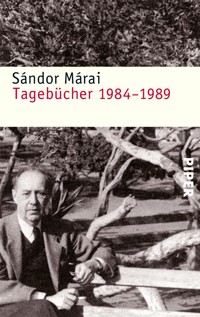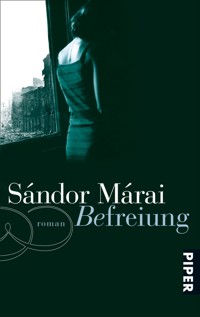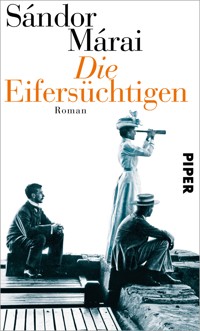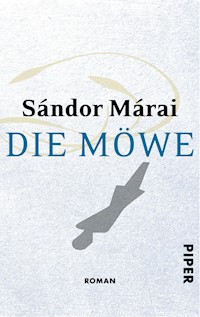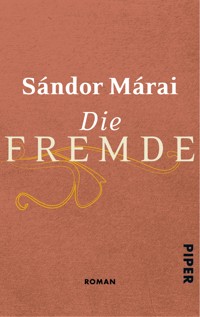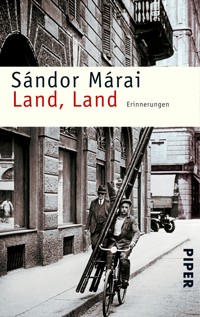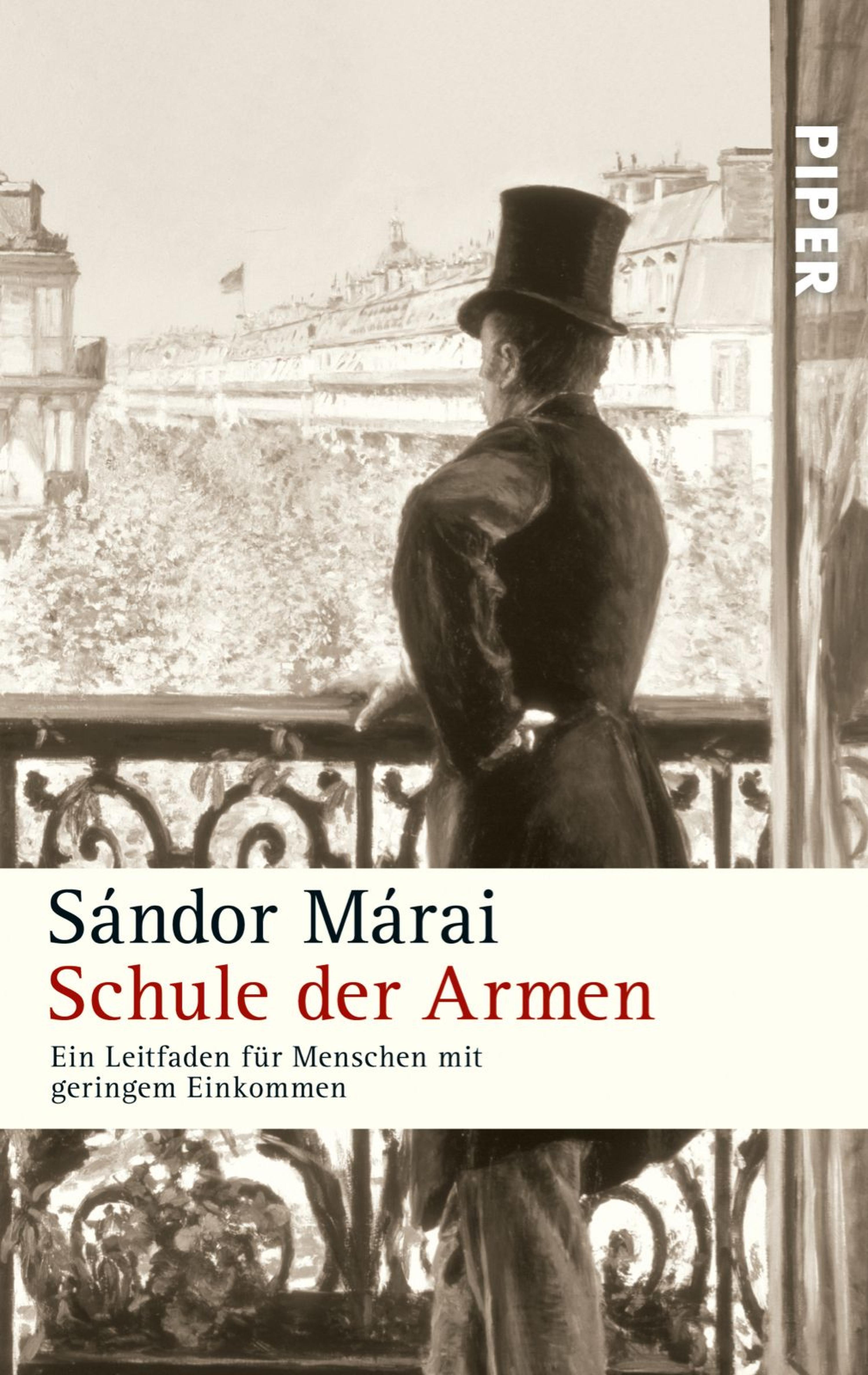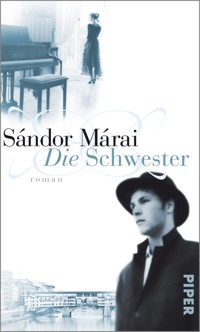9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Marai, der große Erzähler, war auch ein Meister der kleinen Form: In seinen brillanten literarischen Betrachtungen denkt er nach über Liebe und Alter, über Freundschaft und Vergänglichkeit, über das Schreiben nd das Leben mit Büchern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Ungarischen, mit Anmerkungen und einem Nachwort von Ernö Zeltner
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
3. Auflage 2004
ISBN 978-3-492-96014-4
© Heirs of Sándor Márai
Csilla Gaal, Toronto
Titel der ungarischen Originalausgabe:
»Ég és föld«, Révai, Budapest 1942
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2001
Covergestaltung und -illustration: Petra Dorkenwald
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
HIMMEL UND ERDE
Ich lebe zwischen Himmel und Erde, habe etwas Unsterbliches und Göttliches in mir, pflege aber auch in der Nase zu bohren, wenn ich allein im Zimmer bin, in meiner Seele haben sämtliche Weisheiten Indiens Platz, doch habe ich mich im Kaffeehaus einmal mit einem betrunkenen Industriebaron geprügelt, ich kann stundenlang aufs Wasser schauen, dem Flug der Vögel folgen, trug mich aber auch schon mit Selbstmordgedanken, weil ein Wochenblatt in unverschämtem Ton über mein Buch geschrieben hat, im Verstehen menschlicher Dinge wie in weisem Gleichmut bin ich Konfuzius’ Bruder, aber ich ertrage es nicht, wenn die Gazetten meinen Namen nicht unter den Anwesenden erwähnen, ich bleibe am Waldrand stehen, betrachte staunend die Farben des Herbstlaubs und kann der Natur doch nur mit Argwohn und Vorbehalt begegnen, ich glaube an die höhere Kraft der Vernunft und verbrachte die meisten Abende meines Lebens in einfältiger Gesellschaft mit hohlem Geschwätz, ich glaube an die Liebe und bin meist doch nur mit käuflichen Frauen zusammen, ich glaube an den Himmel und an die Erde, weil ich ein Mensch bin, zwischen Himmel und Erde, amen.
DIE MUTIGEN
Schätzen kann ich nur noch die, die den Mut haben, auch nutzlos zu fühlen. Jene, die das Wagnis eingehen, nutzlos zu denken. Alle sind wir schon so zielstrebig … so tauglich. Ich schätze diejenigen, die sich trauen, Wörter zu denken wie »Ich«. Oder: »Ich liebe dich, schöne kalte Langeweile«, schätze aber keinen mehr, von dem ich annehmen muß, daß ihm auch noch etwas einfallen könnte, wenn er tagsüber so beginnt: »Bezüglich der bestehenden Möglichkeiten …«
PFINGSTEN
Eine Bombe als Blumenstrauß.
ABENTEUER
Du lebst, plötzlich springt dich das Abenteuer an. Was ist dieses Abenteuer? Niemand kennengelernt, billige, belanglose Freude hat dich nicht angelacht, bist allein. Und dennoch geschieht in diesen Stunden etwas um dich herum. Das Leben wird, nachmittags um vier, plötzlich aufregend und gefährlich. Allerlei Zeichen weisen darauf hin, das Alltägliche bekommt seinen Sinn. Eine Tür öffnet sich, als hätte der Bote des Schicksals die Klinke niedergedrückt. Wie die Klinge des Meuchelmörders trifft dich der Sonnenstrahl ins Herz. Du lauschst, witterst. Was ist das für ein Abenteuer, das da hereinbrach ins schläfrige, bleierne Dasein? Dann, plötzlich, verstehst du und wirst blaß.
Verstehst, daß du lebst. Dies ist das einzige Abenteuer.
VAN GOGH
Der Titel eines seiner Bilder heißt: »Der Maler geht morgens zur Arbeit«1. Auf diesem Bild ist die Welt zu sehen, die der Maler verewigen will: Wiesen, Täler, Häuser. Aber diese Welt ist nur die seine, die Welt des Malers! Sie hat mit der Welt der Geographiebücher nichts zu tun. Diese grüne Wiese, diesen blauen Himmel, die roten Hausdächer gab es nur einmal: in dem Augenblick, als das Malerauge die Welt erfaßte.
Dieses Sehen ist sinnlich und fachgerecht. Der »wahnsinnige« Maler hat die Welt so objektiv gesehen wie durch einen Feldstecher. Der große Maler hat eine Vision von der Welt, und diese malt er dann so unverfälscht und objektiv wie der fähigste Konstruktionszeichner eines Architekturbüros. Insofern unterscheidet er sich vom Laienmaler, der keinerlei Vision von der Welt hat und dennoch seine Striche und Farben visionär hinkleckst. Der große Maler schaut zum Himmel und malt die Erde, getreulich. Der Stümper malt fiebernd den Himmel und schaut dabei mit Besorgnis auf sein Hühnerauge.
DER TEILHABER
Ja, Gott ist ein stiller Teilhaber bei all unseren Geschäften. Fordert genaue Abrechnung. Er ist hart und objektiv, nicht empfindsam, nicht teilnahmsvoll. Vorsicht, wenn du mit ihm teilst.
BALATONFÜRED2
Die »Lustwandelei«, die Allee, unter deren Blätterdach die Helden der Vörösmarty3-Erzählung, die Herzensbrecher von Füred, ihren auserwählten Damen hinterherschritten, die Ruinen des Kisfaludy-Theaters, die Fußspuren von Jókai4 und der gefeierten Lujza Blaha5 auf den Waldwegen: Dies ist reinstes ungarisches Biedermeier.
Doch sanft ist auch die Landschaft, als hätten hier die Leidenden, die unter diesen Bäumen, an dieser Quelle und unter diesem hellblauen Himmelsgewölbe Genesung für ihr krankes Herz suchen, die Natur gebändigt. Die Landschaft hat sich sanft den Kranken angepaßt; sie ist bläßlich und edel ermattet, wie jeder, der schon eine erste leichte und höfliche Berührung durch den Tod erfahren hat. Eine liebliche Landschaft, eine rufende, lockende. Sie sagt: »Eile nicht. Verweile und raste. Hörst du die Bäume rauschen? Sie haben eine Botschaft für dich.« Man hält inne, lauscht dem Geraune, und auf einmal hat man verstanden: es war schade, geeilt zu sein.
DER GEZEICHNETE
Der Mensch, der nicht ins Flugzeug gestiegen war, das abgestürzt ist und alle Passagiere unter sich begraben hat, zeigt wortlos sein reserviertes Flugticket, die numerierte Platzkarte. Ja, auch er wäre in den Tod gestürzt.
Doch er ist nicht abgestürzt, und jetzt steht er da mit seinem Leben, das er vom Schicksal, vom Zufall, beschert bekam, mit diesem unbegründeten, unfaßbaren Geschenk. Was soll er nun damit anfangen? … Er könnte es ja vergeuden, denn es ist geschenkt. Aber er kann es auch vor jedem Windhauch bewahren, vor Magenverstimmung und Aufregung, denn es ist ein gezeichnetes Leben, ein kostbares, außerordentliches Leben, und das Schicksal hat offensichtlich etwas mit ihm vor. Er wirkt ein wenig verstört. Bisher hat er nur gelebt, jetzt aber ist ihm bewußt, daß er lebt – und diese Überraschung deprimiert ihn fast ein wenig.
DIE BEGEGNUNG
Ja, später, später begegnen wir den Menschen. Diese Begegnung ist nicht gerade erhebend, wenn der Mensch sein Schicksal ernsthaft an jemanden bindet, keine Luftsprünge vollbringt, sich nicht freut, sondern dem Schicksalsgefährten blaß und ernst in die Augen schaut. »Aha, so seid ihr also!« – denkt er. Dann kennt er sie bereits, in jeder Beziehung, hat den Menschen auf dem Seziertisch gesehen und in der Kirche, während er ewige Treue gelobt, und vor dem Richter, wenn er einen falschen Schwur tut, hat den Menschen als Kinder- und Muttermörder erlebt, als großen Künstler, der sich in der Ekstase der Inspiration Gott zuwendet, als Helden, der sein menschliches Schicksal stumm auf sich nimmt … hat den Menschen bereits gesehen und akzeptiert ihn endlich. Eines Tages begegnen wir den Menschen und akzeptieren sie. Dieser Augenblick ist still. »Ja, ja« – murmeln wir. In solchen Augenblicken fangen wir an, alt zu werden.
DER KLEINE HERBST
Zwischen zwei schmerzend heißen Tagen der kleine Herbst. Die Bäume, die Steine, der Straßenbelag flimmern im Dunst, die Stadt füllt sich mit säuerlichen Gerüchen, dem Mief der Krankenzimmer, in denen geschundene Körper im kalten Schweiß schmachten. Doch die Brechung des Lichts an diesem Morgen ist anders: fahler, toter. Die Luft ist erfüllt von Gärungsgeschmack, wie abgestandener, lauer Champagner am Morgen nach dem Gelage. Diese Gerüche sind stimulierend und unheimlich zugleich. Der Augenblick des Katzenjammers nach dem blumenbekränzten, heißen, sinnlichen Fest des Sommers. Man kommt wieder zu sich, und der Kopf schmerzt. Noch gehen wir nicht in uns, doch wir beginnen, die verrinnenden Stunden zu zählen, wie der Hochstapler sein letztes Geld. Das Zechgelage ist aus. Zieh den Hut tiefer in die Stirn. Dies ist der kleine Herbst.
DIE DEMOKRATIE
Ich habe mir den zornigen Demokraten angehört, der Diktaturen Bomben, Schwefel, Hölle und die sieben ägyptischen Plagen an den Hals wünscht, und dachte mir:
– Ja, die Demokratie wird schließlich siegen, aber nicht auf diese Weise, vor allem nicht mit den Mitteln, an die dieser zornige und verzweifelte Demokrat glaubt. Die Demokratie kann nicht in irgendeinem historischen Augenblick siegen, auf dem Schlachtfeld, inmitten schmetternder Trompeten und flatternder Fahnen, wenn die Leichen von Hunderttausenden Tyrannen auf dem Marsfeld liegen und der Sturmtrupp der siegreichen, guten, makellosen und vollkommenen Demokratie im Stechschritt über die Kadaver hinwegschreitet. So, nur so, kann die Demokratie nicht siegen.
– Aber sie wird siegen, unbemerkt, in mir und in dir. Wenn wir alle einst gebildeter, also menschlicher werden, wenn wir aufgeklärter, also besser sind, geduldiger, also männlicher – denn Willkür ist immer Irrsinn und auch unmännlich –, dann siegt die Demokratie. Wann? Am Dienstag? Oder Samstag? Das glaube ich nicht. Die letzten Siege sind nicht so billig und pünktlich zu haben.
DIE WOHNUNG
Sooft ich Wohnungsanzeigen in den Zeitungen lese – das Angebot kann zentral gelegen oder außerhalb sein, ganz gleich –, empfinde ich immer noch diese Unruhe, diesen diffusen Stich ins Herz, als ob ich sofort den Hut nehmen und hineilen müßte, die Wohnung zu besichtigen und zu mieten – in der ich endlich zu Hause sein kann.
MONTAG, DER ERSTE
Es ist Montag, und es ist der erste, und ich beginne nichts von vorn. Möchte nur mehr schlecht und recht, schleppend, krächzend, stöhnend, mit dem Okular und scharf geschliffenen Instrumenten das fortsetzen, was ich letzten Montag angefangen habe. Ich möchte montags und am ersten nicht mehr die Welt erlösen oder sie aus den Angeln heben. Möchte nur noch leben in dieser Welt, montags und auch am ersten, genauso lange, bis ich meine Arbeit getan und meine Pflicht erfüllt habe. So bescheiden? Im Gegenteil, so ehrgeizig, am Montag und am ersten.
DIE UHREN
Nein, die Uhren des Lebens und der Geschichte schlagen nicht immer unheilvoll feierlich und pünktlich zu Mittag oder Mitternacht. Die Söhne glücklicher Epochen bekommen auf dem Zifferblatt der Zeit derlei Daten zu lesen: Vor fünf Minuten war es halb neun. Oder: In sieben Minuten wird es Viertel drei. Die Zeit, die sich zwischen das »war« und das »wird« schiebt, nennt man Frieden.
Zwischen 18676 und 1912 dachten die Menschen, es wäre ständig Viertel drei oder halb neun. Dann begann der Zeiger zu jagen, und plötzlich zeigten alle Uhren Mitternacht. Und jetzt leben wir wieder so, als ob jemand irgendwo mit der Stoppuhr in der Hand das Verfliegen der Sekunden zählen würde.
DER GENIESSER
Er ist siebenundsiebzig. Und auch hier im Bad auf der Suche nach einem Heilkräutlein für sein Herz. In Gesellschaft einer Pflegerin; hin und wieder gibt er sich so galant, wendet sich so schelmisch lächelnd an die Frau, als ob sie sich gerade auf der Promenade kennengelernt hätten und nun die Umstände eines nächtlichen Tête-à-tête aushandeln würden. Unverbesserlich.
Er trägt ein Monokel, weiße Gamaschen, ein grünes Seidentuch und einen Siegelring, dazu einen sehr feinen Strohhut, der so leicht ist, als wenn er aus Vogelfedern geflochten wäre. Täglich erscheint er in einem anderen Anzug bei der Quelle, betört und blendet seine Bewunderer. Er macht sich mit jedermann bekannt; ist vornehm, aber nicht exklusiv. Histörchen, die er mit deutschen, französischen, lateinischen und englischen Brocken würzt, sprudeln aus seinem Mund wie die Kohlensäure aus dem Heilwasser, von dem er trinkt. Er spricht von Frauen, Schlachten am Spieltisch und von seinen vornehmen Freunden. Einmal, in Nizza, sagte eine englische Lady … Einmal in London zog er nach der Neun ein As … Damals, in Paris, sagte der spanische Thronanwärter … Der zarte Glorienschein all der Abenteuer strahlt mild um seinen kahlen, schlauen, verschlagenen und unglücklichen Kopf. Seine Hand, die siegelringgeschmückte, faltige, edle und verlotterte Hand, die gern Frauen gekost und Karten aufgefächert, die die Hände so vieler verdächtig vornehmer und weniger solider Zeitgenossen getätschelt hat, führt er gelegentlich müde zu seinem Herzen hin. Ja, das große Spiel ist aus. Einsatz war der Genuß. Ein großer, trauriger Einsatz. Jetzt könnte er auch sagen, daß er etwas bereut und daß er die Freude verlor, als er mit diesem Einsatz gewonnen hat. Aber in Wahrheit hat er nichts bereut. Hier eilt er, der Genießer, mit nicht gerade elastischen Schritten, am Arm der Pflegerin über den Korridor, hin zur Ordination, wo ihn teure Tropfen, aufbauende, herzstärkende Mittel aus der Nadel erwarten. Er eilt zu einem Abenteuer, zu irgendeinem allerletzten, geheimnisvollen Abenteuer; sein Monokel ins linke Auge geklemmt, schielt er mit mißfallend fragendem Blick in Richtung Tod – nimmt ihn in Augenschein wie eine unangenehme Amtsperson, deren Anwesenheit man hinnehmen muß. Schaden kann es nicht, wenn man ihn spüren läßt, daß er nicht zur guten Gesellschaft gehört.
TODESANZEIGE
Er ist gestorben. Ist vor der Schmach geflohen, Gewalt und Willkür haben ihn umgebracht. Was soll ich auf sein Grabkreuz schreiben?
Ich schulde ihm viel, weil er ein wenig auch für mich gestorben ist, für meine Menschenwürde und auch für meine Ehre. Und so werde ich die vornehmste Huldigung schreiben, die man in ein Grabkreuz kerben kann. Ich schreibe: »Er kannte den Sinn des menschlichen Lebens: das Mitgefühl und die Ehre.«
BLUMENSPRACHE
Juni. Plötzlich merken wir, daß die Wohnung, die Welt, das Leben voller Blumen ist. Eine sonderbare, unmenschliche Pracht! Sie verhüllt etwas Ermattetes und Böswilliges, Muffiges und Tödliches, das Leben, und sie verfügt über Millionen von Wörtern. Ich aber kenne nur die Urbegriffe: die Rosen, die Nelken, die Primeln. Sie sind in der Sprache der Blumen Subjekt und Prädikat. Hinter diesen Stammwörtern reiht sich eine unendliche Zahl von Attributen ein: vom Basilienkraut bis zum Tausendschön.
So mault der leicht entflammbare Sommer, spricht in der Blumensprache zu uns. Und was will er sagen? Für einen kurzen Augenblick, zwischen Leben und Tod, teilt er uns etwas mit. Er sagt: »Die Welt ist nicht nur eine nützliche, sondern auch eine überflüssige. Atme, erinnere dich, verschwende. Schönheit ist Überfluß. Fühlst du das? …« Ja, ich schaue mich um, staune, sehe und fühle es.
AN EINEN TOTEN
Soeben, mein Freund, höre ich, daß du gestorben bist. Einen Augenblick lang erscheinst du mir in diesem Übermaß, in der Vergrößerung, die der Tod verleiht. Warst du groß? Ich weiß es nicht. Aber ein Mensch warst du und ein Künstler.
Die Grimasse der Krankheit und des Schicksals hat dein Gesicht verzerrt. Auch mit fünfzig warst du wie ein schreckhafter, spöttischer Lausbub. Als ob du der Welt ständig feixend Gesichter schneiden wolltest. Taubstumm geboren, hast du mit übermenschlichem Kraftaufwand sprechen gelernt, dir Sprachen angeeignet. Zum Lebensabend hin bist du dann bereits viersprachig taubstumm gewesen. Stammelnd, mit animalischen Lauten hast du Menschliches ausgedrückt, stöhnend, röchelnd. Als hättest du beim Sprechen mit allerlei Schreckensbildern gerungen. Ein Caliban.
Aber dann hast du der Welt gesagt, was du ihr zu sagen hattest – in Bildern, in mehr und mehr erstarrenden, einsilbigen Bildern. Gegen Ende hast du nur noch kleine Gegenstände in riesigem grauem Raum gemalt. Ich habe das nicht verstanden, dir aber geglaubt, daß es nur so wahr ist und du deine Vision nicht anders mitteilen kannst.
Die Frauen haben sich deiner bedient, aber ohne Gefühl, so wie ein Perverser des Tiers. Du hast die Achseln gezuckt und sie geliebt. Und dennoch, du hattest etwas unsterblich und grotesk Erhabenes, etwas besessen, übertrieben, unbarmherzig Erhabenes. Ja, mein Freund, du warst ein Mensch, der sich an die Wahrheit erinnert hat und diese auch ausdrücken wollte. Du warst also Künstler. Ich weiß, du pfeifst darauf; dennoch, ich verneige mich vor deinem Andenken.
DER DOM
Der Mensch betrachtet Dome seit langem als Kunstwerke. Wandelt unter ihren Spitzbögen, bestaunt Monstranzen, das geschnitzte Gestühl, ihre Kunstschätze. Und all das aufmerksam höflich, vielleicht begeistert. Ja, natürlich, der Dom zu Florenz, zu Chartres, der Pariser, der Kaschauer Dom7.
Aber dann weht das Leben mit seiner Traurigkeit, den Erfahrungen und mit Hoffnungslosigkeit darüber hin. Und eines Tages beginnen wir, die Alten, greise Männer, armselige alte Weiblein, zu beneiden, die – in Florenz, Chartres, Paris oder Kaschau – zum Beten, um ein Nickerchen zu machen, oder auch nur, um sich in Erinnerungen zu verlieren, ins Halbdunkel des Doms einkehren und keinerlei Ahnung haben von den Kunstwerken, vor denen sie knien. Für sie wurde der Dom gebaut. Ihre Ahnungslosigkeit ist der wahre Sinn eines Doms.
WINTERSCHLAF
Winter ist, und ich sehne mich nach diesem tiefen Schlaf, wie Bären, wie die Toten. Ach, wäre es schön, zu schlafen! Verborgen in Winter und Einsamkeit, in irgendeinem rauhen, haarigen und schummrigen Alleinsein, nur noch brummelnd, dösend von Himbeerstauden, den Gesten des Lebens und vom Sonnenlicht träumen – schlafen, in diesem tiefen und gar nicht mehr beleidigten, gleichgültigen und würgend dumpfen Alleinsein, welches das Schicksal ist, in dieser tauben Einsamkeit, die das Leben ist. Schlafen, verbissener, zäher, wie die Toten. Schlafen und nicht mehr sehen. Schlafen und vergeben. Schlafen will ich – vergebt –, weil ich vergeben möchte.
TOTE MÖWE
Gegen Abend spülte die Flut eine tote Möwe in den Hafen. Mit ausgebreiteten Flügeln schaukelte sie ernst und im Gleichmaß auf den schäumenden, schwarzgrünen Wellen, als ob sie nach einem tristen und kühnen Abenteuer zwischen den Ufern von zwei Erdteilen ausruhen wollte. Diese zwei Erdteile, die beiden Ufer, Leben und Tod.
Die tote Möwe hatte die Schwingen weit ausgebreitet und den Kopf zur Seite geneigt. Sie war jetzt ganz Ergebung und weich wiegende Sanftheit. Ich beugte mich über das Ufergeländer und betrachtete lange den toten Vogel. Wie und wo sterben Möwen? … Stürzen sie plötzlich herab, weil sie ermattet sind, zwischen den Schiffen, dem Himmel und dem Meer? … Sterben sie an Angina pectoris? Oder an Herzverfettung? … Wir wissen es nicht. Vielleicht sterben sie nur, weil sie genug vom Leben haben.
Bis zum Morgen hatte sich der Sturm gelegt, und das Hafenbecken war leer, Wind und Wasser haben die tote Möwe begraben. Das Wasser schien glatt wie die Marmorplatte einer riesigen Gruft und hellblau die Himmelskuppel, dem Deckengewölbe eines geheimnisvollen und erhabenen Mausoleums gleich. Das Grab der Möwen ist schlicht, würdevoll und unbezeichnet, wie die Ruhestätte der Könige. Ihr Leben und ihr Tod geheimnisumwittert, salutieren wir.
GLAS
Ein Tag Ende September, alles ist so ergreifend hell und zart, als ob man die Welt, dieses zerbrechliche Gebilde, hinter Glas verwahrt hätte.
Jetzt, in der Vitrine des September, wird es offenbar – die Welt ist wirklich ein Meisterwerk. Die Bäume, diese verkaterten Strohwitwer mit ihrem zerzausten, struppigen Laub. Die Gärten mit dem verdrießlichen Blumenschmuck, wie Katafalke; die mit Misteln besetzten Pappeln gleichen federbuschgeschmückten Gespannen im Leichenzug. Die Wiesen im feierlichen, klaren Licht der Septembersonne. Und es herrscht Stille. Sogleich wird der Held, vom Scheitel bis zur Sohle geharnischt, erscheinen und die Dahlien zu metzeln beginnen.
Jetzt ist alles fern und unwirklich. Die Luft gibt, wenn du sie berührst, einen kalten Ton, als ob du an Glas klopfen würdest. Höflich stehe ich vor der Auslage, betrachte die zur Schau gestellten Gegenstände und wünsche mir nichts.
SZEGED8
Schmerz über der Theiß, die Radialstraßen, auf denen die Schattengestalt von Gyula Juhász wandelt, die Theiß, diese behäbig hingestreckte, gezähmte Bestie, die Ebene, in deren Dunkelheit einsame Lichtlein von Sekten die Nacht durchwachen, Halászlé, in die man jedwede kulinarische Weisheit aus fünf Jahrhunderten eingedampft hat, die Bläue über der Stadt und die Stadt, festgeklammert im Sand der unendlichen Ebene, mit ihren Türmen und ihren Dichtern, ihren beharrlichen, schweigsamen Ungarn. Der Schmerz und die Stille. Nachts um zwei gehe ich unter der Brücke, nichts ist zu vernehmen, nur das Glucksen des Wassers. Wie vertraut mir das alles ist! Alt und vertraut! Wann hörte ich es zuletzt, dieses mitternächtliche Gluckern des Wassers, wann habe ich über der Ebene das Verlöschen der Sterne gesehen, was für ein Duft, Duft von Wasser und Erde. Wer wandelt hier in der Dunkelheit, welche Blonde spukt hier umher, was für ein Rauschen des Kleides? … Irgendwo geht hier Anna um, unsichtbar, Anna die Muse. Und tief unten in der Finsternis wälzt sich das Wasser fort, wie die Zeilen eines ewigen Gedichts.
DER TOTE
Ich ging hin, um mich mit ihm zu versöhnen. Sein Grab war kahl, ohne Blumen. Er war ein einsamer Toter; die Grabstätte verriet, daß, wer unter dieser Erdscholle modert, sich auch im Tod mit uns, den Lebenden, mit seinen Gegnern und mit der Welt nicht ausgesöhnt hat.
Doch jetzt ist nichts mehr zu diskutieren mit ihm. Im Leben war er unterlegen, wie jeder, der verstorben ist; aber im großen Zwiegespräch, in der verzweifelten Auseinandersetzung, die er mit den Menschen ausgetragen hat, ist er, der Tote, obenauf geblieben. Und so stand ich stumm an seinem Grab, ohne innere Regung und ohne irgendein Argument. Das Schweigen war vernünftig. Dieses Schweigen, mit dem wir am Grab der Dahingeschiedenen stehen, erledigt etwas, das die Lebenden mitsamt ihrem großen Wortschatz niemals erledigen konnten.
WERKSTATT, MECHANIK
Wer noch keine Geburt gesehen hat, weiß etwas vom Leben nicht, etwas Bestimmtes und auch etwas »Grundsätzliches«, wie man in der Schule sagen würde – dies ist gewiß, wer keine Geburt miterlebte, hat keinen Einblick in die Mechanik, kennt die Werkstatt nicht, diese geheimnisvolle und furchtbare Werkstatt, in der das Leben geschaffen wird. Die Kräfte, die bei der Geburt in Gang kommen, Kräfte des Lebens und des Todes: in diesen Stunden ertasten Mutter und Kind mit tauben Instinkten im Dunkel den Weg – zwischen Leben und Tod. In diesen Augenblicken setzen sich Kräfte in Bewegung, drängen und sprengen den mütterlichen Leib einem Erdbeben gleich. Der Betrachter würde nicht staunen, strömten statt Blut und Plazenta dampfende Lava und Asche aus der Gebärmutter hervor.
Ja, ich habe die Werkstatt gesehen. Man wird still, ganz still. Später, wenn das Kind zu weinen beginnt und der Augenzeuge aus dem Zimmer schleicht, nimmt er den Eindruck mit, daß Michelangelo ein Pfuscher und Newton mit all seinen Berechnungen nur ein Dilettant war.
MÄRZSCHNEE
Geschmolzenes Parfait mit glasiertem Veilchendekor.
GESCHENK
Und dennoch, auch heute, auch so, immer und ewig gibt uns das Leben so reichlich! Schenkt sie uns leise, mit beiden Händen: den Morgen und den Nachmittag, die Abenddämmerung und die Sterne, den schwülen Duft der Bäume, die grüne Welle im Fluß, den Widerschein eines Augenpaars, die Einsamkeit und den Lärm! Und was es alles gibt, wie reich ich bin, wie reich beschenkt, welcher Überfluß, zu jeder Tageszeit, in jedem Augenblick! Ein Geschenk ist das, ein wunderbares. Bis zum Boden will ich mich verneigen, so will ich danken dafür.
DER ABREISENDE
Jetzt fährt er bereits, der Abreisende! Doch für einen Augenblick sehen wir ihn noch, wie er dort am Fenster des mit Auswanderern vollgepferchten Abteils steht, den Glanz des Entzückens in den Augen, eine Flasche Kecskeméter Riesling im Arm, den ich ihm zum Abschied überreichte. Er fährt nun, und im Weggehen vom Bahnhof unterhalten wir uns über sein Schicksal, das Schicksal, das ihn jetzt in den unendlichen Raum, in eine fremde Zeit hinauskatapultiert, sprechen bereits über seine Bibliothek und sein Erbe, gesittet, wie man über die Angelegenheiten von Toten zu sprechen pflegt. Aber er hört das nicht mehr, er reist hinaus in die Welt.
In der Stadt bleibt nur sein Andenken zurück, verworrene Erinnerungen und die Erinnerung an ihn, traurige und kindliche. Jetzt tut er uns allen leid, der Abreisende. Ein bißchen sind wir alle seine Mörder, und deshalb reden wir laut über ihn, auf Männerart. Er verstand etwas von Literatur und von gutem Stil, stellen wir fest. Bei den Frauen hatte er wenig Glück. Überhaupt hatte er mit nichts Glück. Jetzt wird er in Paris leben, stöhnend und unglücklich wird er unter Brücken mit Negerfrauen schmusen und mit Emigranten aus Litauen über die ungarische Literatur diskutieren. Er wird einsam sein, wie ein Stern, und unglücklich wie Beelzebub, sein Kissen der Mond, seine Lagerstatt die Marmorbank der Morgue … Wieso eigentlich, wieso beneide ich ihn dennoch?
DER REGEN
Dieser Regen ist warm, warm wie die Tränen der Frauen. Ohne Geschmack, ohne Duft, nur warm. Und bis zum Abend ist er auch schon vergessen.
Ich koste den Regen, erinnere mich, daß ich mich auch an andere Stürme entsinnen kann, Tränen von anderem Geschmack, auch heiße Tropfen eines anderen Geschicks über die Wangen laufen spürte. Immer erinnere ich mich daran, und alles erinnert mich.
TRAUER
Trauer ist keine Feier, mit pathetischen, schwarz-silbernen Schabracken, mit Weihrauch und Musik, mit förmlich kühlen Beileidsbezeugungen. Trauer ist eine Explosion: die größte Explosion im Leben. Jeder Trauernde ist ein wenig Hiob, auf dem Kehrichthaufen, ohne Hab und Gut und kinderlos, inmitten von Schutt, zwischen den Scherben des Lebens, räudig, und er wendet sein Angesicht hin zu dem mit schwarzen, zerrissenen Wolken verhangenen Himmel. Der Mensch lebt tief in Trauer, ungewaschen, übelriechend, in irgendeiner niederträchtigen, ranzigen Einsamkeit. Das, nicht mehr, ist die Trauer. Alles andere ist nur Übung.
DAS MEISTERWERK
Bei Morgengrauen, in dunkler Stube, zündete ich am Sterbetag meines Vaters vor seinem Foto eine Kerze an. Saß frierend im Dunkeln und starrte in die schwache Flamme.
Das Ganze war völlig unverständlich: das Bild, die Kerze, der dunkle Raum, daß mein Vater tot war und ich lebte. Unverständlich und dennoch so überlegen geordnet, wie ein Meisterwerk.
ALTWEIBERSOMMER
Wir haben Mitte Oktober, und plötzlich wird es Sommer. Ein dickflüssiger Sommer voller Mostgeruch, ein im Wespengesumm dösender Altweibersommer. Sommer, die Wälder eine blutige Kulisse! Ein Sommer, als hätte sich Pan aus der Verbannung zurückgeschlichen und ließe jetzt hier in der Mikógasse9 unter meinem Fenster die Flöte erklingen. Da, schon führt ihn der Schutzmann als Landstreicher ab, weil er sich gelbes Laub ins Haar gesteckt hat, schreibt ihn auf wegen Ruhestörung.
Im herbstlichen Schein schlägt unser Herz heftiger. Wir wittern etwas, gehen im Licht und im Duft benommen umher und atmen den scharfen Modergeruch vom faulenden Laub. Es ist, als wenn sich Sterbende einen Augenblick lang besser fühlen, sich aufsetzen im Bett, ein Glas Tokajer trinken und sich kurz an der süßen Sinnlosigkeit des Lebens berauschen, mit blutunterlaufenen Augen und fiebrigem Angesicht aufschreien. Dann fällt ihr Kopf wieder aufs Kissen zurück. So leben wir jetzt, Mitte Oktober.
Morgen muß wieder geheizt werden. Dann muß man sterben. Komm, wir setzen uns in die Sonne hinaus – hörst du die Wespen summen? –, laß uns schweigen, Most trinken; lächle doch, schnell, laß uns leben.
BACKFISCH
Von Zeit zu Zeit kommt der Tafelrichter10 an und erklärt mir, welche Folgen der Krieg haben und wie er schlechterdings überhaupt sein wird. Der Tafelrichter ist schon über sechzig, trägt festliche Kleider, hat eine Glatze, und sein englisches Bärtchen wird bereits grau, er bewegt sich möglichst auf Zehenspitzen, streckt beim Sprechen Zeige- und kleinen Finger kokett in die Höhe und spricht mit lispelnder, dünner, mutierender Stimme, er hüpft ständig hoch, küßt Hände und läßt dabei die unsichtbaren Sporen klirren, überhaupt möchte er gern Engländer oder französischer General sein, einer, der Mitglied der Akademie ist, zum Tee bei Hofe geladen, mehr im Oberhaus politisiert als auf dem Kasernenhof kommandiert, möglichst nicht kämpft und mit gespitzten Lippen Dinge sagt wie: »Meine Herren, stets der Ihre.« Auch warte ich bisweilen darauf, daß er ein Bein hebt und einen Bückling macht; überraschen würde mich auch nicht, wenn von seiner Glatze zwei Weiberzöpfe mit hellblauen Schleifen baumeln würden. Denn der Tafelrichter ist ein Backfisch; doch er weiß es nicht.
MITTERNACHTSMESSE
Mitternachtsmesse am Heiligen Abend im Dom zu Kaschau; nach zwanzig Jahren sehe und höre ich das zum ersten Mal wieder. Meine Rührung ist kühl und ohne Pathos. Es ist etwas Höheres und Ewiges im Dom, in den Gesichtern der Menschen, in den graugelben Schatten, in der eisigen Stille; und hinter all dem die Kindheit.
Ja, die Stadt und der Dom, die bleiben erhalten – man muß sie trennen von der Kindheit, von den Menschen, vom Zeitgemäßen, von dem sich Verändernden und Verfallenden, was so fürchterlich fremd ist gerade in dieser Stadt, weil durch Fleisch, Blut und durch die Erinnerung ewig bekannt: Für uns kann nur das wirklich sterben, womit wir allerbestens vertraut gewesen sind. Die Erinnerung ist gestorben und erkaltet. Aber die Stadt und der Dom stehen in kühler Überlegenheit über allen Erinnerungen und Veränderungen: und das mit einer Gleichgültigkeit, die schon unmenschlich ist, so wie nur große Kunstwerke herabschauen können auf den, der sie schuf und den sie geschaffen haben.
SOMMERKRANKHEIT
Die Sommerkrankheit nimmt einen dramatischen Verlauf: mit hohem Fieber und am Rande der Bewußtseinstrübung. Überschwengliche Menschen werden vom Redeeifer mitgerissen, der dieser Krankheit innewohnt; sie sterben daran. Andere kehren aus dem fieberheißen Abenteuer wieder und irren bleich und leicht taumelnd zwischen den fremdartigen Kulissen des Sommers umher, wittern mit der herben Begeisterung des Heimgekehrten die Dünste und Düfte des Lebens, erinnern sich, betasten das Leben, das zugleich Rose und Ruhr, Liebe und Influenza, Wassermelone und Aspirin für sie ist. Aus solchen Elementen setzt sich das Leben, dieses schicksalsträchtige Phänomen, zusammen. Im Sommer wird man das leichter verstehen.
KRANKHEIT
Die Krankheit, dieser angenehme Koben. Schon ein bißchen Himmel, ein bißchen auch das Verlies der Tscheka, wo sich chinesische Scharfrichter herumdrücken, ein bißchen Kammermusik mit viel Mozart-Erinnerung und ein bißchen Viehmarkt bei Stuhlweißenburg11 mit Bremsen und Dung, ein bißchen was von den »letzten Dingen«, und in der Tat ein bißchen auch das letzte Ding. Sowohl die Leibschüssel wie der Rhythmus von Rilke-Gedichten gehören dazu, zugleich aber auch Rülpsen und Sphärenmusik. Und vor allen Dingen die Chance, welche das Schicksal gewährt, die Gelegenheit: leben oder sterben. Nutze sie!
DER ARZT
Im Leben des Erwachsenen übernimmt der Arzt nach und nach die Rolle des Lehrers, der gestrengen, aber liebevoll rügenden Eltern und der Autorität. Es gibt kein peinlicheres Gefühl, als jenseits der Vierzig im Gasthaus mit unserem Hausarzt zusammenzutreffen und zu sehen, wie dieses hochgeachtete Wesen ein Schweinskotelett verzehrt und sich im Familienkreis amüsiert.
FREUD
Er starb mit dreiundachtzig Jahren in einem Haus am Primrose Hill in London. Und die heulende, jaulende Meute, die er mit seinen Thesen ins Herz getroffen und verwundet hat, fällt jetzt über sein Andenken her, reißt es schmatzend in Stücke und schwört seiner Lehre ab.