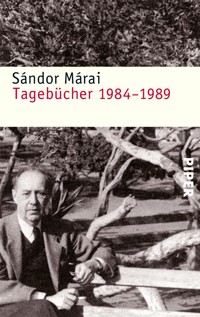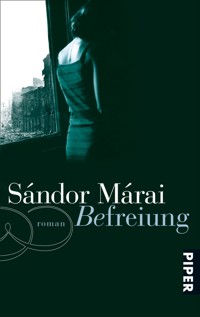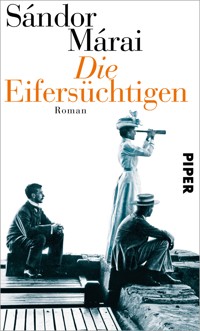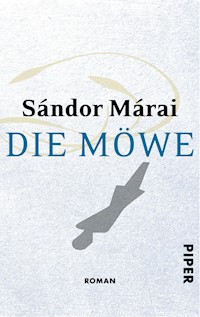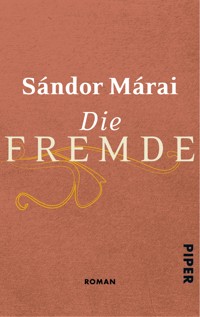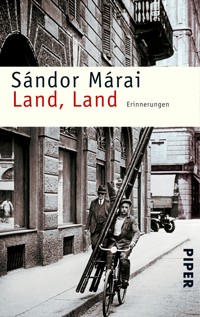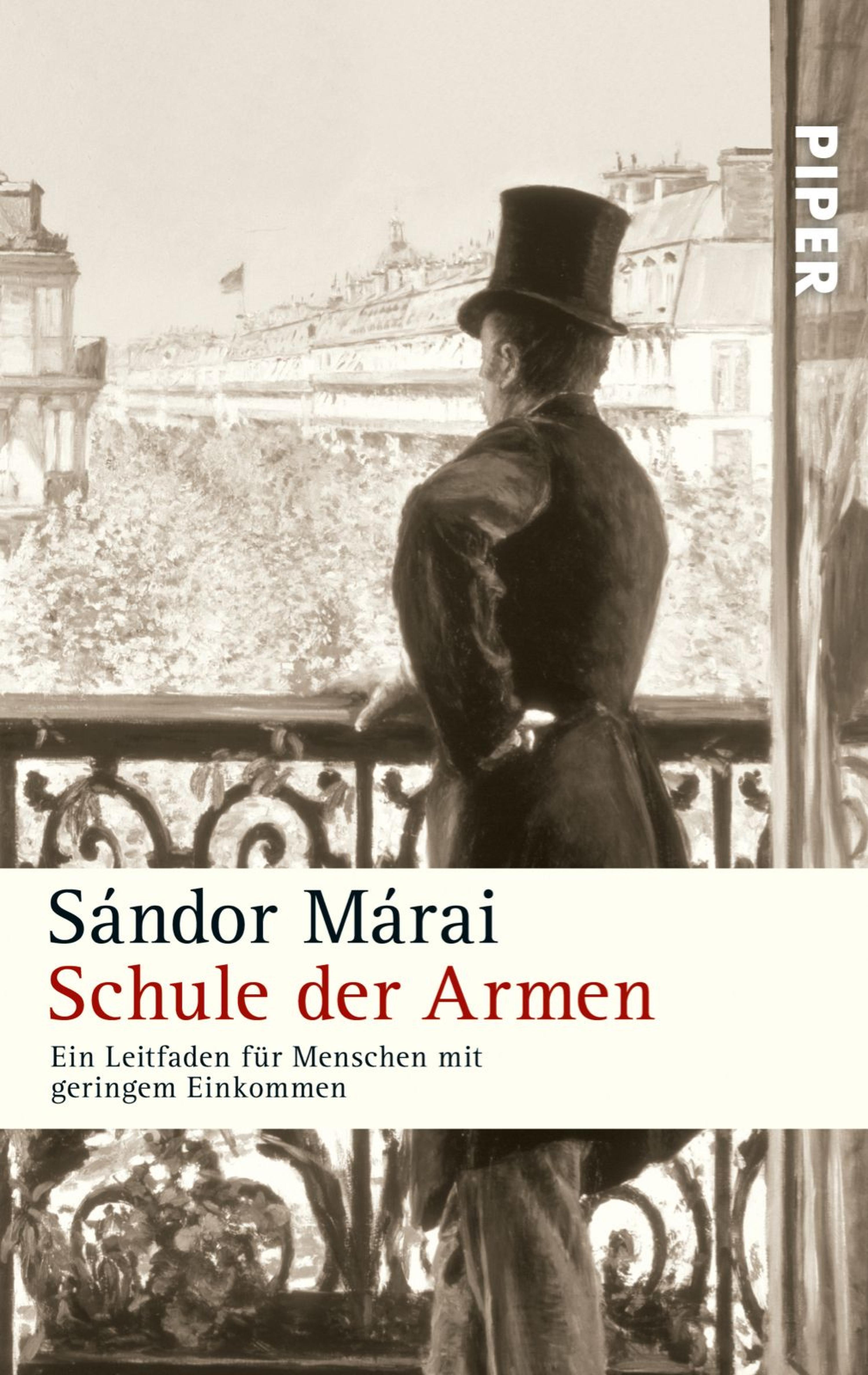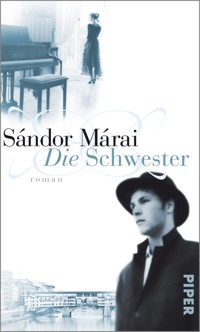9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer der berühmtesten Romane Sándor Márais erzählt von der Liebe und deren Vergänglichkeit – und von der Utopie eines dauerhaften Lebensglücks. Den Verliesen Venedigs entflohen, bezieht der vornehme Fremde Quartier in Bozen. Als er erfährt, dass auch der Graf von Parma mit seiner bezaubernden Frau in der Nähe weilt, ist es um seine Ruhe geschehen. Denn Francesca ist die einzige Frau, die ihn je wirklich berührt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die vorliegende Übersetzung, erstmals 1943 unter dem Titel »Ein Herr aus Venedig« und 1950 unter dem Titel »Begegnung in Bolzano« erschienen, wurde von Hanna Siehr überarbeitet.
Übersetzung aus dem Ungarischen von Renée von Stipsicz-Gariboldi, überarbeitet von Hanna Siehr
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
6. Auflage 2009
ISBN 978-3-492-96002-1
Nachlaß Sándor Márai, Vörösváry-Weller Publishing Toronto Titel der ungarischen Originalausgabe: »Vendégjáték Bolzánóban«, Budapest 1940 Deutschsprachige Ausgabe: © 2002 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagabbildung: Composing unter Verwendung von John Kelly / Stone / Getty Images, Fox Photos / Hutton Archive / Getty Images, Alfred Buellesbach / buchcover.com, Irata / Fotolia Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Der Gast aus Venedig
In Mestre verabschiedete er sich von den Gondolieri. Balbi, der verlotterte Klosterbruder, hätte ihn hier fast noch einmal der Polizei in die Hände geliefert, war er doch im Augenblick der Abfahrt der Postkutsche nirgends zu sehen. Schließlich fand er ihn in einem Kaffeehaus, wo er, sorglos eine Tasse Schokolade schlürfend, mit der Kellnerin schäkerte. In Treviso ging ihnen das Geld aus. Durch die Porta San Tomaso stahlen sie sich ins Freie und erreichten im Schutz von Gartenmauern und Gehölzen in der Dämmerung die ersten Häuser von Valdepiadene. Hier zog er seinen Dolch und bedrohte den unbequemen Reisegefährten. Sie verabredeten ein Stelldichein in Bozen und trennten sich. Balbi schlich übelgelaunt zwischen den kahlen Stämmen des Ölbaumwäldchens dahin; hungrig und struppig, mit finsterem, geducktem Blick, immer wieder zurückschauend, glich er einem von seinem Herrn verjagten räudigen Hund.
Als der Mönch endlich verschwunden war, ging er in die Gemeinde und bat dort mit sicherem Instinkt im Haus des Polizeihauptmanns um Unterkunft. Eine freundliche Frau, die Gattin des Hauptmanns, nahm ihn auf; er bekam ein Nachtessen, man wusch seine Wunden – auf seinen Knien und Knöcheln klebte geronnenes Blut. Bei seiner Flucht über die Dächer der Bleikammern hatte er sich Ellbogen und Knie aufgeschlagen. Bevor er einschlief, erfuhr er noch, daß der Hauptmann eben unterwegs war, um ihn, den Flüchtigen, zu suchen. In der Morgendämmerung schlich er davon. Er schlief in Pergine und erreichte am dritten Tage Bozen, diesmal im Wagen, denn er hatte unterwegs von einem seiner Bekannten sechs Dukaten erpreßt.
Balbi erwartete ihn schon. Im Gasthof »Zum Hirschen« verlangte er Unterkunft. Gepäck besaß er nicht; er war in Lumpen gekommen, in einem Frack aus bunter Seide, der nur noch aus Fransen bestand, und ohne Mantel. Durch die engen Straßen von Bozen pfiff schon der Novemberwind.
Der Wirt musterte betroffen den abgerissenen Gast. »Wie, die schönsten Zimmer?« stotterte er.
»Jawohl, die schönsten Zimmer«, sagte er ruhig, aber streng. »Und hab ein Auge auf die Küche! Bei euch hier kocht man mit allerhand ranzigem Fett statt mit Öl; seit ich den Boden der Republik verlassen habe, bekam ich noch keinen anständigen Bissen. Brate mir Kapaun zum Abendessen, aber nicht einen, sondern drei, und mit Kastanien gefüllt. Und sorge für Zypernwein! Mein Kleid gefällt dir nicht? Du suchst nach meinem Gepäck? Und wunderst dich, daß wir mit leeren Händen kommen? Gibt es hier keine Zeitungen? Liest du nicht die Leidener Gazette? … Dummkopf!« rief er heiser; er hatte sich auf dem Weg erkältet, und ein quälender Husten plagte ihn. »Hast du nicht davon gehört, daß ein Edelmann aus Venedig mit seinem Sekretär und der Dienerschaft an der Grenze ausgeraubt wurde? Hat sich die Polizei noch nicht nach mir erkundigt?«
»Nein, Herr«, stotterte der Wirt erschrocken.
Balbi lachte sich ins Fäustchen. Schließlich bekamen sie tatsächlich die schönsten Zimmer: einen Gesellschaftsraum mit zwei großen Flügelfenstern auf den Hauptplatz, mit vergoldeten Möbeln und einem venezianischen Spiegel über dem Kamin, dazu ein Schlafzimmer mit französischem Himmelbett. Balbi wohnte am Ende des Korridors, nahe der engen und steilen Treppe, die zu den Mägdekammern führte; diese Lage des Zimmers erfüllte ihn mit besonderer Befriedigung.
»Mein Sekretär!« hatte er Balbi dem Wirt vorgestellt.
»Die Polizei«, sagte dieser entschuldigend, »ist auch bei uns sehr streng. Sie wird gleich dasein. Jeder Fremde steht unter Kontrolle.«
»Sag ihnen«, versetzte er nachlässig, »daß ein vornehmer Gast bei dir eingekehrt ist. Ein Herr …«
»Ja, aber ich bitte«, drängte der Wirt und verbeugte sich, die Troddelmütze in der Hand, untertänig und voller Neugierde.
»Ein Herr aus Venedig«, ergänzte er in einem Ton, als wäre dies ein außerordentlicher Titel oder eine besondere Würde. Bei der Betonung dieser Worte hatte sogar Balbi aufgehorcht.
Dann schrieb er mit spitzen Buchstaben und geübter Hand seinen Namen ins Gästebuch. Der Wirt wurde rot vor Aufregung; er rieb sich die Schläfe mit seinen dicken Fingern und wußte nicht, ob er die Polizei holen oder auf die Knie fallen und ihm die Hände küssen sollte. Er war in großer Verlegenheit und schwieg.
Endlich zündete er die Lampe an und geleitete seine Gäste ins Stockwerk hinauf. Die Mägde machten schon die Zimmer zurecht; sie brachten Kerzen in vergoldeten Leuchtern, warmes Wasser in einem silbernen Krug und Handtücher aus Limburger Leinen. Er begann sich langsam zu entkleiden, wie ein König inmitten seiner Höflinge. Die schmutzigen Kleidungsstücke reichte er einzeln dem Wirt und den Mägden; die von geronnenem Blut befleckte, an der Haut klebende Seidenhose mußte mit der Schere an den Nähten aufgetrennt werden. In einen Lehnstuhl hingesunken, stellte er seine Füße in die silberne Waschschüssel, halbtot vor Erschöpfung. Zuweilen nickte er für einige Minuten ein, murmelte vor sich hin und schrie im Traum auf. Balbi, der Wirt und die Mägde standen mit offenem Mund um ihn herum; sie bereiteten das Bett, zogen die Vorhänge zu und löschten fast alle Kerzen. Zur Essenszeit pochten sie lange an seine Tür.
Als er gegessen hatte, schlief er sofort wieder ein und rührte sich nicht bis zum nächsten Mittag, schlief mit entspanntem, ungerührtem Gesicht wie ein Toter.
»Ein vornehmer Herr«, sagten die Mägde und gingen kichernd und miteinander tuschelnd an ihre Arbeit in Küche und Keller; sie wuschen den Wagen, sie spülten Geschirr, spalteten Kleinholz und bedienten in der Trinkstube; sie sprachen leiser als sonst, legten den Finger an den Mund, kicherten, wurden wieder ernst und verbreiteten wichtigtuerisch die große Neuigkeit: ein Herr, jawohl, ein Herr aus Venedig.
Am Abend fanden sich zwei Geheimpolizisten ein; sein Name, dieser verdächtige, interessante und gefährliche Name, den das große Abenteuer und die Kunde von seiner Flucht aufs neue vergoldet hatte, lockte in jeder Stadt die Geheimpolizei an. »Schläft er? Hat er kein Gepäck?«
»Einen Dolch«, sagte der Wirt. »Mit einem Dolch kam er an. Das ist sein ganzes Hab und Gut.«
»Ein Dolch«, wiederholten sie mit sachverständigem Interesse, »was für ein Dolch?«
»Ein venezianischer Dolch«, betonte voll Andacht der Wirt.
»Sonst hat er nichts?« forschten sie weiter.
»Nein«, versicherte der Wirt, »sonst hat er nichts. Der Dolch ist alles, was er besitzt.«
Das überraschte die Polizisten. Sie hätten sich nicht gewundert, wenn er mit reicher Beute angekommen wäre, mit Edelsteinen und gefüllten Taschen, mit Halsketten und Ringen, die er unterwegs von den Fingern leichtgläubiger Frauen gestreift hatte.
Sein Ruf eilte ihm voraus wie ein Herold, der seinen Namen ausrief.
Der Prälat hatte schon am Morgen zum Polizeichef geschickt und um Ausweisung des berüchtigten Gastes gebeten. In Tirol und in der Lombardei sprach man schon morgens nach der Messe und abends in den Schenken von seiner abenteuerlichen Flucht.
»Beobachte ihn genau«, mahnten die Polizisten. »Jedes seiner Worte müssen wir kennen. Ob er Briefe bekommt und von wem? Ob er Briefe schreibt und an wen? Achte auf jede Bewegung. Es scheint«, sagten sie leiser und wölbten ihre Hände zu Trichtern, um es dem Wirt ins Ohr zu flüstern, »es scheint, daß er einen Gönner hat. Auch der Herr Prälat kann nichts gegen ihn ausrichten.«
»Vorläufig«, nickte verständnisvoll der Wirt.
»Vorläufig«, echoten die Schergen düster.
Sie entfernten sich auf den Fußspitzen, sorgenvoll und mit ernsten Gesichtern. Der Wirt setzte sich in die Trinkstube und seufzte. Ihm gefielen solche erlauchten Gäste nicht, die das Interesse des Prälaten und der Polizei auf sich zogen. Er dachte an die Augen des Gastes, an das dunkle Feuer, an die heimliche Glut, die in diesen Augen flackerte, und er hatte Angst. Er dachte an den Dolch, an den venezianischen Dolch, der das einzige Gepäckstück seines Gastes war, und hatte Angst. Er dachte an den üblen Ruf, der den Gast umgab, und begann leise zu fluchen.
»Therese!« rief er zornig.
Ein Mädchen, schon in Nachtkleidung, trat ein. Sie war sechzehn Jahre alt, hielt in einer Hand die brennende Kerze und raffte mit der anderen ihr Hemd über der Brust zusammen.
»Hör zu«, sagte der Wirt leise und zog das Mädchen auf seine Knie. »Ich vertraue nur dir. Wir haben einen gefährlichen Gast bekommen, Therese. Dieser Herr …«
»Aus Venedig?« fragte das Mädchen in kindlichem, singendem Ton.
»Aus Venedig, aus Venedig«, bestätigte er gereizt. »Aus dem Kerker. Aus der Gesellschaft der Ratten. Vom Fuße des Galgens. Hör zu, Therese. Achte auf jedes seiner Worte. Halte deine Ohren und Augen immer am Schlüsselloch. Du weißt, ich liebe dich wie meine Tochter, du bist ja mein Pflegekind; doch wenn er dich zu sich ins Zimmer ruft, ziere dich nicht. Du bringst ihm auch das Frühstück. Bewahre deine Tugend und sei wachsam.«
»Ja«, flüsterte das Mädchen.
Dann ging sie hinaus, schlank und schattenhaft, die brennende Kerze in der Hand.
In der Tür sagte sie klagend, mit gedehnter Stimme: »Ich habe Angst.«
»Ich auch«, sagte der Wirt. »Jetzt geh schlafen. Doch zuvor bring mir noch Rotwein.«
In dieser ersten Nacht schliefen sie alle schlecht.
Die Nachricht
Sie schliefen unruhig, stöhnten und ächzten, schreckten häufig auf und hatten das Empfinden, als drohe ihnen Unheil. Sie glaubten Schritte zu hören, als schliche jemand um das Haus. Dann wieder war es, als spräche sie jemand an und sie müßten antworten, wie sie noch nie im Leben geantwortet hatten. Die Frage, die der Fremde an sie richtete, war hochfahrend und unverschämt, über die Maßen furchterregend und doch traurig. Aber als sie am Morgen erwachten, vermochten sie sich an die Frage nicht mehr zu erinnern.
Während sie schliefen, verbreitete sich die Nachricht, daß er eingetroffen sei, den Bleikammern entronnen und am hellichten Tage aus seiner Geburtsstadt Venedig geflohen; daß er den hohen und gefürchteten Herren der Inquisition ein Schnippchen geschlagen und Lorenzo, den Kerkermeister, hinters Licht geführt habe; daß er dem ausgestoßenen Klosterbruder zur Flucht verholfen habe und aus der Zwingburg der Dogen hinausspaziert sei; man habe ihn in Mestre gesehen, als er mit dem Postkutscher feilschte, und in Treviso, wo er in einem Kaffeehaus Wermut trank; ein Bauer schwor, gesehen zu haben, wie er die Kühe auf den Feldern verzauberte. Die Kunde drang in die Paläste Venedigs und in die Schenken der Vorstädte; die Kardinäle und Senatoren, die Henker und die Schergen, die Spione und die Spieler, die Liebhaber und die Ehemänner, die Jungfern in der Kirche, die Frauen im warmen Bett, sie alle lachten laut und riefen »Hoho!« oder schrien aus vollem Halse »Haha!«, oder sie erstickten ihr Kichern in den Kopfkissen. Alle freuten sich über die gelungene Flucht. Am Abend des nächsten Tages wurde die Neuigkeit dem Papst zugetragen; er erinnerte sich an den Flüchtigen und auch daran, daß er ihn persönlich mit einem niederen päpstlichen Orden ausgezeichnet hatte. Auch er lachte. Immer weiter flog die Nachricht; in Venedig besprachen die Gondolieri, auf die langen Riemen gestützt, sachkundig jede Einzelheit der Flucht und freuten sich, daß es ihm geglückt war, zu entkommen. Sie freuten sich, weil er Venezianer war und die Mächtigen überlistet hatte, sie freuten sich, weil einer stärker war als Steine, Ketten und Bleidächer. Sie sprachen leise, spuckten ins Wasser und rieben sich zufrieden die Hände. Die Nachricht flog weiter, und den Menschen wurde warm ums Herz.
Was hatte er denn so Schweres verbrochen? fragten sie. – Er hatte Karten gespielt, du lieber Gott, vielleicht mit nicht ganz reinen Händen, hatte die Bank in Spielhöllen gehalten und sich insgeheim mit einer Maske vorm Gesicht an den Banken berufsmäßiger Spieler beteiligt! Aber wer tat das nicht in Venedig? … Und daß er des Nachts jene verprügelte, die ihn verrieten? Daß er die Frauen aus der Stadt in sein Liebesnest nach Murano lockte? Aber welcher junge Mann lebte in Venedig anders, solange es ging? – War er frech, spitzzüngig und redselig? – Doch wo waren jene, die schwiegen in Venedig?
So schwatzten sie und waren vergnügt. Es war etwas Gutes in dieser Nachricht, eine Art Genugtuung, etwas Herzerwärmendes. Denn jeder fühlte sich von der Inquisition bedroht und fürchtete die Bleikammern; jetzt hatte einer gezeigt, daß er stärker war, stärker als Bleidächer und Häscher, stärker als Messer Grande, der Bote des Henkers. Die Kunde flog weiter, und in den Polizeiämtern stürzte man sich nervös auf die Akten, die Polizeigewaltigen schrien, mit roten Ohren verhörten die Richter die Angeklagten und verhängten zornerfüllt Kerkerstrafen, Ächtung, Galeere und Strick.
In den Kirchen sprach man von ihm, nach der Messe wurde gegen ihn gepredigt, denn er vereinigte alle sieben Todsünden in seinem verruchten Körper, der nach den Worten des Predigers dereinst in der Hölle in einem besonderen Kessel, über einem besonderen Feuer sieden würde, bis ans Ende aller Zeiten. Sogar im Beichtstuhl wurde sein Name geflüstert; kniende Frauen, den Kopf tief geneigt, stammelten ihn hinter dem Gebetbuch, schlugen sich an die Brust und gelobten Buße. Jedermann freute sich, als ob sich in Venedig und überall in den Städten und Dörfern, die er durchquert hatte, Gutes ereignet hätte.
Man schlief und lächelte im Traum; wo er hinkam, wurden die Fenster und Türen zur Nachtzeit sorgfältiger verschlossen, und hinter den verschlossenen Fensterläden warnten die Ehemänner ihre Frauen. Es war, als ob Gefühle, die gestern noch Asche und Glut waren, nun aufloderten. Die Kühe hatte er nicht verzaubert, doch die Hirten waren sich einig, daß es in diesem Jahr mehr und schönere Kälber geben würde. Die Frauen erwachten, holten in bauchigen Holzeimern Wasser vom Brunnen, machten Feuer im Herd, wärmten die Milch und legten Obst in irdene Schalen; sie stillten die Kinder, gaben den Männern das Essen, fegten die Stuben, machten die Betten und lächelten dabei. Dieses Lächeln schwand lange nicht von den Gesichtern in Venedig, in Tirol und in der Lombardei. Es verbreitete sich immer weiter, flog über die Grenzen und drang bis nach München und Paris. Man erzählte dem König im Hirschpark die Geschichte der Flucht, und auch er lächelte. Man erfuhr davon in Parma und Turin, in Wien und in Berlin. Und überall lächelte man. Die Schergen und die Richter, die Wächter und Häscher, sie alle waren in diesen Tagen voller Argwohn und strenger als sonst. Denn es gibt nichts Gefährlicheres als einen Mann, der sich der Tyrannei widersetzt.
Sie wußten, daß er nichts besaß als einen Dolch, doch sie verstärkten die Wachen an den Grenzen. Sie wußten, daß er keine Komplizen hatte, und trotzdem arbeitete der Generalsekretär der Inquisition einen ganzen Kriegsplan aus, um seiner wieder habhaft zu werden, ihn zurückzulocken, lebend oder tot, mit Gold oder Gewalt, koste es, was es wolle. Als seine Flucht dem Dogen gemeldet wurde, schlug der untersetzte Herr mit dem stechenden Blick die beringte Hand auf den Tisch und versprach den Kerkermeistern die Galeere. Die Senatoren rafften mit feingliedrigen vergilbten Fingern den Aufschlag ihres dunklen Seidenmantels über der Brust zusammen, saßen stumm in den großen Sälen, betrachteten aus zusammengekniffenen Augen mit nichtssagendem Blick die Deckengemälde und Balken des Ratssaals im Dogenpalast, stimmten den verschärften Regeln zu, zuckten die Achseln und schwiegen.
Doch das Lächeln breitete sich weiter aus wie ein Fieber; die Frau des Bäckers wurde angesteckt, die Schwester des Goldschmieds und sogar die Tochter des Dogen. Waren die Leute unter sich in sorgsam verschlossener Stube, so schlugen sie sich vor Freude auf den Bauch und lachten von einem Ohr zum anderen. Es lag ein grimmiger Trost darin, daß ein Venezianer trotz meterdicker Mauern, trotz der Wachsamkeit der Wächter, trotz armdicker Ketten hatte entfliehen können. Die Leute gingen ihren Geschäften nach, standen auf dem Markt herum und tranken Veroneser Wein in den Kneipen; die Wucherer wogen Goldstaub auf haarfeinen Waagen, die Apotheker pantschten ihre Abführmittel und Liebestränke und brauten schnell wirkende Gifte, die man, zu trockenem Pulver zerrieben, hinter dem Stein des Siegelrings verbergen konnte; dickbäuchige Marktweiber standen breitspurig hinter den mit Fischen, Obst, Fleisch und wohlriechenden Kräutern beladenen Verkaufstischen, Weißwarenhändler stellten in parfümierten Saffiankassetten die eben eingetroffenen Lyoner Strümpfe und die in Brügge gehäkelten Busenleibchen aus, und zwischen Arbeit und Schwatz, Geschäft und Amt wandte sich jeder für einen Augenblick ab und lachte verstohlen hinter der vorgehaltenen Hand.
Die Frauen fühlten, daß diese Flucht und alles, was damit zusammenhing, ein wenig auch in ihrem Interesse geschehen war; sie hatten keine bestimmte Erklärung hierfür, sie waren eben Frauen, vor allem Venezianerinnen, die nicht gegen ihr Gefühl angingen, sondern die stumme Beweisführung anerkannten, die ihnen das Herz, das Blut und die Leidenschaft in die Ohren raunten. Es war, als wäre aus Märchen und Sagen, aus Büchern und Erinnerungen, aus Träumen und aus jener Leidenschaft, die bei Mann und Frau der geheime, unschickliche und doch so wahre zweite Inhalt des Lebens ist, jemand ohne Maske, Perücke und Puder in unverhüllter Nacktheit hervorgetreten: Die Frauen blickten ihm nach, hoben den Fächer vor Mund und Augen, neigten ein wenig den Kopf und blieben stumm; doch ihre Augen, die dem Flüchtigen mit verschleiertem Blick folgten, sagten: »Ja, ja.« Und ein paar Tage lang war ihnen, als wäre die kleine Welt, in der sie lebten, von Zärtlichkeit erfüllt. Des Abends standen sie an den Fenstern und auf den Balkonen über den Kanälen, den Spitzenschleier über dem Haar, den Seidenschal auf den Schultern, und sahen auf das öligtrübe Wasser hinab, auf dem die Gondeln leicht und gleichmütig dahinglitten; sie erwiderten Blicke, auf die sie gestern noch nicht reagiert hätten, ließen ein Taschentuch fallen, das unten über dem Wasserspiegel von einer flinken braunen Hand aufgefangen wurde, drückten eine Blume an ihre Lippen und lächelten. Dann schlossen sie die Fenster, und in den Zimmern erloschen die Lichter. Doch in den Herzen und Mienen, in den Augen der Frauen und in den Blicken der Männer strahlte etwas in diesen Tagen, als hätte jemand ein geheimes Zeichen gegeben, daß ihr Leben schrankenloser und leidenschaftlicher sei, als sie bisher geglaubt hatten. Und für einen Augenblick verstanden sie dieses Zeichen und lächelten einander zu.
Aber diese geheime Verbundenheit war nicht von Dauer: Die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze des Lebens sorgten dafür, daß die Erinnerung an den Flüchtling bald aus den Herzen der Menschen getilgt wurde. Schon nach wenigen Wochen hatte man ihn in Venedig wieder vergessen. Nur Messer Bragadin, sein gütiger und milder Schirmherr, und einige Frauen, denen er ewige Treue geschworen hatte, sowie etliche Wucherer und Pächter von Spielbanken, denen er Geld schuldete, erinnerten sich seiner weiterhin.
»Ein Mann«
So war seine Flucht, und so sprach man in Venedig noch eine Zeitlang von ihm. Bald aber hatte die Stadt wieder andere Sorgen und vergaß ihren rebellischen Sohn. Zur Faschingszeit befaßte man sich nur mehr mit einem Grafen B., der eines Morgens, in Maske und schwarzem Domino, erhängt vor dem Haus des französischen Botschafters aufgefunden wurde. Denn Venedig war undankbar.
Der Flüchtling aber schlief noch in Bozen, in einem der Zimmer des Gasthofs »Zum Hirschen« hinter geschlossenen Fensterläden; und da er nach sechzehn Monaten zum erstenmal in einem richtigen Bett lag, bequem und sorglos, hatte er sich ganz der tiefen Seligkeit des Schlafes hingegeben. Quer über das breite Bett hingestreckt, schlief er leidenschaftlich, mit wirrem Haar und gespreizten Armen und Beinen, ein verächtliches, müdes Lächeln auf den Lippen, als fühlte er, daß man ihn durch das Schlüsselloch beobachtete.
Denn man belauschte ihn, und das kam so: Zuerst sah Therese, die Pflegetochter des Wirtes, die als entfernte Verwandte den Dienst einer Magd im Haus versah, durch das Schlüsselloch. Sie war schon erwachsen und, wie die Verwandten meinten, von guter Statur, aber etwas einfältig. Doch darüber sprach man nicht viel. Auch Therese selbst sprach nicht viel. Man nannte sie einfältig und hielt es nicht für nötig, diese Ansicht zu begründen; sie galt weniger im »Hirschen« als der kleine weiße Esel, der jeden Morgen mit dem Wagen zum Markt fuhr; sie war die arme Verwandte im Haus, die für jeden da war, um die sich niemand kümmerte und die auch keine Entlohnung erhielt. Sie ist beschränkt, sagten die Leute; und in den dunklen Gängen wurde sie von den einquartierten Soldaten und durchreisenden Kaufleuten in Wangen und Arme gekniffen. Sie hatte ein sanftes Gesicht, um ihren Mund lag ein herber Zug; die vom Geschirrspülen geröteten Hände waren schön geformt, und in ihren Augen schimmerte eine stille Frage, die zugleich andachtsvoll war, auf die man keine Antwort wußte, der man aber auch nicht ausweichen konnte; alles in allem war sie mit ihrem schmalen Gesicht und den fragenden Augen recht unbedeutend. Es lohnte sich nicht, viel von ihr zu sprechen.
Nun kniete sie vor dem Schlüsselloch und betrachtete den Schlafenden. Die Hände hatte sie, um besser zu sehen, an die Schläfen gelegt, auch der Rücken und die starken Hüften waren angespannt, als ob sie mit dem ganzen Körper durchs Schlüsselloch spähte. Was sie sah, war nicht sonderlich interessant. Sie hatte schon vieles durch das Schlüsselloch gesehen. Seit ihrem zwölften Jahr diente sie im »Hirschen«; sie trug das Frühstück auf die Zimmer und machte morgens und abends die Betten zurecht, in denen fremde Männer und Frauen, zusammen oder getrennt, geschlafen hatten. Sie hatte viel gesehen und sich über nichts gewundert. Sie begriff, daß die Menschen nun einmal so waren: Die Frauen saßen lange vor dem Spiegel, die Männer, selbst die Soldaten, puderten ihre Perücken oder kürzten und polierten ihre Nägel; sie seufzten oder lachten, sie weinten und schlugen mit der Faust gegen die Wand, sie kramten Kleidungsstücke und Briefe hervor und benetzten diese sinnlosen Dinge mit ihren Tränen.
So zeigten sich die Menschen durchs Schlüsselloch, wenn sie allein im Zimmer waren. Doch dieser hier war anders. Da schlief er jetzt in dem großen Bett, mit ausgebreiteten Armen, als hätte man ihn ermordet. Sein Gesicht war ernst und häßlich. Es war ein Gesicht bar jeder Schönheit und Gefälligkeit, die Nase groß und fleischig, die Lippen schmal und streng, das Kinn spitz und brutal. Er war klein, und nach den sechzehn langen Monaten der Bewegungslosigkeit im Kerker hatte er einen Ansatz von Bauch. Ganz unbegreiflich, dachte Therese aufgeregt und mit roten Ohren.
Was mögen die Frauen wohl an ihm lieben? Denn nachts in der Trinkstube und morgens auf dem Markt, in den Läden und Schenken und überall in der Stadt sprach man von ihm; daß er gekommen sei, abgerissen und blutig, mit einem Dolch, ohne Geld und mit einem Sekretär, der in der Nebenzelle eingelocht gewesen war. Es sei besser, gar nicht davon zu sprechen. Aber man sprach von ihm. Man sprach sogar auffallend viel von ihm und wollte alles wissen. Wie alt er wäre, ob blond oder braun, und wie seine Stimme? Man sprach von ihm, als wäre ein berühmter Sänger angekommen oder ein Athlet.
Was der da wohl kann? dachte Therese und drückte die Nase an die Tür und das Auge ans Schlüsselloch. Der Mann, der dort mit ausgestreckten Armen und Beinen im Bett lag, war wirklich nicht schön. Therese dachte an Giuseppe, den Barbier; der hatte ein rosiges Gesicht, einen weichen Mund und blaue Augen wie ein Mädchen. Der war schön. Er kam oft in den »Hirschen«, und wenn Therese ihn ansprach, wurde er rot und schlug die Augen nieder. Und der Hauptmann aus Wien, der während des Sommers hier gewohnt hatte, der war schön; sein pomadisiertes Haar war gelockt und der Schnurrbart spitz aufgezwirbelt; er trug Stiefel und einen breiten Säbel, an dem eine Tasche hing, und sprach eine ganz fremde, wilde Sprache, die sie nicht verstehen konnte. Später hatte ihr jemand gesagt, daß es Ungarisch sei, vielleicht aber auch Türkisch. Sie wußte es nicht mehr. Auch der Herr Prälat war schön, mit dem weißen Haar und den feinen Händen, mit seiner roten Schärpe und dem lila Käppchen. Von Männerschönheit meinte Therese doch etwas zu verstehen. Dieser Mann da aber war ganz bestimmt nicht schön; er war eher häßlich und durchaus anders als die Männer, die den Frauen gefielen. Auf dem unrasierten Gesicht des Fremden trat jetzt, während er schlief, der harte und gleichgültige Zug um den Mund, der ihr schon gestern aufgefallen war, noch deutlicher hervor; als hätte der Kampf der Leidenschaft die Muskeln um seinen Mund verhärtet. Jetzt stöhnte er im Schlaf. Therese erhob sich rasch, eilte zum Fenster, stieß die Fensterläden auf und gab mit ihrem Wischlappen ein Zeichen.
Denn die Frauen vom Obstmarkt vor dem »Hirschen« wollten ihn sehen; Therese hatte Lucia und Gretl, den Blumenverkäuferinnen, und der alten Helene, der Gemüsehändlerin, und Nannette, der traurigen Witwe, die gestrickte Strümpfe verkaufte, versprochen, sie heraufzurufen und ihnen, wenn es anging, den Schläfer durch das Schlüsselloch zu zeigen. Sie wollten ihn um jeden Preis sehen. Auf dem Obstmarkt ging es diesen Morgen besonders lebhaft zu; der Apotheker stand gegenüber in seiner Tür und unterhielt sich lange mit Balbi, dem Sekretär; er bewirtete ihn mit Branntwein und wollte immer neue Einzelheiten der Flucht von ihm hören. Der Bürgermeister und der Arzt, der Steuereinnehmer und der Stadthauptmann, alle kehrten an diesem Vormittag in der Apotheke ein, lauschten den Erzählungen Balbis, schielten nach den Fenstern des ersten Stocks im »Hirschen« und benahmen sich aufgeregt und unsicher, da sie nicht wußten, ob sie den Fremden mit einem nächtlichen Fackelzug und Musik feiern oder ihn kurzerhand aus der Stadt weisen sollten, wie es der Schinder mit den räudigen und tollwutverdächtigen Hunden machte. Darüber konnten sie sich weder an diesem Vormittag noch während der folgenden Tage schlüssig werden. Darum schwatzten sie bloß in der Apotheke und hörten Balbi zu, der, aufgebläht von Eitelkeit und Stolz, die berühmte Flucht, aus der inzwischen ein Heldenepos geworden war, jede halbe Stunde auf andere Art erzählte; sie schielten zu den geschlossenen Fensterläden des »Hirschen« hinauf und spazierten vor den Zelten des Obstmarktes und den vornehmen Verkaufsständen der benachbarten Gebäude auf und ab. Sie waren unruhig und besorgt, wie es gewissenhaften Bürgern geziemt, die für Ordnung in den Häusern, Straßen und Seelen verantwortlich sind und die Stadt vor Wasser, Feuersgefahr und feindlichem Angriff zu schützen haben. Doch jetzt wußten sie nicht, ob sie lachen oder die Polizei in Bewegung setzen sollten. Darüber wurde es Mittag, die Marktweiber packten ihre Waren zusammen, und die Bürger gingen zum Mittagessen.
Zu dieser Stunde erwachte der Fremde. Therese ließ die Frauen in den halbdunklen Salon eintreten. »Nun, wie sieht er aus?« flüsterten sie, zerknüllten den Saum ihrer Schürzen und preßten die Faust vor den Mund. So standen sie im Halbkreis vor der Tür, die zum Schlafraum führte. Es gruselte sie angenehm, und sie unterdrückten ein Quieken, als hätte man sie in die Seite gekniffen. Therese hob den Zeigefinger an den Mund. Als erste nahm sie Lucia, die braunäugige dicke Marktschönheit, an der Hand und führte sie vor die Tür. Lucia hockte sich nieder – ihr Rock blähte sich wie eine Glocke über dem Boden – und preßte das linke Auge an das Schlüsselloch; dann erhob sie sich mit rotem Kopf und einem leisen Schrei und machte das Zeichen des Kreuzes.
»Was hast du gesehen?« fragten die anderen flüsternd und rückten zusammen wie Krähen, die sich auf einem Ast niederlassen.
Die Braunäugige besann sich: »Einen Mann«, sagte sie dann leise und erregt.
Diese Antwort ließ die Frauen für einen Augenblick verstummen. Sie erschien töricht, aber dennoch lag etwas Außergewöhnliches und Beängstigendes darin. Mein Gott, einen Mann, dachten sie, hoben den Blick zur Decke und wußten nicht, ob sie lachen oder davonlaufen sollten. »Einen Mann, na und?« sagte Gretl. Und die alte Helene schlug mit fast andachtsvoller Gebärde die Hände zusammen, und ihr zahnloser Mund stammelte voller Anerkennung und Demut: »Einen Mann!« Nannette, die Witwe, sah zu Boden und wiederholte ernst mit leiser Stimme, in der die Erinnerung mitschwang: »Einen Mann!« So sannen sie einen Augenblick vor sich hin, dann kicherten sie, knieten der Reihe nach vor dem Schlüsselloch, spähten in das Zimmer und fühlten sich unsagbar wohl dabei. Am liebsten hätten sie Kaffee gekocht, sich mit den Kaffeeschalen in der Hand um den Tisch mit den vergoldeten Beinen gesetzt und so in Feiertagsstimmung den fremden Mann erwartet.
Sie waren stolz, und ihr Herz pochte heftig, denn sie hatten den Fremden gesehen, und nun konnten sie von ihm auf dem Markt und in der Stadt, daheim und am Brunnen erzählen. Sie waren stolz und zugleich unruhig, besonders Nannette, die Witwe, und Lucia, die Neugierige, und auch Gretl, die Dummdreiste, als wäre es etwas Außergewöhnliches und Wunderbares, daß ein Mann in diese Stadt gekommen war. Sie wußten wohl, daß ihre Aufregung einfältig und sinnlos war, fühlten aber gleichzeitig, daß sie nicht nur unschicklicher Neugier entsprang. Es war, als hätten sie nun wahrhaftig einen Mann durch das Schlüsselloch gesehen und als würden im gleichen Augenblick, als sie den schlafenden Fremden sahen, ihre Gatten und Liebhaber und alle Männer, die sie kannten, einer besonderen Prüfung unterworfen. Es schien fast, als ob ein Mann, der weder schön noch stattlich war und von dem man nichts wußte, als daß er ein berüchtigter Spieler und Glücksritter war, der vielleicht auch einen falschen Namen trug und der wie die meisten Schürzenjäger im Ruf stand, im Verkehr mit Frauen frech und selbstsicher zu sein – daß eine solche Erscheinung dennoch eine Seltenheit wäre.
Sie waren Frauen und fühlten das. Ist denn ein Mann etwas so Seltenes? fragten sich die Frauen von Bozen. Und der Schlag ihres Herzens, den man nicht mißverstehen konnte, gab die Antwort: Ja, etwas ganz Seltenes.
Denn die Männer, das fühlten sie in diesem Augenblick undeutlich, waren Väter, Ehegatten oder Liebhaber, und gern betonten sie ihre Männlichkeit, rasselten mit dem Säbel, renommierten mit ihrem Adel, ihrer Würde oder ihrem Vermögen und liefen jedem Rock nach. So waren sie in Bozen und auch anderswo, wenn man den Leuten glauben mochte. Doch von diesem hier sprach man anders. Die Männer taten gern wichtig, sie schwadronierten, und manchmal krähten sie vor Hochmut wie die Hähne; es war oft lächerlich. Dabei waren die meisten zu Hause grämlich und kindisch oder einfältig und gierig.
Nun wußten sie, daß Lucia die Wahrheit gesprochen hatte; der, den sie gesehen hatten, war wirklich ein Mann. Einer, der ganz und gar Mann war, nur das und nichts anderes, wie die Eiche nur Eiche ist und ein Felsen nur Fels. Dies fühlten sie und staunten einander mit runden Augen und halbgeöffnetem Mund an und sannen aufgescheucht darüber nach. Sie fühlten es, weil sie ihn mit eigenen Augen gesehen hatten, weil das Zimmer, das Haus und die Stadt erfüllt waren von der Spannung und Erregung, welche die Gegenwart des Fremden ausströmte; sie begriffen, daß ein echter Mann eine ebenso seltene Erscheinung war wie eine echte Frau. Er war ein Mann, der nicht mit lauten Worten und Säbelgerassel daherkam, der nicht wie ein Gockel krähte und keine Zärtlichkeit begehrte, die er nicht selbst geben konnte; der in der Frau nicht die Mutter und Freundin suchte, der sich nicht in die Arme der Liebe flüchtete und sich nicht hinter Weiberröcken verkroch; ein Mann, der nur geben und nehmen wollte, ohne Eile und Hast, weil sein ganzes Leben, jeder Funke seines Bewußtseins, jeder Nerv und jeder Muskel seines Körpers dem Genuß des Lebens hingegeben war: Ein solcher Mann ist etwas ganz Seltenes.
Ende der Leseprobe