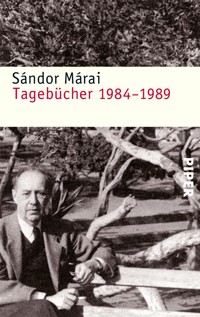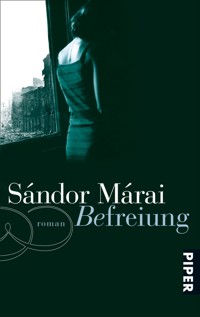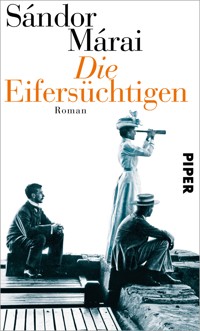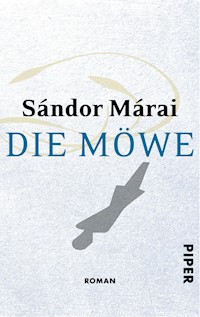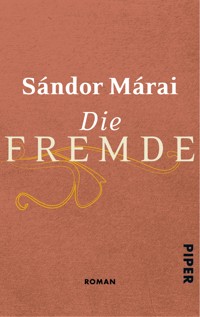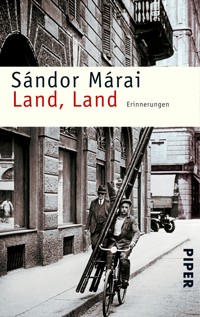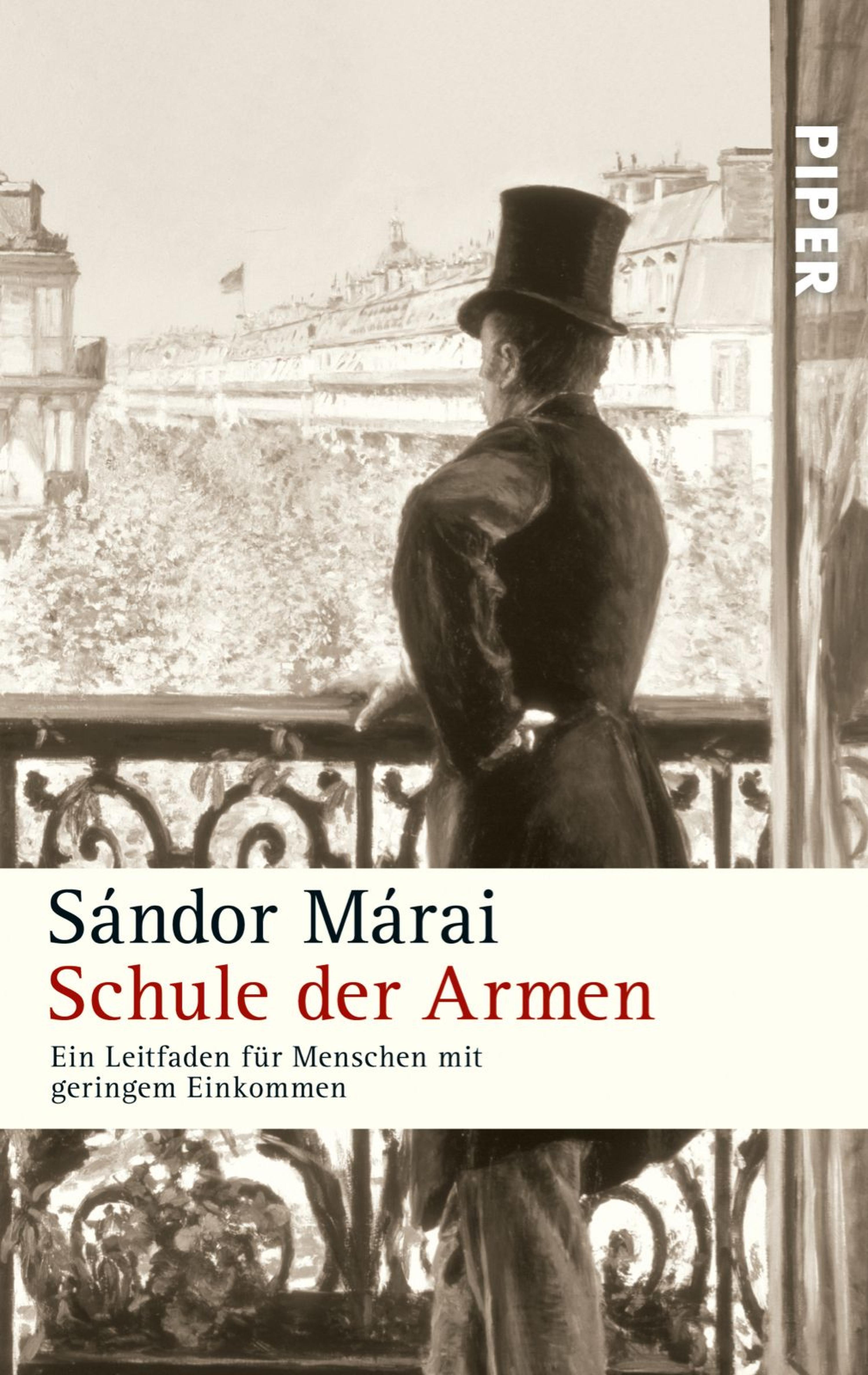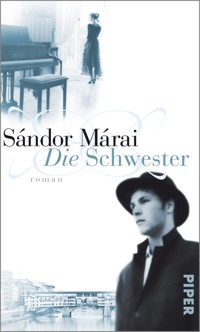9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Darauf hat Henrik über 40 Jahre gewartet: Sein Jugendfreund Konrád kündigt sich an. Nun kann die Frage beantwortet werden, die Henrik seit Jahrzehnten auf dem Herzen brennt: Welche Rolle spielte damals Krisztina, Henriks schöne junge Frau? Warum verschwand Konrád nach jenem denkwürdigen Jagdausflug Hals über Kopf? Eine einzige Nacht haben die beiden Männer, um den Fragen nach Leidenschaft und Treue, Wahrheit und Lüge auf den Grund zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95047-3 © 1998 Heirs of Sándor Márai, Csaba Gaal, Toronto Titel der ungarischen Originalausgabe: »A gyertyák csonkig égnek«, Budapest 1942 Neuausgabe: Helikon Kiadó, Budapest 1990 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2015 Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: Musee d'Orsay, Paris, France/Bridgeman Images Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Nachwort
Guide
1
Am Vormittag hielt sich der General lange in seinen Kellereien auf. Er war in der Morgenfrühe mit seinem Winzer hingegangen, um nach zwei Fässern zu sehen, in denen der Wein zu gären begonnen hatte. Als er mit dem Abfüllen fertig war und nach Hause kam, war es schon elf Uhr vorbei. Zwischen den Säulen der Veranda, die von den feuchten Steinplatten moderig roch, stand sein Jäger und überreichte ihm einen Brief.
»Was willst du?« fragte der General unwirsch. Er schob sich den Strohhut, dessen breite Krempe sein rotes Gesicht beschattete, aus der Stirn. Schon seit etlichen Jahren öffnete und las er keine Briefe mehr. Die Post wurde im Büro des Gutsverwalters von einem der Angestellten aufgemacht und sortiert.
»Das hat ein Bote gebracht«, sagte der Jäger und stand stramm.
Der General erkannte die Schrift, nahm den Brief und steckte ihn in die Tasche. Er trat in die kühle Vorhalle und reichte dem Jäger wortlos Stock und Hut. Aus seiner Zigarrentasche holte er eine Brille hervor, stellte sich ans Fenster und begann im Licht, das durch die Ritzen der Rollläden hereinsickerte, den Brief zu lesen.
»Warte«, sagte er über die Schulter hinweg, als der Jäger mit Stock und Hut gehen wollte.
Den Brief stopfte er sich in die Tasche.
»Kálmán soll auf sechs Uhr anspannen. Den Landauer, denn es gibt Regen. Und er soll die Paradelivree anlegen. Du auch«, sagte er mit unerwartetem Nachdruck, als hätte ihn plötzlich etwas erbost. »Und alles auf Hochglanz. Wagen und Geschirr sollen unverzüglich geputzt werden. Die Livree anlegen, hast du verstanden? Und dann setzt du dich neben Kálmán auf den Bock.«
»Jawohl, gnädiger Herr«, sagte der Jäger und schaute seinem Herrn gerade in die Augen. »Auf sechs Uhr.«
»Um halb sieben fahrt ihr los«, sagte der General und bewegte lautlos die Lippen, als zählte er. »Du meldest dich beim Weißen Adler und sagst nur, ich hätte dich geschickt, und der Wagen für den Herrn Hauptmann sei da. Wiederhole.«
Der Jäger wiederholte. Daraufhin hob der General die Hand, als wäre ihm noch etwas eingefallen, und blickte zur Decke. Doch dann sagte er nichts, sondern ging in den ersten Stock hinauf. Der Jäger, in Habachtstellung erstarrt, sah ihm glasigen Blickes nach und wartete, bis die untersetzte, breitschultrige Gestalt hinter der Kehre der steinernen Balustrade verschwunden war.
Der General ging in sein Zimmer, wusch sich die Hände und trat an sein schmales, hohes Stehpult, das mit tintenfleckigem grünen Filz bezogen war und auf dem Federn, Tinte und, millimetergenau aufeinandergestapelt, Hefte lagen, wachstuchbezogene mit Pepitamuster, wie sie die Schüler für ihre Aufgaben verwenden. In der Mitte des Pults stand eine Lampe mit grünem Schirm, die der General anschaltete, da es im Zimmer dunkel war. Hinter den geschlossenen Läden, im vertrockneten, verdorrten, versengten Garten, tobte der Sommer in einem letzten Auflodern, wie ein Brandstifter, der in sinnloser Wut die Felder anzündet, bevor er sich davonmacht. Der General nahm den Brief hervor, glättete das Blatt sorglich und las im starken Licht, die Brille auf der Nase, die geraden kurzen Zeilen mit den spitzen Buchstaben. Die Arme verschränkte er auf dem Rücken.
An der Wand hing ein Kalender mit faustgroßen Datumsziffern. Vierzehnter August. Der General blickte zur Decke und rechnete. Vierzehnter August. Zweiter Juli. Er rechnete aus, wieviel Zeit seit einem langverflossenen Tag und dem heutigen vergangen war. Einundvierzig Jahre, sagte er schließlich halblaut. In letzter Zeit sprach er laut, auch wenn er allein im Zimmer war. Vierzig Jahre, sagte er dann verwirrt. Einem Schüler gleich, der über einer schwierigen Lektion durcheinandergerät, errötete er, legte den Kopf in den Nacken und schloß die tränenden Augen. Sein Hals über dem maisgelben Jackenkragen schwoll rot an. Zweiter Juli achtzehnhundertneunundneunzig, da war die Jagd, murmelte er und verstummte. Wie ein büffelnder Student stützte er die Ellenbogen auf das Pult und starrte wieder sorgenvoll auf den Brief, auf diese paar handgeschriebenen Zeilen. Einundvierzig, wiederholte er heiser. Und dreiundvierzig Tage. Ja, ganz genau.
Er schien jetzt ruhiger und begann auf und ab zu gehen. Das Zimmer hatte eine gewölbte Decke, in der Mitte eine Säule als Stütze. Einst waren da zwei Zimmer gewesen, ein Schlafzimmer und ein Ankleideraum. Vor vielen Jahren – er dachte nur noch in Jahrzehnten, genaue Zahlen mochte er nicht, als erinnerten die ihn an etwas, das man besser vergißt – hatte er die Wand zwischen den beiden Zimmern einreißen lassen. Nur die Säule, die den mittleren Deckenbogen trug, blieb stehen. Das Schloß war zweihundert Jahre zuvor gebaut worden, von einem Heereslieferanten, der den österreichischen Kavalleristen Hafer verkaufte und später geadelt wurde. Der General war hier zur Welt gekommen, in diesem Zimmer. Damals war das hintere, dunklere Zimmer, dessen Fenster auf den Garten und die Betriebsgebäude gingen, das Zimmer seiner Mutter, während dieses hellere, luftigere als Ankleideraum diente. Seit einigen Jahrzehnten nun, nachdem er die Zwischenwand hatte einreißen lassen und diesen Flügel des Gebäudes bezogen hatte, war da anstelle der beiden Zimmer der große, dämmrige Raum. Siebzehn Schritte betrug der Weg von der Tür zum Bett. Und achtzehn Schritte von der garten seitigen Wand zum Balkon. Genau abgezählte Schritte.
Wie ein Kranker, der sich an eine bestimmte Raumeinteilung gewöhnt hat, so lebte er hier. Als wäre ihm das Zimmer auf den Leib geschnitten. Es vergingen Jahre, ohne daß er den anderen Flügel des Schlosses betrat, wo ein Salon dem anderen folgte, grüne, blaue, rote Salons mit goldenen Lüstern. Und wo die Fenster auf den Park gingen, auf die Kastanien, die sich im Frühling über die Balkongeländer neigten und mit rosaroten Kerzen und in dunkelgrüner Pracht im Halbkreis die geschwungenen Balustraden umstanden, die ausladende Umfassung des Südflügels, die von dicken Engeln gestützt wurde. Er machte seine Gänge zu den Kellereien oder in den Wald, oder – jeden Morgen, auch im Winter, auch wenn es regnete – zum Forellenteich. Und wenn er nach Hause kam, ging er durch die Vorhalle in sein Zimmer hinauf, und hier nahm er auch die Mahlzeiten ein.
»Er ist also zurückgekommen«, sagte er jetzt laut, in der Zimmermitte stehend. »Einundvierzig Jahre. Und dreiundvierzig Tage.«
Diese Wörter schienen ihn auf einmal zu ermüden, als begriffe er erst jetzt, was für eine lange Zeit einundvierzig Jahre und dreiundvierzig Tage sind. Er schwankte und setzte sich in den Ledersessel mit der abgewetzten Lehne. Auf dem Tischchen in Reichweite lag eine silberne Glocke, mit der er klingelte.
»Nini soll heraufkommen«, sagte er zum Diener. Und dann, höflich: »Ich lasse bitten.«
2
Nini war einundneunzig Jahre alt. Sie kam unverzüglich. In diesem Zimmer hatte sie den General gewiegt. In diesem Zimmer hatte sie gestanden, als der General geboren wurde. Sechzehn war sie gewesen und sehr schön. Kleingewachsen, aber so muskulös und ruhig, als wüßte ihr Körper um ein Geheimnis. Als wäre in ihren Knochen, ihrem Blut, ihrem Fleisch etwas verborgen, das Geheimnis der Zeit oder des Lebens, das niemandem gesagt, das in keine Sprache übersetzt werden kann, weil Wörter ein solches Geheimnis nicht fassen. Sie war die Tochter des Postbeamten vom Dorf, mit sechzehn bekam sie ein Kind, und nie erfuhr jemand, von wem es war. Als ihr Vater sie aus dem Haus prügelte, kam sie zum Schloß und stillte das Neugeborene, denn sie hatte viel Milch. Sie besaß nichts außer dem Kleid, das sie am Leibe trug, und eine Haarlocke ihres toten Kindes in einem Briefumschlag. So stellte sie sich im Schloß ein. Sie war zur Geburt gekommen. Seinen ersten Schluck Milch hatte der General aus Ninis Brust gesogen.
So lebte sie im Schloß, fünfundsiebzig Jahre lang, schweigend. Und lächelnd. Ihr Name flog durch die Zimmer, als machten die Schloßbewohner einander auf etwas aufmerksam. »Nini«, sagten sie. Als meinten sie: »Wie seltsam, daß es auf der Welt noch etwas anderes als Selbstsucht, Leidenschaft, Eitelkeit gibt, Nini…« Und da sie stets am rechten Ort war, sah man sie nie. Und da sie stets guter Laune war, fragte man sie nie, wie sie guter Laune sein konnte, wenn doch der Mann, den sie geliebt hatte, weggegangen und das Kind, das ihre Milch hätte trinken sollen, gestorben war. Sie stillte den General und zog ihn auf, und dann vergingen fünfundsiebzig Jahre. Zuweilen schien die Sonne über dem Schloß und der Familie, und in diesen Augenblicken allgemeinen Strahlens stellte man überrascht fest, daß Nini ja lächelte. Dann starb die Gräfin, die Mutter des Generals, und Nini wusch mit einem essiggetränkten Lappen die kalte, weiße, schweißverklebte Stirn der Toten. Und eines Tages brachten sie den Vater des Generals auf einer Bahre nach Hause, denn er war vom Pferd gefallen. Er lebte noch fünf Jahre lang, und Nini pflegte ihn. Sie las ihm französische Bücher vor, las die Buchstaben einzeln, weil sie die Sprache nicht konnte, und so reihte sie eben ganz langsam Buchstaben an Buchstaben. Aber auch so verstand es der Kranke. Dann heiratete der General, und als das Paar von der Hochzeitsreise heimkehrte, stand Nini am Tor und erwartete sie. Sie küßte der neuen gnädigen Frau die Hand und überreichte ihr Rosen. Wieder lächelnd. Dieser Moment kam dem General manchmal in den Sinn. Dann starb die Frau, nach zwölf Jahren, und Nini pflegte das Grab und die Kleider der Toten.
Im Haus hatte sie weder Rang noch Titel. Man spürte nur, daß sie Kraft hatte. Außer dem General wußte niemand, daß Nini über neunzig war. Man sprach nicht darüber. Ninis Kraft durchströmte das Haus, die Menschen, die Wände, die Gegenstände, so wie die verborgene Elektrizität auf der kleinen Bühne des wandernden Puppenspielers die Figuren bewegt, den János Vitéz und den Tod. Manchmal hatte man das Gefühl, das Haus und die Dinge könnten, ähnlich wie uralte Stoffe, unter einer Berührung plötzlich zerfallen, sich auflösen, wenn Nini sie nicht mit ihrer Kraft zusammenhielt. Als seine Frau gestorben war, ging der General auf Reisen. Er kehrte nach einem Jahr zurück und bezog sogleich im alten Flügel des Schlosses das Zimmer seiner Mutter. Den neuen Flügel, in dem er mit seiner Frau gelebt hatte, die farbigen Salons mit den schon rissigen französischen Seidentapeten, das große Herrschaftszimmer mit dem Kamin und den Büchern, das Treppenhaus mit den Hirschgeweihen, ausgestopften Auerhähnen und präparierten Gamsköpfen, den großen Speisesaal, durch dessen Fenster man das Tal und das Städtchen und in der Ferne die silbrig-bläulichen Berge sah, die Zimmer seiner Frau und nebenan sein eigenes Schlafzimmer ließ er alle verschließen. Seit zweiunddreißig Jahren, seit dem Tod seiner Frau, seit seiner Rückkehr aus dem Ausland, betraten nur Nini und das Gesinde diese Zimmer, um sie – alle zwei Monate – zu putzen.
»Setz dich, Nini«, sagte der General.
Die Amme setzte sich. Im letzten Jahr war sie alt geworden. Nach neunzig altert man anders als nach fünfzig oder sechzig. Man altert ohne Verbitterung. Ninis Gesicht war rosarot und runzelig – edle Stoffe altern so, jahrhundertealte Seide, in die eine Familie ihre ganze Handfertigkeit und alle ihre Träume hineingewoben hat. Im Jahr zuvor war eins ihrer Augen vom Star befallen worden, und das war jetzt grau und traurig. Das andere Auge war blau geblieben, so blau und zeitlos wie ein Bergsee im August. Ein lächelndes Auge. Nini war wie immer dunkelblau gekleidet, in einen dunkelblauen Filzrock und eine schlichte Bluse. Als hätte sie sich während fünfundsiebzig Jahren nie Kleider machen lassen.
»Konrád hat geschrieben«, sagte der General und hielt nebenbei den Brief hoch. »Erinnerst du dich?«
»Ja«, sagte Nini. Sie erinnerte sich an alles.
»Er ist hier, in der Stadt«, sagte der General so leise, wie man eine hochwichtige und streng vertrauliche Nachricht weitergibt. »Er ist im Weißen Adler abgestiegen. Er kommt am Abend hierher, ich lasse ihn abholen. Er wird bei uns essen.«
»Wo bei uns?« fragte Nini ruhig. Sie ließ ihren blauen Blick, den lebendigen und lächelnden, durch das Zimmer schweifen.
Seit zwei Jahrzehnten empfingen sie keine Gäste mehr. Die Besucher, die mitunter zum Mittagessen eintrafen, die Herren vom Komitat und von der Stadtverwaltung sowie die Gäste der großen Treibjagden wurden vom Verwalter im Waldhaus empfangen, das zu jeder Jahreszeit bereitstand; Tag und Nacht war alles für den Empfang von Gästen gerüstet, die Schlafgemächer, die Badezimmer, die Küche, die große Jägerstube, die offene Veranda, die rustikalen Tische. Bei solchen Gelegenheiten saß der Verwalter am Tischende und bewirtete die Jäger und die offiziellen Herrschaften im Namen des Generals. Niemand war darüber beleidigt, man wußte, daß sich der Hausherr nicht blicken ließ. Ins Schloß kam nur der Pfarrer, einmal im Jahr, winters, um am Eingang die Anfangsbuchstaben von Kaspar, Melchior und Balthasar mit Kreide auf den Türsturz zu schreiben. Der Pfarrer, der die Hausbewohner beerdigt hatte. Sonst niemand, nie.
»Drüben«, sagte der General. »Geht das?«
»Wir haben vor einem Monat saubergemacht«, sagte die Amme. »Es müßte gehen.«
»Auf acht Uhr. Geht das? …« fragte er aufgeregt und irgendwie kindlich gespannt, wobei er sich im Sessel vorbeugte. »Im großen Saal. Jetzt ist es Mittag.«
»Mittag«, sagte die Amme. »Dann will ich Bescheid sagen. Bis sechs sollen sie lüften, dann den Tisch decken.« Sie bewegte lautlos die Lippen, als berechne sie die Zeit und die Menge der zu erledigenden Dinge. »Ja«, sagte sie dann ruhig und bestimmt.
Vorgebeugt betrachtete der General sie aufmerksam. Ihrer beider Leben wälzten sich gemeinsam vorwärts, im langsam holpernden Rhythmus sehr alter Menschen. Sie wußten alles voneinander, mehr als Mutter und Kind, mehr als ein Ehepaar. Die Gemeinsamkeit, die sie verband, war vertrauter als jede Art körperlicher Nähe. Vielleicht lag es an der Muttermilch. Vielleicht weil Nini der erste Mensch gewesen war, der den General bei seiner Geburt gesehen hatte, im Augenblick des Geborenwerdens, in Blut und Kot, so wie die Menschen zur Welt kommen. Vielleicht wegen der fünfundsiebzig Jahre, die sie gemeinsam verlebt hatten, unter demselben Dach, dieselben Speisen essend, dieselbe Luft atmend. Die Muffigkeit des Hauses, die Bäume vor den Fenstern, alles war ihnen gemeinsam. Und das alles war nicht zu benennen. Sie waren nicht Geschwister, nicht Liebende. Es gibt auch noch anderes, und das wußten sie unbestimmt. Es gibt ein Verwandtsein, das stärker und enger ist als die Verbindung von Zwillingen im Mutterleib. Das Leben hatte ihre Tage und Nächte vermischt, sie wußten um den Körper des anderen, und auch um seine Träume.
Die Amme sagte: »Willst du, daß es so ist wie früher?«
»Ja«, sagte der General. »Genau so. Wie beim letzten Mal.«
»Gut«, sagte sie kurz.
Sie ging zu ihm, beugte sich hinunter und küßte seine beringte Greisenhand mit den Leberflecken und den dicken Adern.
»Versprich mir, daß du dich nicht aufregen wirst«, sagte sie.
»Ich verspreche es«, sagte der General leise und gehorsam.
3
Bis fünf kam aus seinem Zimmer kein Lebenszeichen. Dann klingelte er nach dem Diener und verlangte ein kaltes Bad. Das Mittagessen hatte er zurückgeschickt und nur eine Tasse kalten Tee getrunken. Er lag im halbdunklen Zimmer auf dem Diwan, jenseits der kühlen Wände sirrte und gärte der Sommer. Er lauschte auf das heiße Brodeln des Lichts, auf das Rauschen des warmen Winds im ermatteten Laub, auf die Geräusche des Schlosses.
Jetzt, nach der ersten Überraschung, fühlte er sich mit einemmal müde. Man bereitet sich ein Leben lang auf etwas vor. Ist zunächst betroffen. Sinnt dann auf Rache. Wartet. Er wartete schon lange. Er wußte gar nicht mehr, wann sich die Betroffenheit in ein Bedürfnis nach Rache und in ein Warten verwandelt hatte. Die Zeit bewahrt alles auf, doch es wird farblos, wie die ganz alten, noch auf Metallplatten fixierten Photographien. Das Licht, die Zeit verwischen auf den Platten die scharfen und typischen Schattierungen der Gesichter. Man muß das Bild hin und her drehen, denn es braucht eine bestimmte Lichtbrechung, damit man auf der blinden Platte denjenigen erkennt, dessen Merkmale das Metall einst in sich aufgenommen hatte. So verblaßt mit der Zeit jede menschliche Erinnerung. Eines Tages aber kommt von irgendwoher Licht, und man erkennt wieder ein Gesicht. In einer Schublade hatte der General solche alten Photographien. Das Bild seines Vaters. In der Uniform eines Gardehauptmanns, das Haar in dichten Locken, wie ein Mädchen. Um seine Schultern der weiße Umhang des Gardisten, den er sich mit einer beringten Hand auf der Brust zusammenhält. Den Kopf stolz und beleidigt seitwärts geneigt. Er hatte nie gesagt, wo und warum er beleidigt worden war. Wenn er von Wien nach Hause kam, ging er auf die Jagd. Tag für Tag Jagd, zu jeder Jahreszeit; gab es kein Rotwild oder war Schonzeit, jagte er Füchse und Krähen. Als ob er jemanden umbringen wollte und sich ständig auf diesen Racheakt vorbereitete. Die Mutter des Generals, die Gräfin, verbot den Jägern das Schloß, ja, sie verbot und entfernte alles, was an die Jagd erinnerte, die Gewehre, die Patronentaschen, die alten Pfeile, die ausgestopften Vögel und Hirschköpfe, die Geweihe. Damals ließ der Gardeoffizier das Jagdhaus bauen. Dort war dann alles beisammen: Vor dem Kamin lagen große Bärenfelle, an den Wänden hingen braungerahmte, mit weißem Filz bezogene Tafeln mit den Gewehren. Belgische und österreichische Flinten. Englische Messer, russische Büchsen. Für jede Art von Wild. Und in der Nähe des Jagdhauses waren die Hunde untergebracht, das vielköpfige Rudel, die Spürhunde und die Vizslas, und auch der Falkner wohnte hier, mit den drei Falken mit der Falkenhaube. Hier, im Jagdhaus, verbrachte der Vater des Generals seine Zeit. Die Schloßbewohner sahen ihn nur beim Essen. Im Schloß waren die Wände in Pastell gehalten, von hellblauen, hellgrünen, blaßroten goldgestreiften Seidentapeten bedeckt, wie sie in den Webereien in der Umgebung von Paris hergestellt wurden. Jedes Jahr wählte die Gräfin in den französischen Fabriken und Geschäften persönlich Tapeten und Möbel aus – jeden Herbst, wenn sie auf Familienbesuch in ihre Heimat fuhr. Nie ließ sie diese Reise aus. Sie hatte ein Recht darauf, es war im Ehevertrag festgelegt worden, als sie den fremden Gardeoffizier heiratete.
»Vielleicht war es wegen der Reisen«, dachte der General.
Er dachte es, weil sich die Eltern nicht verstanden hatten. Der Gardeoffizier ging auf die Jagd, und da er die Welt, in der es auch noch anderes und andere gab – fremde Städte, Paris, Schlösser, fremde Sprachen und Sitten –, nicht ausrotten konnte, so tötete er eben die Bären, die Rehe und Hirsche. Ja, vielleicht war es wegen der Reisen. Er stand auf und stellte sich vor den bauchigen weißen Porzellanofen, der einst das Schlafzimmer seiner Mutter beheizt hatte. Es war ein großer hundertjähriger Ofen, aus dem die Wärme strömte wie die Gutmütigkeit aus einem dicken, trägen Menschen, der seinen Egoismus mit einer wohlfeilen guten Tat mildern möchte. Es war eindeutig, daß die Mutter hier gefroren hatte. Dieses Schloß mitten im Wald, mit seinen gewölbten Zimmern, war ihr zu dunkel: daher die hellen Tapeten an den Wänden. Und sie fror, weil es im Wald immer windig war, auch sommers, ein Wind, der wie die Bergbäche roch, wenn sie im Frühling von der Schneeschmelze anschwellen und über die Ufer treten. Sie fror, und man mußte fortwährend den weißen Ofen heizen. Sie wartete auf ein Wunder. Sie war nach Osteuropa gekommen, weil die Leidenschaft, von der sie angerührt war, sich als stärker erwiesen hatte als ihre Vernunft. Der Gardeoffizier hatte sie während seines diplomatischen Dienstes kennengelernt. Er war in den fünfziger Jahren bei der Pariser Gesandtschaft Kurier gewesen. Sie lernten sich auf einem Ball kennen, und irgendwie war diese Begegnung unvermeidlich. Die Musik spielte, und der Gardeoffizier sagte auf französisch zu der Grafentochter: »Bei uns sind die Gefühle stärker, endgültiger.« Es war der Gesandtschaftsball. Draußen war die Straße weiß, es schneite. In diesem Augenblick hielt der König Einzug im Saal. Alle verneigten sich. Der König trug einen blauen Frack mit weißer Weste und hob sein goldenes Lorgnon mit einer langsamen Geste vor die Augen. Als sich die beiden aus dem tiefen Hofknicks aufrichteten, blickten sie einander in die Augen. Da wußten sie schon, daß sie miteinander leben mußten. Sie lächelten blaß und verlegen. Im Nebenzimmer spielte die Musik. Die junge Französin sagte: »Bei Ihnen, wo ist das? …« und lächelte kurzsichtig. Der Gardeoffizier nannte seine Heimat. Das erste vertrauliche Wort, das zwischen ihnen fiel, war der Name der Heimat.
Sie kamen im Herbst zu Hause an, fast ein ganzes Jahr später. Die fremde Frau saß unter Schleiern und Decken ganz tief drinnen in der Kutsche. Sie fuhren über die Berge, durch die Schweiz und Tirol. In Wien wurden sie von Kaiser und Kaiserin empfangen. Der Kaiser war wohlwollend wie in den Schulbüchern. Er sprach: »Nehmen Sie sich in acht! Im Wald, wohin er Sie mitnimmt, gibt es Bären. Auch er ist ein Bär.« Und er lächelte. Alle lächelten. Es war ein großer Gunstbeweis, daß der Kaiser mit der französischen Frau des ungarischen Gardeoffiziers scherzte. Sie erwiderte: »Ich werde ihn mit Musik zähmen, Majestät, so wie Orpheus die wilden Tiere gezähmt hat.« Sie fuhren durch obstduftende Wiesen und Wälder. Als sie die Grenze passierten, verschwanden Berge und Städte, und die Frau begann zu weinen. »Chéri«, sagte sie, »mir ist schwindlig. Da ist ja alles endlos.« Die Pußta machte sie schwindeln, diese von der schwebend-schweren Herbstluft benommene Einöde, wo die Ernte schon vorbei war, wo sie stundenlang über schlechte Wege fuhren, wo am Himmel nur Kraniche zogen und am Straßenrand die Maisfelder so geplündert dalagen wie nach einem Krieg, wenn die verletzte Landschaft dem abziehenden Heer nachstirbt. Der Gardeoffizier saß mit verschränkten Armen wortlos im Wagen. Zuweilen verlangte er ein Pferd und ritt über lange Strecken neben dem Wagen her. Er blickte auf die Heimat, als sähe er sie zum ersten Mal. Er betrachtete die niedrigen Häuser mit grünen Fensterläden und weißer Veranda, in denen sie übernachteten, die Häuser der Menschen seines Volks, von dichten Gärten umgeben, die kühlen Zimmer, in denen ihm jedes Möbelstück, ja, sogar der Geruch in den Schränken vertraut war. Und die Landschaft, deren Einsamkeit und Melancholie sein Herz anrührten wie nie zuvor: Mit den Augen der Frau sah er die Ziehbrunnen, die trockenen Felder, die Birkenwälder, die rosa Wolken am Abendhimmel über der Ebene. Die Heimat öffnete sich vor ihnen, und der Gardeoffizier spürte mit Herzklopfen, daß die Landschaft, die sie empfing, auch ihr Schicksal war. Die Frau saß in der Kutsche und schwieg. Manchmal hob sie das Taschentuch ans Gesicht. Bei solchen Gelegenheiten beugte sich ihr Mann vom Sattel herunter und blickte fragend in die tränennassen Augen. Doch die Frau bedeutete ihm, daß sie weiterfahren wollte. Sie waren einander verbunden.
In der ersten Zeit war ihr das Schloß ein Trost. Es war so groß, der Wald und die Berge schlossen es so eindeutig gegen die Ebene ab, daß sie es als Heim in der fremden Heimat empfand. Und es trafen Transportwagen ein, jeden Monat einer, aus Paris, aus Wien. Wagen mit Möbeln, Leinen, Damast, Stichen und einem Spinett, denn die Frau wollte ja mit Musik die wilden Tiere zähmen. Der erste Schnee lag schon auf den Bergen, als sie eingerichtet waren und das Leben hier aufnahmen. Der Schnee riegelte das Schloß ab wie ein düsteres nordisches Heer die belagerte Burg. Nachts traten Rehe und Hirsche aus dem Wald, blieben im Schnee im Mondlicht stehen und beobachteten die beleuchteten Fenster mit schiefgelegtem Kopf und mit ernsten Tieraugen, die wundersam blau schimmerten, während sie der Musik lauschten, die aus dem Schloß sickerte. »Siehst du ?…« sagte die Frau am Klavier und lachte. Im Februar jagte der Frost die Wölfe von den Bergen herunter, die Bediensteten und die Jäger machten im Park Reisigfeuer, in deren Bann die Wölfe heulend kreisten. Der Gardeoffizier ging mit dem Messer auf sie los; die Frau schaute vom Fenster aus zu. Es gab etwas, das sie miteinander nicht ausmachen konnten. Aber sie liebten sich.
Der General trat vor das Bild seiner Mutter. Es war das Werk eines Wiener Malers, der auch die Kaiserin porträtiert hatte, mit herabhängendem, geflochtenem Haar. Das Porträt hatte der Gardeoffizier im Arbeitszimmer des Kaisers in der Burg gesehen. Die Gräfin trug auf dem Bild einen rosaroten Strohhut mit Blumen wie die Florentiner Mädchen im Sommer. Das goldgerahmte Bild hing über der Kirschbaumkommode mit den vielen Schubladen. Die Kommode hatte noch seiner Mutter gehört. Der General stützte sich mit beiden Händen darauf, um zu dem Bild des Wiener Malers hinaufzublicken. Die junge Frau hielt den Kopf schräg und schaute ernsten und zärtlichen Blickes ins Leere, als fragte sie: »Warum?« Das war die Bedeutung des Bildes. Die Gesichtszüge waren edel, Hals, Hände und die Unterarme, die in gehäkelten Handschuhen steckten, waren genauso sinnlich wie die weißen Schultern und der Busen im Dekolleté. Sie war eine Fremde. Wortlos rangen sie miteinander, ihre Waffen waren die Musik, die Jagd, die Reisen und die Abendgesellschaften, wenn das Schloß so erleuchtet war, als reite der Rote Hahn durch die Räume, während die Ställe mit Pferden und Wagen vollgestopft waren und auf jeder vierten Stufe der großen Treppe steife Heiducken wie Wachspuppen aus dem Panoptikum standen und zwölfarmige silberne Kandelaber hielten und die Musik, das Licht, die Stimmen und der Duft der Körper durch die Räume wirbelten, als sei das Leben ein verzweifeltes Fest, eine tragische, erhabene Feier, die damit endet, daß die Hornbläser ihre Instrumente erklingen lassen, um den Teilnehmern der Soiree einen unheilvollen Befehl zu verkünden. Der General konnte sich noch an solche Gesellschaften erinnern. Manchmal mußten die Pferde und die Kutscher im verschneiten Park um Reisigfeuer lagern, weil in den Ställen kein Platz mehr war. Und einmal kam auch der Kaiser, der hierzulande König hieß. Er kam im Wagen, in Begleitung von Reitern mit weißem Federbusch. Er blieb zwei Tage, ging im Wald auf die Jagd, wohnte im anderen Flügel des Schlosses, schlief in einem Eisenbett und tanzte mit der Dame des Hauses. Beim Tanzen redeten sie miteinander, und die Augen der Frau füllten sich mit Tränen. Der König hörte auf zu tanzen, verneigte sich, küßte der Dame die Hand und führte sie in den Nebenraum, wo seine Begleitung im Halbkreis herumstand. Er führte die Frau zum Gardeoffizier und küßte ihr noch einmal die Hand.
»Wovon habt ihr geredet?« fragte der Gardeoffizier seine Frau später, viel später.
Doch die Frau sagte es nicht. Nie erfuhr jemand, was der König zu der Frau gesagt hatte, die aus der Fremde kam und beim Tanzen weinte. Was in der Gegend noch lange zu reden gab.
4
Das Haus schloß alles ein, wie ein großes steinernes Prunkgrab, in dem die Knochen von Generationen modern, von Frauen und Männern früherer Zeiten in Totengewändern aus allmählich zerfallender grauer Seide oder schwarzem Tuch. Es schloß auch die Stille ein wie einen wegen seines Glaubens verfolgten Häftling, der benommen, bärtig und zerlumpt im Kellerverlies schmachtet, auf schimmligem, verrottetem Stroh. Es schloß auch die Erinnerungen ein, die Toten galten. Die Erinnerungen lauerten in den muffigen Winkeln der Räume, so wie in den feuchten Kellern alter Häuser Pilze, Fledermäuse, Ratten und Käfer zu finden sind. An den Türklinken war das Zittern einer Hand, die Erregung eines lang vergangenen Augenblicks zu spüren, und die eigene Hand zögerte, die Klinke hinunterzudrücken. Jedes Haus, in dem die Leidenschaft die Menschen mit voller Wucht gepackt hat, ist mit solchen unfaßbaren Wesen gefüllt.
Der General betrachtete das Bild seiner Mutter. Er kannte jeden einzelnen Zug des schmalen Gesichts. Die Augen blickten mit schläfriger, trauriger Verachtung in die Zeit hinaus. Mit einem solchen Blick hatten Frauen früherer Zeiten das Blutgerüst bestiegen, voller Verachtung für die, um derentwillen sie starben, und auch für die, die ihnen den Tod gaben. Die Familie seiner Mutter besaß in der Bretagne ein Schloß am Meer. Der General mochte acht Jahre alt gewesen sein, als man ihn eines Sommers dorthin mitnahm. Damals reisten sie schon im Zug, allerdings sehr langsam. Im Gepäcknetz lagen die mit den Initialen seiner Mutter versehenen bestickten Reisekoffer in ihren Leinenhüllen. In Paris regnete es. Das Kind saß in einem Wagen, der mit blauer Seide ausgeschlagen war, sah durch die dunstigen Scheiben hindurch die Stadt, die im Regen wie der Bauch eines dicken Fisches schlüpfrig glänzte. Er sah hoch aufragende Hausdächer, hohe Kamine, die schräg in die schmutzigen Vorhänge des nassen Himmels ragten und die das Geheimnis ganz anderer und unverständlicher Schicksale zu verkünden schienen. Frauen gingen lachend durch die Nässe, lüpften mit einer Hand ihre Röcke, ließen die Zähne blitzen, als wären der Regen, die fremde Stadt, die französische Sprache etwas Lustiges und Wunderbares, das nur das Kind nicht verstehen konnte. Er war acht Jahre alt und saß ernsthaft in der Kutsche neben seiner Mutter, gegenüber der Zofe und der Gouvernante, und er spürte, daß ihm etwas aufgegeben war. Alle beobachteten ihn, den kleinen Wilden, der von fernher kam, aus dem Wald mit den Bären. Die französischen Wörter sprach er mit Bedacht aus, vorsichtig und sorgfältig. Er wußte, daß er jetzt auch im Namen seines Vaters, des Schlosses, der Hunde, des Waldes und der zurückgelassenen Heimat sprach. Ein Tor ging auf, der Wagen fuhr in einen großen Hof ein, vor breiten Treppen verbeugten sich französische Diener. All das schien ein bißchen feindselig. Er wurde durch Räume geführt, in denen alles peinlich genau und bedrohlich an seinem Platz stand. Im großen Saal des ersten Stocks empfing ihn die französische Großmutter. Sie hatte graue Augen und schwarzen Flaum auf der Oberlippe; ihr Haar, das einst rot gewesen war und jetzt in eine Schmutzfarbe spielte, als hätte die Zeit vergessen, es zu waschen, trug sie hochgesteckt. Sie küßte das Kind und bog mit ihren knochigen weißen Händen seinen Kopf etwas nach hinten, um sein Gesicht von oben zu betrachten. »Tout de même«, sagte sie zu seiner Mutter, die besorgt neben ihm stand, als wäre er im Examen, als würde sich jetzt gleich etwas herausstellen. Später wurde Lindenblütentee gebracht. Alles roch so seltsam, dem Kind wurde es schwindlig. Gegen Mitternacht begann es zu weinen und zu erbrechen. »Ich will Nini haben«, sagte der kleine Junge tränenerstickt. Totenbleich lag er im Bett.
Ende der Leseprobe