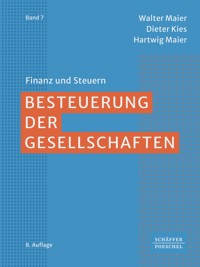
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Finanz und Steuern
- Sprache: Deutsch
Das Lehrbuch stellt zum einen die Grundlagen der Besteuerung von Gesellschaften systematisch und methodisch anhand einer Vielzahl von ausführlichen Beispielen und Übersichten dar. Zum anderen bietet es Praktiker:innen eine umfassende Darstellung des Gesellschafts-, Bilanz- und Steuerrechts der Personen- und Kapitalgesellschaften. Bei der Abhandlung der Personengesellschaften gehen die Autoren nicht nur auf die schwierigen Fragen der Sonder- und Ergänzungsbilanzen, sondern auch auf die Besteuerung des Mitunternehmers (einschließlich seiner Wahlmöglichkeit zur Thesaurierungsbesteuerung) und die Veräußerung der Mitunternehmeranteile ein. Ausführlich sind auch die Mischformen (GmbH & Co. KG und Betriebsaufspaltung) dargestellt. Bei den Kapitalgesellschaften spannt sich der Bogen von der Gründung (einschließlich Einbringung von Unternehmen) bis zur Liquidation. Neben den Fragen des Körperschaftsteuerrechts werden auch die Querverbindungen zur Besteuerung des Gesellschafters dargestellt. Das Lehrbuch empfiehlt sich sowohl für Studierende von Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien als auch für die Vorbereitung auf die Steuerberater:innen- oder Bilanzbuchhalter:innenprüfung. Für Praktiker:innen in der Steuerberatung und in Betrieben bietet es sich als Nachschlagewerk für täglich auftretende Fragen an. Die 8. Auflage berücksichtigt u.a. die umfangreichen gesetzlichen Änderungen durch das Wachstumschancengesetz vom 27.03.2024 und das Jahressteuergesetz 2024 vom 02.12.2024; eingearbeitet ist zudem der Umwandlungssteuererlass 2025. Rechtsstand: 1. August 2025
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1929
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumAutorenVorwort zur 8. AuflageAbkürzungsverzeichnisKapitel I Einführung1 Grundsätzliche Unterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften2 Buchführung und Bilanzierung2.1 Handelsbilanz- und Steuerbilanzrecht2.1.1 Handelsbilanz2.1.2 Steuerbilanz2.2 Buchführungspflicht nach Handelsrecht2.3 Buchführungspflicht nach Steuerrecht2.3.1 Abgeleitete (derivative) Buchführungspflicht2.3.2 Originär steuerliche Buchführungspflicht2.4 E-Bilanz (§ 5b EStG)3 Buchmäßige Besonderheiten in der Bilanz der Personengesellschaft3.1 Bilanzierung3.2 Kapitalkonten3.3 Privatkonten3.4 Entnahmen und Einlagen3.5 Sonderbilanzen und Ergänzungsbilanzen3.6 Prüfungs- und Publizitätspflichten4 Buchmäßige Besonderheiten in der Bilanz der Kapitalgesellschaft4.1 Aufgaben des Jahresabschlusses4.2 Bilanzgliederung und anwendbare Vorschriften4.3 Kapitalkonten4.4 Gewinn- und Verlustrechnung (§§ 275‒278 HGB)4.5 Anhang (§§ 284‒288 HGB)4.6 Lagebericht (§ 289 HGB)4.7 Erleichterungen für mittelgroße und kleine Kapitalgesellschaften4.8 Kleinstkapitalgesellschaften4.9 Personensteuern4.9.1 Behandlung in Buchführung und Bilanz4.9.2 Körperschaftsteuerrückstellung, Steuernachzahlungen und -erstattungen4.10 Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses4.11 Offenlegung des Jahresabschlusses5 Beteiligungen an Personengesellschaften5.1 Bilanzierung von Beteiligungen in der Handelsbilanz5.2 Bilanzierung von Beteiligungen in der Steuerbilanz6 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften6.1 Bilanzierung von Anteilen an Kapitalgesellschaften6.2 Bilanzierung von Gewinnausschüttungen6.3 Veräußerung von Anteilen an KapitalgesellschaftenKapitel II Die Besteuerung der PersonengesellschaftenTeil A Personengesellschaften ‒ Zivilrecht1 Gesellschaftsrecht1.1 Zivilrechtliche Grundlagen1.1.1 Zivilrecht und Besteuerung1.1.2 Grundformen des Gesellschaftsrechts1.1.3 Außen- und Innengesellschaften1.1.3.1 Personenaußengesellschaften1.1.3.2 Personeninnengesellschaften1.1.4 Gesamthandsvermögen1.1.5 Typenzwang und Vertragsfreiheit1.1.6 Optionsmodell für Personenhandelsgesellschaften1.2 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts1.2.1 Grundlagen1.2.2 Gründung der Gesellschaft1.2.3 Rechte und Pflichten der Gesellschafter1.2.4 Vermögensrechte1.2.5 Haftung1.2.6 Gesellschafterwechsel1.2.7 Beendigung der Gesellschaft1.2.8 Neuerungen für die GbR durch das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)1.2.8.1 Überblick1.2.8.2 Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts1.2.8.3 Vermögen und Bestand der GbR (§§ 713, 722 BGB)1.2.8.4 Gesellschaft bürgerlichen Rechts eintragungsfähig (eGbR)1.2.8.5 Orientierung der Beteiligungsverhältnisse an den Beiträgen1.2.8.6 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft1.2.8.7 Ausübung freier Berufe1.2.8.8 Fehlerhafte Gesellschafterbeschlüsse1.2.8.9 Steuerliche Auswirkungen1.3 OHG1.3.1 Grundlagen1.3.2 Gründung der Gesellschaft1.3.3 Rechte und Pflichten der Gesellschafter1.3.4 Vermögensrechte1.3.5 Haftung1.3.6 Gesellschafterwechsel1.3.7 Beendigung der Gesellschaft1.3.8 Neuerungen für die OHG durch das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)1.4 Kommanditgesellschaft1.4.1 Grundlagen1.4.2 Gründung der Gesellschaft1.4.3 Rechte und Pflichten der Gesellschafter1.4.4 Vermögensrechte1.4.5 Haftung1.4.6 Gesellschafterwechsel und Beendigung der Gesellschaft1.4.7 Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)1.4.8 Neuerungen für die KG durch das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)1.5 Partnerschaftsgesellschaft1.5.1 Grundlagen1.5.2 Gründung der Gesellschaft1.5.3 Rechte und Pflichten der Gesellschafter1.5.4 Gewinn- und Verlustverteilung1.5.5 Haftung1.5.6 Gesellschafterwechsel und Beendigung der Gesellschaft1.5.7 Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 1.5.8 Neuerungen für die PartG durch das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)1.6 Stille Gesellschaft1.6.1 Grundlagen1.6.2 Gründung und Ende der Gesellschaft1.6.3 Rechte und Pflichten der Gesellschafter1.6.4 Gewinn- und Verlustverteilung1.6.5 Haftung1.6.6 Gesellschafterwechsel und Beendigung der Gesellschaft1.7 Unterbeteiligung1.7.1 Grundlagen1.7.2 Gründung der Gesellschaft und Gesellschafterrechte und -pflichten1.7.3 Organisation2 Europäisches Gesellschaftsrecht2.1 Vereinheitlichung des Gesellschaftsrechts2.2 Rechtsquellen der Europäischen Union2.2.1 Übersicht2.2.2 EU-Verordnungen2.2.3 EU-Richtlinien2.3 Rechtswahlfreiheit im europäischen Gesellschaftsrecht2.4 Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)2.4.1 Grundlagen2.4.2 Gründung2.4.3 Rechte und Pflichten der Gesellschafter2.4.4 Gewinn- und Verlustverteilung und Haftung2.4.5 Gesellschafterwechsel und Beendigung der Gesellschaft2.4.6 Beendigung der Gesellschaft2.4.7 Steuerrecht2.5 Europäische Gesellschaft (SE)2.5.1 Grundlagen2.5.2 Gründung2.5.3 Institutionelle Ordnung der Societas Europaea2.5.4 Rechnungslegung2.6 Europäische Genossenschaft (SCE)2.7 Europäischer VereinTeil B Allgemeine Besteuerungsfragen1 Besteuerung von Mitunternehmerschaften1.1 Regelung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG1.1.1 Regelungszweck der Mitunternehmerschaft1.1.2 Grundlagen1.1.3 Unternehmensteuerreform 1.1.4 Änderungen durch das MoPeG ab 01.01.20241.2 Personengesellschaft1.2.1 Übersicht1.2.2 Bruchteilsgemeinschaft1.2.3 Eheliche Gütergemeinschaft1.2.4 Miterbengemeinschaft1.2.5 Beteiligung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts1.3 Gewerbliche Einkünfte1.3.1 Übersicht1.3.2 Teilweise gewerblich tätige Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG)1.3.2.1 Voraussetzungen und Rechtsfolgen1.3.2.2 Probleme bei selbstständiger Arbeit1.3.3 Gewerblich geprägte Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG)1.3.3.1 Voraussetzungen und Rechtsfolgen1.3.3.2 Andere Gesellschaftsformen1.3.4 Nicht gewerbliche Personengesellschaft1.3.4.1 Andere Gewinneinkünfte1.3.4.2 Überschusseinkünfte1.3.4.3 Zebra-Gesellschaft1.4 Mitunternehmerschaft1.4.1 Begriff des Mitunternehmers1.4.2 Merkmale der Mitunternehmerschaft im Einzelnen1.4.2.1 Erbringen einer Einlage1.4.2.2 Unternehmerinitiative1.4.2.3 Unternehmerrisiko1.4.2.3.1 Beteiligung am Gewinn1.4.2.3.2 Beteiligung am Verlust1.4.2.3.3 Beteiligung am Vermögen und an den stillen Reserven1.4.2.3.4 Entnahmerecht1.4.2.3.5 Treuhandschaft1.4.3 Mitunternehmerschaft bei den einzelnen Gesellschaftsformen1.4.3.1 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts1.4.3.2 Offene Handelsgesellschaft1.4.3.3 Kommanditgesellschaft1.4.3.4 Stille Gesellschaft und Unterbeteiligung1.4.4 Verdeckte Mitunternehmerschaft1.5 Nießbrauch bei Personengesellschaften1.5.1 Überblick1.5.2 Nießbrauch am Gesellschaftsanteil (Vollrechtsnießbrauch)1.5.3 Nießbrauch am Gewinnstammrecht1.5.4 Ertragsnießbrauch2 Gewinnermittlung der Personengesellschaft2.1 Gemeinsamkeiten mit Einzelunternehmen2.2 Unterschiede zu Einzelunternehmen2.3 Betriebsvermögen der Personengesellschaft2.3.1 Gesellschaftsvermögen (Gesamthandsvermögen)2.3.1.1 Handelsrechtliches Betriebsvermögen2.3.1.2 Notwendiges Betriebsvermögen2.3.1.3 Notwendiges Privatvermögen2.3.2 Sonderbetriebsvermögen2.3.2.1 Übersicht2.3.2.2 Notwendiges Sonderbetriebsvermögen2.3.2.3 Gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen2.3.2.4 Bilanzierungskonkurrenz zwischen Einzelunternehmen und Sonderbetriebsvermögen2.3.3 Sonderbetriebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben2.3.4 Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter2.3.4.1 Positive Ergänzungsbilanz2.3.4.2 Negative Ergänzungsbilanz2.3.5 Steuerliche Gesamtbilanz der Personengesellschaft2.3.6 Besteuerungsverfahren3 Beziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter3.1 Übersicht3.2 Tätigkeitsvergütungen3.2.1 Laufende Vergütungen3.2.2 Versorgungszusagen3.2.2.1 Pensionszusagen3.2.2.2 Witwer-/Witwenrenten3.2.2.3 Rückdeckungsversicherung3.2.3 Vergütungen für Dienst- und Werkleistungen3.3 Vergütungen für die Hingabe von Darlehen3.3.1 Forderung des Gesellschafters an die Gesellschaft3.3.2 Verzicht des Gesellschafters auf seine Forderung gegen die Personengesellschaft3.3.3 Darlehen der Gesellschaft an den Gesellschafter3.3.3.1 Betriebliche Veranlassung des Darlehens3.3.3.2 Fehlende betriebliche Veranlassung des Darlehens3.3.4 Refinanzierung durch Gesellschafter3.4 Vergütungen für die Überlassung von Wirtschaftsgütern3.5 Ausnahmen von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG3.5.1 Veräußerungsgeschäfte zwischen Gesellschafter und Gesellschaft3.5.2 Werklieferungen zwischen Gesellschafter und Gesellschaft3.5.3 Vergütungen des Gesellschafters an die Gesellschaft3.5.4 Leistungsaustausch zwischen den Personengesellschaftern untereinander3.5.5 Leistungsaustausch zwischen gewerblich tätigen Personengesellschaften3.5.5.1 Leistungen einer Schwestergesellschaft, die gewerbliche Einkünfte hat3.5.5.2 Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung3.5.5.3 Überlassende Personengesellschaft hat keine gewerblichen Einkünfte3.6 Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG3.6.1 Grundsatz3.6.2 Über- und Unterentnahmen3.6.3 Berechnungsweise3.6.4 Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften4 Übertragung von Wirtschaftsgütern4.1 Problemstellung4.2 Geltende Rechtslage4.2.1 Änderungen4.2.2 Übersicht über § 6 Abs. 5 EStG4.2.3 Überführung von Wirtschaftsgütern ohne Rechtsträgerwechsel (§ 6 Abs. 5 Satz 2 EStG)4.2.4 Überführung von Wirtschaftsgütern mit Rechtsträgerwechsel (§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG)4.3 Übertragungen im Betriebsvermögen4.3.1 Entgeltliche Übertragungen von Wirtschaftsgütern4.3.1.1 Veräußerung wie unter fremden Dritten4.3.1.2 Veräußerung über dem Teilwert4.3.2 Unentgeltliche Überführung bzw. Übertragung von Wirtschaftsgütern4.3.3 Teilentgeltliche Übertragungen4.3.4 Übertragungen gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten4.3.4.1 Grundsätze4.3.4.2 Sperrfrist4.3.4.3 Körperschaftsklausel4.4 Reinvestitionsrücklage (§ 6b EStG)4.4.1 Rechtslage4.4.2 Veräußerungen der Gesellschaft4.4.3 Veräußerungen der Gesellschafter4.4.4 Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften4.4.5 Veräußerung des Mitunternehmeranteils4.5 Übertragungen zwischen Betriebs- und Privatvermögen4.5.1 Entgeltliche Übertragungen4.5.2 Übertragungen gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten4.5.3 Unentgeltliche Übertragungen4.5.4 Teilentgeltliche Übertragungen5 Gewinnverteilung5.1 Gesetzliche Gewinnverteilung5.2 Vertragliche Gewinnverteilung5.2.1 Allgemeines5.2.2 Kriterien und Möglichkeiten vertraglicher Gewinnverteilung5.2.3 Steuerrechtliche Beurteilung5.3 Verteilung steuerlicher Mehrgewinne5.4 Zinserträge der Personengesellschaft6 Doppelstöckige Personengesellschaft6.1 Unmittelbare Leistungen bei mittelbarer Beteiligung6.2 Rechtsfolgen6.3 Mehrstöckige Personengesellschaft6.4 Atypische Unterbeteiligung6.5 Mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft7 Gründung von Personengesellschaften7.1 Überblick7.2 Bargründung7.3 Sachgründung7.3.1 Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten7.3.2 Einbringung einzelner Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens7.3.3 Einbringung einzelner Wirtschaftsgüter des Privatvermögens7.4 Eintritt von Mitunternehmern7.5 Unentgeltliche ÜbertragungTeil C Wechsel im Gesellschafterbestand1 Einführung2 Veräußerung eines Mitunternehmeranteils2.1 Ebene des Veräußerers2.1.1 Veräußerungsgewinn2.1.2 Gewerbesteuer2.1.3 Bildung einer Rücklage nach § 6b EStG2.1.4 Ergänzungsbilanzen des Verkäufers2.1.5 Sonderbetriebsvermögen des Verkäufers2.1.6 Unterjähriger Gesellschafterwechsel2.1.7 Im Ausland ansässiger Gesellschafter bzw. Wegzug eines Gesellschafters2.1.8 Ausländische Beteiligungen2.2 Ebene des Erwerbers2.2.1 Aktivierung des Kaufpreises2.2.2 Abschreibung der erworbenen Wirtschaftsgüter2.2.3 Finanzierung des Kaufpreises3 Hebung stiller Lasten4 Abstockungsbilanz5 Pauschaler Abschlag6 Negatives Kapitelkonto7 Eintritt eines Gesellschafters7.1 Keine Einlage7.2 Einlage von Geld (Buchwertansatz)7.3 Einlage von Geld (Zwischenwertansatz)7.4 Einlage von Geld (Ansatz der gemeinen Werte)7.5 Einlage von Wirtschaftsgütern (Privatvermögen)7.5.1 Offene Einlagen7.5.2 Verdeckte Einlagen7.5.3 Kombinierte offene und verdeckte Einlage7.5.4 Einlage in eine ausländische Personengesellschaft7.6 Überführung von Betriebsvermögen (§ 6 Abs. 5 EStG)7.6.1 Grundprinzip7.6.2 Teilwertansatz7.6.3 Verbringung ins Ausland7.6.4 Verletzung der Sperrfrist7.6.5 Buchwertübertragung und Entgelt7.7 Einbringung eines Betriebs durch den Neugesellschafter7.7.1 Umwandlungsteuerrecht7.7.2 Zuzahlungen7.7.2.1 Buchwertfortführung7.7.2.2 Ansatz der gemeinen Werte8 Ausscheiden eines Mitunternehmers8.1 Gegen Entgelt8.2 Ausscheiden gegen Sachwertabfindung8.2.1 Sachwertabfindung ins Privatvermögen8.2.2 Sachwertabfindung ins Betriebsvermögen8.3 Realteilung einer Mitunternehmerschaft8.3.1 Ohne Ausgleichszahlung8.3.2 Sperrfristverletzung8.3.3 Realteilung mit Spitzen- oder Wertausgleich9 Übertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge9.1 Unentgeltliche Übertragung9.1.1 Übertragung des ganzen Mitunternehmeranteils9.1.1.1 Entnahme des Sonderbetriebsvermögens9.1.1.2 Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG9.1.2 Übrige Rechtsfolgen des § 6 Abs. 3 EStG9.1.2.1 Anschaffungsnebenkosten9.1.2.2 Rücklage nach § 6b EStG9.1.2.3 Negatives Kapitalkonto9.1.2.4 Zinsen/Investitionsabzugsbetrag9.1.2.5 Verlustvorträge9.1.3 Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils9.2 Teilentgeltliche Übertragung9.2.1 Entgelt kleiner als das Kapitalkonto9.2.2 Entgelt größer als das Kapitalkonto9.3 Beschenkter im Ausland9.4 Verhältnis § 6 Abs. 3 EStG zu § 24 UmwStG10 Erbfall und ErbauseinandersetzungTeil D Besondere Rechtsformen1 Stille Gesellschaft1.1 Grundlagen1.2 Abgrenzung stille Gesellschaft ‒ partiarisches Darlehen1.3 Besteuerung des typisch stillen Gesellschafters1.3.1 Einnahmen des typisch stillen Gesellschafters1.3.2 Werbungskosten bei typisch stiller Gesellschaft1.3.3 Verluste des stillen Gesellschafters1.3.4 Kapitalertragsteuer1.3.5 Besteuerung des Inhabers des Handelsgewerbes1.3.6 Gewerbesteuer1.4 Besteuerung des atypisch stillen Gesellschafters1.4.1 Mitunternehmerschaft1.4.2 Gewinnermittlung1.4.2.1 Gewinnermittlung und -feststellung auf der Ebene der atypisch stillen Gesellschaft1.4.2.2 Besteuerung des Inhabers des Handelsgewerbes1.4.2.3 Besteuerung des atypisch stillen Gesellschafters1.4.3 Verluste aus Innengesellschaften mit Kapitalgesellschaften1.4.4 Gewerbesteuer1.5 Umsatzsteuer2 Unterbeteiligung2.1 Überblick2.2 Typische echte Unterbeteiligung2.3 Atypische echte Unterbeteiligung2.4 Unechte Unterbeteiligung3 Familienpersonengesellschaften3.1 Begriff und Grundsätze3.2 Zivilrechtliche Anerkennung der Familienpersonengesellschaft3.2.1 Zivilrechtliche Formerfordernisse3.2.2 Bestellung eines Ergänzungspflegers3.2.3 Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung3.3 Tatsächliche Durchführung des Gesellschaftsvertrages3.3.1 Angehörige als stille Gesellschafter oder Unterbeteiligte3.3.2 Angehörige als Mitunternehmer3.3.2.1 Mitunternehmerrisiko3.3.2.2 Mitunternehmerinitiative3.3.3 Zeitliche Aspekte3.4 Prüfung der Angemessenheit der Gewinnverteilung3.4.1 Angehörige als Mitunternehmer3.4.1.1 Grundsätze3.4.1.2 Realer Wert des Betriebsvermögens3.4.1.3 Realer Wert des Gesellschaftsanteils3.4.1.4 Ermittlung des nachhaltig zu erwartenden Gewinns3.4.2 Angehörige als typische stille Gesellschafter und typisch Unterbeteiligte3.4.3 Kapitalverzinsung bei Beteiligung nicht mitarbeitender Familienangehöriger3.4.3.1 Bemessungsgrundlage3.4.3.2 Renditesätze3.4.4 Beispielsfälle zum angemessenen GewinnanteilTeil E Verluste bei beschränkter Haftung1 Verluste bei beschränkt haftenden Gesellschaftern (§ 15a EStG)1.1 Zielsetzung des § 15a EStG1.2 Handelsrecht1.2.1 Handelsrechtliche Grundsätze1.2.2 Einlage1.3 Steuerrechtliche Grundsätze1.3.1 Kein Verlustzurechnungsverbot, Ausgleichs- und Abzugsverbot1.3.2 Verrechnungsgebot1.4 Regeln zur Auflösung negativer Kapitalkonten und § 15a EStG1.4.1 Grundsätze1.4.2 Fälle des Wegfalls negativer Kapitalkonten1.4.3 Nachholung unterlassener Nachversteuerung1.5 Grundbegriffe des § 15a EStG1.5.1 Kapitalkonto i. S. d. § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG1.5.1.1 Begriff des Kapitalkontos im Handelsrecht1.5.1.2 Begriff des Kapitalkontos im Steuerrecht1.5.1.3 Unterschied Ergänzungsbilanzen ‒ Sonderbilanzen1.5.2 Anteil am Verlust der KG i. S. d. § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG1.5.3 Doppelstöckige Personengesellschaft1.6 Außenhaftung nach § 171 HGB bei noch nicht erbrachter Hafteinlage1.6.1 Grundsätze des § 15a Abs. 1 Sätze 2 und 3 EStG1.6.2 Bürgschaftsübernahme durch Kommanditisten1.6.3 Atypische Unterbeteiligung1.7 Haftungsminderung (§ 15a Abs. 3 Sätze 3 und 4 EStG)1.8 Einlagenminderung (§ 15a Abs. 3 Sätze 1 und 4 EStG)1.8.1 Grundsätze1.8.2 Ausnahmen von § 15a Abs. 3 Satz 1 EStG1.8.2.1 Entnahmen von Konten mit Forderungscharakter1.8.2.2 Einlagenminderung mit Wiederaufleben der unbeschränkt persönlichen Haftung1.8.3 Behandlung von Einlagen1.8.3.1 Zeitkongruente Einlagen1.8.3.2 Nachgelagerte Einlagen1.8.3.3 Vorgezogene Einlagen1.9 Statuswechsel des Gesellschafters1.9.1 Kommanditist wird Komplementär1.9.2 Komplementär wird Kommanditist1.10 Verrechnung mit künftigen Gewinnen (§ 15a Abs. 2 EStG)1.11 Gesellschafterwechsel1.12 Gesonderte Feststellung des verrechenbaren Verlusts1.13 Entsprechende Anwendung des § 15a EStG in anderen Fällen von Mitunternehmerschaften1.14 Entsprechende Anwendung des § 15a EStG auf andere Gewinneinkunftsarten1.15 Sinngemäße Anwendung des § 15a EStG in Fällen der Überschusseinkunftsarten (§§ 20 Abs. 1 Nr. 4, 21 Abs. 1 Satz 2 EStG)1.16 Konkurrenzverhältnis zu anderen Vorschriften1.16.1 Verhältnis des § 15a EStG zu § 2 Abs. 3, § 10d Abs. 2 EStG1.16.2 Verhältnis des § 15a EStG zu § 2a EStG1.17 Übertragung des KG-Anteils durch Schenkung oder Erbschaft2 Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen (§ 15b EStG)2.1 Zweck und Wirkungsweise des § 15b EStG2.2 Modellhafte Gestaltung (§ 15b Abs. 2 EStG)2.3 Verlustquote (§ 15b Abs. 3 EStG)2.4 Nicht betroffene Steuersparmodelle2.5 Geschlossene Fonds2.6 Einzelinvestitionen2.7 Rechtsfolgen2.8 Verfahren (§ 15b Abs. 4 EStG)Teil F Zins- und Lizenzschranke sowie Gewinnthesaurierung1 Zinsschranke (§ 4h EStG, § 8a KStG)1.1 Übersicht1.2 Abzugsfähigkeit der Zinsaufwendungen1.2.1 Grundsatz1.2.2 Betriebsbezogene Ermittlung1.2.3 Maßgeblicher Gewinn1.2.4 Zinsaufwendungen1.2.5 Zinserträge1.3 Grenzen der Zinsschranke1.3.1 Freigrenze (§ 4h Abs. 2 Buchst. a EStG)1.3.2 Eigenständige Unternehmen (§ 4h Abs. 2 Buchst. b EStG)1.3.3 Konzern-Escape-Klausel (§ 4h Abs. 2 Buchst. c EStG)1.4 EBITDA-Vortrag1.5 Zinsvortrag1.6 Weitere Regeln zur Anwendung bei Personengesellschaften1.6.1 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen1.6.2 Zinssaldo1.6.3 Zu hohe Gesellschafterfremdfinanzierung1.6.4 Zinsschranke bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften1.6.5 Untergang des Zinsvortrags bei Mitunternehmern1.7 Verhältnis des § 4h EStG zu anderen Vorschriften1.8 Zinsschranke bei Körperschaften2 Aufwendungen für Rechteüberlassungen (§ 4j EStG)2.1 Abzugsbeschränkung2.2 Präferenzregelung und niedrige Besteuerung2.3 Rechtsfolgen2.4 Europarechtliche und DBA-Korrelationen2.5 Anwendungsbereich3 Gewinnthesaurierung bei Personenunternehmen (§ 34a EStG)3.1 Überblick3.2 Thesaurierungsbegünstigung3.2.1 Persönlicher Anwendungsbereich3.2.2 Sachlicher Anwendungsbereich3.3 Thesaurierung im Einzelnen3.3.1 Grundsatz3.3.2 Begünstigungsfähiger Gewinn, Begünstigungsbetrag und nachzuversteuernder Betrag3.4 Besonderheiten bei Personengesellschaften3.4.1 Ermittlung des nicht entnommenen Gewinns3.4.2 Ausübung des Wahlrechts3.4.3 Doppel- und mehrstöckige Personengesellschaften3.5 Nachversteuerung3.5.1 Nachversteuerungsbetrag3.5.2 Entnahme der Thesaurierungssteuer3.5.3 Reihenfolge der Verwendung des nicht entnommenen Gewinns3.5.4 Ermittlung des nachversteuerungspflichtigen Betrags3.5.5 Übertragung und Überführung von Wirtschaftsgütern3.5.6 Anteilige Nachversteuerung3.5.7 Vollständige NachversteuerungTeil G Gewerbesteuer1 Rechtsentwicklung2 Zuständigkeiten und Steuerverfahren3 Steuergegenstand4 Gewerbesteuerpflicht4.1 Gewerbesteuerpflicht der Einzelunternehmen4.2 Gewerbesteuerpflicht der Personengesellschaften4.3 Gewerbesteuerpflicht der Kapitalgesellschaften und wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe4.4 Gewerbesteuerliche Organschaft5 Gewerbeertrag5.1 Ermittlung des Gewerbeertrags5.2 Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb bei Personenunternehmen5.2.1 Gewerbesteuerlicher Gewinn5.2.2 Veräußerungs- und Aufgabegewinne bei Personenunternehmen5.2.3 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften5.2.4 Weitere Besonderheiten bei der Ermittlung des Gewerbeertrags5.3 Gewerbeverlust (§ 10a GewStG)5.4 Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb bei Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen5.5 Wegfall des Abzugs der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe6 Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen6.1 Übersicht6.2 Hinzurechnungstatbestände nach § 8 Nr. 1 Buchst. a‒f GewStG6.2.1 Entgelte für Schulden (§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG)6.2.2 Renten und dauernde Lasten (§ 8 Nr. 1 Buchst. b GewStG)6.2.3 Gewinnanteile des stillen Gesellschafters (§ 8 Nr. 1 Buchst. c GewStG)6.2.4 Miet- und Pachtzinsen (§ 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG)6.2.5 Hinzurechnungsfreibetrag6.2.6 Zusammenfassung6.3 Gewinnanteile von Komplementären bei KGaA (§ 8 Nr. 4 GewStG)6.4 Dividendenerträge aus Anteilen im Streubesitz (§ 8 Nr. 5 GewStG)6.5 Anteile am Verlust in- oder ausländischer Personengesellschaften (§ 8 Nr. 8 GewStG)6.6 Sonstige Hinzurechnungstatbestände (§ 8 Nr. 9‒12 GewStG)7 Gewerbesteuerliche Kürzungen7.1 Übersicht7.2 Kürzung für betrieblichen Grundbesitz (§ 9 Nr. 1 GewStG)7.3 Anteile am Gewinn von Personengesellschaften (§ 9 Nr. 2 GewStG)7.4 Erträge aus inländischen Schachtelbeteiligungen (§ 9 Nr. 2a GewStG)7.5 Kürzung der Gewinnanteile des KGaA-Komplementärs (§ 9 Nr. 2b GewStG)7.6 Gewinne aus ausländischen Betriebsstätten (§ 9 Nr. 3 GewStG)7.7 Spenden (§ 9 Nr. 5 GewStG)7.8 Gewinne aus Schachtelbeteiligungen an aktiv tätigen Auslandsgesellschaften (§ 9 Nr. 7 GewStG)7.9 Gewinne aus Beteiligungen an Auslandsgesellschaften im DBA-Fall (§ 9 Nr. 8 GewStG)8 Ermittlung der Gewerbesteuer8.1 Grundsatz8.2 Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG)8.3 Entrichten der Gewerbesteuer9 Gewerbesteueranrechnung nach § 35 EStG9.1 Inhalt und Zielrichtung9.2 Gewerbliche Einkünfte9.3 Anrechnungsvolumen9.4 Begrenzung der Tarifermäßigung9.5 Besonderheiten bei MitunternehmerschaftenTeil H GmbH & Co. KG und UG & Co. KG1 Besonderheiten der Rechtsform2 Arten2.1 Personen- und beteiligungsidentische GmbH & Co. KG2.2 GmbH-beherrschte GmbH & Co. KG2.3 Einheits-GmbH & Co. KG2.4 Doppelstöckige GmbH & Co. KG2.5 Publikums-GmbH & Co. KG2.6 Komplementärgesellschaften der KG in anderen Rechtsformen2.6.1 UG & Co. KG2.6.2 AG & Co. KG2.6.3 Stiftung & Co. KG2.6.4 Ausländische Komplementärgesellschaft2.7 GmbH & Co. KGaA3 Handelsrechtliche Verhältnisse3.1 Rechtsnatur und Entstehung3.2 Jahresabschluss, Prüfung und Offenlegung3.3 Finanzierung3.4 Gewinnanteile3.5 Geschäftsführung3.6 Haftung4 Grundsätze der steuerlichen Behandlung4.1 Allgemeines4.2 Gewerbliche Einkünfte4.3 Mitunternehmerschaft4.3.1 Mitunternehmerschaft der Komplementär-GmbH4.3.2 Mitunternehmerschaft der Kommanditisten5 Betriebsvermögen der GmbH & Co. KG und Sondervergütungen5.1 Betriebsvermögen und Sonderbetriebsvermögen bei der KG5.2 Anteile an der Komplementär-GmbH, GmbH-Ausschüttungen5.3 Tätigkeitsvergütungen5.3.1 Geschäftsführergehälter5.3.1.1 Der Geschäftsführer der GmbH ist nicht Personengesellschafter der KG (Fremdgeschäftsführer)5.3.1.2 Der Geschäftsführer der GmbH ist Personengesellschafter der KG5.3.2 Pensionszusagen6 Gewinnverteilung bei der GmbH & Co. KG6.1 Grundsätze6.2 Arbeitseinsatz6.3 Risikotragung6.4 Kapitaleinsatz6.5 Unangemessene Gewinnbeteiligung6.5.1 Verdeckte Gewinnausschüttung6.5.2 Unangemessen niedriger Gewinnanteil der GmbH6.5.3 Unangemessen hoher Gewinnanteil der GmbH7 Neuerungen für die GmbH & Co. KG durch das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)Teil I Umsatzsteuerliche Fragen1 Die Unternehmereigenschaft der Personengesellschaft2 Beginn der unternehmerischen Tätigkeit3 Ende der unternehmerischen Tätigkeit3.1 Auflösung einer Personengesellschaft durch Liquidation3.2 Auflösung einer Personengesellschaft durch Austritt aller Gesellschafter bis auf einen3.2.1 Ein Gesellschafter erwirbt alle Anteile der übrigen Gesellschafter3.2.2 Ausscheiden aller Gesellschafter bis auf einen gegen Abfindung seitens der Gesellschaft3.3 Verschmelzung4 Die Unternehmereigenschaft des Gesellschafters einer Personengesellschaft5 Leistungsaustausch bei der Gründung einer Personengesellschaft5.1 Leistungen der Personengesellschaft5.2 Leistungen des Gesellschafters bei Gründung6 Leistungen der Gesellschaft an Gesellschafter oder diesen nahestehenden Personen außerhalb des Gründungsvorganges6.1 Unentgeltliche Leistungen der Gesellschaft6.2 Entgeltliche Leistungen der Gesellschaft7 Leistungen des Gesellschafters an die Gesellschaft7.1 Geschäftsführungsleistungen7.2 Leistungen außerhalb der GeschäftsführungTeil J Verfahrensrechtliche Besonderheiten1 Einheitliche und gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen2 Erklärungspflichten im Feststellungsverfahren3 Adressierung und Bekanntgabe von Bescheiden an Personengesellschaften3.1 Adressierung und Bekanntgabe bei Bescheiden, die die Personengesellschaft als solche betreffen3.2 Adressierung und Bekanntgabe bei Bescheiden, welche die Gesellschafter betreffen3.3 Die Bekanntgabe von einheitlichen Feststellungsbescheiden gegenüber rechtsfähigen Personenvereinigungen gemäß § 183 AO4 Besonderheiten in Rechtsbehelfsverfahren gegen einheitliche und gesonderte Feststellungsbescheide4.1 Einschränkung der Rechtsbehelfsbefugnis (§ 352 AO und § 48 FGO)4.2 Einschränkung der Hinzuziehung (§ 360 AO)4.3 Besonderheiten bei der Aussetzung der Vollziehung (§ 361 Abs. 2 und 3 AO, § 69 Abs. 2 FGO)5 Verfahrensrechtliche Behandlung der stillen Gesellschaft5.1 Verfahrensrechtliche Behandlung der typisch stillen Gesellschaft5.2 Verfahrensrechtliche Behandlung der atypisch stillen Gesellschaft6 Unterbeteiligung an einer Personengesellschaft7 Korrekturen von einheitlichen und gesonderten Feststellungen8 Feststellungsverjährung für einheitliche und gesonderte Feststellungen9 Beteiligung von Familienangehörigen10 Besonderheiten bei Personengesellschaften im Insolvenzverfahren10.1 Insolvenz der Personengesellschaft10.2 Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter der PersonengesellschaftKapitel III Die Besteuerung der KapitalgesellschaftenTeil A Allgemeines zur GmbHTeil B Gründung1 Besonderheiten2 Die Gründungsgesellschafter3 Sitz der Gesellschaft4 Firma5 Gegenstand des Unternehmens6 Der Gesellschaftsvertrag6.1 Rechtsnatur6.2 Notwendiger Inhalt6.3 Fakultativer Inhalt6.4 Formvorschriften6.5 Vereinfachte Gründung6.6 Fehlerhafter Gesellschaftsvertrag7 Die einzelnen Stadien der Gründung ‒ Vorgründungsstadium7.1 Gesellschaftsrechtliche Beurteilung7.2 Steuerliche Beurteilung7.3 Buchführungspflicht7.4 Haftung der Gesellschafter8 Das eigentliche Gründungsstadium (Vorgesellschaft)8.1 Gesellschaftsrechtliche Beurteilung8.2 Steuerliche Beurteilung8.3 Buchführungspflicht9 Stammkapital und Stammeinlage9.1 Bareinlage9.2 Sacheinlage9.2.1 Überblick9.2.2 Bewertung9.2.3 Sachgründungsbericht9.2.4 Gegenstand der Einlage9.3 Verdeckte Sacheinlage9.4 Änderung von Bar- in Sacheinlagen und umgekehrt10 Die bilanzielle und steuerliche Behandlung der Einlagen10.1 Allgemeines10.2 Behandlung eines Agios10.3 Sacheinlage10.3.1 Übertragung eines Wirtschaftsguts aus dem Privatvermögen10.3.2 Übertragung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens10.3.3 Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils10.3.4 Einbringung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft10.3.4.1 Ansatz durch die GmbH10.3.4.2 Folgen für den Gesellschafter10.3.5 Veräußerung nach Einbringung (sperrfristverhaftete Anteile)10.3.5.1 Einbringungsgewinn I10.3.5.2 Einbringungsgewinn II10.3.5.3 Nachweispflicht11 Gründungskosten12 Haftungsfragen12.1 »Unechte« Vorgesellschaft12.2 Die Vorgesellschaft gelangt nicht zur Eintragung12.3 Haftung nach § 11 Abs. 2 GmbHG12.4 Vorbelastungs- und Unterbilanzhaftung12.5 Differenzhaftung (§ 9 GmbHG)12.6 Gründerhaftung (§ 9a GmbHG)12.7 Voreinzahlung von Einlagen12.8 Ausfallhaftung (§ 24 GmbHG)12.9 Grundsatz der KapitalerhaltungTeil C Die Organe der GmbH1 Die Gesellschafterversammlung2 Beirat/Aufsichtsrat3 Geschäftsführer3.1 Organ der Gesellschaft3.1.1 Bestellung des Geschäftsführers3.1.2 Vertretungsbefugnis3.1.3 Geschäftsführungsbefugnis3.1.4 Abberufung3.2 Anstellungsvertrag3.3 Pflichten und Haftung des GeschäftsführersTeil D Verträge zwischen Gesellschaftern und der GmbH1 Die Geschäftsführervergütung im Steuerrecht1.1 Allgemeines1.2 Angemessenheit der Geschäftsführervergütung1.2.1 Anerkennung der Vergütungsbestandteile dem Grunde nach1.2.2 Gesamtausstattung1.2.3 Art und Umfang der Tätigkeit1.2.4 Ertragsaussichten der Gesellschaft1.2.5 Fremdvergleich1.2.6 Pensionszusage als Teil der Gesamtausstattung1.2.7 Rechtsfolgen der Unangemessenheit1.3 Tantieme / variable Gehaltsbestandteile / Gratifikation1.3.1 Angemessenheit der Tantieme dem Grunde nach1.3.2 Angemessenheit der Tantieme der Höhe nach1.3.3 Tantieme bei Verlustvorträgen1.3.4 Auslegung unklarer Tantiemevereinbarungen1.4 Vermögensbeteiligung am Arbeitgeber1.4.1 Freibetrag nach § 3 Nr. 39 EStG1.4.2 Aufgeschobene Besteuerung1.5 Sozialversicherungspflicht1.6 Kfz-Gestellung durch die GmbH1.6.1 Pauschalwertmethode1.6.2 Fahrtenbuchmethode1.6.3 Vertragliches Verbot der Kfz-Nutzung1.6.4 Zuzahlung zum Kfz1.6.5 Kfz-Nutzung als ausschließliche Vergütung1.7 Überlassung eines PC oder Smartphone etc.1.8 Überlassung einer Wohnung oder Unterkunft1.9 Versicherung gegen Haftungsrisiken des Geschäftsführers1.10 Abfindungen1.11 Betriebliche Altersversorgung1.12 Pensionszusage1.12.1 Allgemeine zivilrechtliche Voraussetzungen1.12.2 Steuerliche Prüfung1.12.3 Ernsthaftigkeit und Angemessenheit1.12.4 Probezeit1.12.5 Finanzierbarkeit1.12.6 Erdienbarkeit1.12.7 Überversorgung 1.12.8 Auslagerung der Pensionsverpflichtung1.12.9 Verzicht auf eine Pensionszusage1.12.10 Pensionszusage und Weiterarbeit1.13 Zeitwertkonten1.14 Verstoß gegen ein Wettbewerbsverbot1.15 Risikogeschäfte1.16 Werbungskosten1.16.1 Arbeitszimmer (§ 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG)1.16.2 Arbeitszimmer bis zum VZ 20221.16.3 Homeoffice-Pauschale (§ 4 Abs. 5 Nr. 6C EStG)1.16.4 Sonstige Werbungskosten1.17 Sonderausgaben1.17.1 Beiträge zur Rentenversicherung1.17.2 Beiträge zur Krankenversicherung2 Darlehensverträge zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern2.1 Allgemeines2.2 Beteiligungen im Privatvermögen2.2.1 Darlehensverlust2.2.2 Darlehensverzicht2.2.3 Darlehen zur Sicherung des Arbeitsplatzes2.3 Beteiligungen im Betriebsvermögen2.4 Beteiligung im Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft2.5 Sonderproblem: Bürgschaften2.5.1 Beteiligung im Privatvermögen2.5.2 Beteiligung im Betriebsvermögen3 Mietverträge zwischen Gesellschafter und Gesellschaft3.1 Beteiligung im Privatvermögen3.2 Beteiligung im BetriebsvermögenTeil E Die Besteuerung der GmbH1 Steuerpflicht1.1 Unbeschränkte Steuerpflicht1.1.1 Beginn1.1.2 Geschäftsleitung1.1.3 Sitz1.1.4 Ausländische Kapitalgesellschaften1.2 Beschränkte Steuerpflicht2 Ermittlung des zu versteuernden Einkommens2.1 Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft2.1.1 Handelsrechtliche Bilanzierungspflicht2.1.2 Publizitätspflichten2.1.3 Abschlussprüfung2.1.4 Die Bilanzgliederung nach § 266 HGB2.1.5 Bilanzierung der Finanzanlagen2.1.5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen2.1.5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen2.1.5.3 Beteiligungen2.1.5.4 Buchmäßige Behandlung der Finanzanlagen2.1.5.4.1 Beteiligungen an einer anderen Kapitalgesellschaft2.1.5.4.2 Bilanzierung eigener Anteile2.1.5.4.3 Beteiligung an einer Personengesellschaft2.1.6 Die bilanzmäßige Darstellung des Eigenkapitals2.1.7 Ergebnisverwendung2.1.8 Verstoß gegen den Grundsatz der Kapitalerhaltung2.1.9 Pensionsrückstellungen2.1.9.1 Handelsrechtliche Passivierungspflicht2.1.9.2 § 6a EStG2.1.9.2.1 Rechtsverbindliche Zusage2.1.9.2.2 Keine gewinnabhängigen Bezüge2.1.9.2.3 Widerrufsvorbehalte2.1.9.2.4 Schriftform2.1.9.2.5 Beginn der Rückstellungsbildung2.1.9.2.6 Höhe der Pensionsrückstellung2.1.9.2.7 Nachholverbot2.1.9.2.8 Dynamisierung2.1.9.3 Auflösung der Pensionsrückstellung2.1.9.4 Verdeckte Gewinnausschüttungen2.1.9.5 Rückdeckungsversicherungen2.1.9.6 Verzicht auf die Pensionszusage2.1.9.7 Verzicht für die Zukunft (sog. Future Service)2.1.9.8 Übertragung einer Pensionsverpflichtung2.1.10 Steuerrückstellungen2.1.10.1 Gewerbesteuerrückstellung2.1.10.2 Rückstellungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag2.1.11 Sonderposten mit Rücklagenanteil2.1.12 Die Gewinn- und Verlustrechnung2.2 Steuerbilanz2.2.1 Maßgeblichkeitsgrundsatz2.2.2 Latente Steuern2.2.3 Notwendigkeit steuerlicher Ausgleichsposten2.3 Verdeckte Gewinnausschüttungen2.3.1 Tatbestand einer verdeckten Gewinnausschüttung2.3.1.1 Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung2.3.1.1.1 Rückgängigmachung der verdeckten Gewinnausschüttung2.3.1.1.2 Vorteilsausgleich2.3.1.1.3 Schadenersatzforderungen2.3.1.2 Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis2.3.1.2.1 Beherrschende Gesellschafter2.3.1.2.2 Nahestehende Person2.3.2 Bewertung der verdeckten Gewinnausschüttung2.3.3 Rechtsfolgen der verdeckten Gewinnausschüttung2.3.3.1 Hinzurechnung bei der Kapitalgesellschaft2.3.3.2 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei der Passivierung von Verpflichtungen2.3.3.2.1 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Pensionsrückstellungen in der Anwartschaftsphase2.3.3.2.2 Verdeckte Gewinnausschüttung bei Pensionsrückstellungen in der Leistungsphase2.3.3.2.3 Vollständiger Wegfall der Pensionsverpflichtung durch Tod2.3.3.3 Verdeckte Gewinnausschüttung bei Posten der Aktivseite2.3.3.4 Steuerliche Folgen der verdeckten Gewinnausschüttung beim Gesellschafter2.3.3.5 Gesellschafter ist eine Kapitalgesellschaft2.3.4 vGA und Gewerbesteuer2.3.5 vGA und Kapitalertragsteuer2.3.6 Änderung von Steuerbescheiden2.4 Zinsschranke (§ 8a KStG)2.4.1 Allgemeines2.4.2 Zinsschranke bei Körperschaften (§ 8a KStG)2.4.2.1 Verhältnis zu § 4h EStG2.4.2.2 Bemessungsgrundlage2.4.2.3 Ausnahmetatbestände2.4.2.4 Zinsvortrag und Verlustabzugsbeschränkungen für Körperschaften2.4.2.5 Verhältnis zur verdeckten Gewinnausschüttung2.4.3 Mögliche Verfassungswidrigkeit2.5 Einlagen2.5.1 Offene Einlagen2.5.2 Verdeckte Einlagen2.5.3 Verdeckte Einlagen von Anteilen an Kapitalgesellschaften2.5.4 Weitere Einzelfälle von verdeckten Einlagen2.5.5 Rechtsfolgen bei der Gesellschaft2.5.6 Das steuerliche Einlagekonto2.5.7 Rechtsfolgen beim Gesellschafter2.5.8 Bescheinigung2.5.9 Einlagekonto bei Organschaft2.5.10 Einlagekonto in Umwandlungsfällen2.5.11 Änderung von Steuerbescheiden (§ 32a KStG)2.6 Steuerbefreiung nach § 8b KStG2.6.1 Intention des Gesetzgebers2.6.2 Steuerfreiheit der Dividende (§ 8b Abs. 1 KStG)2.6.3 Streubesitzdividenden2.6.4 Aufwendungen auf die Beteiligung2.6.5 Veräußerungsgewinne (§ 8b Abs. 2 KStG)2.6.6 Gewinnminderungen (§ 8b Abs. 3 KStG)2.6.7 Beteiligung über eine Personengesellschaft (§ 8b Abs. 6 KStG)2.6.8 § 8b KStG und Gewerbesteuer2.7 Die Berücksichtigung von Verlusten2.7.1 Handelsrechtliche Beurteilung2.7.2 Steuerliche Beurteilung2.7.3 § 2a EStG2.7.4 § 15a EStG2.8 Verlustrücktrag und Verlustvortrag2.8.1 Verlustentstehungsjahre bis einschließlich VZ 20192.8.2 Verlustentstehungsjahre 2020 und 20212.8.3 Verlustentstehungsjahre 2022 ff.2.8.4 Gewerbesteuer2.9 Untergang des Verlustvortrags bei Veräußerung (§ 8c KStG)2.9.1 Anwendungsbereich2.9.2 Grundtatbestand2.9.3 Erwerberkreis2.9.4 Unmittelbare und mittelbare Beteiligung2.9.5 Vergleichbare Sachverhalte2.9.6 Kapitalerhöhung2.9.7 Zeitpunkt und Umfang des Verlustuntergangs2.9.8 Berücksichtigung stiller Reserven2.9.9 Sanierungsklausel2.10 Fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d KStG2.11 § 10a GewStG3 Abziehbare Aufwendungen (§ 9 KStG)4 Nicht abziehbare Aufwendungen4.1 Liebhaberei4.2 Abzugsbeschränkung nach § 4 Abs. 5 und 5b EStG5 § 10 KStG5.1 Abzugsverbot für Aufwendungen zur Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke5.2 Abzugsverbot für Einkommen- und sonstige Personensteuern5.3 Geldstrafen / Geldbußen5.4 Aufsichtsrats- und ähnliche Vergütungen6 Die tarifliche Körperschaftsteuer6.1 Internationaler Vergleich6.2 Das aktuelle Körperschaftsteuersystem7 Organschaft7.1 Motive für die Organschaft7.2 Grundprinzip7.3 Voraussetzungen der Organschaft7.3.1 Organgesellschaft7.3.2 Organträger7.3.3 Finanzielle Eingliederung7.4 Gewinnabführungsvertrag7.4.1 Handelsrechtliche Voraussetzungen7.4.2 Zeitliche Voraussetzungen7.4.3 Tatsächliche Durchführung7.4.4 Beendigung7.5 Steuerliche Folgen der Organschaft7.5.1 Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft7.5.2 Ausgleichszahlungen (§ 16 KStG)7.6 Die Einkommensermittlung beim Organträger7.6.1 Allgemeines7.6.2 Verdeckte Gewinnausschüttungen7.6.3 Rückstellung für Verlustübernahme7.6.4 Teilwertabschreibungen7.6.5 Schuldzinsen7.6.6 Organschaftliche Minder- bzw. Mehrabführungen beim Organträger7.6.6.1 Regelung bis zum KöMoG7.6.6.2 Änderungen durch das KöMoG7.7 Verunglückte Organschaften7.8 Gewerbesteuerliche OrganschaftTeil F Das Optionsmodell nach § 1a EStG1 Einführung2 Zeitliche Anwendung3 Persönlicher Anwendungsbereich4 Antrag4.1 Form des Antrags4.2 Gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen4.3 Adressat des Antrags4.4 Unwiderruflichkeit des Antrags5 Übergang zur Körperschaftsbesteuerung5.1 Allgemeines5.2 Wahlrecht5.3 Sonderbetriebsvermögen5.4 Ergänzungsbilanzen5.5 Sperrfristverhaftete Anteile5.6 Verlustvorträge5.7 Steuerliches Einlagekonto6 Folgen der Option7 Laufende Besteuerung der Gesellschafter8 Veräußerung der Anteile9 Auslandsbezug9.1 Wahlrecht des § 20 UmwStG9.2 Im Ausland ansässige Gesellschafter10 RückoptionTeil G Die GmbH & Still1 Motive2 Abgrenzung zwischen typisch und atypisch stiller Beteiligung3 Typisch stille Beteiligung3.1 Ebene der GmbH (bilanzielle Behandlung)3.2 Ebene des typisch Stillen3.3 Beteiligung Minderjähriger3.4 Angemessene Gewinnverteilung4 Atypisch stille Beteiligung4.1 Grundsätze4.2 Ebene der GmbH (Bilanzierungsgrundsätze)4.3 Ebene des atypisch StillenTeil H Veräußerung von Beteiligungen1 Überblick2 Veräußerung von privaten Beteiligungen (§ 17 EStG)2.1 Grundtatbestand2.2 Mittelbare Beteiligungen2.3 Eigene Anteile2.4 Anteile im Gesamthandsvermögen2.5 Sperrfristverhaftete Anteile2.6 Infektion2.7 Einlage von Anteilen2.7.1 Einlage einer Beteiligung in ein Einzelunternehmen2.7.2 Einlage einer Beteiligung in eine Gesamthand2.7.3 Einlage einer Beteiligung in eine Kapitalgesellschaft2.8 Veräußerung von Anteilen an einer ausländischen Gesellschaft2.9 Veräußerung durch einen ausländischen Gesellschafter3 Veräußerungsgewinn3.1 Grundfall3.2 Veräußerung von Teilen einer Beteiligung3.3 Veräußerung gegen Rente3.4 Rückwirkende Änderungen3.5 Teilweise Verfassungswidrigkeit4 Veräußerungsverluste4.1 Gesetzliche Regelung5 Nachträgliche Anschaffungskosten5.1 Verdeckte Einlagen5.2 Gesellschafterdarlehen5.2.1 Rechtslage bis 27.09.20175.2.2 Änderung der Rechtsprechung5.2.3 Änderung durch das JStG 20195.3 Bürgschaftsverluste5.3.1 Rechtslage bis 27.09.20175.3.2 Die neue Rechtsprechung5.3.3 Wiederherstellung der alten Rechtslage (JStG 2019)5.4 Drittaufwand6 Vorweggenommene Erbfolge6.1 Unentgeltliche Übertragung6.2 Teilentgeltliche Übertragung6.3 Entgeltliche Übertragung7 Erbfolge und Erbauseinandersetzung8 Liquidation, Kapitalherabsetzung und Einlagenrückgewähr8.1 Liquidation8.2 Kapitalherabsetzung8.3 Einlagenrückgewähr9 Sitzverlegung ins Ausland (§ 17 Abs. 5 EStG)10 Entstehung eines privaten Veräußerungsgewinnes11 Beteiligungen im Betriebsvermögen11.1 Gewerblicher Gewinn11.2 Rücklage nach § 6b EStG11.3 Veräußerung einer Beteiligung durch eine Kapitalgesellschaft (§ 8b Abs. 2 bis 5 KStG)12 Auslandssachverhalte (§ 6 AStG)12.1 Steuerverhaftung der stillen Reserven12.2 Aufgabe des Wohnsitzes12.3 Entstehung der Steuer12.4 Unentgeltliche Übertragung der Anteile12.5 Auffangtatbestand12.6 Problem der DoppelbesteuerungTeil I Betriebsaufspaltung1 Problem2 Gründe für die Betriebsaufspaltung3 Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung4 Die verschiedenen Arten der Betriebsaufspaltung4.1 Echte und unechte Betriebsaufspaltung4.2 Kapitalistische Betriebsaufspaltung4.3 Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung4.4 Umgekehrte Betriebsaufspaltung4.5 Freiberufler-Betriebsaufspaltung5 Die Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung im Einzelnen5.1 Personelle Verflechtung5.1.1 Beteiligungsidentität5.1.2 Beherrschungsidentität5.1.3 Personengruppentheorie5.1.4 Einstimmigkeitsabreden5.1.5 Mittelbare Beherrschung5.1.6 Faktische Beherrschung5.1.7 Betriebskapitalgesellschaft5.1.8 Ehegattenanteile5.1.9 Anteile von minderjährigen Kindern5.2 Sachliche Verflechtung5.2.1 Wesentliche Betriebsgrundlage5.2.2 Unentgeltliche bzw. verbilligte Nutzungsüberlassung5.2.3 Unangemessen hohe Miete5.2.4 Berechnung der angemessenen Miete5.3 Geschäftswert bei Betriebsaufspaltung6 Steuerliche Folgen der Betriebsaufspaltung6.1 Anteile am Betriebsunternehmen6.2 Sonstiges Betriebsvermögen6.2.1 Aktivierungspflicht6.2.2 Anspruch auf Substanzerhaltung6.2.2.1 Pachterneuerungsrückstellung6.2.2.2 Forderung auf Substanzerhaltung (bisherige Ansicht)6.2.2.3 Neue Rechtsprechung6.3 Darlehen6.4 Arbeitslohn6.5 Gewerbesteuer7 Begründung der Betriebsaufspaltung7.1 Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung7.2 Begründung einer sonstigen echten Betriebsaufspaltung7.3 Begründung einer kapitalistischen Betriebsaufspaltung8 Beendigung der Betriebsaufspaltung9 Vermeidung der Aufdeckung stiller Reserven10 Betriebsaufspaltung über die GrenzeTeil J Die Besteuerung der Dividenden1 Gesellschaftsrecht2 Besteuerung von Dividenden (Privatvermögen)2.1 Abgeltungsteuer2.2 Zufluss der Dividende2.3 Disquotale Ausschüttungen2.4 Verdeckte Gewinnausschüttungen2.5 Ausschüttungen aus dem Einlagekonto2.6 Dividende in Form sonstiger Vorteile2.7 Vorabausschüttungen2.8 Ausschüttung nach Kapitalherabsetzung2.9 Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag2.10 Werbungskosten3 Beteiligungen im Betriebsvermögen4 Anteile, die von einer Kapitalgesellschaft gehalten werden5 Nießbrauch an einem Anteil an einer KapitalgesellschaftTeil K Veränderungen im Stammkapital1 Kapitalherabsetzung1.1 Gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen1.1.1 Ordentliche Kapitalherabsetzung1.1.2 Vereinfachte Kapitalherabsetzung1.2 Bilanzmäßige Behandlung1.3 Steuerliche Folgen für die Gesellschaft1.4 Steuerliche Folgen für die Gesellschafter2 Kapitalerhöhung2.1 Gründe für eine Kapitalerhöhung2.2 Gesellschaftsrecht2.2.1 Effektive Kapitalerhöhung2.2.2 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln2.3 Steuerliche Auswirkungen bei der Kapitalgesellschaft2.4 Steuerliche Auswirkungen beim Gesellschafter3 Die Auflösung der GmbH4 Liquidation5 Liquidationsbesteuerung (§ 11 KStG)5.1 Besteuerungszeitraum5.2 Ermittlung des Liquidationsgewinns5.3 Besteuerung des Liquidationsgewinns5.4 Vermögensverteilung5.4.1 Steuerliche Folgen für die Gesellschaft5.4.2 Steuerliche Folgen für den Gesellschafter6 Sitzverlegung ins AuslandTeil L Umsatzsteuer bei der GmbH1 Unternehmerfähigkeit der GmbH2 Beginn der Unternehmereigenschaft der GmbH2.1 Neugründungen2.2 Umwandlungen2.2.1 Spaltungen2.2.2 Verschmelzung2.2.3 Formwechsel2.2.4 Einbringungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge durch Sacheinlage3 Ende der Unternehmereigenschaft4 Organschaft4.1 Allgemeines4.2 Finanzielle Eingliederung4.3 Wirtschaftliche Eingliederung4.4 Organisatorische Eingliederung4.5 Sonderfall GmbH & Co. KG4.6 Grenzüberschreitende Organschaft4.7 Beendigung der Organschaft insbesondere in Insolvenzfällen5 Das Unternehmen der GmbH6 Leistungsaustausch zwischen der GmbH und ihren Gesellschaftern6.1 Gründungsstadium der GmbH6.2 Veräußerung eines Gesellschaftsanteils bei Fortbestehen der GmbH6.3 Veräußerung von Gesellschaftsanteilen bei Liquidation der GmbH6.4 Leistungsbeziehungen zwischen Gesellschafter und GmbH außerhalb der Gewährung von Gesellschaftsrechten6.4.1 Leistungen der Gesellschafter an die GmbH6.4.2 Leistungen der GmbH an die GesellschafterKapitel IV Umwandlung1 Gründe für eine Umwandlung2 Verhältnis Zivilrecht ‒ Steuerrecht3 Gesellschaftsrechtliche Möglichkeiten der Umwandlung3.1 Einzelrechtsnachfolge3.2 Anwachsung/Aufnahme weiterer Gesellschafter3.3 Gesamtrechtsnachfolge4 Umwandlungsgesetz4.1 Allgemeines4.2 Die Verschmelzung4.2.1 Allgemeines4.2.2 Verschmelzungsfähige Rechtsträger4.2.3 Das Verschmelzungsverfahren4.2.4 Rechtsfolgen der Verschmelzung4.3 Spaltung4.3.1 Möglichkeiten der Spaltung4.3.2 Spaltungsfähige Rechtsträger4.3.3 Das Spaltungsverfahren4.3.4 Folgen der Spaltung4.4 Vermögensübertragung4.5 Formwechsel4.6 Grenzüberschreitende Umwandlungen5 Steuerliche Regelung (Umwandlungssteuergesetz)5.1 Allgemeines5.2 Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft5.2.1 Umwandlungsbilanzen5.2.2 Auswirkungen bei der übertragenden Körperschaft5.2.2.1 Bewertungswahlrecht (§ 3 UmwStG)5.2.2.2 Ausstehende Einlagen5.2.2.3 Pensionsverpflichtungen5.2.2.4 Beteiligung an anderen Gesellschaften5.2.2.5 Eigene Anteile5.2.2.6 Ansatz immaterieller Wirtschaftsgüter5.2.2.7 Forderungen und Verbindlichkeiten5.2.2.8 Körperschaft mit negativem Betriebsvermögen5.2.2.9 Umwandlungskosten5.2.2.10 Ausschüttungsverbindlichkeiten5.2.3 Auswirkungen bei der übernehmenden Personengesellschaft5.2.3.1 Wertansätze5.2.3.2 Übernahmegewinn5.2.3.2.1 Beteiligung im Betriebsvermögen5.2.3.2.2 Beteiligung an der übertragenden Körperschaft im Privatvermögen5.2.3.2.3 Besteuerung offener Rücklagen5.3 Vermögensübergang einer Kapitalgesellschaft auf eine natürliche Person5.4 Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft5.4.1 Steuerfolgen bei der übertragenden Körperschaft5.4.2 Steuerfolgen bei der übernehmenden Körperschaft5.4.3 Auswirkungen auf die Körperschaftsteuer5.4.4 Auswirkung bei den Anteilseignern5.5 Spaltung einer Kapitalgesellschaft5.6 Einbringung in eine Kapitalgesellschaft (§ 20 UmwStG)5.6.1 Wahlrecht (§ 20 UmwStG)5.6.2 Voraussetzungen des Wahlrechts5.6.3 Rückwirkung5.6.4 Buchwertfortführung5.6.5 Zwischenwertansatz5.6.6 Ansatz des gemeinen Wertes5.6.7 Einbringung von Mitunternehmeranteilen5.6.8 Einbringung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (Anteilstausch)5.6.8.1 Ansatz durch die GmbH5.6.8.2 Folgen für den Gesellschafter5.6.9 Sperrfristbehaftete Anteile5.7 Einbringung in eine Personengesellschaft (§ 24 ff. UmwStG)5.7.1 Verhältnis zum Umwandlungsgesetz5.7.2 Voraussetzungen für das Wahlrecht5.7.3 Rechtsfolgen bei Buchwertansatz5.7.3.1 Bilanzierung und Abschreibung der Wirtschaftsgüter5.7.3.2 Korrekturen mittels Ergänzungsbilanzen5.7.4 Rechtsfolgen bei Zwischenwertansatz5.7.5 Rechtsfolgen bei Ansatz der gemeinen Werte5.7.5.1 Rückwirkung5.7.5.2 Einbringung von Beteiligungen5.7.5.3 Rechtsfolgen von ZuzahlungenKapitel V Haftungsfragen bei GesellschaftenTeil A VorbemerkungTeil B Haftung der »Vertreter« nach § 69 AO1 Haftender Personenkreis2 Die Pflichtverletzung3 Der Haftungsschaden3.1 Schaden in Form der Nichtfestsetzung bzw. teilweisen Nichtfestsetzung3.2 Schaden in Form der nicht rechtzeitigen Festsetzung3.3 Schaden bei der Erfüllung des Anspruches4 Verschulden5 Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden5.1 Grundsatz der anteiligen Tilgung5.2 Feststellung des Haftungsumfangs6 Umfang der HaftungTeil C Die Haftung nach weiteren Haftungsnormen1 Die Haftung des Steuerhinterziehers nach § 71 AO2 Die Haftung bei Organschaft nach § 73 AO3 Die Eigentümerhaftung nach § 74 AO4 Die Haftung des Betriebsübernehmers nach § 75 AO5 §§ 126, 128 HGB: Haftung der OHG-Gesellschafter6 § 161 Abs. 2 HGB: Haftung des Komplementärs7 § 171 HGB: Haftung des Kommanditisten8 Haftungslage bei einer (Außen-)GbRTeil D Der HaftungsbescheidStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6673-8
Bestell-Nr. 20240-0006
ePub:
ISBN 978-3-7910-6674-5
Bestell-Nr. 20240-0102
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6675-2
Bestell-Nr. 20240-0155
Walter Maier/Dieter Kies/Hartwig Maier
Besteuerung der Gesellschaften
8., überarbeitete und aktualisierte Auflage, November 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Breitscheidstr. 10, 70174 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Starkekonzepte, Christina Peter, Wörthsee
Produktmanagement: Rudolf Steinleitner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Autoren
Walter Maier
Rechtsanwalt und Steuerberater, em. Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Dieter Kies
em. Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Hartwig Maier
Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Bearbeiterübersicht:
Kies: Kapitel II Teile I, J; Kapitel III Teil L; Kapitel V
Maier, H.: Kapitel II Teile C, F, G; Kapitel III Teile A-K; Kapitel IV
Maier, W.: Kapitel I; Kapitel II Teile A, B, D, E, H
Vorwort zur 8. Auflage
Mit dieser Auflage verabschieden wir unseren Mit-Autor Herrn Professor Dr. Uwe Grobshäuser in den wohlverdienten Ruhestand, danken ihm herzlich für die hervorragende fachliche und persönliche Zusammenarbeit und wünschen ihm einen langen und gesunden Ruhestand. Seine Bearbeitungsteile wurden von Professor Dr. Hartwig Maier übernommen.
Dass das Steuerrecht einem stetigen Wandel unterliegt, ist nicht neu und bedarf keiner besonderen Erwähnung. Es ist schwierig geworden, bei den ständigen Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Sowohl die Studierenden der steuerlichen bzw. betriebswirtschaftlichen Fächer als auch die Praktikerinnen und Praktiker in der Finanzverwaltung, den Betrieben und der Steuerberatung können hiervon ein Lied singen. Beispielhaft sei nur auf die Rechtsprechung des EuGH in Sachen umsatzsteuerliche Organschaft hingewiesen, die in einer langen Reihe von Entscheidungen zu einem umfassenden Wandel in der deutschen Rechtstradition geführt hat.
Weitere Änderungen brachten das Wachstumschancengesetz und die Jahressteuergesetze der vergangenen Jahre. Dargestellt werden auch die umfangreichen Änderungen des Umwandlungssteuererlasses 2025. In diesem wurden die Gesetzesänderungen und die BFH-Rechtsprechung der vergangenen Jahre aufgenommen und die Verwaltungssicht dazu veröffentlicht. Der neue Umwandlungssteuererlass 2025 tritt an die Stelle des Erlasses vom 11.11.2011.
Eine immer größere Bedeutung erlangt zudem das internationale Steuerrecht. Wir haben daher an vielen Stellen den Blick über die Grenze gerichtet (z. B. bei der Besteuerung der Dividenden).
Dies alles machte es erforderlich, das Buch nunmehr bereits in achter, umfangreich überarbeiteter Auflage vorzulegen.
Wir bedanken uns bei unseren Lesern und Leserinnen für die Anregungen und Kritiken, die wir stets schätzen und in unsere weitere Arbeit einfließen lassen.
Ludwigsburg/Stuttgart im September 2025
Die Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
a. a. O.
am angegebenen Ort
ABl.
Amtsblatt
Abs.
Absatz
ADS
Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, Kommentar
AdV
Aussetzung der Vollziehung
AEAO
Anwendungserlass zur AO
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a. F.
alte Fassung
AfA
Absetzung für Abnutzung
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
Alt.
Alternative
AO
Abgabenordnung
ARAP
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
AReG
Abschlussprüfungsreformgesetz
Art.
Artikel
AStG
Außensteuergesetz
ATAD
Anti-Tax Avoidance Directive
Aufl.
Auflage
Az.
Aktenzeichen
BARefG
Berufsaufsichtsreformgesetz
BayObLG
Bayerisches Oberlandesgericht
BB
Betriebs Berater (Zeitschrift)
BC
Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling
Beih.
Beiheft
BEPS
Base Erosion and Profit Shifting
BetrAVG
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BeurkG
Beurkundungsgesetz
BewG
Bewertungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BFH/NV
Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH (Zeitschrift)
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Bundesgerichtshof in Zivilsachen
BiLiRiG
Bilanzrichtliniengesetz
BilMoG
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilReG
Bilanzrechtsreformgesetz
BilRUG
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BMF
Bundesministerium der Finanzen
BS
Buchungssatz
BSG
Bundessozialgericht
BStBl
Bundessteuerblatt
Buchst.
Buchstabe
BürgEntlG
Bürgerentlastungsgesetz
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Zeitschrift)
BW
Buchwert
bzw.
beziehungsweise
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
DBA
Doppelbesteuerungsabkommen
d. h.
das heißt
DiRUG
Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie
DMBilG
Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung
DSrRK
Deutsches Steuerrecht kurzgefasst (Zeitschrift)
DStJG
Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e. V.
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DStRE
Deutscher Steuerrecht-Entscheidungsdienst
EBITDA
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EFG
Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift)
EFH
Einfamilienhaus
EG
Europäische Gemeinschaft
eGbR
eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts
EGHGB
Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EK
Eigenkapital
ErbStB
Der Erbschaft-Steuerberater (Zeitschrift)
ESt
Einkommensteuer
EStB
Der Einkommensteuer-Berater (Zeitschrift)
EStDV
Einkommensteuerdurchführungsverordnung
EStG
Einkommensteuergesetz
EStH
Einkommensteuerhinweise
EStR
Einkommensteuerrichtlinien
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWIV
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
EWIVG
EWIV-Ausführungsgesetz
EuZW
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
f., ff.
folgende, fortfolgende
FG
Finanzgericht
FGG
Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
FGO
Finanzgerichtsordnung
FinMin
Finanzministerium
FR
Finanzrundschau (Zeitschrift)
GBO
Grundbuchordnung
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
gem.
gemäß
GenG
Genossenschaftsgesetz
GesRV
Gesellschaftsregisterverordnung
GewSt
Gewerbesteuer
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GewStH
Gewerbesteuer-Hinweise
GewStR
Gewerbesteuerrichtlinien
GG
Grundgesetz
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
GmbH-Gesetz
GmbHR
GmbH-Rundschau (Zeitschrift)
grds.
grundsätzlich
GrESt
Grunderwerbsteuer
GrEStG
Grunderwerbsteuergesetz
GrS
Großer Senat
gUG
gemeinnützige Unternehmergesellschaft
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
GWG
Geringwertiges Wirtschaftsgut
H
Hinweis
H/H/S
Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Kommentar (Loseblatt)
HGB
Handelsgesetzbuch
h. L.
herrschende Lehre
h. M.
herrschende Meinung
HRefG
Handelsrechtsreformgesetz
HS
Halbsatz
IAS
International Accounting Standards
i. d. F.
in der Fassung
i. d. R.
in der Regel
IFRS
International Financial Reporting Standards
i. G.
in Gründung
i. H. d.
in Höhe der/des
i. H. v.
in Höhe von
i. R. d.
im Rahmen der/des
i. S. d.
im Sinne der/des
i. S. v.
im Sinne von
InsO
Insolvenzordnung
InvZul
Investitionszulage
IStR
Internationales Steuerrecht (Zeitschrift)
i. V. m.
in Verbindung mit
JStG
Jahressteuergesetz
JuS
Juristische Schulung (Zeitschrift)
Kap.
Kapitel
KapCoRiLiG
Kapitalgesellschaften- und Co-Richtlinie-Gesetz
KapESt
Kapitalertragsteuer
KG
Kommanditgesellschaft
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KöMogG
Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts
KÖSDI
Kölner Steuerdialog (Zeitschrift)
KSt
Körperschaftsteuer
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KStH
Körperschaftsteuerhinweise
KStR
Körperschaftsteuerrichtlinien
LG
Landesgericht
LSt
Lohnsteuer
LStR
Lohnsteuerrichtlinien
Ltd.
Limited
m. E.
meines Erachtens
MgVG
Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz
MicroBilG
Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz
Mitbest
Mitbestimmung
MitbestG
Mitbestimmungsgesetz
MoMiG
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
MontanMitbestG
Montanmitbestimmungsgesetz
MoPeG
Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
MwStSystRL
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie
n. F.
neue Fassung
NJW
Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
Nr.
Nummer
n. v.
nicht veröffentlicht
NWB
Neue Wirtschaftsbriefe
NZG
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
o. Ä.
oder Ähnliche/s
OECD
Organisation of Economic and Cultural Development
OFD
Oberfinanzdirektion
o. g.
oben genannt
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OLG
Oberlandesgericht
PartG
Partnerschaftsgesellschaft
PartGG
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PartGmbB
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
p. a.
per annum
PRAP
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PublG
Publizitätsgesetz
R
Richtlinie
RL
Richtlinie
Rn.
Randnummer
Rs.
Rechtssache
Rspr.
Rechtsprechung
Rz.
Randziffer
S.
Seite
s.
siehe
S. A. R. L.
Société à responsabilité limitée
SBV
Sonderbetriebsvermögen
SCE
Societas Cooperativa Europaea (Europäische Gemeinschaft)
SE
Societas Europaea (Europäische Aktiengesellschaft)
SEStEG
Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
Slg.
Sammlung
s. o.
siehe oben
sog.
sogenannte/r/s
SolZ
Solidaritätszuschlag
SolZG
Solidaritätszuschlaggesetz
SPE
Societas Privata Europaea (Europäische Privatgesellschaft)
st.
ständige
StÄndG
Steueränderungsgesetz
StBerG
Steuerberatungsgesetz
StEntlG
Steuerentlastungsgesetz
SteuerStud
Steuer und Studium (Zeitschrift)
SteuK
Steuerrecht kurzgefaßt (Zeitschrift)
Stbg
Die Steuerberatung (Zeitschrift)
StGB
Strafgesetzbuch
Stpfl., stpfl.
Steuerpflichtige/r, steuerpflichtig
str.
strittig
StuB
Unternehmensteuern und Bilanzen (Zeitschrift)
StuW
Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
Teilbd.
Teilband
TW
Teilwert
Tz.
Textziffer
UG
Unternehmergesellschaft
UmwG
Umwandlungsgesetz
UmwStG
Umwandlungssteuergesetz
UntStFG
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz
UntStRefG
Unternehmenssteuerreformgesetz
USt
Umsatzsteuer
UStAE
Umsatzsteuer-Anwendungserlass
UStG
Umsatzsteuergesetz
USt-Id. Nr.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
u. U.
unter Umständen
vGA
verdeckte Gewinnausschüttung
vgl.
vergleiche
VO
Verordnung
VuV
Vermietung und Verpachtung
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VZ
Veranlagungszeitraum
WachsBeschlG
Wachstumsbeschleunigungsgesetz
WiPrO
Wirtschaftsprüferordnung
Wj.
Wirtschaftsjahr
WPg
Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
z. B.
zum Beispiel
ZIP
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO
Zivilprozessordnung
zzgl.
zuzüglich
Kapitel I Einführung
1 Grundsätzliche Unterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften
Zwischen Buchführung und Bilanzierung der Personen- und der Kapitalgesellschaften bestehen beträchtliche Unterschiede, die sich aus der unterschiedlichen Rechtsstellung ergeben. Die Unterschiede schlagen sich u. a. im Betriebsvermögen, der Finanzierung der Beteiligung, den Kapitalkonten, der Gewinnausschüttung und Gewinnverteilung, der Behandlung von Verlusten, der Haftung der Gesellschafter, der Einflussrechte auf die Geschäftsführung, den Publizitätspflichten, den besonderen Rechtsgeschäften zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern und den Gesellschaftervergütungen nieder.
Personengesellschaften
Kapitalgesellschaften
Rechtsform
GbR, OHG, KG, PartG, stille Gesellschaft
GmbH, AG, UG, KGaA, UG, e. G.
Haftung
Persönliche Haftung der Gesellschafter
Haftung beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen
Besteuerung
ESt der Gesellschafter
KSt der Gesellschaft
Geschäftsführung
Gesellschafter arbeiten im Unternehmen
Geschäftsführung durch angestellte Geschäftsführer oder Vorstände
Gründungskapital
Kein festgelegtes Gründungskapital
Mindestkapital gesetzlich vorgeschrieben
Gewinn-/Verlustverteilung
Nach Vereinbarung oder gesetzlicher Regelung
Nach Anteilen am Kapital
Rechtsfähigkeit
Natürliche Personen
Juristische Personen
Bei den Personengesellschaften (GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG) sind die Ebene der Gesellschaft und die Ebene der Gesellschafter zu unterscheiden.
Das Vermögen der Gesellschaft war nach altem Recht Gesamthandsvermögen; im Eigentum des Gesellschafters stehende Wirtschaftsgüter, die einen betrieblichen Bezug zur Gesellschaft haben, waren SBV des Gesellschafters. Durch das MoPeG wurde ab 01.01.2024 das Gesamthandsprinzip für alle Personengesellschaften abgeschafft. Nach § 713 BGB sind die Beträge der Gesellschafter sowie die für oder durch die Gesellschaft erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten Vermögen der Gesellschaft.
Für jeden Gesellschafter wird mindestens ein Kapitalkonto und mindestens ein Privatkonto geführt. Die Gesellschafter sind steuerlich Mitunternehmer.
Die Gesellschaft ist zwar Subjekt der Gewinnermittlung, aber nicht Subjekt der Einkommensbesteuerung. Gewinne der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Erwirtschaftung einkommensteuerlich nicht der Gesellschaft, sondern den Gesellschaftern zuzurechnen (TransparenzprinzipTransparenzprinzip).
Zwischen thesaurierten und ausgeschütteten Gewinnen wird bei der Einkünfteermittlung nicht unterschieden. Auch nicht entnommene Gewinne werden den Mitunternehmern periodengerecht anteilig nach dem Gewinnverteilungsschlüssel zugerechnet.
Verluste sind den Gesellschaftern ebenso wie Gewinne im Zeitpunkt der Erwirtschaftung zuzurechnen. Die Gesellschafter können Verluste aus dem Gesamthandsvermögen gesellschaftsintern mit Gewinnen aus ihrem SBV, horizontal mit Gewinnen aus anderen Gewerbebetrieben oder vertikal mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgleichen. Nicht ausgeglichene Verluste unterliegen dem Verlustabzug nach § 10d EStG; dabei gilt die Begrenzung des Verlustrücktrags i. H. v. 1 Mio. € für jeden einzelnen Gesellschafter. Lediglich bei beschränkt haftenden Gesellschaftern gelten Beschränkungen bei der steuerlichen Berücksichtigung von Verlusten (§ 15a EStG).
Verlustbedingte Teilwertabschreibungen auf Beteiligungen an Personengesellschaften sind nicht zulässig.
Schuldrechtliche Beziehungen zwischen der Personengesellschaft und ihren Gesellschaftern in Bezug auf Dienstleistungen, Kapitalzuführungen und Nutzungsüberlassungen werden steuerlich nicht anerkannt, sondern führen zu gewerblichen Vorabgewinnen oder Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben der Gesellschafter (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG).
Im Bilanzsteuerrecht wird die additive Methode angewendet, die aus der Handelsbilanz der Gesellschaft sowie aus den Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter die steuerliche Gesamtbilanz der Gesellschaft ableitet.
Bei den Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, KGaA) ist die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Haftbar ist die Gesellschaft als juristische Person. Die Gesellschafter haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.
Bei der Kapitalgesellschaft gibt es nur notwendiges Betriebsvermögen. Gewillkürtes Betriebsvermögen und eine Privatsphäre der Gesellschafter innerhalb der Kapitalgesellschaft in der Form von Privatkonten sind nicht denkbar. Alle Wirtschaftsgüter im Eigentum der Gesellschaft gehören zum Betriebsvermögen der Gesellschaft, selbst wenn sie nicht der Einkunftserzielung, sondern privaten Zwecken der Anteilseigner dienen. Wenn es an fremdüblichen Vereinbarungen fehlt, wird die Korrektur über das Rechtsinstitut der vGA vorgenommen.
Wirtschaftsgüter im Eigentum der Gesellschafter gehören nicht zum Betriebsvermögen der Gesellschaft, selbst wenn sie betrieblichen Zwecken dienen. SBV der Gesellschafter gibt es nicht.
Gewinne sind im Zeitpunkt der Erwirtschaftung insgesamt der Kapitalgesellschaft zuzurechnen und von ihr zu versteuern (TrennungsprinzipTrennungsprinzip). Sie erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 8 Abs. 2 KStG).
Nur wenn Gewinne ausgeschüttet werden, unterliegen sie zusätzlich der Besteuerung bei den Gesellschaftern. Die Einkunftsart richtet sich danach, ob die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft von den Gesellschaftern im Privatvermögen oder in einem Betriebsvermögen gehalten wird. Es kommt also seit der Abschaffung des körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahrens, das in der Zeit zwischen 1977 und 2000 galt, wieder wie früher zur Doppelbesteuerung der Gewinne sowohl bei der Gesellschaft als auch bei den Gesellschaftern. Sofern der Gesellschafter eine natürliche Person ist, wird auf die Ausschüttung KSt bei der Kapitalgesellschaft und ESt beim Gesellschafter erhoben. Ist der Anteilseigner der Kapitalgesellschaft seinerseits eine Kapitalgesellschaft, ist die Ausschüttung nach § 8b Abs. 1 KStG steuerfrei, allerdings im Ergebnis nur zu 95 %, da 5 % der Beteiligungserträge gem. § 8b Abs. 5 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt werden.
Während Gewinne einer Personengesellschaft von den Gesellschaftern der Personengesellschaft ohne Rücksicht auf die Gewinnverwendung periodengerecht im Jahr der Erwirtschaftung zu versteuern sind, werden Gewinne einer Kapitalgesellschaft bei den Gesellschaftern der Kapitalgesellschaft im Fall der Ausschüttung grds. nach dem Zuflussprinzip (§ 11 EStG) im Zeitpunkt der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht als Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) versteuert, wenn die Beteiligung Privatvermögen ist. Lediglich bei Alleingesellschaftern oder beherrschenden Gesellschaftern wird auf den Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses abgestellt.
Wenn die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft im Betriebsvermögen eines bilanzierenden Gewerbetreibenden gehalten wird, ist der Beteiligungsertrag steuerlich im Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses gem. § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu erfassen. Befindet sich die Beteiligung im Betriebsvermögen eines Einnahmen-Überschuss-Rechners nach § 4 Abs. 3 EStG, gilt für die Erfassung der ausgeschütteten Erträge das Zuflussprinzip (§ 11 EStG).
Verluste sind ausschließlich dem Gewerbebetrieb der Kapitalgesellschaft zuzurechnen. Ein Verlustausgleich mit anderen Einkünften ist nicht möglich. Aufgrund des Trennungsprinzips können die Gesellschafter Verluste steuerlich nicht berücksichtigen. Lediglich für die Gesellschaft ist der Verlustabzug anwendbar (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 10d EStG). Deshalb gilt die Beschränkung des Verlustrücktrags auf 1 Mio. € unabhängig von der Zahl der Gesellschafter nur für die Gesellschaft. Der Verlustvortrag setzt die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Kapitalgesellschaft voraus (§ 8 Abs. 4 Satz 1 KStG). Nach einem schädlichen Beteiligungserwerb können nicht genutzte Verluste gem. § 8c KStG grds. nicht mehr geltend gemacht werden.
Bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im Betriebsvermögen kommt eine verlustbedingte Teilwertabschreibung in Betracht. Bei wesentlichen Beteiligungen im Privatvermögen können Veräußerungsverluste im Rahmen des § 17 EStG nach dem Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Buchst. c EStG, § 3c Abs. 2 EStG) zu 60 % ausgeglichen und nach § 10d abgezogen werden, sofern die Beteiligung nicht innerhalb der letzten fünf Jahre unentgeltlich erworben worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 6 EStG). Bei nicht wesentlichen Beteiligungen unterfallen Veräußerungsverluste der Vorschrift des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG und können gem. § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG nicht mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen oder abgezogen werden.
Zwischen der Kapitalgesellschaft und ihren Gesellschaftern können auch steuerlich wirksame Verträge geschlossen werden. Miet- oder Zinszahlungen an Gesellschafter führen beispielsweise bei der Kapitalgesellschaft zu Betriebsausgaben und beim Gesellschafter zu privaten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) oder aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG), soweit sie einem Fremdvergleich standhalten. Überhöhte Zuwendungen an die Gesellschafter führen zu vGA.
Die zum Ausgleich der rechtsformbedingten Unterschiede zwischen Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft geschaffenen Vorschriften beseitigen die steuerlich abweichende Erfassung der Ergebnisse nur unzureichend.
Aufgrund von § 34a EStG können bilanzierende Personenunternehmer den nicht entnommenen Gewinn ebenfalls einer abgesenkten Thesaurierungsbelastung unterwerfen (vgl. II F 2).
§ 35 EStG verfolgt das Ziel, gewerbliche Personenunternehmen durch eine pauschale Teilanrechnung der GewSt auf die ESt von der GewSt zu entlasten (vgl. II G 9).
2 Buchführung und Bilanzierung
2.1 Handelsbilanz- und Steuerbilanzrecht
2.1.1 Handelsbilanz
Der Zweck der Handelsbilanz ist mehrfacher Natur. Die Handelsbilanz soll entweder direkt die Ausschüttungen beeinflussen (Ausschüttungssperre, Mindestausschüttung) oder Informationen gewähren über die Ausschüttungserwartungen, über die Veränderung der Ausschüttungserwartungen (Leistungsfähigkeitsentwicklung), über die Schuldendeckungsfähigkeit und im Wege der Dokumentation über die Zugriffsobjekte (Moxter, Bilanzlehre Bd. I, Einführung in die Bilanztheorie). Buchführung und Bilanzierung sind handelsrechtlich für alle Kaufleute ‒ sowohl Einzelunternehmer als auch Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und Genossenschaften ‒ im dritten Buch des HGB geregelt (Handelsbücher §§ 238‒339 HGB). Die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen vor Gewinnverkürzungen schützen, Kapitalschutz gewährleisten und dem Kaufmann sowie Dritten die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen. Die Handelsbilanz soll in Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ausschüttung eines zu hohen Gewinns verhindern, räumt aber erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten und Wahlrechte ein.
Der Gesetzgeber hielt im Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG vom 25.05.2009 BStBl I 2009, 650) an dem Konzept der multifunktionalen Zwecksetzung des handelsrechtlichen Abschlusses unter dem Primat der Ausschüttungsbemessung fest (Lorson, in: Küting/Pfitzer/Weber, Das neue deutsche Bilanzrecht, 2. Aufl., Stuttgart 2009). Damit steht im HGB nach wie vor der Gläubigerschutz an erster Stelle. Die Aussagekraft der Handelsbilanz über die Vermögens- und Ertragslage wurde durch die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit verbessert. Bis 31.12.2009 waren steuerliche Wahlrechte bei der Gewinnermittlung in Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jahresbilanz auszuüben; korrespondierende einkommensteuerrechtliche Wahlrechte durften in Handels- und Steuerbilanz nicht unterschiedlich ausgeübt werden. Dies konnte zur »Verfälschung« der Handelsbilanz führen. § 5 Abs. 1 Satz 1 2. HS EStG sieht ab 2010 ausdrücklich vor, dass die Maßgeblichkeit nicht gilt, sofern von einem steuerlichen Ansatzwahlrecht für einen anderen Ansatz Gebrauch gemacht wird. Anstelle der Bilanzierung in der Handelsbilanz ist die einzige Voraussetzung für die Ausübung steuerlicher Wahlrechte, dass die Wirtschaftsgüter, die nicht mit dem handelsrechtlich maßgeblichen Wert in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse aufgenommen werden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG). Die Generalklausel des § 5 Abs. 6 EStG ordnet überdies an, dass die steuerlichen Vorschriften über Entnahmen und Einlagen, über die Zulässigkeit der Bilanzänderung, über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die Absetzung für Abnutzung zu befolgen sind. Auch bei diesen steuerlich bindenden Ansätzen ist die Handelsbilanz für die Steuerbilanz nicht maßgebend.
Beispiel
Die X-OHG bewertet den hergestellten Warenbestand mit einem unter dem am Bilanzstichtag beizulegenden Wert (=Teilwert) liegenden Wert gem. § 253 Abs. 4 HGB.
Lösung: Der in der Steuerbilanz zulässige niedrigste Wert ist der Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). Deshalb darf in der Steuerbilanz der handelsrechtlich zulässige Wert nicht verwendet werden. Es ist steuerlich zwingend der Teilwert anzusetzen, sofern er voraussichtlich auf Dauer bestehen bleibt.
2.1.2 Steuerbilanz
Der Zweck der steuerlichen Gewinnermittlung und der Steuerbilanz besteht in der periodengerechten Ermittlung des »vollen« steuerlichen Gewinns (BFH GrS vom 03.02.1969 BStBl II 1969, 291). Die Kernbereiche des Bilanzsteuerrechts umfassen aufgrund des Maßgeblichkeitsgrundsatzes der Handelsbilanz für die Steuerbilanz (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG) die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit nicht steuerliche Spezialvorschriften anwendbar sind (§ 5 Abs. 6 EStG). Zwingendes Steuerrecht ist vorrangig. Handelsbilanzielle Wahlrechte werden im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung eingeschränkt. Handelsrechtliche Aktivierungswahlrechte führen zu steuerlichen Aktivierungsgeboten, handelsrechtliche Passivierungswahlrechte zu steuerlichen Passivierungsverboten.
Die Steuerbilanz ist bei Gewerbetreibenden grds. die steuerrechtlich korrigierte Handelsbilanz. Abweichungen ergeben sich aus steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorbehalten, z. B. in § 5 Abs. 3, 4b EStG. Insbesondere sind die §§ 4‒7k EStG zu beachten, die auch im Bereich der KSt und der GewSt anwendbar sind (§ 8 Abs. 1 KStG, § 7 Abs. 1 GewStG). Das Bilanzsteuerrecht ist nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit und Tatbestandsmäßigkeit sowie der Systemgerechtigkeit der Besteuerung auszulegen. Das Steuerrecht geht bei der Gewinnermittlung gem. § 4 Abs. 1, § 5 EStG vom Betriebsvermögensvergleich (Bestandsvergleich) aus. Gewinn ist die Differenz zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wj. und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wj., vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen.
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung einer Steuerbilanz besteht nicht. Der Steuererklärung ist eine Abschrift der Bilanz, die auf dem Zahlenwerk der Buchführung beruht, und der GuV beizufügen (§ 60 Abs. 1 EStDV, zur elektronischen Übermittlung s. 2.4). Die Bilanz ist nach handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. Wenn sie Ansätze oder Beträge enthält, die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen, sind diese Ansätze oder Beträge den steuerlichen Vorschriften anzupassen (§ 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV). Der Stpfl. kann auch eine den steuerlichen Vorschriften entsprechende Steuerbilanz beifügen (§ 60 Abs. 2 Satz 2 EStDV). In der Praxis leiten die meisten Unternehmen bisher die Steuerbilanz aus der Handelsbilanz in Form einer Überleitungsrechnung ab. Sie enthält eine Gegenüberstellung der Handels- und Steuerbilanzwerte mit den Vermögensunterschieden und den Ergebnisunterschieden der einzelnen Bilanzposten. Der Gewinnunterschied wird in der Steuererklärung als Überleitungsbetrag vom Handelsbilanz- zum Steuerbilanzergebnis erfasst.
Dies war bisher praktikabel, da die handelsbilanziellen Ansätze i. d. R. für steuerliche Zwecke maßgeblich waren. Aufgrund des BilMoG wurde jedoch die formelle Maßgeblichkeit weitgehend durch einen eigenständigen steuerlichen Wahlrechtsvorbehalt außer Kraft gesetzt. Handelsrechtliche Wertansätze sind für Zwecke der Besteuerung nur maßgeblich, wenn kein anders lautendes steuerliches Wahlrecht existiert und angewendet wird (§ 5 Abs. 1 Satz 1 letzter HS EStG). Voraussetzung für die Ausübung steuerlicher Wahlrechte ist, dass die Wirtschaftsgüter, die nicht mit dem handelsrechtlich maßgeblichen Wert in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse aufgenommen werden. In den Verzeichnissen sind der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Vorschrift des ausgeübten steuerlichen Wahlrechts und die vorgenommenen Abschreibungen nachzuweisen (§ 5 Abs. 1 Satz 2, 3 EStG). Dadurch weichen die Ansätze in Handels- und Steuerbilanz häufiger voneinander ab als bisher. Der Vorteil der neuen Regelungen liegt darin, dass Unternehmen im Rahmen ihrer Steuerstrategie eine eigenständige Steuerbilanzpolitik verfolgen können, die sich nicht unmittelbar auf das ausschüttbare Ergebnis auswirkt. Beispielsweise können durch steuerlich höhere Abschreibungen Steuerzahlungen in die Zukunft verschoben und dadurch dem Unternehmen zeitweise höhere liquide Mittel verschafft werden. Dies kann zu einer teilweisen Entkoppelung der Steuerbilanz von der handelsrechtlichen Darstellung des Eigenkapitals und des Ergebnisses führen. Unternehmen stellen inzwischen vermehrt bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses und auch unterjährig eine Steuerbilanz auf, um den zutreffenden Aufwand und die Steuerrückstellungen zu ermitteln.
2.2 Buchführungspflicht nach Handelsrecht
Nach den handelsrechtlichen Vorschriften sind Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften verpflichtet, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu erstellen (§§ 238‒263 HGB). Weitere Sondervorschriften gelten für:
Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, SE, GmbH, §§ 264‒335 HGB),
bestimmte Personenhandelsgesellschaften (GmbH & Co. KG, §§ 264‒264c HGB),
Aktiengesellschaften (§ 91 AktG),
GmbH (§ 41 GmbHG),
eingetragene Genossenschaften (§§ 336‒339 HGB, § 33 GenG),
Unternehmen bestimmter Rechtszweige (§§ 340‒341o HGB).
Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG) sind als Kaufleute buchführungspflichtig, wenn die zusammengeschlossenen Personen gemeinschaftlich ein Handelsgewerbe betreiben (§§ 1, 105, 161 HGB). Lediglich wenn das Handelsgewerbe keinen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, ist die Personengesellschaft nur dann Kaufmann, wenn ihre Firma im Handelsregister eingetragen ist (§§ 2, 105 Abs. 2, 161 Abs. 2 HGB).
Kapitalhandelsgesellschaften (GmbH, AG, KGaA) sind kraft Rechtsform Kaufleute (Formkaufleute, § 6 HGB, §§ 1, 13 Abs. 3 GmbHG, § 3 AktG). Unter die Formkaufleute fallen auch die eingetragenen Genossenschaften (§ 17 Abs. 2 GenG).
Zur Buchführung verpflichtete Personen
Einzelfirma
Kaufmann/Inhaber des Handelsgewerbes
Personenhandelsgesellschaft
Gesetzlich vertretungsberechtigten Organe (§§ 114, 164 HGB)
GmbH
Geschäftsführer (§ 41 GmbHG)
AG
Vorstand (§ 91 AktG)
Genossenschaft
Vorstand (§ 33 GenG)
Die Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und Erstellung eines Inventars gem. § 241a HGB bei Erlösen von nicht mehr als 600 000 € und einen Jahresüberschuss von nicht mehr als 60 000 € gilt nicht für Personen- und Kapitalgesellschaften, sondern nur für Einzelkaufleute.
2.3 Buchführungspflicht nach Steuerrecht
2.3.1 Abgeleitete (derivative) Buchführungspflicht
Nach der Abgabenordnung sind steuerlich die originäre und die abgeleitete (derivative) Buchführungspflicht zu unterscheiden.
Die abgeleitete, nach anderen gesetzlichen Vorschriften bestehende Verpflichtung zur Führung von Büchern ist auch steuerlich zu beachten. Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat diese Verpflichtungen auch für die Besteuerung zu erfüllen (§ 140 AO). Damit sind vor allem Gewerbetreibende erfasst, die als Kaufleute handelsrechtlich verpflichtet sind, Bücher zu führen und Abschlüsse zu erstellen.
2.3.2 Originär steuerliche Buchführungspflicht
Über das Handelsrecht und die aus § 140 AO folgende Buchführungspflicht hinaus knüpft § 141 AO an die Größe und Ertragskraft des Unternehmens an und legt für gewerbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte eine erweiterte steuerliche Buchführungspflicht fest. Diese originär steuerliche Buchführungspflicht entsteht, wenn in dem einzelnen Betrieb mindestens eine der folgenden Grenzen überschritten ist:
Umsätze einschließlich der nicht steuerbaren Auslandsumsätze und der steuerfreien Umsätze, ausgenommen die Umsätze nach § 4 Nr. 8‒10 UStG, von mehr als 600 000 € im Kalenderjahr oder
selbst bewirtschaftete Land- und forstwirtschaftliche Flächen mit einem Wirtschaftswert (§ 46 BewG) von mehr als 25 000 € oder
ein Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 60 000 € im Wj. oder
ein Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 60 000 € im Kalenderjahr.
2.4 E-Bilanz (§ 5b EStG)
Im Rahmen des Steuerbürokratieabbaugesetzes 2008 wurde in § 5b EStG die elektronische Übermittlung des Inhalts der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer Überleitungsrechnung bestimmt. Auf dieser gesetzlichen Grundlage werden Steuererklärungen und weitere steuererhebliche Unterlagen von den Unternehmen papierlos elektronisch und kostensparend an die Finanzverwaltung übermittelt. Schon bisher mussten Unternehmen Lohn- und Umsatzsteuervoranmeldungen elektronisch übermitteln. Dies gilt nunmehr auch für die Gewinnfeststellung von Personengesellschaften, die KSt und die GewSt. Nach § 5b Abs. 1 EStG besteht für Unternehmen die Verpflichtung, den Inhalt der Bilanz und weiterer Daten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln:
E-Bilanz;
Gewinn- und Verlustrechnung;
Ergebnisverwendung;
Kapitalkontenentwicklung (bei Personenhandelsgesellschaften und anderen Mitunternehmerschaften);
steuerliche Gewinnermittlung (bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften);
steuerliche Modifikationen (insbesondere Umgliederung, Überleitungsrechnung).
Die E-Bilanz ist Pflicht für alle bilanzierenden Unternehmen, die ihren Gewinn nach §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 5a EStG ermitteln. Der Inhalt der E-Bilanz wird über sog. Taxonomien definiert, die sich zwar an der Gliederung der §§ 266, 275 HGB orientieren, jedoch umfangreiche Ergänzungen zur Anpassung an steuerliche Vorschriften vorsehen. Die jeweils jährlich aktualisierten Taxonomien stehen unter www.esteuer.de zum Abruf bereit (BMF-Schreiben vom 21.06.2022 ‒ IV C 6-S 2133-b/21/10002 : 003, BStBl I 2022, 954). Der Begriff TaxonomieTaxonomie umreißt einen erweiterten Kontenrahmen, den die Finanzverwaltung als Mindeststandard definiert. Die E-Bilanz erfordert damit deutlich detailliertere Informationen als die bisherige Steuererklärung. Die hohe Gliederungstiefe der E-Bilanz wird in der Literatur kritisiert (Herzig, DB 2011, 1; Schiffers, Stbg 2011, 7; Weber-Grellet, BB 2011, 43). Größenabhängige Erleichterungen sind nicht vorgesehen. Die steuerliche Berichterstattung beeinflusst dadurch die Ausgestaltung des Rechnungswesens weit mehr als bisher. Es kommt auch zu einer erheblichen Ausweitung der steuerlichen Berichtspflichten. Das neue Verfahren bringt aber wesentliche Vorteile für Stpfl. und Finanzverwaltung. Die Daten aus dem Rechnungswesen gelten für die Steuerberechnung im Jahresabschluss und in den Steuererklärungen. Doppelarbeiten durch manuelle Eingaben entfallen. Auch Aktualisierungen im Rechnungswesen fließen automatisch in die Steuerberechnung ein. Weil die Bilanz in verschiedene Kennziffern unterteilt elektronisch an das Finanzamt übermittelt wird, kann die Betriebsprüfung nach Prüffeldern kennzahlengestützt geplant und durchgeführt werden.
Die Einführung der E-Bilanz erfolgt im Rahmen des bund-/länderübergreifenden Verwaltungsabkommens KONSENS (»Koordinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung«). Die wesentlichen Grundlagen wurden erstmals im Schreiben des BMF vom 19.01.2010 (BStBl I 2010, 47) beschrieben. Wenn Unternehmen sich nicht an die Verordnung halten, droht ihnen die Festsetzung von Zwangsgeldern (§ 328 AO). Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die Finanzverwaltung unter bestimmten Umständen bei kleineren Unternehmen auf die elektronische Datenübermittlung verzichten (§ 5b Abs. 2 Satz 2 EStG i. V. m. § 150 Abs. 8 AO). Zur weiteren Entwicklung vgl. Ellrott/Krämer, in: Beck’scher Bilanzkommentar § 266 HGB Rz. 300 ff. m. w. N.; Kowallik/Bongaerts, DB Beil. 4/16; Rippolt, StuB 2017, 544; Winnefeld, Bilanzhandbuch, Rn. 1141 ff.). Das Datenschema der Taxonomien als amtlich vorgeschriebener Datensatz nach § 5b EStG wurde veröffentlicht (BMF vom 02.07.2019 DStR 2019, 1469) und steht unter www.esteuer.de zum Herunterladen bereit.
3 Buchmäßige Besonderheiten in der Bilanz der Personengesellschaft
3.1 Bilanzierung
Für alle Kaufleute gilt, dass die Bilanz übersichtlich, vollständig und einheitlich gegliedert aufzustellen ist. Nach § 247 Abs. 1 HGB sind in der Bilanz das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten gesondert auszuweisen und hinreichend aufzugliedern. Das HGB enthält kein für alle Kaufleute verbindliches Gliederungsschema. Die Steuerberaterkammern empfehlen, die Bilanz auch bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften nach der Gliederungsvorschrift des § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften vorzunehmen. Aus Gründen der Bilanzklarheit sollte die Bilanzgliederung von Personengesellschaften zumindest die folgenden Bilanzpositionen ausweisen.
Schema einer verkürzten Bilanz für Personengesellschaften
Aktiva
Passiva
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks
C. Rechnungsabgrenzungsposten
A. Eigenkapital
Kapital Gesellschafter X
Kapital Gesellschafter Y
B. Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Besonderheiten gelten für GmbH & Co. KG (§§ 264a‒c HGB). Aufgrund des Generalverweises in § 264a Abs. 1 HGB sind grds. die für Kapitalgesellschaften gültigen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264‒330 HGB anwendbar. Gewisse Befreiungsmöglichkeiten bestehen, wenn der Jahresabschluss in einen Konzernabschluss einbezogen wird (§ 264b HGB).
Weitere Besonderheiten gelten darüber hinaus für Personengesellschaften, die unter das Publizitätsgesetz fallen. Dies ist der Fall, wenn die Personengesellschaft gem. § 1 Abs. 1 PublG an drei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen mindestens zwei der einschlägigen Merkmale überschreitet (65 Mio. € Bilanzsumme, 130 Mio. € Umsatz, 5 000 Arbeitnehmer).
3.2 Kapitalkonten
Für jeden Personengesellschafter wird handelsrechtlich mindestens ein KapitalkontoKapitalkonto geführt. Im Regelfall gibt es für jeden Personengesellschafter jedoch zwei oder mehrere Kapitalkonten. Wenn für den Gesellschafter zwei Kapitalkonten geführt werden, werden diese wie folgt gegliedert:
Festkapital (Kapitalkonto I), welches das im Gesellschaftsvertrag festgelegte Beteiligungskapital ausweist,
variables Kapitalkonto (Kapitalkonto II, auch als Darlehenskonto, Verrechnungsskonto o. Ä. bezeichnet), auf dem die Privatkonten verrechnet und die Gewinnanteile gutgeschrieben werden.
Gem. § 246 Abs. 1 HGB ergibt sich das handelsbilanzielle Eigenkapital aus dem Saldo der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Höhe des als bilanzielles Eigenkapital auszuweisenden Saldos zwischen Aktiva und Schulden hängt bei Personengesellschaften von der Abgrenzung zwischen Gesellschafterkapital und schuldrechtlichen Gesellschafteransprüchen ab. Der für alle Kaufleute geltende § 247 Abs. 1 HGB regelt, dass das Eigenkapital in der Bilanz »gesondert auszuweisen und hinreichend aufzugliedern« ist. Weder im HGB noch im EStG sind Regelungen zu der Abgrenzung enthalten, ob eine Kapitalüberlassung eines Mitgesellschafters einer Personengesellschaft eine Eigen- oder eine Fremdkapitalgewährung ist. Die Kapitalaufbringung ist für die GbR in §§ 705, 706 BGB geregelt, für die OHG i. V. m. § 105 Abs. 3 HGB und für die KG i. V. m. § 161 Abs. 2 HGB, jedoch jeweils abstrakt, ohne Abgrenzung zwischen Eigen- und Fremdkapital. Nach der Rspr. liegt Gesellschaftereigenkapital vor, wenn gegen das Konto laufende Verluste gebucht werden (BFH vom 15.05.2008, IV R 46/05, DStR 2008, 1577; BFH vom 16.10.2008, IV R 98/06, BStBl II 2009, 272; Eggert, BBK 2016, 830). Ausreichend ist auch eine Verlustverrechnung im Ausscheidens- oder Liquidationsfall. Eine solche Verrechnung liegt vor, wenn das Gesellschafterkonto in die Ermittlung des Abfindungsguthabens einbezogen wird (Ley, DStR 2003, 957).
Bei der KG gelten Besonderheiten. Die Haftung des Kommanditisten ist auf die von ihm geleistete Einlage beschränkt (§ 172 HGB). An dem Verlust nimmt der Kommanditist nur bis zum Betrag seines Kapitalanteils und seiner noch rückständigen Einlage teil (§ 167 Abs. 3 HGB). Wegen dieser besonderen Rechtsstellung wird das Kapitalkonto des Kommanditisten regelmäßig aufgeteilt. Der auf ihn entfallende Gewinn wird so lange seinem Kapitalanteil auf dem Konto Kommanditeinlage zugeschrieben, als dieser den Betrag der bedungenen Einlage nicht erreicht (§ 167 Abs. 2 HGB). Ist die Einlage vollständig erbracht, werden die Gewinnanteile einem besonderen Verrechnungsskonto (Kapitalkonto II, Darlehenskonto, Verrechnungsskonto o. Ä.) gutgeschrieben. Auf diesem Konto werden auch die Entnahmen des Kommanditisten erfasst. Dieses Konto gehört handelsrechtlich nicht zum Eigenkapital der Personengesellschaft, stellt aber steuerlich Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft dar.
Die Abgrenzung von Gesellschafterkonten ist sowohl im Zivilrecht als auch im Steuerrecht sehr bedeutsam. Die Kapitalkonten der Gesellschafter sind für die Stimmrechte, die Haftung und die Gewinnverteilung wichtig. Die Gesellschafterdarlehenskonten beinhalten einen schuldrechtlichen Anspruch des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft (Ley, DStR 2009, 613; Kahle, DStZ 2010, 720). Gesellschaftsvertraglich werden statt eines Kapitalanteils mehrere Gesellschafterkonten für die Gesellschafter unterhalten. In der gesellschaftsvertraglichen Praxis sind unterschiedliche Fallgestaltungen anzutreffen, die u. a. auch wegen der Anforderungen des § 15a EStG entstanden sind (Zwei-, Drei-, Vierkontenmodelle, vgl. Ley, DStR 2013, 271 und unten II B 12.5.1).
Die KontenmodelleKontenmodelle sehen die folgenden Konten vor:
Zweikontenmodell
Dreikontenmodell
Vierkontenmodell
Kapitalkonto I
Kapitalkonto I
Kapitalkonto I
Kapitalkonto II
Kapitalkonto II oder Rücklage
Kapitalkonto II oder Rücklage
Verlustvortragskonto
Gesellschafterdarlehenskonto
3.3 Privatkonten
Für jeden Personengesellschafter wird handelsrechtlich auch mindestens ein PrivatkontoPrivatkonto geführt. Dieses Konto kann wie bei Einzelunternehmen auch in weitere Unterkonten aufgeteilt werden (z. B. Sachentnahmen, Personensteuern usw.). Solche Unterkonten des Privatkontos werden im Rahmen der Bilanzerstellung auf dem einheitlichen Kapitalkonto des Gesellschafters oder ggf. auf seinem Kapitalkonto II abgeschlossen.
3.4 Entnahmen und Einlagen
Die Vorschriften über Entnahmen und Einlagen (§ 4 Abs. 1 Satz 2, 7 EStG) gelten auch für Personengesellschaften. Als EntnahmenEntnahme werden die nicht betrieblich veranlassten Wertabgaben der Gesellschaft an ihren Gesellschafter erfasst. Die betriebliche Veranlassung fehlt, wenn Zuwendungen ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis haben.
Beispiel
Hat eine Personengesellschaft eine Pensionszusage an einen Gesellschafter und dessen Hinterbliebene durch den Abschluss eines Versicherungsvertrages rückgedeckt, gehört der der Versicherungsgesellschaft zustehende Versicherungsanspruch (Rückdeckungsanspruch) nicht zum Betriebsvermögen der Gesellschaft. Die Prämien für die Versicherung sind keine Betriebsausgaben. Sie sind (verdeckte) Entnahmen, die allen Gesellschaftern nach Maßgabe ihrer Beteiligung zuzurechnen sind (BFH vom 28.06.2001 BStBl II 2002, 724; BMF vom 29.01.2008 BStBl I 2008, 317, Rz. 19; Wacker, FR 2008, 801).
Wenn dagegen der Wertabgang aus dem Gesellschaftsvermögen an den Gesellschafter betrieblich veranlasst ist und auf einem Rechtsgrund wie unter fremden Dritten, z. B. einen Kaufvertrag, beruht, scheidet eine Entnahme aus. Lediglich wenn die Personengesellschaft für die Übertragung eines Wirtschaftsgutes aus dem Gesamthandsvermögen in das Privatvermögen des Gesellschafters ohne betriebliche Veranlassung ein zu niedriges Entgelt erhält, ist von einer sog. verdeckten EntnahmeEntnahme, verdeckte





























