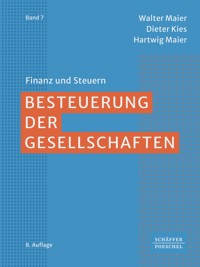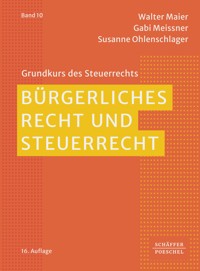
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Grundkurs des Steuerrechts
- Sprache: Deutsch
Band 10 der Reihe »Grundkurs des Steuerrechts« bietet eine klar strukturierte und an der Systematik des Bürgerlichen Gesetzbuches angelehnte Einführung in die Grundzüge des bürgerlichen Rechts. Im Unterschied zu rein zivilrechtlich orientierten Lehrbüchern werden im Rahmen dieses Lehrbuchs neben der originär zivilrechtlichen Materie auch die Bezugspunkte und Berührungspunkte des Zivilrechts zu den einzelnen Steuerarten dargestellt. Das Buch eignet sich deshalb gut als zivilrechtliches Begleitmaterial für die steuerrechtliche Ausbildung. Die 16., aktualisierte Auflage berücksichtigt neben aktuellen Gesetzesänderungen auch neue Entwicklungen der Rechtsprechung im Zivil- und Steuerrecht sowie wichtige Erlasse der Finanzverwaltung. Rechtslage: 1. Juli 2025
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumAutorenVorwort zur 16. AuflageAbkürzungsverzeichnisTeil A Einführung1 Geschichtliches2 Die Stellung des »Bürgerlichen Rechts« im Rechtssystem3 Bedeutung des Zivilrechts für das Steuerrecht3.1 Anknüpfung des Steuerrechts an das Zivilrecht3.2 Verweisung des Steuerrechts auf Begriffe des Zivilrechts3.3 Grundsätze der Gesamtrechtsordnung3.4 Bedeutung der zivilrechtlichen Begriffe im Steuerrecht3.5 Wirtschaftliche Betrachtungsweise3.6 Gesetz- und sittenwidriges Handeln (§ 40 AO)3.7 Zivilrechtlich unwirksame Rechtsgeschäfte (§ 41 AO)3.8 Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO)3.9 Der sogenannte Maßgeblichkeitsgrundsatz4 Rechtsanwendung4.1 Aufbau des BGB4.2 Technik der Rechtsanwendung4.2.1 Aufbau von Rechtsnormen4.2.2 Reihenfolge bei der Fallbearbeitung4.2.3 Anspruchshindernde Einwendungen4.3 Weitere Regeln der Gesetzestechnik4.3.1 Anwendung abstrakter Normen4.3.2 Auslegung4.3.3 Schließung von Gesetzeslücken4.3.4 Umdeutung4.3.5 Analogie4.3.6 Grenzen der Schließung von Gesetzeslücken4.3.7 Legaldefinitionen4.3.8 Regel-Ausnahme-Verhältnis4.3.9 Verweisungen4.3.10 Vermutungen und VerweisungenTeil B BGB − Allgemeiner Teil1 Natürliche Personen, juristische Personen, nichtrechtsfähige Personenvereinigungen des Privatrechts1.1 Objektives Recht, subjektives Recht und Rechtssubjekt1.1.1 Relative Rechte1.1.2 Absolute Rechte (Herrschaftsrechte)1.1.3 Gestaltungsrechte1.1.4 Rechtssubjekte1.2 Rechtsfähigkeit natürlicher und juristischer Personen1.2.1 Natürliche Personen1.2.2 Juristische Personen1.2.2.1 Begriff1.2.2.2 Arten der juristischen Personen1.2.3 Inhalt der Rechtsfähigkeit juristischer Personen1.2.3.1 Entstehung von juristischen Personen1.2.3.2 Übersicht über die Rechtssubjekte1.2.3.3 »Verbraucher« und »Unternehmer«1.3 Steuerliche Rechtsfähigkeit (Steuerfähigkeit)1.4 Handlungsfähigkeit der natürlichen Personen1.4.1 Begriff der Geschäftsfähigkeit1.4.2 Voraussetzungen der Geschäftsfähigkeit1.4.3 Geschäftsunfähigkeit (§ 104 BGB)1.4.4 Beschränkte Geschäftsfähigkeit1.5 Handlungsfähigkeit juristischer Personen1.6 Handlungsfähigkeit im Steuerrecht1.6.1 Begriff1.6.2 Handlungsfähigkeit bei Minderjährigen1.6.3 Partielle Handlungsfähigkeit (§ 79 Abs. 1 Nr. 2 AO)1.7 Besonderheiten der Personenvereinigungen des Privatrechts1.7.1 Die Personengesellschaften1.7.2 Der nichtrechtsfähige Verein (§ 54 BGB)2 Rechtsgeschäfte2.1 Willenserklärung2.1.1 Wille als subjektiver Bestandteil der Willenserklärung2.1.2 Erklärung als objektiver Bestandteil der Willenserklärung2.2 Abgabe der Willenserklärung2.3 Wirksamkeit der Willenserklärung2.4 Zugang der Willenserklärung2.5 Form der Willenserklärung2.5.1 Einfache Schriftform2.5.2 Öffentliche Beglaubigung (§ 129 BGB)2.5.3 Notarielle Beurkundung (§ 128 BGB)2.5.4 Folgen von Formfehlern2.6 Willensmängel bei Willenserklärungen2.6.1 Bewusste Willensmängel2.6.2 Unbewusste Willensmängel2.6.3 Sonderfälle2.6.4 Anfechtung von Willenserklärungen2.7 Die »Willenserklärung« im Steuerrecht2.8 Willenserklärungen durch Dritte (Vertretung)2.8.1 Rechtsgeschäftliche Vertretung2.8.2 Folgen wirksamer Vollmacht2.8.3 Auftragserteilung und Vollmacht2.8.4 Vertreter ohne Vertretungsmacht (falsus procurator)2.8.5 Beendigung der Vollmacht2.8.6 Abgrenzung zur Botenstellung2.9 Sonderfälle im Bereich der rechtsgeschäftlichen Vertretung2.9.1 Verdeckte Stellvertretung2.9.2 Handelsvertreter2.9.3 Kommissionär2.9.4 Treuhänder2.9.5 Handelsrechtliche Vertretung2.9.5.1 Prokura2.9.5.2 Handlungsvollmacht2.10 Gesetzliche Vertretung2.11 Verbot des Selbstkontrahierens (§ 181 BGB)2.12 Vertretung im Steuerrecht2.12.1 Gesetzliche Vertretung2.12.2 Gewillkürte (rechtsgeschäftliche) Vertretung2.13 Besonderheiten im Umsatzsteuerrecht2.13.1 Umsatzsteuerliche Behandlung der Agentur (Vertretung)2.13.2 Umsatzsteuerliche Behandlung der Kommission2.14 Bedingung und Befristung2.14.1 Bedingung2.14.2 Befristung2.14.3 Bedingung und Befristung im Steuerrecht3 Zustandekommen von Verträgen3.1 Das Angebot3.2 Zeitliche Grenzen des Angebots3.3 Die Annahme3.4 Übersicht über das Zustandekommen von Verträgen13.5 Übersicht über die Vertragstypen des BGB3.6 Unbestellte Lieferungen und Leistungen3.7 Der Vertrag im Steuerrecht4 Inhalt des Vertrags4.1 Verpflichtungs- und Verfügungsverträge4.1.1 Verpflichtungsgeschäft4.1.2 Verfügungsgeschäft4.2 Abstraktionsprinzip4.3 Bedeutung der Unterscheidung Verpflichtungs-/Verfügungsgeschäft für das Steuerrecht4.3.1 Umsatzsteuerrecht4.3.2 Bewertungsrecht4.3.3 Einkommensteuer und Buchführung4.3.4 GrunderwerbsteuerTeil C Schuldrecht − Allgemeiner Teil1 Leistungspflichten1.1 Gegenstand der Leistung1.2 Regelungen zur Leistungszeit1.2.1 Leistungszeit1.2.2 Leistungszeit im Steuerrecht1.3 Ort der Leistung1.3.1 Holschuld − Bringschuld − Schickschuld1.3.2 Leistungsort im Steuerrecht1.4 Gesamtschuld1.5 Gefahrtragung beim Kaufvertrag2 Beendigung der Schuldverhältnisse2.1 Beendigung durch Erfüllung2.2 Annahme an Erfüllungs statt2.3 Leistung erfüllungshalber2.4 Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuerrechtsverhältnis2.5 Aufrechnung2.5.1 Aufrechnungslage2.5.2 Aufrechnungserklärung2.5.3 Aufrechnung im Steuerrecht2.6 Erlass2.6.1 Erlass im Zivilrecht2.6.2 Erlass im Steuerrecht3 Verjährung3.1 Zivilrechtliche Verjährung3.1.1 Grundsätze3.1.2 Exkurs: Einrede3.1.3 Berechnung der Verjährungsfrist3.1.4 Höchstfristen3.1.5 Hemmung der Verjährung3.1.6 Ablaufhemmung (AblH)3.1.7 Neubeginn der Verjährung (§ 212 BGB)3.2 Steuerliche Verjährung4 Leistungsstörungen4.1 Allgemeine Voraussetzungen (§ 280 BGB)4.1.1 Schuldverhältnis4.1.2 Pflichtverletzung4.1.3 Vertretenmüssen4.1.3.1 Vorsatz4.1.3.2 Fahrlässigkeit4.1.3.3 Verschulden Dritter4.2 Unmöglichkeit4.2.1 Unmöglichkeit der Leistungspflicht4.2.2 Leistungsverweigerungsrecht (§ 275 Abs. 2, 3 BGB)4.2.3 Ausnahmen zu § 275 BGB4.2.4 Teilweise Unmöglichkeit4.3 Rechte des Gläubigers4.4 Auswirkungen bei gegenseitigen Verträgen4.5 Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung (§§ 280 Abs. 2, 286 ff. BGB)4.5.1 Verzögerung der Leistung durch den Schuldner4.5.2 Sonderfall bei Entgeltforderungen (§ 286 Abs. 3 BGB)4.5.3 Folgen des Schuldnerverzugs4.6 Gläubigerverzug4.7 Schadensersatz statt der Leistung (§ 280 Abs. 3 BGB)4.7.1 Schadensersatz wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung (§ 281 BGB)4.7.2 Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer sonstigen Pflicht (§§ 280 Abs. 3, 282 BGB)4.7.3 Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht (§§ 280 Abs. 3, 283 BGB)4.7.4 Ersatz vergeblicher »frustrierter« Aufwendungen (§§ 280 Abs. 3, 284 BGB)4.7.5 Herausgabe des Ersatzes (§ 285 BGB)4.8 Rücktritt bei Leistungsstörungen4.8.1 Rechte des Gläubigers bei Verzögerung/Schlechterfüllung (§ 323 BGB)4.8.2 Rechte des Gläubigers bei Verletzung einer Pflicht nach § 241 Abs. 2 BGB (§ 324 BGB)4.9 Begriff des Schadens4.9.1 Naturalrestitution4.9.2 Schadensersatz in Geld4.9.3 Mitverschulden4.9.4 Immaterieller Schaden4.9.5 Rücktritt neben Schadensersatz (§ 325 BGB)4.10 Rücktritt (§§ 346 ff. BGB)4.10.1 Allgemeines4.10.2 Wertersatz statt Rückgewähr4.10.3 Kein Wertersatz4.10.4 Nutzungen/Verwendungen (§ 347 BGB)4.10.5 Fristbestimmung (§ 350 BGB)4.11 Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313)5 Widerrufs- und Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen (§§ 355 ff. BGB)5.1 Widerrufsrecht5.2 Rechtsfolgen § 357 BGB5.2.1 Kosten und Gefahr der Rücksendung5.2.2 Wertersatz für Verschlechterung im Wege bestimmungsgemäßer Ingebrauchnahme5.2.3 Weitergehende Ansprüche5.3 Widerrufsrecht bei besonderen Vertriebsformen (§§ 312 ff. BGB)5.3.1 Allgemeines5.3.2 Geschäfte außerhalb von Geschäftsräumen5.3.2.1 Begriff und Problemstellung5.3.2.2 Kein Widerrufsrecht (§ 312 Abs. 2 BGB)5.3.3 Fernabsatzverträge (§§ 312c ff. BGB)5.3.3.1 Definition »Fernabsatzvertrag«5.3.3.2 Definition »Fernkommunikationsmittel«5.3.3.3 Unterrichtungspflichten des Unternehmers5.3.3.4 Widerrufsrecht nach § 355 BGB6 Abtretung6.1 Rechtsgeschäftliche Abtretung6.1.1 Abtretungsvertrag6.1.2 Abtretungsverbote6.1.3 Sonderprobleme bei der Abtretung6.1.4 Abtretung von anderen Rechten6.2 Gesetzlicher Forderungsübergang6.3 Abtretung im SteuerrechtTeil D Schuldrecht − Besonderer Teil1 Allgemeines über die einzelnen Schuldverhältnisse1.1 Überblick über vertragliche und gesetzliche Schuldverhältnisse1.2 Die Vertragsfreiheit und ihre Grenzen1.2.1 Grundsätze der Vertragsfreiheit1.2.2 Grenzen der Vertragsfreiheit1.2.2.1 Unzulässige Geschäfte1.2.2.2 Zwingende inhaltliche Ausgestaltung von Verträgen1.2.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen1.2.3.1 Ziel und Inhalt1.2.3.2 Einbeziehung von AGB in den Vertrag1.2.3.3 Überraschende und unangemessene Klauseln1.2.3.4 Vorrang der Individualabrede1.2.3.5 Anwendungsbereich der Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen1.2.3.6 Verfahrensrecht1.2.4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz2 Schuldrechtliche Verträge zur Übertragung von Gegenständen2.1 Kaufvertrag2.1.1 Rechte und Pflichten im Kaufvertrag2.1.2 Sachmängel (§ 434 BGB)2.1.2.1 Begriff des Sachmangels2.1.2.2 Ansprüche aus der Sachmängelgewährleistung2.1.2.3 Grenzen der Ansprüche aus der Sachmängelgewährleistung2.1.3 Rechtsmängel (§ 435 BGB)2.1.4 Produkthaftung2.1.4.1 Problemstellung2.1.4.2 Der Haftungstatbestand2.1.4.3 Der Produktbegriff2.1.4.4 Der Fehlerbegriff2.1.4.5 Der Hersteller2.1.4.6 Umfang der Haftung2.1.5 Besondere Arten des Kaufs2.1.5.1 Kauf unter Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB)2.1.5.2 Kauf auf Probe (§ 454 f. BGB)2.1.5.3 Wiederkauf (§§ 456 ff. BGB)2.1.5.4 Schuldrechtlicher Vorkauf (§§ 463 ff. BGB), dingliches Vorkaufsrecht (§§ 1094 ff. BGB)2.1.5.5 Verbrauchsgüterkauf (§§ 474−479 BGB)2.1.5.5.1 Anwendungsbereich2.1.5.5.2 Sonderregeln des Verbrauchsgüterkaufs2.1.5.5.3 Rückgriff des Verkäufers Letztverkäuferregress2.1.5.5.4 Verbrauchsgüterkauf von Waren mit digitalen Elementen2.1.5.6 Factoring2.1.5.7 Franchising2.1.6 Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verträge über langfristige Urlaubsprodukte, Vermittlungsverträge und Tauschsystemverträge2.1.6.1 Besondere Verträge2.1.6.2 Gemeinsame Regeln zum Schutz des Verbrauchers2.1.7 Verbraucherschutz2.1.7.1 Überblick2.1.7.2 Gelddarlehen (§§ 488−490 BGB)2.1.7.3 Verbraucherdarlehen (§§ 491−498 BGB)2.1.7.3.1 Schutzzweck2.1.7.3.2 Persönlicher Anwendungsbereich2.1.7.3.3 Sachlicher Anwendungsbereich2.1.7.3.4 Schriftform (§ 492 BGB)2.1.7.3.5 Widerrufsrecht (§ 495 BGB)2.1.7.3.6 Informationspflichten des Darlehensgebers2.1.7.3.7 Verbundene Verträge (§ 358 BGB)2.1.7.3.8 »Schuldturm-Problematik«2.1.7.4 Finanzierungshilfen (§ 506 BGB)2.1.7.5 Ratenlieferungsvertrag (§ 510 BGB)2.1.8 Der Kaufvertrag im Steuerrecht2.2 Tausch (§ 480 BGB)2.3 Schenkungsvertrag (§§ 516 ff. BGB)2.3.1 Begriff der Schenkung2.3.2 Form der Schenkung2.3.3 Besonderheiten des Schenkungsrechts2.3.4 Schenkung im Steuerrecht2.3.5 Schenkungen im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge2.3.5.1 Zivilrechtliche Behandlung2.3.5.2 Steuerliche Behandlung3 Schuldrechtliche Verträge zur Überlassung von Gegenständen auf Zeit3.1 Abgrenzungsfragen3.2 Mietvertrag (§§ 535 ff. BGB)3.2.1 Begründung und Inhalt des Mietverhältnisses3.2.2 Rechte und Pflichten im Mietvertrag3.2.3 Beendigung des Mietverhältnisses3.2.4 Änderungen des Mietrechts über Wohnraum3.2.5 Mietvertrag im Steuerrecht3.3 Leasing-Vertrag3.3.1 Zivilrechtliche Problematik3.3.2 Steuerliche Problematik3.3.2.1 Bilanzierung und Abschreibung des Leasing-Gutes3.3.2.2 Behandlung der Leasing-Raten3.3.3 Mietkauf3.4 Der Pachtvertrag (§§ 581 ff. BGB)3.5 Sachdarlehen3.6 Darlehensvertrag im Steuerrecht4 Schuldrechtliche Verträge zur Tätigkeit für andere4.1 Abgrenzungsfragen4.2 Der Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB)4.2.1 Dienstvertrag im Privatrecht4.2.2 Dienstverhältnis im Steuerrecht4.3 Werkvertrag und Werklieferungsvertrag (§§ 631 ff., 651 BGB)4.3.1 Werkvertrag4.3.1.1 Abgrenzung zum Dienstvertrag4.3.1.2 Vertragspflichten4.3.1.3 Gewährleistungsrecht (§§ 633−639 BGB)4.3.2 Werklieferungsvertrag4.3.3 Werkvertrag und Werklieferungsvertrag im Steuerrecht4.3.4 Auslobung4.4 Maklervertrag (§§ 652 ff.)4.5 Handelskauf4.6 Unternehmenskauf5 Sonstige Leistungsversprechen5.1 Abgrenzungsfragen5.2 Bürgschaftsvertrag5.2.1 Schuldrechtliche Beziehungen bei der Bürgschaft5.2.2 Voraussetzungen des Bürgschaftsvertrages5.2.3 Inanspruchnahme des Bürgen5.2.4 Rückgriffsansprüche des Bürgen gegen den Hauptschuldner6 Ungerechtfertigte Bereicherung6.1 Übersicht6.2 Leistungskondiktion6.3 Eingriffskondiktion6.4 Rückgriffskondiktion6.5 Verwendungskondiktion6.6 Sonderfälle bei Nichtberechtigten (§ 816 BGB)7 Unerlaubte Handlung7.1 Übersicht7.2 Grundtatbestand der unerlaubten Handlung (§ 823 Abs. 1 BGB)7.2.1 Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB7.2.2 Rechtswidrigkeit7.2.3 Schuld7.2.4 Verjährung7.3 Verletzung eines Schutzgesetzes (§ 823 Abs. 2 BGB)7.4 Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung (§ 826 BGB)7.5 Haftung bei mehreren Beteiligten (§ 830)7.6 Haftung für Verrichtungsgehilfen (§ 831 BGB)7.7 Umfang des Ersatzanspruchs7.7.1 Allgemeine Vorschriften (§§ 249 ff. BGB)7.7.2 Sondervorschriften bei Verletzung einer Person oder bestimmter Persönlichkeitsgüter (§§ 842 ff. BGB)7.8 Besondere Deliktstatbestände7.8.1 Kreditgefährdung7.8.2 Haftung des Aufsichtspflichtigen7.8.3 Billigkeitshaftung7.8.4 Tierhaftung7.8.5 Gebäudehaftung7.8.6 AmtshaftungTeil E Sachenrecht1 Überblick über das Sachenrecht1.1 Grundprinzipien des Sachenrechts1.1.1 Absolutheitsgrundsatz1.1.2 Typenzwang1.2 Grundbegriffe1.2.1 Sachen als körperliche Gegenstände1.2.2 Bewegliche und unbewegliche Sachen1.3 Bestandteile1.4 Zubehör (§ 97 BGB)1.5 Steuerlicher Sachbegriff1.5.1 Allgemeines1.5.2 Sachbegriff im Einkommensteuerrecht1.5.3 Sachbegriff im Umsatzsteuerrecht1.5.4 Sachbegriff in weiteren Steuerrechtsgebieten2 Dingliche Rechte im Einzelnen2.1 Eigentum2.1.1 Einschränkungen durch das Gesetz2.1.2 Einschränkung durch Rechte Dritter2.1.3 Eigentumsformen2.1.4 Steuerliche Behandlung2.2 Besitz2.2.1 Mittelbarer und unmittelbarer Besitz2.2.2 Eigenbesitz oder Fremdbesitz2.2.3 Besitzdiener2.3 Besitzerwerb und Besitzverlust3 Eigentumserwerb an beweglichen Sachen3.1 Eigentumserwerb durch Rechtsgeschäft3.2 Erwerb des Eigentums durch Einigung und Übergabe (§ 929 Satz 1 BGB)3.3 Eigentumserwerb nach § 929 Satz 2 BGB3.4 Eigentumserwerb durch Besitzkonstitut (§ 930 BGB)3.5 Eigentumserwerb nach § 931 BGB3.6 Rechtsfolgen des Eigentumserwerbs4 Gutgläubiger Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten4.1 Überblick4.2 Gutgläubiger Eigentumserwerb nach § 932 Abs. 1 BGB4.3 Gutgläubiger Eigentumserwerb gem. § 933 BGB4.4 Gutgläubiger Eigentumserwerb gem. § 934 BGB4.5 Zusammenfassung5 Rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb an Grundstücken5.1 Einigung5.2 Grundbucheintragung5.2.1 Das Grundbuch5.2.2 Die Eintragung5.3 Gutgläubiger Eigentumserwerb an Grundstücken5.4 Zusammenfassung der wichtigsten Übertragungstatbestände6 Eigentumserwerb an beweglichen Sachen und Grundstücken im Umsatzsteuerrecht7 Eigentumsvorbehalt7.1 Anwartschaftsrecht auf Eigentumserwerb7.2 Besonderheiten bei Verfügungen unter aufschiebender Bedingung7.2.1 Verfügung des Vorbehaltseigentümers während der Schwebezeit7.2.2 Verhinderung des Bedingungseintritts durch den Vorbehaltsverkäufer7.3 Eigentumsvorbehalt im Geschäftsleben7.3.1 Der weitergeleitete Eigentumsvorbehalt7.3.2 Der verlängerte Eigentumsvorbehalt7.3.3 Der nachgeschaltete Eigentumsvorbehalt7.3.4 Der Kontokorrentvorbehalt7.3.5 Der Konzernvorbehalt7.4 Steuerliche Auswirkungen beim Eigentumsvorbehalt7.4.1 Einkommensteuerrecht7.4.2 Umsatzsteuerrecht7.4.3 Bewertungsrecht8 Sicherungsübereignung8.1 Problemstellung und Abgrenzung8.2 Die Sicherungsübereignung als »besitzloses Pfandrecht«?8.3 Steuerliche Behandlung der Sicherungsübereignung8.3.1 Einkommensteuerrecht8.3.2 Umsatzsteuerrecht8.3.3 Bewertungsrecht8.4 Exkurs: Sicherungsabtretung9 Pfandrechte und beschränkt dingliche Rechte9.1 Pfandrecht an Sachen9.1.1 Akzessorietät9.1.2 Entstehung des Pfandrechts9.1.3 Haftung des Pfands9.1.4 Übertragung des Pfandrechts9.1.5 Erlöschen des Pfandrechts9.1.6 Pfandrecht an Rechten9.1.7 Steuerliche Behandlung des Pfandrechts9.2 Hypothek (§§ 1113 ff. BGB)9.2.1 Wesen der Hypothek9.2.2 Entstehung der Hypothek9.2.3 Zweck der Hypothek9.2.4 Befriedigung des Hypothekengläubigers9.2.5 Übertragung der Hypothek9.2.6 Sonderformen der Hypothek9.2.7 Steuerliche Behandlung der Hypothek9.2.8 Rangverhältnis der Rechte9.3 Grundschuld (§§ 1191 ff. BGB)9.4 Rentenschuld9.5 Sonstige beschränkte dingliche Rechte an Grundstücken (Auswahl)9.5.1 Erbbaurecht9.5.2 Dienstbarkeit9.5.2.1 Grunddienstbarkeit9.5.2.2 Persönlich beschränkte Dienstbarkeit9.5.2.3 Wohnungsrecht des § 1093 BGB9.5.2.4 Steuerliche Hinweise9.5.3 Nießbrauch9.5.3.1 Nießbrauch an Sachen (§§ 1030 ff. BGB)9.5.3.2 Nießbrauch an Rechten (§§ 1068 ff. BGB)9.5.3.3 Nießbrauch an einem Vermögen (§§ 1085 ff. BGB)9.5.3.4 Nutzungsrechte im SteuerrechtTeil F Familienrecht1 Einführung1.1 Schutzbereich des Familienrechts1.2 Verfassungsrechtliche Grundlagen1.3 Übersicht über die Rechtsgrundlagen1.4 Rechtsentwicklung2 Das Ehe- und Ehegüterrecht2.1 Eheschließung2.2 Ehewirkungen2.2.1 Überblick2.2.2 Eheliche Lebensgemeinschaft2.2.3 Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit2.2.4 Mitarbeit des Ehegatten2.2.4.1 Familienrechtliche Mitarbeitspflicht2.2.4.2 Vertragliche Ehegattenmitarbeit2.2.4.2.1 Ernsthafter, zivilrechtlich wirksamer Arbeitsvertrag2.2.4.2.2 Tatsächliche Durchführung des Arbeitsvertrages2.2.4.2.3 Angemessenheit der Zahlungen2.2.5 Unterhaltspflichten bei bestehender Ehe (§§ 1360, 1361 BGB)2.2.6 Namensrecht2.2.7 Ehewirkungen im Steuerrecht2.3 Eheliches Güterrecht2.3.1 Überblick2.3.2 Zugewinngemeinschaft (Gütertrennung mit Zugewinnausgleich)2.3.2.1 Gütertrennung2.3.2.2 Selbstständige Vermögensverwaltung, Verfügungsbeschränkungen2.3.2.3 Zugewinnausgleich bei Beendigung des Güterstandes2.3.3 Gütertrennung2.3.4 Gütergemeinschaft2.3.5 Bedeutung der Güterstände für das Steuerrecht2.4 Ehescheidung2.4.1 Grundsatz: Zerrüttungsprinzip2.4.2 Unterhalt der geschiedenen Ehegatten und der gemeinsamen Kinder (§§ 1569 ff., 1601 ff. BGB)2.4.3 Der Versorgungsausgleich (§ 1587 BGB)2.4.4 Güterrechtliche Auseinandersetzung2.4.5 Elterliches Sorgerecht2.4.6 Gerichtliches Verfahren2.4.6.1 Familiengericht2.4.6.2 Scheidungssachen und andere Familiensachen (Verbundverfahren)2.5 Nichteheliche Lebensgemeinschaft2.6 Eingetragene Lebenspartnerschaft3 Verwandtschaft und Unterhalt3.1 Abstammung3.2 Unterhalt3.2.1 Übersicht3.2.2 Unterhalt gegenüber Verwandten (§§ 1601 ff. BGB)3.2.2.1 Verwandtschaft in gerader Linie3.2.2.2 Bedürftigkeit des Anspruchsberechtigten3.2.2.3 Leistungsfähigkeit des Verpflichteten3.2.2.4 Reihenfolge bei Mehrheit von Unterhaltsverpflichtungen3.2.2.5 Reihenfolge bei Mehrheit von Unterhaltsberechtigten3.2.2.6 Art und Umfang des Unterhalts3.2.2.6.1 Unterhaltsberechtigte Kinder3.2.2.6.2 Unterhaltsberechtigte Ehegatten, dauernd getrennt Lebende und Geschiedene3.2.2.7 Abänderungsklage nach § 323 ZPO3.2.3 Unterhalt der Eltern gegenüber Kindern3.2.4 Unterhalt von nichtehelichen Kindern (§ 1615a BGB)3.2.5 Unterhaltszahlungen im Steuerrecht3.2.5.1 Abzugsverbot für Zuwendungen3.2.5.2 Wiederkehrende Zahlungen im Zusammenhang mit einer Gegenleistung4 Eltern-Kind-Verhältnis4.1 Rechtsstellung des Kindes4.2 Elterliche Sorge4.2.1 Grundsätze4.2.2 Personensorge4.2.3 Vermögenssorge4.3 Gesetzliche Vertretung4.4 Gerichtliche Genehmigung4.5 Elterliche Sorge bei Getrenntlebenden und nach Scheidung4.6 Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern4.6.1 Arbeitsverhältnisse mit Kindern4.6.2 Übertragung von Vermögen5 Vormundschaft5.1 Vormundschaft über Minderjährige5.1.1 Voraussetzungen der Vormundschaft (§§ 1773, 1774 BGB)5.1.2 Führung der Vormundschaft (§§ 1793−1836a BGB)5.2 Betreuung5.2.1 Voraussetzungen der Betreuung5.2.2 Rechtsstellung des Betreuten5.2.3 Rechtsstellung des Betreuers5.2.4 Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 BGB)5.3 PflegschaftTeil G Erbrecht1 Einführung1.1 Grundbegriffe des Erbrechts1.2 Grundregeln des Erbrechts1.2.1 Gesamtrechtsnachfolge1.2.2 Anfallprinzip1.2.3 Annahme und Ausschlagung der Erbschaft1.2.4 Privaterbrecht und Familienerbfolge1.2.5 Testierfreiheit1.2.6 Gesetzliches Erbrecht des Staates1.3 Erbrecht und Steuerrecht1.3.1 Erbschaftsteuer1.3.2 Ertragsteuerrecht2 Berufung zum Erben2.1 Gesetzliche Erbfolge (§§ 1924−1936 BGB)2.1.1 Gesetzliches Verwandtenerbrecht2.1.1.1 Grundregeln2.1.1.2 Erben der ersten Ordnung (§ 1924 BGB)2.1.1.3 Erben der zweiten Ordnung (§ 1925 BGB)2.1.1.4 Erben der dritten Ordnung (§ 1926 BGB)2.1.1.5 Gesetzliches Erbrecht des Staates (§ 1936 BGB)2.1.2 Gesetzliches Ehegattenerbrecht2.1.2.1 Grundregeln des § 1931 BGB2.1.2.2 Einfluss der Güterstände auf das Ehegattenerbrecht2.1.2.2.1 Zugewinngemeinschaft2.1.2.2.2 Gütertrennung2.1.2.2.3 Gütergemeinschaft2.1.2.2.4 Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten2.1.3 Erbfolge bei nichtehelicher Abstammung2.2 Rechtsgeschäftliche Erbfolge2.2.1 Überblick über die Verfügungen von Todes wegen2.2.2 Testament2.2.3 Gemeinschaftliches Testament2.2.4 Erbvertrag3 Besondere Inhalte letztwilliger Verfügungen3.1 Alleinerbe − Miterbe3.2 Vor- und Nacherbschaft, Ersatzerbschaft3.3 Erbeinsetzung, Vermächtnis, Auflage, Teilungsanordnung3.3.1 Erbeinsetzung3.3.2 Vermächtnis (§§ 1939, 2147 ff. BGB)3.3.3 Auflage (§§ 1940, 2192 ff. BGB)3.3.4 Teilungsanordnung (§ 2048 BGB)3.3.5 Testamentsvollstreckung (§§ 2197 ff. BGB)3.3.6 Testamentsanfechtung4 Ausschluss von der Erbfolge4.1 Enterbung und Pflichtteilsrecht4.1.1 Enterbung4.1.2 Pflichtteilsrecht (§§ 2303 ff. BGB)4.1.3 Erbverzichtsvertrag (§§ 2346 ff. BGB)4.1.4 Erbunwürdigkeit (§§ 2339 ff. BGB)4.1.5 Ausschlagung der Erbschaft5 Nachlassschulden5.1 Grundregeln der Erbenhaftung5.2 Beschränkung der Erbenhaftung5.3 Arten der Schulden des Erben5.3.1 Nachlassschulden5.3.2 Eigen- oder Erbenschulden5.3.3 Nachlasseigen- oder Nachlasserbenschulden6 Miterbengemeinschaft (§§ 2032−2063 BGB)6.1 Gesamt- und Sondererbfolge6.1.1 Gesamterbfolge und Gesamthandsvermögen6.1.2 Sondererbfolge6.2 Verwaltung des Nachlasses6.3 Auseinandersetzung und Nachlassteilung6.4 Erbauseinandersetzung im Ertragsteuerrecht6.4.1 Erbauseinandersetzung von Privatvermögen6.4.1.1 Grundsätze6.4.1.2 Realteilung von Privatvermögen ohne Ausgleichszahlung6.4.1.3 Erbauseinandersetzung von Privatvermögen mit Ausgleichszahlung6.4.2 Erbauseinandersetzung über Betriebsvermögen6.4.2.1 Grundsätze6.4.2.2 Realteilung von Betriebsvermögen ohne Ausgleichszahlungen6.4.2.3 Realteilung von Betriebsvermögen mit Ausgleichszahlungen6.4.3 Schuldzinsenabzug bei ErbfallschuldenTeil H Lösungshinweise zu den FällenLösung zu Fall 1 Lösung zu Fall 2Lösung zu Fall 3Lösung zu Fall 4Lösung zu Fall 5Lösung zu Fall 6Lösung zu Fall 7Lösung zu Fall 8Lösung zu Fall 9Lösung zu Fall 10 Lösung zu Fall 11Lösung zu Fall 12Lösung zu Fall 13Lösung zu Fall 14Lösung zu Fall 15Lösung zu Fall 16Lösung zu Fall 17 Lösung zu Fall 18Lösung zu Fall 19Lösung zu Fall 20Lösung zu Fall 21Lösung zu Fall 22Lösung zu Fall 23Lösung zu Fall 24 Lösung zu Fall 25Lösung zu Fall 26Lösung zu Fall 27Lösung zu Fall 28Lösung zu Fall 29Lösung zu Fall 30Lösung zu Fall 31Lösung zu Fall 32Lösung zu Fall 33Lösung zu Fall 34Lösung zu Fall 35Lösung zu Fall 36Lösung zu Fall 37Lösung zu Fall 38Lösung zu Fall 39Lösung zu Fall 40Lösung zu Fall 41Lösung zu Fall 42Lösung zu Fall 43Lösung zu Fall 44Lösung zu Fall 45Lösung zu Fall 46Lösung zu Fall 47Lösung zu Fall 48Lösung zu Fall 49Lösung zu Fall 50Lösung zu Fall 51Lösung zu Fall 52Lösung zu Fall 53Lösung zu Fall 54Lösung zu Fall 55Lösung zu Fall 56 Lösung zu Fall 57Lösung zu Fall 58Lösung zu Fall 59Lösung zu Fall 60Teil I Komplexe ÜbungsfälleÜbungsfall 1Sachverhalt 1Sachverhalt 2Sachverhalt 3Übungsfall 2Sachverhalt 1Sachverhalt 2Sachverhalt 3Sachverhalt 4Übungsfall 3Sachverhalt 1Sachverhalt 2Teil J Lösungshinweise zu den komplexen ÜbungsfällenLösung zu Übungsfall 1Sachverhalt 1Sachverhalt 2Sachverhalt 3Lösung zu Übungsfall 2Sachverhalt 1Sachverhalt 2Sachverhalt 3Sachverhalt 4Lösung zu Übungsfall 3Sachverhalt 1Sachverhalt 2StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bearbeiterübersicht:Maier: Teile A, D, F, GMeissner: Teile C, EOhlenschlager: Teile B, I, JAlle: Teil H
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6642-4
Bestell-Nr. 20241-0005
ePub:
ISBN 978-3-7910-6643-1
Bestell-Nr. 20241-0101
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6644-8
Bestell-Nr. 20241-0154
Walter Maier/Gabi Meissner/Susanne Ohlenschlager
Bürgerliches Recht und Steuerrecht
16. Auflage, August 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Starkekonzepte, Christina Peter, Wörthsee
Produktmanagement: Rudolf Steinleitner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Autoren
Prof. Walter Maier
Rechtsanwalt und Steuerberater, em. Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Prof. Dr. Gabi Meissner
Professorin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Prof. Dr. Susanne Ohlenschlager
Professorin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Bearbeiterübersicht:
Maier: Teile A, D, F, G
Meissner: Teile C, E
Ohlenschlager: Teile B, I, J
Alle: Teil H
Vorwort zur 16. Auflage
Dieses Buch bietet eine klar strukturierte und an der Systematik des Bürgerlichen Gesetzbuches angelehnte Einführung in die Grundzüge des bürgerlichen Rechts. Es wendet sich vor allem an Studierende der Finanzverwaltung und der steuerberatenden Berufe, die sich insbesondere zu Beginn ihrer Ausbildung sowohl mit den Steuerfächern als auch mit den Regelungen des BGB beschäftigen.
Im Unterschied zu rein zivilrechtlich orientierten Lehrbüchern werden im Rahmen dieses Lehrbuchs neben der originär zivilrechtlichen Materie auch die Bezugs- und Berührungspunkte des Zivilrechts zu den einzelnen Steuerarten dargestellt. Das Ertragsteuerrecht, das Bewertungsrecht sowie das Recht der Verkehrssteuern (insbesondere Umsatzsteuer) können ohne gründliche Kenntnisse des Zivilrechts nur unzureichend verstanden werden. Die steuerlichen Hinweise werden sich dem Anfänger zum Teil erst im Laufe der weiteren Ausbildung voll erschließen. Das Buch ist deshalb auch als zivilrechtliches Begleitmaterial für die gesamte Steuerausbildung geeignet.
Mit Hilfe dieses Buches können die Grundzüge des bürgerlichen Rechts durch zahlreiche leicht verständliche Fälle erarbeitet werden. Der Leser kann exemplarisch lernen, indem er in den Einzelfällen die abstrakte, für alle Fälle geltende Regelung erkennt und die Technik ihrer Anwendung durchdringt. Die Übungsfälle in jedem Kapitel bieten darüber hinaus eine effektive Möglichkeit zur Lernzielkontrolle.
Die komplexen Übungsfälle in den Teilen I und J dienen der Prüfungsvorbereitung. Die Fälle entstammen Originalprüfungsklausuren an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.
Das Lehrbuch wurde in allen Teilen überarbeitet und auf den aktuellen Stand in Gesetzgebung und Rechtsprechung gebracht. Neue Entwicklungen im Privatrecht und im Steuerrecht wurden berücksichtigt. Eingearbeitet wurden im Allgemeinen Teil unter anderem neue Richtlinien und mehrere Gesetze. Im Schuldrecht wurden die Darstellung der Gesamtschuld und der Störung der Geschäftsgrundlage sowie Neuerungen im Besonderen Schuldrecht eingefügt. Im Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags (WKRL-UG) wurden mit Wirkung ab 01.01.2022 neue Regelungen zur Kaufrechtsmodernisierung eingeführt.
Ergänzt wurde im Familienrecht die Darstellung der neu erlassenen zivilrechtlichen und zivilprozessualen Gesetze. Im Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts wurden mit Wirkung ab 01.05.2025 neue Namensrechtregelungen eingeführt.
Im Erbrecht wurden die Vorschriften über die Testamentsanfechtung und die Ausschlagung der Erbschaft erläutert.
Wir haben wiederum Vorschläge und Ideen unserer Studierenden und Leser aufgegriffen und umgesetzt. Das bewährte Konzept einer auf das Wesentliche beschränkten Einführung in die Grundbegriffe des BGB anhand der Fallmethode, die zugleich die steuerlichen Bezugspunkte hervorhebt, wurde beibehalten und vertieft.
Wir wünschen dem Leser beim Studium viel Erfolg und sind für Kritik und Anregungen weiterhin stets dankbar.
Ludwigsburg, im Juli 2025
Walter Maier
Prof. Dr. Gabi Meissner
Prof. Dr. Susanne Ohlenschlager
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
anderer Ansicht
ABl EU
Amtsblatt der Europäischen Union
AblH
Ablaufhemmung
Abs.
Absatz
AdVermiG
Adoptionsvermittlungsgesetz
AEAO
Anwendungserlass AO
a. F.
alte Fassung
AfA
Absetzung für Abnutzung
AG
Aktiengesellschaft
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGBG
Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
AO
Abgabenordnung
AK
Anschaffungskosten
AK-BGB
Alternativ-Kommentar zum BGB
AktG
Aktiengesetz
Alt.
Alternative
AWR
Anwartschaftsrecht
BAG
Bundesarbeitsgericht
BB
Betriebsberater
BbauG
Bundesbaugesetz
Bd.
Band
BeurkG
Beurkundungsgesetz
BewG
Bewertungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BFHE
Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des BGH in Zivilsachen
BilMoG
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BImSchG
Bundesimmissionsschutzgesetz
BiRiLiG
Bilanzrichtliniengesetz
BMF
Bundesministerium der Finanzen
BMJV
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
BSHG
Bundessozialhilfegesetz
BStBl
Bundessteuerblatt
BtG
Betreuungsgesetz
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Sammlung)
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
DIRL
Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen
DiRUG
Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
EG
Europäische Gemeinschaft
EGBGB
Einführungsgesetz zum BGB
EGMR
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EheG
Ehegesetz
EMRK
Europäische Menschenrechtskonvention
ErbbauRG
Erbbaurechtsgesetz
ErbbVO
Verordnung über das Erbbaurecht, heute ErbbauRG
ErbGleichG
Erbrechtsgleichstellungsgesetz
ErbStG
Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz
ESt
Einkommensteuer
estl.
einkommensteuerlich
EStDV
Einkommensteuerdurchführungsverordnung
EStG
Einkommensteuergesetz
EStR
Einkommensteuerrichtlinien
e. V.
eingetragener Verein
EVB
Eigentumsvorbehalt
FA
Finanzamt
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen
FamRZ
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FG
Finanzgericht
FGG
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FGO
Finanzgerichtsordnung
FR
Finanz-Rundschau (Zeitschrift)
FVG
Gesetz über die Finanzverwaltung
GB
Grundbuch
GBO
Grundbuchordnung
GbR/GdbR
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
GenG
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GG
Grundgesetz
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GrEStG
Grunderwerbsteuergesetz
GrS
Großer Senat
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
HGB
Handelsgesetzbuch
HK
Herstellungskosten
h. M.
herrschende/r Meinung
HS
Halbsatz
i. d. R.
in der Regel
i. e. S.
im engeren Sinne
i. H. v.
in Höhe von
InsO
Insolvenzordnung
i. R. d.
im Rahmen der
i. V. m.
in Verbindung mit
JuS
Juristische Schulung (Zeitschrift)
KG
Kommanditgesellschaft
KindRG
Kindschaftsrechtsreformgesetz
LBO
Landesbauordnung Baden-Württemberg
LFGG
Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit Baden-Württemberg
LG
Leasinggeber/Landgericht
LN
Leasingnehmer
LPartG
Lebenspartnerschaftsgesetz
LSt
Lohnsteuer
MHbeG
Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz
MünchKomm
Münchener Kommentar
NEhelG
Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder
n. h. M.
nach herrschender Meinung
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NWB
Neue Wirtschaftsbriefe
o. Ä.
oder Ähnliches
OHG
offene Handelsgesellschaft
OLG
Oberlandesgericht
PartGG
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
ProdHaftG
Produkthaftungsgesetz
RFH
Reichsfinanzhof
RG
Reichsgericht
rkr.
rechtskräftig
Rn.
Randnummer
Rspr.
Rechtsprechung
Rz.
Randziffer
ScheckG
Scheckgesetz
SG
Sicherungsgeber
SGB
Sozialgesetzbuch
SigG
Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen
SN
Sicherungsnehmer
sog.
sogenannte
StAnpG
Steueranpassungsgesetz
StBJB
Steuerberater-Jahrbuch
SteuerStud
Steuer und Studium (Zeitschrift)
StGB
Strafgesetzbuch
Stpfl.
Steuerpflichtiger
str.
strittig/streitig
st. Rspr.
ständige Rechtsprechung
SÜ
Sicherungsübereignung
Tz.
Teilziffer, Textziffer
UHG
Umwelthaftungsgesetz
UKlaG
Unterlassungsklagengesetz
USt
Umsatzsteuer
UStG
Umsatzsteuergesetz
u. U.
unter Umständen
VA
Verwaltungsakt
VerbrGKRL
Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf
VerbrKrG
Verbraucherkreditgesetz
VersAusglG
Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs
VOB
Verdingungsordnung für das Baugewerbe
VuV
Vermietung und Verpachtung
WE
Willenserklärung
WEG
Wohnungseigentumsgesetz
WG
Wirtschaftsgut; mit §§-Angabe: Wechselgesetz
WK
Werbungskosten
WKRL-UG
Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags
ZEV
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZPO
Zivilprozessordnung
Teil A Einführung
1 Geschichtliches
Das BGB trat am 01.01.1900 als Abschluss einer langen rechtsgeschichtlichen Entwicklung in Kraft. Seine Wurzeln reichen zurück bis in das römische Recht (vor allem im Ersten Buch: Allgemeiner Teil des BGB und im Zweiten Buch: Recht der Schuldverhältnisse) und in das altdeutsche Recht (vor allem im Dritten Buch: Sachenrecht, im Vierten Buch: Familienrecht und im Fünften Buch: Erbrecht). Durch die Zusammenfassung des gültigen Rechts zu einem Gesetzeswerk setzte das liberale Bürgertum als der damalige Träger des politischen und wirtschaftlichen Fortschritts seine auf den drei Säulen »VertragsfreiheitVertragsfreiheit«, »PrivateigentumPrivateigentum« und »Privates Erbrechtprivates Erbrecht« ruhende Konzeption durch, die ihm den bestimmenden Einfluss auf Produktion und Güterverkehr sicherte. Stimmen, die schon zur Jahrhundertwende die Zurückhaltung des BGB gegenüber modernen sozialen Fragestellungen − z. B. gegenüber den Rechtsproblemen der abhängigen Arbeit − und die einseitige Bevorzugung des Warenverkehrs zu Lasten des Persönlichkeitsschutzes der sozial Schwächeren kritisierten (u. a. Otto von Gierke, Anton Menger), fanden bei der Ausgestaltung des BGB kein Gehör.
Der Regelungsgehalt des BGB hat sich im demokratischen und sozialen RechtsstaatRechtsstaat ganz erheblich gewandelt. Da die Annahme sich als falsch erwiesen hat, Vertragsfreiheit und Wettbewerb verhinderten die einseitige Machtentfaltung Einzelner, mussten Inhalt und Schranken des Eigentumsbegriffs und der Vertragsfreiheit neu interpretiert werden. Einige Rechtsgebiete des BGB, die zum Teil nicht mit dem Grundgesetz in Einklang standen, wurden neu gefasst, so z. B. das Familienrecht durch das GleichberechtigungsgesetzGleichberechtigungsgesetz von 1957, durch das Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder von 1969 und durch das Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts von 1976.
Auf bestimmten Rechtsgebieten kam es zu Sonderentwicklungen, die zu eigenständigen Rechtsmaterien des Privatrechts außerhalb des BGB führten, so z. B. im Arbeitsrecht und im HaftpflichtrechtHaftpflichtrecht. Einige dieser Materien wurden später in das BGB eingegliedert und dort fortentwickelt, so z. B. das Mieterschutzrecht,Mieterschutzrecht das Eheschließungsrecht und das Reisevertragsrecht.
Im Jahr 2001 ordnete der Gesetzgeber mit dem Schuldrechtsreformgesetz einen Kernbereich der Privatrechtsordnung neu, der seit über 100 Jahren im Wesentlichen unverändert geblieben war. Es handelt sich um die größte Reform des Privatrechts seit dem Bestehen des BGB. Die Reform war seit langem gefordert worden. Die Kritik der Rechtswissenschaft am alten BGB war berechtigt, weil der Text des BGB den aktuellen Rechtszustand nicht mehr richtig wiedergab. Rechtsinstitute wie z. B. die positive Vertragsverletzung, die culpa in contrahendo und die Lehre vom Wegfall der GeschäftsgrundlageWegfall der Geschäftsgrundlage waren nicht im BGB selbst geregelt, sondern dem Richterrecht überlassen. Wichtige Rechtsgebiete waren zuvor immer noch außerhalb des BGB in Sondergesetzen enthalten. Außerdem waren erhebliche strukturelle Defizite festzustellen. Die Regelungen zur Unmöglichkeit der Leistung, zum Rücktritt vom Vertrag, zu Schadensersatzansprüchen und zum Sach- und Rechtsmängelrecht waren nicht praxisgerecht.
Auch mussten zwingende Vorgaben im europäischen Gemeinschaftsrecht zum Verbraucherschutz in nationales Recht transformiert werden:
Die Richtlinie 1999/44/EG vom 25.05.1999 über den Verbrauchsgüterkauf (ABl EG Nr. L 171, 12) war die Ursache für die Neuregelung des Kaufrechts zwischen Verbrauchern und gewerblichen Verkäufern über bewegliche Sachen.
Die Richtlinie 2000/35/EG vom 29.06.2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl EG Nr. L 200, 35) hatte bereits zu einer Neuregelung in dem Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen vom 30.03.2000 geführt, die allgemein als missglückt galt. Im Reformgesetz wurde die Richtlinie neu umgesetzt.
Die Richtlinie 2000/31/EG vom 08.06.2000 über den elektronischen Geschäftsverkehr (ABl EG Nr. L 178, 1).
Die Richtlinie (VerbrGKRL) war zum 01.01.2002 umzusetzen und wurde mit der Schuldrechtsmodernisierung durch das SMG verbunden. Die VerbrGKRL wurde ab 01.01.2022 durch die Richtlinie (WKRL) und die Richtlinie 2019/770/EU über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (DIRL) ersetzt.
Im Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie vom 05.07.2021 (DiRUG) und im Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags (WKRL-UG) wurden mit Wirkung ab 01.01.2022 neue Regelungen zur Kaufrechtsmodernisierung eingeführt. Die Anforderungen werden durch die §§ 437-441, 445a-455c, 453, 474-479 und die Verweisungen in das Allgemeine Schuldrecht erfüllt. Zur richtlinienkonformen Auslegung sind die WKRL und die DIRL einschlägig.
Das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001 (BGBl. I 2001, 3138) trat am 01.01.2002 in Kraft. In den fünf Büchern des BGB, insbesondere im 2. Buch (Schuldrecht) wurden über 200 Paragraphen abgeändert oder neu eingefügt.
Im Allgemeinen Teil wurde das Verjährungsrecht neu gefasst und vereinheitlicht. Die regelmäßige Verjährungsfrist wurde für gesetzliche und vertragliche Ansprüche auf drei Jahre verkürzt (§ 195). Bei Mängelansprüchen aus einem Kaufvertrag gilt je nach Fallgestaltung eine Frist von 30, 10, 5, 3 oder 2 Jahren (§ 438), bei Werkverträgen von 3 oder 2 Jahren (§ 634a).
Im Allgemeinen Schuldrecht wurde das Leistungsstörungsrecht völlig neu geregelt. Zum Leitbegriff wurde die Pflichtverletzung, an die das System der Leistungsstörungen anknüpft (§ 280). Die Zusammenfassung in einem Paragraphen und der Wegfall der Unterscheidung der verschiedenen Pflichtverletzungen machen die Arbeit mit dem Schuldrecht einfacher. Es kommt nicht mehr darauf an, ob eine Haupt- oder eine Nebenpflicht verletzt wird. Die Unterscheidung zwischen anfänglicher/nachträglicher und subjektiver/objektiver Unmöglichkeit ist entbehrlich geworden. Die Nichtigkeit bei anfänglicher Unmöglichkeit und die daraus folgende Garantiehaftung sind aufgegeben und durch eine Haftung wegen zu vertretender Pflichtverletzung aus Vertrag ersetzt (§ 311a). Die Schadensersatzansprüche sind neu strukturiert. Rücktritt und Schadensersatz schließen sich nicht mehr aus. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Gläubigers ist nicht mehr davon abhängig, ob der Schuldner die Pflichtverletzung zu vertreten hat (§ 323). Die Rechtsinstitute der positiven Vertragsverletzung (§ 280), der culpa in contrahendo (§§ 311 Abs. 2, 280), des Wegfalls der Geschäftsgrundlage (§ 313) und der Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314) sind nunmehr gesetzlich geregelt. Spezialgesetze, die vorher außerhalb des BGB standen, wie z. B. das AGB-Gesetz, das Verbraucherkreditgesetz, das Haustürwiderrufsgesetz, das Fernabsatzgesetz und das Teilzeit-Wohnrechtegesetz wurden in das BGB eingegliedert.
Im Besonderen Schuldrecht wurde aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen das Kaufrecht überarbeitet. Insbesondere wurden die Mängelhaftung, der Verbrauchsgüterkauf, die Vorschriften über den Verbraucherkredit, die das bisherige Verbraucherkreditgesetz ersetzen, sowie das Darlehensrecht neugestaltet. Auch das Werkvertragsrecht wurde überarbeitet und in weiten Teilen an das Kaufrecht, insbesondere im Recht der Mängelhaftung, angeglichen. Im Kaufvertrags- und im Werkvertragsrecht wurden die bisher eigenständigen Gewährleistungsrechte der Wandelung und des Schadensersatzes beseitigt und in das allgemeine Leistungsstörungsrecht eingegliedert. Bei Mängeln gibt es vier Rechte des Käufers (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz), wobei zunächst vorrangig die Nacherfüllung geltend zu machen ist. Für Sachmängel und für Rechtsmängel gelten nach neuem Recht dieselben Rechtsfolgen (zur Synopse der alten und neuen Vorschriften vgl. die Vorauflage).
Neuere Regelungen im BGB erfolgten durch die folgenden Gesetzesbestimmungen: Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (v. 25.06.2021, BGBl. I 2021, 2123 Nr. 37), Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz, SanInsFoG v. 22.12.2020, BGBl. I 2020, 3256 Nr. 66), Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit (v. 21.12.2021, BGBl. I 2021, 5252 Nr. 86), Gesetz für faire Verbraucherverträge (v. 10.08.2021, BGBl. I 2021 Nr. 53), Gesetz zur Anpassung des Finanzdienstleistungsrechts (v. 09.06.2021, BGBl. I 2021 Nr. 31), Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn (v. 19.03.2020, BGBl. 2020 I Nr. 14), Mietspiegelreformgesetz (MsRG v. 17.08.2021, BGBl. I 2021 Nr. 53), Personengesellschaftsmodernisierungsgesetz (MoPeG v. 17.08.2021, BGBl. I 2021, 3436 Nr. 53), Gesetz über elektronische Wertpapiere (EWPG v. 11.12.2023, BGBl. 2023 I Nr. 354), Adoptionshilfegesetz (v. 29.06.2021, BGBl. I 2021, 2010 Nr. 36), Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung (v. 12.05.2021, BGBl. I 2021, 1082 Nr. 24), Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (v. 22.06.2021, BGBl. I 2021 Nr. 33), Gesetz zur Änderung des Versorgungsausgleichs (v. 21.05.2021, BGBl. I 2021 Nr. 24), Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts (BGBl. I 2024 Nr. 185),Selbstbestimmungsgesetz (SBGG v. 19.06.2024, BGBl. 2024 I Nr. 206), Telekommunikationsmodernisierungsgesetz (TDDDG v. 12.07.2024, BGBl. 2024 I Nr. 234), Reisesicherungsfondsgesetz (v. 02.12.2024, BGBl. 2024 I Nr. 387).
2 Die Stellung des »Bürgerlichen Rechts« im Rechtssystem
Das »Bürgerliche Recht« ist Teil des PrivatrechtsPrivatrecht. Die am Privatrechtsverkehr teilnehmenden Personen treten einander nach der liberalen Grundidee im Verhältnis der Gleichordnung gegenüber und gestalten ihre Rechtsverhältnisse weitgehend nach ihrem Willen. Das Privatrecht steht im Gegensatz zum öffentlichen Recht. Das öffentliche Recht ist Recht, das Hoheitsträgern (Bund, Länder, Gemeinden und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts) zugeordnet ist. Diese handeln grundsätzlich kraft gesetzlich gewährter hoheitlicher Gewalt mit Befehl und Zwang und stehen zum Bürger in einem Über-Unterordnungs-Verhältnis. Die Hauptbedeutung dieser Zweiteilung des Rechts liegt in der Zuweisung der Rechtswege, also in der Frage, welches Gericht für die Entscheidung eines Rechtsstreits zuständig ist.
Das Privatrecht regelt die Beziehungen der einzelnen Bürger auf der Grundlage der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung (PrivatautonomiePrivatautonomie). Verfassungsrechtliche Grundlage ist das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit nicht die Rechte anderer verletzt werden und nicht gegen das Sittengesetz verstoßen wird (Art. 2 Abs. 1 GG). Eine Ausprägung ist die Vertragsfreiheit (zu Inhalt und Grenzen D. 1.2).
Der konservativ-liberalen Leitvorstellung des BGB von 1900, im Austausch gleichwertiger Leistungen durch gleichstarke Wettbewerbsteilnehmer entfalte der Markt Selbstreinigungskräfte gegen ungleiche Machtpositionen in der Gesellschaft, widersprachen seit jeher die Tatsachen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet deshalb in den Grundrechten und im Sozialstaatsprinzip den Gesetzgeber bei der Rechtssetzung, die Verwaltung bei der Rechtsanwendung und die Rechtsprechung bei der Streitschlichtung und Rechtsfortbildung, den Bedürfnissen aller Bürger nach sozialer Gerechtigkeit und nach sozialer Sicherheit Rechnung zu tragen, sei es im Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer oder in den Beziehungen zwischen Produzent und Konsument, zwischen Bank und Kreditnehmer, zwischen Vermieter und Mieter, zwischen Arzt und Patient usw. Ein solches »materielles« (verfassungskonformes) Zivilrecht steht im Gegensatz zu dem »formalen« Zivilrecht des Kaiserreiches (zur Vertiefung vgl. AK-BGB-Dubischar, vor §§ 241 ff. m. w. N.). Zum Spannungsverhältnis zwischen Privatautonomie und grundgesetzwidriger Fremdbestimmung des schwächeren Partners vgl. BVerfG vom 19.10.1993 NJW 1994, 36).
Die grundgesetzlichen Wertentscheidungen, die gegen den Missbrauch wirtschaftlicher Macht und auf den Abbau von Machtgefällen gerichtet sind, wirken in das Zivilrecht hinein und begrenzen die Privatautonomie.
Fall 1
Der Gastwirt G hat an der Tür seines Lokals ein Schild angebracht: »Ausländern ist das Betreten des Lokals verboten!«. Ausländer A fragt, ob er gegen diese Maßnahme etwas unternehmen kann.
Das »Bürgerliche Recht« besteht aus den Rechtssätzen, die im »Bürgerlichen Gesetzbuch« (BGB) stehen. Der weitere Begriff des PrivatrechtsPrivatrecht umfasst neben dem BGB zahlreiche Sondergebiete.
Alle Gebiete des Privatrechts schließen sich mehr oder weniger an die Grundregeln des BGB an. Auch wer sich mit den privatrechtlichen Sondergesetzen beschäftigen will, muss die Grundzüge des BGB kennen. Zwar enthalten die übrigen privatrechtlichen Gesetze i. d. R. ergänzende, zum Teil auch abändernde Vorschriften, sie bauen aber grundsätzlich auf dem BGB auf.
Beispiel
Die Vorschriften über den Abschluss von Verträgen und über die Geschäftsfähigkeit gelten auch für das Recht der Personenhandelsgesellschaften (vgl. §§ 105 ff. HGB), das Wertpapierrecht (vgl. Scheckgesetz, Wechselgesetz) und das Arbeitsrecht (vgl. aber das Kündigungsschutzgesetz als Sondervorschrift zum BGB).
Fast der gesamte Wirtschaftsverkehr geht auf private Rechtsgeschäfte zurück, die mit den Regeln des BGB und der privatrechtlichen Gesetze geordnet sind. Das BGB ist ein wesentliches Element unserer Wirtschaftsverfassung und hat damit auch zentrale Bedeutung für das Steuerrecht.
3 Bedeutung des Zivilrechts für das Steuerrecht
3.1 Anknüpfung des Steuerrechts an das Zivilrecht
Die Besteuerung knüpft an Vorgänge an, die ihre rechtliche Gestaltung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts erhalten haben. Es gibt praktisch keinen steuerlich bedeutsamen Sachverhalt, der nicht eine Grundlage im Bereich des Privatrechts findet.
Beispiele
Wer ein Grundstück kauft oder verkauft (zum Grundstückskaufvertrag s. D 2), kann damit eine Besteuerung nach dem Einkommensteuergesetz, nach dem Umsatzsteuergesetz oder nach dem Grunderwerbsteuergesetz auslösen.
Der Unternehmer, der Waren verkauft, unterliegt mit seinen Umsätzen der Umsatzsteuer, seine Erträge unterliegen der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer.
Die Einkünfte eines nichtselbstständig Tätigen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis sind lohnsteuerpflichtig (§§ 19, 38 ff. EStG).
Ein Hauseigentümer schließt einen Mietvertrag ab (s. D 3.2). Die Einkünfte aus der Vermietung unterliegen der Einkommensteuer (§ 21 EStG), für die Umsatzsteuer stellt sich die Frage steuerfreier Vermietung (§ 1 Abs. 1, § 4 Nr. 12 UStG).
Der Tod eines Menschen (Erbfall, vgl. G) bewirkt den Übergang des Vermögens auf den oder die Erben. Dieser Vorgang ist der Anknüpfungspunkt für die Erbschaftsteuer.
Bei der Besteuerung der in aller Regel privatrechtlich strukturierten Sachverhalte muss derjenige, der das Steuerrecht anwenden will, häufig zunächst über privatrechtliche Vorfragen entscheiden.
Beispiele
Aus der Bestellung eines Nießbrauchsrechts zugunsten naher Angehöriger können steuerliche Folgerungen nur gezogen werden, wenn ein bürgerlich-rechtlich wirksames Nutzungsrecht begründet worden ist und die Beteiligten die zwischen ihnen getroffenen Vereinbarungen auch tatsächlich durchführen (vgl. E 9.5.3.4).
Die Verlustausgleichsbeschränkung bei einem negativen Kapitalkonto des Kommanditisten (§ 15a EStG) wird nur wirksam, wenn der Kommanditist handelsrechtlich beschränkt mit seiner Einlage haftet, nicht aber, wenn er den Gläubigern der Gesellschaft aufgrund von Ausnahmebestimmungen unbeschränkt haftet (vgl. § 15a Abs. 1 Satz 2 EStG).
3.2 Verweisung des Steuerrechts auf Begriffe des Zivilrechts
Das Steuerrecht ist öffentliches Recht; der Steuergläubiger (Bund, Länder, Gemeinden) setzt den Besteuerungsanspruch mit Hoheitsgewalt gegen den privaten Steuerschuldner durch. Trotz des grundsätzlichen Gegensatzes zum Zivilrecht verweisen Steuergesetze in einer Reihe von Vorschriften auf Normen des BGB.
Beispiele
§ 79 AO verweist hinsichtlich der HandlungsfähigkeitHandlungsfähigkeit natürlicher Personen auf das Bürgerliche Recht (s. B 1.6).
§ 3 Abs. 3 UstG benutzt den Begriff der Kommission aus § 383 HGB.
Die gesetzliche Vertretung gem. § 34 Abs. 1 AO beruht auf den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften.
3.3 Grundsätze der Gesamtrechtsordnung
Im BGB sind bestimmte Regeln normiert, die allgemeine Grundsätze der Gesamtrechtsordnung darstellen und damit unmittelbar auch im Steuerrecht gelten. Man spricht daher von der Einheit der RechtsordnungEinheit der Rechtsordnung.
Beispiele
Grundsatz von Treu und GlaubenTreu und Glauben (§ 242).
Auslegung von WillenserklärungenAuslegung von Willenserklärungen (§§ 133, 157).
Von der Einheit der Rechtsordnung werden nur einige Grundsätze erfasst. Aus ihr lässt sich keine Regel ableiten, dass bestimmte Rechtsbegriffe, die im BGB und im Steuerrecht gleichlauten, aber verschiedene Zielrichtungen haben, denselben Inhalt haben müssen.
3.4 Bedeutung der zivilrechtlichen Begriffe im Steuerrecht
Im Regelfall werden die privatrechtlichen Begriffe im Steuerrecht vorausgesetzt und haben grundsätzlich dieselbe Bedeutung.
Beispiele
Nach § 34 Abs. 1 AO haben die gesetzlichen Vertreter der natürlichen und der juristischen Personen deren steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Wer gesetzlicher Vertreter ist, bestimmt sich nach dem Privatrecht (s. B 1.4).
Das Privatrecht ist dafür maßgeblich, ob eine Mehrheit von Personen (Personenvereinigung) eine Personengesellschaft ist (deren Gewinn einheitlich und gesondert festzustellen und den einzelnen Gesellschaftern einkommensteuerlich mit ihrem Anteil zuzurechnen ist) oder ob es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt (deren Gewinn körperschaftsteuerpflichtig ist und deren Ausschüttungen bei den Anteilseignern als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen sind). Das Steuerrecht baut hier auf den privatrechtlichen Begriffen auf: § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG spricht von der OHG und der KG, § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG von Gewinnanteilen aus Aktien und Anteilen an GmbHs.
Andererseits gibt es steuerliche Begriffe, die im Privatrecht keine Entsprechung haben, sondern ganz aus den wirtschaftlichen Bedürfnissen und der Eigenart des Steuerrechts heraus entwickelt worden sind.
Beispiele
Einkommensteuer: Einnahmen, Werbungskosten, Einkünfte, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen usw.
Umsatzsteuerrecht: Lieferung, sonstige Leistung, Umsatz.
Abgabenordnung: Steuerpflichtiger, Steuerschuldverhältnis usw.
Aber auch gleich oder ähnlich lautende Begriffe aus dem Gebiet des Zivil- und des Steuerrechts können mit verschiedenen Begriffsinhalten versehen sein. Das Steuerrecht ist nicht Folgerecht des Zivilrechts i. S. einer strengen Bindung an die zivilrechtlichen Begriffe. Denn das Steuerrecht als öffentliches Recht mit i. d. R. zwingendem Charakter hat ganz andere Zielsetzungen als das vom Grundsatz der Vertragsfreiheit beherrschte Zivilrecht. Das hat zwangsläufig in vielen Fällen eine Durchbrechung der zivilrechtlichen Ordnungsstrukturen zur Folge.
Beispiele
Das BGB versteht unter »GrundstückGrundstück« (vgl. §§ 94, 873 ff.) sowohl den Grund und Boden als auch aufstehende Gebäude. Nach dem Bilanzsteuerrecht sind nach dem Grundsatz der Einzelbewertung der Grund und Boden und die Gebäude getrennt zu aktivieren und zu bewerten. Dies ist auch deshalb wichtig, weil Gebäude der Absetzung für Abnutzung unterliegen (§ 7 Abs. 4 EStG), der Grund und Boden dagegen nicht abschreibungsfähig ist.
Der Begriff des »DienstverhältnissesDienstverhältnis« (§ 1 Abs. 2 LStDV) bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 19 EStG) ist nicht den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über den Dienstvertrag (§ 611) entlehnt. Da das Lohnsteuerrecht an die tatsächlichen Verhältnisse anknüpft, ist es steuerlich unerheblich, ob überhaupt ein zivilrechtlicher Dienstvertrag geschlossen worden ist.
Für den einkommensteuerlichen Begriff der »Vermietung und VerpachtungVermietung und Verpachtung« kommt es nicht darauf an, ob ein Vertrag nach BGB als Miet- oder Pachtvertrag anzusehen ist, sondern der steuerliche Begriff umfasst alle Vergütungen, die für die Nutzung und Verwertung der in § 21 EStG aufgeführten Vermögensteile und Rechte geleistet werden.
Es kann hier nur angedeutet werden, dass das Verhältnis von Privatrecht und Steuerrecht in der Rechtsprechung und in der Literatur äußerst umstritten und dogmatisch ungeklärt ist.
Der BFH ging in einer Reihe von Entscheidungen von einem »Primat des Zivilrechts vor dem Steuerrecht« aus und legte Begriffe im Zweifel im zivilrechtlichen Sinne aus (vgl. BFH vom 12.07.1967 BStBl III 1967, 781 und die dort zitierten weiteren Entscheidungen; vgl. ebenso BVerfGE 13, 313, 340 und BVerfGE 29, 104, 117).
Dem ist in der Literatur entgegengehalten worden, die dem Steuerrecht innewohnenden Eigengesetzlichkeiten schlössen einen Grundsatz aus, wonach zivilrechtlichen Begriffen im Steuerrecht ihre ursprüngliche Bedeutung beizumessen sei.
Von einer Maßgeblichkeit des Zivilrechts für das Steuerrecht könne nicht gesprochen werden. Beide Rechtsgebiete stünden nicht in einem Verhältnis der Über- und Unterordnung, sondern der Gleichordnung (grundlegend Ruppe, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung von Einkunftsquellen, in: Tipke (Hrsg.), Übertragung von Einkunftsquellen im Steuerrecht, 7 ff.; Locher, Grenzen der Rechtsfindung im Steuerrecht, 152 ff.; Tipke/Lang, Steuerrecht, 6 ff.; Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung, 208 ff.).
Die h. M. sieht heute im Steuerrecht zu Recht ein eigenständiges Rechtsgebiet im Rahmen der Gesamtrechtsordnung. Das Steuerrecht ist nur dem Verfassungsrecht untergeordnet, im Übrigen aber autonom und dem Zivilrecht nebengeordnet. Die Gegenmeinung, die das Steuerrecht zum Annexrecht des Zivilrechts herabzudrücken versucht, nimmt für sich in Anspruch, der Privatautonomie im Steuerrecht mehr Geltung zu verschaffen; in Wirklichkeit sind die Versuche, das Steuerrecht zwingend an formale zivilrechtliche Gestaltungen zu binden, gegen die Gleichmäßigkeit der Besteuerung (Art. 3 Abs. 1 GG) gerichtet und begünstigen einseitig die Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) der Begüterten.
Es widerspricht einer gerechten Besteuerung, wenn nur derjenige Steuern zahlt, der die »Schlupflöcher« nicht kennt oder der sie als Lohnabhängiger nicht nutzen kann.
3.5 Wirtschaftliche Betrachtungsweise
Das Steuerrecht kann den Gestaltungen des Zivilrechts dann nicht folgen, wenn besondere steuerrechtliche Vorschriften ausdrücklich oder die wirtschaftliche Betrachtungsweise dem Sinngehalt nach eine Abweichung gebieten.
Die wirtschaftliche Betrachtungsweise − eine ungeschriebene Rechtsregel zur Auslegung von Steuergesetzen − schreibt vor, dass Vorgänge, die in den gesetzlichen Steuertatbeständen mit Begriffen des bürgerlichen Rechts umschrieben sind, unabhängig von ihrem bürgerlich-rechtlichen Gehalt auszulegen sind. Die AO enthält keine dem früheren § 1 Abs. 2, 3 StAnpG entsprechende Vorschrift (danach waren die Volksanschauung, der Zweck und die wirtschaftliche Bedeutung der Gesetze sowie die Entwicklung der Verhältnisse zu berücksichtigen), sondern regelt in den §§ 39 Abs. 2, 41, 42 AO lediglich Unterfälle der wirtschaftlichen Betrachtungsweise. An der bereits vor dem In-Kraft-Treten der AO 77 geltenden Lehre von der wirtschaftlichen Betrachtungsweise hat sich indes nichts geändert. Sie soll vor allem sicherstellen, dass unabhängig von der rechtlichen Gestaltung wirtschaftlich gleiche Sachverhalte auch steuerlich gleich behandelt werden. Den vom Steuerpflichtigen willkürlich geschaffenen, aber wirtschaftlich bedeutungslosen Tatsachen darf kein entscheidender Einfluss auf die Höhe der Steuer eingeräumt werden.
Beispiele
Mietzahlungen eines Gewerbetreibenden an Familienangehörige können dann nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, sondern sind als Versorgungsrenten zu behandeln, wenn das zugrunde liegende, als Miete bezeichnete Rechtsverhältnis alle Merkmale einer Versorgungsabrede enthält.
Bezüge aus einem zivilrechtlichen Dienstvertrag können Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG sein, wenn der Bezügeempfänger in dem Betrieb Unternehmerrisiko trägt und Unternehmerinitiative entfalten kann, so dass er als Mitunternehmer anzusehen ist.
Ein Einzelunternehmer U erhält von seinem Bruder B ein Darlehen, wobei B erkennen lässt, dass er keine Rückzahlung erwartet. U darf das Darlehen nicht passivieren. Zivilrechtliche Schuldverhältnisse sind nur dann zu passivieren, wenn mit einer Inanspruchnahme durch den Gläubiger tatsächlich zu rechnen ist.
Die wirtschaftliche Betrachtungsweise hat ihre eigentliche Bedeutung da, wo das Steuerrecht zivilrechtliche Begriffe verwendet. Sie ist damit eine der wichtigsten Gesetzesanwendungsregeln im Steuerrecht (zur Rechtsanwendung und Gesetzesauslegung im Steuerrecht vgl. Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8; Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen; Urbas, Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht).
Für den Anfänger sei aber betont: Die wirtschaftliche Betrachtungsweise ist nicht »Mädchen für alles«. Sie kann auf keinen Fall zu dem Zweck verwendet werden, sich über das Gesetz hinwegzusetzen oder fingierte Sachverhalte zu besteuern.
Ein gesetzlich normierter Unterfall der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist das wirtschaftliche EigentumWirtschaftliches Eigentum(Definition in § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO, vgl. dazu in diesem Band E 6, und Band 1, Helmschrott/Schaeberle/Scheel; Abgabenordnung, B 3.1).
Beispiele
K kauft von V im Jahr 01 ein Einfamilienhaus mit Auflassungsvormerkung und zieht ein. Erst im Jahr 02 wird K als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Kann K bereits im Jahr 01 die Förderung nach dem Eigenheimzulagegesetz erhalten?
Lösung Das Eigenheimzulagegesetz setzt die Selbstnutzung durch den Eigentümer voraus. Das zivilrechtliche Eigentum erlangt K erst mit der Grundbucheintragung. K ist aber, da Nutzen und Lasten bereits auf ihn übergegangen sind, bereits als wirtschaftlicher Eigentümer anzusehen und kann die Grundförderung erhalten.
Ein Unternehmer verkauft eine Maschine gegen Ratenzahlung. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behält er sich das Eigentum vor (§ 449, s. E 7).
Lösung Die Lieferung des Gegenstandes ist − obwohl zivilrechtlich das Eigentum noch nicht auf den Käufer übergegangen ist − nach § 3 Abs. 1 UStG zu versteuern, weil bereits das wirtschaftliche Eigentum verschafft ist.
3.6 Gesetz- und sittenwidriges Handeln (§ 40 AO)
§ 40 AO verhindert, dass gesetz- oder sittenwidriges Handeln vor legalem und anständigem Handeln privilegiert wird. Ein Rechtsgeschäft, das zivilrechtlich nichtig ist (§§ 134, 138), aber unter ein Steuergesetz fällt, ist steuerlich dennoch zu beachten. Es kommt auf das wirtschaftliche »Ist« an. Dies ist z. B. zu bedenken bei Einnahmen aus SchwarzarbeitSchwarzarbeit oder Einkünften aufgrund von Erpressungen.
3.7 Zivilrechtlich unwirksame Rechtsgeschäfte (§ 41 AO)
Noch deutlicher kommt der Grundsatz, dass es nicht auf die zivilrechtliche Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts, sondern auf seinen tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt ankommt, in § 41 Abs. 1 AO zum Ausdruck (vgl. dazu Heuermann, DB 2007, 1267 m. w. N.).
Beispiele
Der unverheiratete A hat durch eigenhändiges Testament seinen Bruder B zum Erben seines Privathauses und seine Schwester C zur Erbin seines Betriebes eingesetzt. B und C setzen sich über dieses Testament hinweg und befolgen eine von A kurz vor seinem Tod mündlich getroffene Verfügung, wonach B den Betrieb und C das Grundstück erben soll. Wer hat nach dem Tod des A welche Einkünfte zu versteuern?
Lösung Die mündliche Verfügung von Todes wegen erfüllt nicht die zivilrechtlichen Formerfordernisse und ist damit nichtig (§§ 2247, 2258, 125). Sie ist aber von den Erbbeteiligten erfüllt worden und deshalb nach § 41 AO der Besteuerung zugrunde zu legen: B erhält den Betrieb (Fortführung der Buchwerte nach § 6 Abs. 3 EStG) und hat gewerbliche Einkünfte, C erhält das Haus (Fortführung des AfA-Satzes und der AfA-Bemessungsgrundlage nach § 11d EStDV). Vgl. BFH vom 12.12.1973 BStBl II 1974, 340.
Ein sechsjähriges Kind »kauft« beim Spielzeughändler einen Ball.
Lösung Das Kind kann selbst nicht zivilrechtlich wirksam handeln (zur Geschäftsfähigkeit s. unten B 1.4.3). Dennoch muss der Unternehmer diesen Verkauf als Lieferung nach § 3 Abs. 1 UStG der Umsatzsteuer unterwerfen.
Dagegen lösen ScheingeschäfteScheingeschäfte und ScheinhandlungenScheinhandlungen − wenn es also den Parteien an einem ernsthaften Geschäftswillen fehlt − keinen wirtschaftlichen Effekt aus (§ 41 Abs. 2 AO).
Beispiel
A hat B einen Gewerbebetrieb zur Sicherung übereignet. Außerdem haben A und B vertraglich vereinbart, dass A im Betrieb nichts mehr zu bestimmen hat und kein geschäftliches Risiko mehr trägt, aber nach außen noch als Betriebsinhaber auftritt. Wem sind die Erträge zuzurechnen?
Lösung A und B haben nur zum Schein eine Sicherungsübertragung, in Wirklichkeit aber eine Vollübertragung des Betriebes vereinbart. A ist Strohmann für B. Betrieb und Einkünfte sind damit B zuzurechnen.
3.8 Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO)
Zwar ist es erlaubt, seine Rechtsverhältnisse steuerlich möglichst günstig zu gestalten. Vereinbarungen können aber im Steuerrecht nur anerkannt werden, wenn sie eindeutig und ernstlich gewollt und auch tatsächlich durchgeführt sind.
Beispiele
Verträge zwischen nahen Angehörigen werden von der Finanzverwaltung nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen anerkannt (vgl. R 4.8 EStR und R 15.9 EStR für die Anerkennung von Familienpersonengesellschaften):
Der Vertrag muss zivilrechtlich wirksam und ernsthaft und eindeutig abgeschlossen sein.
Der Vertrag muss auch tatsächlich durchgeführt sein. Denn Papier ist geduldig.
Die Leistungen müssen angemessen sein.
Liegt der Fehler bei a) oder b), wird der Vertrag steuerlich nicht anerkannt, und die Lohn- oder Gewinnzahlungen werden nicht gewinnmindernd als Betriebsausgaben, sondern gewinnneutral als Privatentnahmen behandelt. Liegt der Fehler bei c), wird der Vertrag zwar steuerlich anerkannt, aber die Zahlung an den Familienangehörigen darf den Gewinn nur in angemessener Höhe mindern.
Die Rechtsprechung leitet solche Rechtsfolgen i. d. R. aus der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ab. Die Vorschrift des § 42 AO wird selten angewendet. Sie setzt voraus, dass der Steuerpflichtige außersteuerliche Rechtsverhältnisse in der Absicht der Steuerumgehung den wirtschaftlichen Vorgängen gegenüber unangemessen gestaltet. Eine Gestaltung ist dann unangemessen, wenn verständige Parteien sie zur Erreichung des erstrebten wirtschaftlichen Ziels nicht gewählt hätten (vgl. Band 1, Helmschrott/Schaeberle/Scheel; Abgabenordnung, B 3.3).
Merksatz
Aufgrund der wirtschaftlichen Betrachtungsweise sind zivilrechtliche Begriffe und Rechtsgeschäfte im Steuerrecht nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt auszulegen. Ein Rechtsgeschäft, das zivilrechtlich unwirksam ist, kann dennoch steuerliche Folgen haben, wenn es einen Besteuerungstatbestand erfüllt. Ein Rechtsgeschäft, das zivilrechtlich wirksam ist, kann dennoch ohne die gewünschten steuerlichen Folgen bleiben, wenn es nicht tatsächlich durchgeführt ist oder zur missbräuchlichen Umgehung von Steuergesetzen dienen soll.
3.9 Der sogenannte Maßgeblichkeitsgrundsatz
Eine besondere Verknüpfung des Privatrechts − und zwar des Handelsrechts − mit dem Steuerrecht ist der Maßgeblichkeitsgrundsatz. Nach dem Grundsatz der materiellen Maßgeblichkeit ist bei buchführenden Gewerbetreibenden in der Bilanz das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) auszuweisen ist (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Die Handelsbilanz ist grundsätzlich für die Steuerbilanz maßgeblich. Die Steuerbilanz kann als abgeleitete Handelsbilanz angesehen werden. Mit der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten in der Handelsbilanz legt sich der Steuerpflichtige grundsätzlich auch für die Steuerbilanz fest. In der Praxis ist es i. d. R. umgekehrt; wegen der rechtlichen Abhängigkeit der Steuerbilanz von der Handelsbilanz ist der Unternehmer gezwungen, die steuerlich zweckmäßigen Ansätze in die Handelsbilanz aufzunehmen (faktische Dominanz der Steuerbilanz). Ein von der Handelsbilanz abweichender Posten erscheint in der Steuerbilanz nur dann, wenn die handelsrechtlich zulässigen Ansätze zwingenden steuerlichen Vorschriften widersprechen (z. B. § 5 Abs. 1a, 2−4a EStG steuerrechtlicher Bewertungsvorbehalt des § 5 Abs. 6 EStG). Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist eine steuergesetzliche Abweichung von der Maßgeblichkeit nur dann verfassungswidrig, wenn sie willkürlich ist (BVerfG vom 12.05.2009, 2 BvL 1/00 BStBl II 2009, 685).
Nach dem Grundsatz der konkreten MaßgeblichkeitMaßgeblichkeit sind die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten Bewertungseinheiten auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich (§ 5 Abs. 1a Satz 2 EStG).
Mit dem Maßgeblichkeitsgrundsatz werden bestimmte Normen des Handelsrechts in das Einkommensteuerrecht transformiert:
geschriebene und ungeschriebene formelle Anforderungen an die laufende Buchführung und an den Jahresabschluss;
gesetzliche Bilanzierungsvorschriften (Ansatz von Aktiv- und Passivposten dem Grunde nach), Gliederungsvorschriften und Bewertungsvorschriften (Ansatz von Aktiv- und Passivposten der Höhe nach) im Dritten Buch des HGB (§§ 238 ff. HGB);
(auch nach dem Inkrafttreten des BiRiLiG ungeschrieben gebliebene) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, vgl. § 238 Abs. 1, § 243 Abs. 1 HGB).
Ob der Maßgeblichkeitsgrundsatz der Vereinfachung oder dem Schutz vor dem Fiskus dienen soll, ist nicht eindeutig bestimmbar. Der Maßgeblichkeitsgrundsatz birgt die Gefahr in sich, dass die teilweise unterschiedliche Zwecksetzung der handelsrechtlichen und steuerlichen Gewinnermittlung vernachlässigt und das Handelsrecht zur Erlangung steuerlicher Gruppenvorteile missbraucht wird.
Ob es einen Grundsatz der »umgekehrten Maßgeblichkeit«Maßgeblichkeit, umgekehrte gibt, also einen Grundsatz der Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für die Handelsbilanz, war lange Zeit umstritten. In § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a. F. war geregelt, dass steuerrechtliche Wahlrechte bei der Gewinnermittlung in Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jahresbilanz auszuüben sind. Die Befürworter machten geltend, steuerliche Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte könnten generell nicht dazu führen, dass die steuerpflichtigen Einkünfte geringer seien als die handelsrechtlichen Gewinne. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung wurde klargestellt, dass sich Inhalt und Grenzen der Maßgeblichkeit des Steuerrechts für das Handelsrecht nur aus den Normen des Steuerrechts ergeben können (BFH vom 24.04.1985 BStBl II 1986, 324). Im Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2010 (BilMoG) wurde die umgekehrte Maßgeblichkeit beseitigt. Steuerrechtliche Wahlrechte sind bei der Gewinnermittlung nach geltendem Recht unabhängig von der Behandlung der Sachverhalte in der Handelsbilanz auszuüben. Der Gesetzgeber wollte damit die handelsrechtliche Rechnungslegung vereinfachen und den Informationsgehalt des handelsrechtlichen Jahresabschlusses verbessern (vgl. Band 3, Fanck/Guschl; Buchführungstechnik und Bilanzsteuerrecht, D 3.5).
4 Rechtsanwendung
Die Arbeit mit dem BGB fällt dem Anfänger schwer. Ihm fehlt − anders als in schon in der Schule unterrichteten Studienfächern (z. B. Sprachen, Naturwissenschaften, Mathematik) − das notwendige Basiswissen für die Gesetzesanwendung. Der Einstieg wird durch einen Überblick über den Aufbau und über die typischen Strukturen des BGB erleichtert. Außerdem gilt es, die für die Gewinnung juristischer Ergebnisse maßgeblichen Regeln kennenzulernen, die der Bearbeiter eines Rechtsfalles regelmäßig zu beachten und anzuwenden hat.
4.1 Aufbau des BGB
Die rund 2 400 Paragraphen des BGB sind so gegliedert, dass zumindest der »Suchbereich« mancher Fragestellungen auf einige hundert Vorschriften eingeengt wird. Wenn man das Inhaltsverzeichnis liest, so ist eine Einteilung erkennbar, die bestimmte Themen den »Büchern« des BGB zuordnet. Im 2. Buch (Recht der Schuldverhältnisse) sind Verträge geregelt, im 3. Buch (Sachenrecht) die Rechtsbeziehungen zwischen Person und Sache, im 4. Buch familienrechtliche Fragen und im 5. Buch alles, was im weitesten Sinne zum Erbrecht gehört. Der Inhalt des 1. Buches (Allgemeiner Teil) beruht auf einer für das BGB typischen Struktur. Der Gesetzgeber hat darin solche Aussagen, Vorschriften und Definitionen zusammengefasst, die für die Bücher 2 bis 5 in gleicher Weise gelten. Er hat also Gemeinsames − wie in der Mathematik − »vor die Klammer gezogen«.
Beispiele
Einen Kaufvertrag zu schließen (2. Buch: § 433), das Eigentum an einer Sache zu erwerben (3. Buch: § 929), einen Ehevertrag zu vereinbaren (4. Buch: § 1408) oder ein Testament zu errichten (5. Buch: § 1937) setzt immer eine gleich lautende Eigenschaft voraus: Die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein (Rechtsfähigkeit, s. B 1.2). Sie ist deshalb als gemeinsam geltende Vorschrift im Allgemeinen Teil des BGB (AT) vor die Klammer gezogen (vgl. § 1!).
Ein Kaufvertrag über eine Sache (z. B. ein Auto), der Eigentumserwerb an diesem Auto und eine testamentarische Verfügung über dieses Auto setzen jeweils gleichermaßen eine »Sache« (= Auto) voraus. Diese findet sich folglich im AT (vgl. § 90!).
Das BGB regelt nicht jede Rechtsbeziehung geschlossen für sich. In den seltensten Fällen ist eine Norm in sich vollständig. Vielmehr geht das BGB vom Allgemeinen zum Besonderen. Allgemeine Vorschriften werden vor die Klammer gezogen und bei den besonderen Vorschriften vorausgesetzt und nicht mehr wiederholt. Die Vorschriften des AT des BGB (1. Buch) werden in den Büchern 2 bis 5, die des Allgemeinen Schuldrechts (2. Buch, 1. bis 6. Abschnitt) im Besonderen Schuldrecht (2. Buch, 7. Abschnitt) vorausgesetzt.
Technik des Vor-die-Klammer-Ziehens
Diese für das BGB typische Struktur hat den Vorteil, dass das BGB auf kasuistische Aufzählungen verzichten kann. Auch eine noch so umfangreiche Auflistung dessen, was z. B. als Sache gelten kann, müsste unvollständig bleiben. Der Aufbau des BGB hat aber auch zur Folge, dass der Rechtsanwender häufig zugleich mehrere Vorschriften zu prüfen hat.
Beispiel
A kauft von B ein Buch für 20 €.
Bei der rechtlichen Beurteilung dieses einfachen Sachverhalts muss man im BGB weit verstreute Vorschriften anwenden:
§§ 104 ff. für die Frage, ob sich die beiden rechtlich binden können,
§§ 116 ff. für die Frage, ob die Willenserklärungen wirksam sind,
§§ 145 ff. für die Frage, ob und wie ein Vertrag geschlossen wird,
§§ 433 ff. für die Frage, welche Rechte und Pflichten den Käufer und den Verkäufer treffen,
§§ 854 ff. für die Frage, ob und wie der Käufer Besitz an der Sache erlangt,
§§ 929 ff. für die Frage, ob das Eigentum an der Sache übergegangen ist.
4.2 Technik der Rechtsanwendung
Hat man eine oder mehrere Vorschriften gefunden, die für die Lösung eines Problems (»Kann A von B Geld, eine Sache usw. verlangen?«) brauchbar erscheinen, beginnt die Arbeit mit dieser konkreten Norm.
4.2.1 Aufbau von Rechtsnormen
Alle vollständigen Rechtsnormen haben den gleichen inneren Aufbau: Zunächst beschreibt der Gesetzgeber mit abstrakten Begriffen (=TatbestandsmerkmalenTatbestandsmerkmal) einen konkreten Vorgang (=SachverhaltSachverhalt) und zieht dann für diesen zu entscheidenden Fall die Rechtsfolge. Wenn der Sachverhalt alle Tatbestandsmerkmale der Norm erfüllt, tritt die Rechtsfolge ein.
Es gibt auch in den Büchern 3 bis 5 Schuldverhältnisse, z. B. im Familienrecht Unterhalt (§§ 1360, 1601), im Erbrecht Vermächtnis (§ 2167), Pflichtteil (§ 2303).
Beispiel
Adam hat Bertram für 14 Tage ein Buch geliehen. Adam will das Buch nach diesen 14 Tagen wiederhaben (Sachverhalt). Kann er es herausverlangen (Fallfrage)?
Lösung Nach § 604 ist der Entleiher verpflichtet, die geliehene Sache nach dem Ablauf der für die Leihe bestimmten Zeit zurückzugeben. Da Bertram das Buch geliehen hat und die Leihfrist abgelaufen ist, muss er das Buch zurückgeben. Oder: Adam kann das Buch von Bertram herausverlangen.
4.2.2 Reihenfolge bei der Fallbearbeitung
Man nennt den Denkvorgang, bei dem ein Lebenssachverhalt mit den abstrakten Tatbestandsmerkmalen einer Norm verglichen wird, um festzustellen, welche bestimmten Rechtsfolgen hieraus abzuleiten sind, SubsumtionSubsumtion. Diesem Denkvorgang liegt die Lehre des deduktiven Schlusses (Syllogismus) zugrunde. Aus zwei Urteilen (Prämissen) wird ein Schlusssatz (Konklusion) gefolgert. Den beiden Urteilen ist ein Begriff gemeinsam, der die Verknüpfung der beiden Urteile (Obersatz und Untersatz) in einem neuen Schlusssatz ermöglicht. Das klassische Beispiel hierfür lautet:
Wenn auch die Rechtsanwendung außer von logischen wesentlich von anderen Momenten geprägt ist (z. B. Auslegung, Lückenfüllung durch Analogie, Rechtsfortbildung), so bildet doch der Syllogismus die Grundlage jeder juristischen Tätigkeit.
Beispiel
Die Anwendung des Syllogismus auf das obige Beispiel sieht wie folgt aus:
A hat von B für 14 Tage ein Buch entliehen (Untersatz, Sachverhalt).
Der Entleiher muss die Sache nach Ablauf der Leihfrist zurückgeben (Obersatz, Tatbestand des § 604).
B muss das Buch A nach Ablauf der 14 Tage zurückgeben (Schlusssatz, Rechtsfolge).
Der typische Dreischritt des Syllogismus ist nur eine grobe Gliederung für die juristische Arbeitsweise. Für den Anfänger ist es hilfreich, sich bei der Lösung von Rechtsfällen an eine bestimmte, im Folgenden beschriebene Arbeitstechnik zu halten. Sofern nicht die Besonderheit des zu entscheidenden Falles ausnahmsweise ein anderes Vorgehen erfordert, empfiehlt sich eine Prüfungsreihenfolge, die sechs Schritte umfasst:
1. Schritt: Was ist eigentlich geschehen (SachverhaltSachverhalt)?
Der Fallbearbeiter muss sich zunächst den vorgegebenen Lebenssachverhalt einprägen, nichts weglassen und nichts unterstellen. Erörterungen darüber, welche Folgerungen zu ziehen wären, wenn im Sachverhalt etwas anderes stünde, sind fehl am Platz.
Im Ausgangsbeispiel: A hat B für 14 Tage ein Buch geliehen. A will es nach Ablauf der 14 Tage wiederhaben.
2. Schritt: Was soll ich mit diesem Sachverhalt tun (FallfrageFallfrage)?
Nun muss geklärt werden, zu welcher Frage Stellung zu nehmen ist. Dies ergibt sich i. d. R. aus den Sätzen am Ende des Sachverhalts, etwa: »Kann A von B Zahlung des Kaufpreises verlangen?« oder »Kann C von D Herausgabe verlangen?« Die Frage lautet häufig: »Wer (Anspruchsteller) will was (Anspruchsziel) von wem (Anspruchsgegner) woraus (Anspruchsgrundlage)?« Der Bearbeiter muss sich auf die Beantwortung der Fallfrage beschränken. Nur wenn allgemein gefragt ist: »Wie ist die Rechtslage?«, müssen sämtliche Probleme erörtert werden, die der Fall aufwerfen könnte.
Im Ausgangsbeispiel: In unserem Ausgangsfall lautet die Fallfrage: Kann A von B die Herausgabe des Buches verlangen?
3. Schritt: Welche Vorschriften kommen in Frage (Suche nach der AnspruchsgrundlageAnspruchsgrundlage)?
Wenn festgestellt ist, welche Rechtsfrage zu beantworten ist, muss man im Gesetz eine Norm − eine Anspruchsgrundlage − suchen, aus der sich die Antwort auf die Fallfrage ergibt. Die Antwort muss auf der Rechtsfolgeseite der Norm abgelesen werden können. Grundsätzlich sind alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen zu prüfen (vgl. B 1.1.1).
Im Ausgangsbeispiel: Es handelt sich um einen Leihvertrag; demnach sind die §§ 598 ff. (hier § 604) zu prüfen. Außerdem ist das Buch eine Sache, deren Eigentümer A ist. Also kommt auch eine Norm des Sachenrechts (hier § 985) als Anspruchsgrundlage in Betracht (vgl. Fall 2).
4. Schritt: Welche Tatbestand, TatbestandsmerkmaleTatbestandsmerkmale verlangt der Gesetzgeber?
Jede Rechtsnorm enthält mehrere Tatbestandsmerkmale. Jeder Rechtsbegriff − und zwar einer nach dem andern − muss mit den entsprechenden Tatsachen des Lebenssachverhalts zur Deckung gebracht werden. Es ist deshalb wichtig, alle Tatbestandsmerkmale herauszufinden.
Im Ausgangsbeispiel: § 604 verlangt einen Leihvertrag (1), eine geliehene Sache (2) und den Ablauf der Leihfrist (3).
5. Schritt: Vergleich der abstrakten Tatbestandsmerkmale mit dem Lebenssachverhalt (SubsumtionSubsumtion)
Bei jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal ist zu prüfen, ob es eine Entsprechung im Sachverhalt findet, d. h. ob die Tatbestandsmerkmale durch den Sachverhalt erfüllt sind. Wenn auch nur ein Tatbestandsmerkmal fehlt, ist damit die Prüfung dieser Anspruchsgrundlage zu Ende. Die Subsumtion kann zum Ergebnis haben, dass
der Sachverhalt den Tatbestand eindeutig erfüllt (so im Ausgangsfall) oder eindeutig nicht erfüllt,
der Sachverhalt den Tatbestand weder eindeutig erfüllt noch eindeutig nicht erfüllt, so dass durch Auslegung der Wortsinn, der Bedeutungszusammenhang, die Entstehungsgeschichte und der Zweck der Norm oder des einzelnen Tatbestandsmerkmals festgestellt werden muss,
der Sachverhalt von keinem Tatbestand überhaupt erfasst wird, so dass eine Regelungslücke im Wege der Analogie, des Umkehrschlusses oder der sonstigen Rechtsfortbildung geschlossen werden muss.
6. Schritt: Ziehen der RechtsfolgeRechtsfolge
Nachdem die Tatbestandsvoraussetzungen auf ihre Übereinstimmung mit dem Sachverhalt hin überprüft sind, kann die Schlussfolgerung gezogen werden, ob die Rechtsfolge eintritt (oder nicht eintritt, weil eine oder mehrere Voraussetzungen nicht gegeben sind).
Im Ausgangsbeispiel: Es liegen alle (hier: drei) Tatbestandsmerkmale vor. Die Rechtsfolge lautet: Der Entleiher ist verpflichtet, die Sache zurückzugeben. Oder: A kann von B das Buch herausverlangen.
Fälle 2−3
Fall 2 Prüfen Sie, ob im Ausgangsfall (s. Beispiel in 4.2.1) auch noch die weitere Anspruchsgrundlage (§ 985) erfüllt ist!
Fall 3