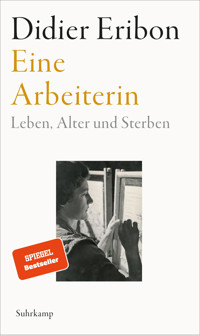37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Didier Eribons Betrachtungen zur Schwulenfrage 1999 in Frankreich erschienen, wurde das als Ereignis gefeiert. Schnell etabliert sich das Buch als Klassiker und Gründungsdokument der Queer Studies. Eribon legt darin eine neue Analyse der Bildung von Minderheitenidentitäten vor, an deren Anfang die Beleidigung steht. Es geht um die Macht der Sprache und der Stigmatisierung, um die Gewalt verletzender Worte im Rahmen einer allgemeinen Theorie der Gesellschaft und der Mechanismen ihrer Reproduktion. Nun liegt das Werk erstmals in deutscher Übersetzung vor.
Eribons Analyse setzt ein mit einer fulminanten »Sozialanthropologie« der gelebten Erfahrung, in der zentrale Etappen der Konstitution einer homosexuellen Identität nachgezeichnet werden. Auf sie folgt eine historische Rekonstruktion der literarischen und intellektuellen Dissidenz sowie der »homosexuellen« Rede – von den Oxforder Hellenisten in der Mitte des 19. Jahrhunderts über Oscar Wilde und Marcel Proust bis zu André Gide im 20. Jahrhundert. Die Untersuchung mündet in einer Neuinterpretation von Michel Foucaults philosophischem Denken über Sexualität, Macht und Widerstand. In der brillanten Verknüpfung von Soziologie, Literatur und Philosophie bietet dieses große Buch mehr denn je Werkzeuge für all jene, die über Differenz und Emanzipation nachdenken wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 875
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Didier Eribon
Betrachtungen zur Schwulenfrage
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer
Suhrkamp
Für G. natürlich
»Es ist wahr, daß das gesellschaftliche Sein das ist, was gewesen ist, aber auch, daß das, was einmal gewesen ist, für immer nicht nur in die Geschichte, was sich von selbst versteht, sondern auch in das gesellschaftliche Sein, in die Dinge und auch die Körper eingeschrieben ist. So nimmt mit jedem Tag, den eine Macht andauert, der Anteil des Irreversiblen zu, mit dem diejenigen rechnen müssen, die sie umstürzen wollen.«
Pierre Bourdieu
Der Tote packt den Lebenden
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
Vorwort zur neuen Ausgabe (2012)
Erster Teil Eine Welt voller Beleidigungen
1 Der Schock der Beleidigung
2 Die Flucht in die Stadt
3 Freundschaft als Lebensform
4 Sexualität und Berufe
5 Familie und »Melancholie«
6 Die Stadt und der konservative Diskurs
7 Sprechen und nicht sprechen
8 Die heterosexuelle Anrufung
9 Die unterworfene »Seele«
10 Die Karikatur und die kollektive Beleidigung
11 Inversionen
12 Über Sodomie
13 Subjektivität und Privatleben
14 Die Existenz geht der Essenz voraus
15 Die unrealisierbare Identität
16 Störungen
17 Individuum und Gruppe
Zweiter Teil Oscar Wildes Gespenster
1 Wie die »arroganten Päderasten« entstehen
2 Ein unaussprechliches Laster
3 Eine Nation von Künstlern
4 Philosoph und Liebhaber
5 Die moralische Ansteckung
6 Die Wahrheit der Masken
7 Die Griechen gegen die Psychiater
8 Die Demokratie der Kameraden
9 Margot-La-Boulangère und La Baronne-Aux-Épingles
10 Von der Lust des Augenblicks zur Reform der Gesellschaft
11 Der Wille zu stören
12 Das »homosexuelle Anliegen«
Dritter Teil Die Heterotopien Michel Foucaults
1 Eine größere Schönheit
2 Von der Nacht zur Sonne
3 Die Kraft zu fliehen
4 Homosexualität und Unvernunft
5 Geburt der Perversionen
6 Das dritte Geschlecht
7 Die Fabrikation der Subjekte
8 Die Philosophie im Versteck
9 Wenn zwei Jungs Händchen halten
10 Widerstand und Gegen-Diskurs
11 Schwul werden
12 Männer unter sich
13 Unterschiede setzen
Anhang
Hannah Arendt und die »diffamierten Gruppen«
Namenregister
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Vorwort zur neuen Ausgabe (2012)
Es ist nicht leicht, einem neuen Leserkreis ein Buch vorzustellen, das bereits eine ziemlich lange »Karriere« hinter sich hat. Ich habe 1995 mit seiner Niederschrift begonnen; sie wurde 1999 abgeschlossen und veröffentlicht. Ich erinnere mich noch der Energie – besser gesagt: der Begeisterung –, die mich damals beseelte, als ich tagsüber las, nachts schrieb … Ich empfand mich zutiefst als Mitglied einer internationalen Bewegung zur Erneuerung des Denkens, einer Bewegung, die in politischen Strömungen wurzelte, die sich zum Ziel gesetzt hatten, Fragen aufzuwerfen – oder vielmehr: sie nochmals und in neuen Begriffen zu stellen –, die mit Gender und Sexualität zu tun haben, um gegen die Normen aufzubegehren, die in diesen Bereichen herrschen, und die Gewalt zu bekämpfen, die diese Normativität mit sich bringt.
Ich hoffe, dass die Leidenschaftlichkeit, ja Fieberhaftigkeit, von denen diese Seiten geprägt waren, inzwischen noch nicht ganz erloschen sind, und dass sie sich auch den Lesern von heute mitteilen, als wäre das Werk gerade erst erschienen. Abgesehen von einigen Streichungen und Zusätzen habe ich in dieser Neuausgabe im Übrigen nur überwiegend geringfügige – wenn auch recht zahlreiche – Änderungen vorgenommen, so sehr bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass diese vor etwa fünfzehn Jahren entwickelten »Betrachtungen« in einem stark gewandelten Kontext ihre Relevanz und Triftigkeit im Wesentlichen bewahrt haben.
Wenn ich zusammenfassen sollte, worum es mir damals ging, könnte ich es so formulieren: In diesem ersten einer Reihe von Werken wollte ich versuchen, die Einwirkung sozialer Verdikte – wie sie durch die Normen, die im Gender- und Sexualitätsbereich gelten, von vornherein gefällt werden – auf die Konstitution der Existenzen und Subjektivitäten zu untersuchen und zu beschreiben, vermittels welcher Mechanismen diese Einwirkung sich vollzieht und wieweit dieses Räderwerk blockiert werden könnte. Deswegen schreibe ich dem Phänomen der Beleidigung, der beleidigenden Äußerung, und allgemeiner: der Logik stigmatisierender und herabsetzender Kategorisierungen, eine so große Bedeutung zu. Die Macht der Beleidigung rührt daher, dass sie von der gesamten Gesellschaftsordnung – hier: der gesamten Sexualordnung – gestützt wird und darauf abzielt, in einer hierarchisch aufgebauten Struktur Plätze anzuweisen, und das auch erwirkt. Daher der Gedanke, dass die Verhaltensweisen und Strömungen, die gegen die Macht der Norm anzugehen beabsichtigen, keinesfalls ohne Gegendiskurse und Gegenpraktiken auskommen, die sich niemals völlig außerhalb dessen situieren können, was sie bekämpfen und wogegen sie Widerstand zu leisten versuchen.
Diese Gegendiskurse und Gegenpraktiken entspringen niemals dem Nichts: Sie sind einer Geschichte, sind Büchern und Ideen, Lebensstilen und Existenzweisen, kurz: einer Kultur oder Gegenkultur, eingeschrieben. Daher beziehen sich die Minderheiten, die Dissidenten bei ihrem Versuch, die Gegenwart zu transformieren, die Zukunft ins Auge zu fassen, unweigerlich auf eine mehr oder weniger nahe Vergangenheit, die Modelle und Vorstellungen zur Verfügung stellt, Wörter und Affekte, und die der Fähigkeit zu handeln und dem Willen zur Autonomie Stützpunkte liefert, deren sie zu ihrer Entwicklung bedürfen. Man bekennt sich zu Vorgängern und lässt sich von ihrem Beispiel anleiten. Indem man sich auf diese Weise ermöglicht, seine persönliche Erfahrung in einen Rahmen zu stellen, der sie verständlich macht, indem man also seiner Existenz eine Bedeutung verleiht, die sich in dem verankert, was anderen zu schaffen gelang, bringt man es dazu, seine eigene Existenz zu konstruieren oder zumindest zusammenzubasteln, so gut es eben geht.
Ich weiß wohl, dass Joan Scott in einem berühmten Artikel eben diese »Evidenz der Erfahrung« in Frage gestellt hat, die sehr oft dazu führt, sich in diesem oder jenem Aspekt einer Vergangenheit wiederzuerkennen, deren kulturelle Gesamtkonfigurationen wir nicht kennen. Dieselben Worte, dieselben Gebärden, dieselben kennzeichnenden Merkmale können in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen annehmen und also nur verstanden werden, wenn man sie wieder in ihre historischen »Orte« einschreibt. »Es sind nicht die Individuen, die Erfahrungen haben, sondern Subjekte werden durch Erfahrungen konstituiert.«1
Ein »Subjekt« ist also immer durch die Gesellschaftsordnung produziert, die die Erfahrungen der Individuen in einem gegebenen Augenblick der Geschichte organisiert. Daher läuft die Versuchung, im Tun und Treiben der Vergangenheit sich selbst wiederzufinden, Gefahr, die Realität der komplexen Systeme auszublenden, die die Erfahrungen jener Epoche steuerten. Sie erwecken heute in uns ein Gefühl von Vertrautheit – dabei müssten wir doch allererst die sozialen, ideologischen, sexuellen Mechanismen auf den Prüfstand stellen, die ihnen ihre Bedeutung verliehen und die »Subjekte« produzierten, die sie ausagierten. Ein »Subjekt« wird stets produziert in »Unterordnung« unter eine Ordnung, unter Regeln, Normen, Gesetze … Das gilt für alle »Subjekte«. »Subjekt« sein und einem System von Zwängen unterliegen ist ein und dasselbe.2 Aber dies gilt noch mehr für »Subjekte«, denen in der Sozial- und Sexualordnung ein »untergeordneter« Platz zugewiesen ist, namentlich für Schwule und Lesben.3 Bei der Lektüre von Proust beispielsweise hätten wir uns zu fragen: Was lehrt uns diese Beschreibung der Homosexualität über die Gesellschaft jener Zeit, über die Art und Weise, in der die Kategorien »Gender« und »Sexualität« geformt wurden, über die Beziehungen zwischen Personen desselben Geschlechts, darüber, wie sie je nach sozialem Milieu wahrgenommen und erfahren wurden, usw.? Und was über die Verflechtung jedes dieser Aspekte mit umfassenderen Realitäten? Kurz, wir hätten uns die wesentliche Frage zu stellen: Wenn wir uns spontan mit diesen Kategorien identifizieren, ratifizieren wir dann nicht ihre »Evidenz«, fixieren und verdinglichen wir sie nicht, statt sie der Kritik zu unterziehen? Naturalisieren wir sie nicht, statt sie zu historisieren?
Ließe sich aber bei der Untersuchung der Prozesse der Produktion von »Subjekten«, das heißt ihrer »Unterwerfung«, nicht doch von jenem Gefühl einer Evidenz ausgehen, das zu beweisen tendiert, dass die Systeme der Sexualordnung trotz all der über ein Jahrhundert hinweg eingetretenen historischen Transformationen eine gewisse Kontinuität bewahrt haben? In Die männliche Herrschaft stellt Pierre Bourdieu sich in Bezug auf Frauen die Frage: Wie kommt es, dass Herrschaftsstrukturen ganze Epochen fast unbeschädigt überdauerten trotz aller Veränderungen, die die Beziehungen zwischen den Geschlechtern umgewälzt haben?4 Lässt sich diese Frage nicht auch analog zur Homosexualität stellen? Gewiss, seit Prousts Zeiten hat sich die Situation beträchtlich geändert, sofern sich überhaupt für irgendeine Epoche von einer Situation im Singular sprechen lässt. In großartigen Arbeiten sind die unterschiedlichen Existenzweisen von »Homosexualität« zu diesem oder jenem Zeitpunkt des 19. und des 20. Jahrhunderts untersucht worden, und es wurde gezeigt, was jede von ihnen einzigartig, unvergleichlich macht. Aus all diesen Beiträgen zur Erkenntnis der Vergangenheit geht hervor, dass der Begriff »Homosexualität« jünger ist, als man glaubt, und dass er selbst für die jüngst vergangenen Perioden zu umfassend, zu massiv, zu normativ ist, als dass er den vielfältigen, heterogenen Erfahrungen gerecht werden könnte … Die Gestalten, die »Homosexualität« annimmt, sind den jeweiligen kulturellen Gegebenheiten stets spezifisch; die Identitäten sind pluralisch, instabil, lassen sich von einfachen, eindeutigen Definitionen nicht einfangen. All das ist unbestreitbar. Und es liegt mir selbstverständlich fern, den Wert und die Bedeutung dieser historischen, soziologischen oder theoretischen Forschungen in Abrede zu stellen. Nichtsdestotrotz: Diejenigen, die das eigene Geschlecht lieben oder allgemeiner: die den Gender- und Sexualitätsnormen zuwiderhandeln, unterliegen einer besonderen Form sozialer Gewalt, und die Wahrnehmungsschemata und mentalen Strukturen, die dieser sicherlich weitgehend auf die androzentrische Sicht der Welt zurückzuführenden Gewalt zugrunde liegen, sind jedenfalls in der westlichen Welt überall fast dieselben, und sie sind es seit zumindest anderthalb Jahrhunderten. Daher das Gefühl der Nähe, das Schwule bei der Lektüre von Werken überkommen mag, die Erfahrungen von Schwulen in einem anderen Land oder einer anderen Epoche rekonstruieren. Das wirft die Frage nach der Verstetigung dieser Gewalt, nach ihren Auswirkungen und natürlich auch nach den Widerstandsformen auf, die ihr unaufhörlich entgegenwirken. Die Geschichte der Herrschaft wie auch die ihrer Bekämpfung sind daher durch eine gewisse – und unvermeidliche – Kontinuität geprägt, sei sie auch nur subjektiv. Es geht darum zu begreifen, wie die der sozialen Welt und zugleich den Wahrnehmungsstrukturen der Welt – hier dem sexuellen Bereich – einbeschriebenen Machtstrukturen sich in historisch unterschiedlichen Situationen reproduzieren und perpetuieren und selbst die Transformationen überdauern, denen die Gesellschaften und die Lebensformen ausgesetzt waren.
Ich habe eine doppelte Aufgabe in Angriff nehmen wollen. Zunächst einmal die, zu untersuchen, was es mit der »Unterwerfung« Schwuler heute auf sich hat und inwiefern diese Prozesse in vieler Hinsicht und trotz aller Entwicklungen nicht so verschieden sind von denen, die vor einem Jahrhundert im Schwange waren (was mich keineswegs dazu führt, eine essentialistische Konzeption von Identität restaurieren zu wollen, wie mir manchmal törichterweise vorgeworfen wurde, sondern dazu, die Sexualitätsfrage als Operator einer Analyse von Herrschaftsstrukturen einzusetzen, also als Verankerungspunkt einer allgemeinen Analyse des Funktionierens der Gesellschaftsordnung, wie es andere mit der Analyse des Bildungssystems taten). Ich habe daher sowohl auf sozialwissenschaftliche Untersuchungen zurückgegriffen (auf die neuesten, aber auch auf solche, die schon zehn oder zwanzig Jahre zurückliegen), aber auch auf die zeitgenössische und die klassische Literatur, namentlich auf Prousts Schriften. Ich habe mich übrigens entschieden, hauptsächlich auf sein Werk zurückzugreifen, zum einen, um eine Multiplizierung von Verweisen zu vermeiden und dem Leser den Zugang zu den Texten zu erleichtern, vor allem aber, weil es mir – anders als vielen anderen – in Bezug auf die Schwulenfrage als äußerst modern erscheint.
Ausgegangen bin ich von dem Problem der Beleidigung, das heute wie gestern im Leben der Schwulen eine derart große Rolle spielt. Ich habe versucht, die Art und Weise zu rekonstruieren, in der die Schwulen von der Sexualordnung »unterworfen« werden, und auch die Art und Weise, wie sie sich, zu jedem Zeitpunkt anders, der Herrschaft widersetzt haben, indem sie Lebensweisen, Spielräume, eine »Schwulenwelt« produziert haben. Ich interessierte mich daher für diese Prozesse der »Subjektivierung« oder »Resubjektivierung«, worunter ich die Möglichkeit verstehe, ausgehend von der zugewiesenen Identität seine persönliche Identität neu zu schaffen. Was folgerichtig heißt, dass der Akt, durch den man seine Identität neu erfindet, immer von der Identität abhängt, die von der Sexualordnung auferlegt worden ist. Nichts entsteht aus nichts, am wenigsten Subjektivitäten. Es handelt sich immer um eine Wiederaneignung oder, um Judith Butlers Bezeichnung zu verwenden, um eine »resignifizierende Praxis«.5 Aber diese »Resignifikation« ist der Akt der Freiheit schlechthin, und übrigens der einzig mögliche, denn er öffnet die Tore zu Unvorhergesehenem, zu Neuem.
Im zweiten, historisch orientierten Teil des Buchs, den ich »Oscar Wildes Gespenster« überschrieben habe, untersuche ich, wie im Verlauf des ausgedehnten Prozesses der Herausbildung eines literarischen und intellektuellen Diskurses, der dem Verbotenen Legitimität zu verschaffen sich bemühte, eine »Schwulensprache« erfunden wurde. Eine ganze Gruppe von Diskursen – angefangen beim »homosexuellen Code« in den um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Schriften der Oxforder Hellenisten über bestimmte Texte von Oscar Wilde bis hin zu Gides Corydon – versuchten, gleichgeschlechtliche Liebschaften öffentlich artikulierbar zu machen. Dieser Wille zu sprechen nahm immer die Form dessen an, was Foucault discours en retour nannte, »Gegendiskurs«: Er wurde stets in »strategischer« Reaktion auf Werte, Normen, Vorstellungen formuliert, die ihn natürlich von vornherein verurteilten, aber mehr noch von innen her formten. Die Repression der Homosexualität nährte historisch die Entschlossenheit, sie auszudrücken. Umgekehrt konnte sich dieser Ausdruck jedoch häufig den Denkweisen, die ihn beleidigten, nicht entziehen. Diese Überlagerung von Schwulensprache und homophobem Diskurs habe ich hier zu analysieren versucht (und wenn mein Buch sich hauptsächlich auf männliche »Homosexualität« bezieht, so selbstverständlich nicht, weil weibliche »Homosexualität« mich nicht interessierte – das Gegenteil ist der Fall –, sondern weil die Sozialisations- und Subjektivationsprozesse wie auch die kulturelle und subkulturelle Geschichte beider nicht genau analog verlaufen und die »Lesbenfrage« einen weiteren Band erforderte, der ebenso viele Forschungen benötigen würde wie der vorliegende).
Wenn in der Schwulenkultur noch immer und in vieler Hinsicht die Phantome Wilde und Gide herumspuken, wenn ihre Erfindungen durch zahllose Fäden mit einer mehr oder weniger unterirdischen Geschichte verbunden sind, wenn Schwule immer noch deren Biographien verfassen, wobei sie, wie Neil Bartlett überzeugend nachgewiesen hat,6 jeweils die Biographien ihrer Vorgänger neu lesen, dann ist dieses Erbe gewiss kritisch unter die Lupe zu nehmen. Erben heißt wählen, sagt Jacques Derrida.7 Es muss unterschieden werden zwischen dem, was bewahrt werden kann, und dem, was mit Sicherheit zu verwerfen ist. So wichtig die Gestalt Wildes ist: Nichts ist doch letztlich abstoßender als seine elitäre Haltung, sein aristokratischer Ästhetizismus. Aber wie sollte man an seinem Lobpreis des self-fashioning nicht festhalten: an dem Gedanken, sich selbst zu erschaffen und aus seinem Leben ein Kunstwerk zu machen?
Bei diesem Thema drängt sich der Name Foucault unmittelbar auf. Eine ganze Reihe seiner Texte enthält zahlreiche Bemerkungen zur Schwulenfrage. Die Idee einer Produktion seiner selbst zum Beispiel greift er nachdrücklich auf; für ihn setzte sie die Erfindung neuer Beziehungsformen zwischen den Individuen und die Entwicklung dessen voraus, was er culture gay nennt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass er die eben erwähnten Diskurse seiner Vorläufer, die unbedingt der Kritik zu unterziehen hat, wer sie sich aneignen will, oft nur in modernem Gewand reproduziert. Ich habe daher versucht, in die – nicht immer kohärente – Argumentation Foucaults einzudringen, ihre Versprechen und zugleich ihre Grenzen herauszuarbeiten.
Für den Bereich, der uns hier beschäftigt, wird der Name Foucaults inzwischen mit der radikalen Auflösung des Begriffs Homosexualität in Verbindung gebracht, die er in Der Wille zum Wissen unternahm, dem ersten Band seiner Geschichte der Sexualität.8 Er beschreibt hier die Erfindung der »homosexuellen Persönlichkeit« durch den psychiatrischen Diskurs gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zuvor gab es ihm zufolge nur verwerfliche »Handlungen«; nun wurden denjenigen, die sie begingen, eine »Psychologie« angehängt, Gefühle, eine Kindheit … Foucault wurde damit zu einem wirksamen Gegenspieler John Boswells und seiner »essentialistischen« Konzeption der Homosexuellengeschichte. Seine Untersuchungen wurden zur Bibel »konstruktivistischer« Historiker; fast alles, was heute in den Vereinigten Staaten und mehr oder weniger in der ganzen Welt geschrieben wird, ist von ihm inspiriert. Die Vorstellung, dass es eine invariante Realität der Homosexualität nicht gibt und die griechische Liebe nicht das Vorspiel zur zeitgenössischen Homosexualität ist, hat sich weitgehend durchgesetzt. Das steht nicht mehr zur Debatte. Aber offenkundig haben die Oxforder Hellenisten in der Mitte des 19. Jahrhunderts sich selbst als von anderen verschiedene »Personen« begriffen, und diesen Eindruck hatten sie seit ihrer Kindheit. Und sie beschrieben ihn, lange bevor der psychiatrische Diskurs sich der »sexuellen Inversion« bemächtigte und Handlungen zwischen Personen desselben Geschlechts in einen Krankheitskatalog von Perversionen und »Identitätsstörungen« einordnete.
Es gibt jedoch noch ein anderes Problem, das meines Wissens bisher niemand aufgeworfen hat: Fünfzehn Jahre vor Der Wille zum Wissen datierte Foucault in Histoire de la folie die Erfindung der »Figur« des »Homosexuellen« auf einen ganz anderen Zeitpunkt, nämlich auf das 17. Jahrhundert.9 In diesem Werk beschreibt er den Prozess der Erfindung der »Homosexualität« nahezu umgekehrt: Weil die Objekte, deren die Psychiatrie sich bemächtigt, der »Homosexuelle« ebenso wie der »Irre«, bereits konstituiert sind (namentlich aufgrund einer tiefen Transformation des »Empfindens«, deren sichtbarstes Symptom die Internierung von »Narren« und »Wüstlingen« darstellt), kann sie im 19. Jahrhundert in Erscheinung treten und sich fortentwickeln.
Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Schriften Foucaults und ihrer widersprüchlichen Thematiken geht es mir nicht nur um einen exakten und präzisen Kommentar seines Werks und seiner Entwicklung. Denn politisch und kulturell steht dabei eine Menge auf dem Spiel. In Wahnsinn und Gesellschaft bot Foucault uns eine Analyse, die sich um Verbot und Repression dreht: Er setzte sich also zum Ziel, die Stimme derjenigen vernehmbar zu machen, die zum Schweigen verurteilt waren. In Der Wille zum Wissen beschreibt er die »Wortmeldung« als konstitutives Element eines Dispositivs der Macht, das die Individuen zum Sprechen auffordert. Es ließe sich vorstellen, dass sich aus diesen beiden Analysetypen weitgehend divergierende politische Perspektiven ergeben. Ich habe jedoch den Eindruck, dass Foucault sich in seinen Interviews aus den achtziger Jahren bemüht hat, beide Problemstellungen zusammenzuführen und durch die Idee einer »Ästhetik der Existenz«, die neue Subjektivitäten hervorbrächte, über sie hinauszugelangen.
Zwischen Foucault und Wilde ist somit eine erstaunliche Verwandtschaft in Bezug auf die Art und Weise festzustellen, in der sie sich bemühen, Widerstandsgesten zu erfinden, Abstand zu den instituierten Normen herzustellen. Foucault schreibt sich ein in die Geschichte der homosexuellen Wortmeldungen und in die Reihe der Autoren, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts versucht haben, Räume, literarische wie theoretische Praktiken zum Leben zu erwecken, die dem Widerstand gegen die Unterwerfung und der Neuformulierung seiner selbst dienen.
Infolgedessen geht es in den drei Teilen dieses Buchs um ein und dieselbe Idee: Ich habe versucht, in der gelebten Erfahrung, in der Geschichte der Literatur und des Denkens, im Leben und Werk Foucaults die Bewegung zu rekonstruieren, die von der Unterwerfung zur Neuerfindung seiner selbst führt. Das heißt von der durch die Gesellschaftsordnung produzierten Subjektivität zur »gewählten« Subjektivität. Gewählt, das heißt unablässig geformt durch kollektive Mobilisierung und politisches Handeln. Geformt ebenfalls durch die notwendig kritische Reflexion, die es ermöglicht, innerhalb dieser Bewegungen die Frage nach Formen von Herrschaft und Herabsetzung aufzuwerfen, die unberücksichtigt geblieben sind, die »abwesenden« Stimmen, die nicht vernommen und nicht angehört wurden … Denn die Arbeit an der Emanzipation kann nur als eine Aufgabe begriffen werden, die stets von neuem zu beginnen ist: eine im Grunde unendliche Aufgabe.
Erster Teil
Eine Welt voller Beleidigungen
»Sein Abenteuer ist, benannt worden zu sein.«
Jean-Paul Sartre Saint Genet, Komödiant und Märtyrer
1
Der Schock der Beleidigung
Am Anfang war die Beleidigung. Die, die jeder Schwule irgendwann zu hören bekommt und die Signum seiner psychischen und sozialen Verletzlichkeit ist. »Schwuchtel«, »Dreckslesbe« – das sind nicht bloß Wörter, die im Vorübergehen fallen. Es sind verbale Aggressionen, die sich ins Bewusstsein eingraben. Traumatisierungen, die momentan mehr oder weniger heftig empfunden werden, sich aber dem Gedächtnis und dem Körper einschreiben (denn Schüchternheit, Befangenheit, Furcht, Unsicherheit, Scham usw. sind körperliche Reaktionsweisen, die von der Feindlichkeit der Außenwelt produziert werden). Und eine der Konsequenzen der Beleidigung besteht darin, die Beziehung zu anderen und zur Welt zu formen. Und folglich die Persönlichkeit, die Subjektivität, das eigentliche Sein eines Individuums.
Der Text, den Sara Miles für Bob Ostertags Komposition All the Rage schrieb, beschreibt sehr gut, was ein Schwuler empfinden kann, wenn er beleidigt wird:
Das erste Mal, als jemand queer sagte und ich begriff, daß ich gemeint war […], brach die Welt auseinander, das einfache Wort explodierte aus dem Satz, irgendwas hatte ich falsch gemacht, irgendwie war ich falsch, queer.1
Das Schimpfwort macht mir bewusst, dass ich nicht bin wie die anderen, nicht in der Norm. Jemand, der queer ist: merkwürdig, seltsam, krank … Unnormal.
Wie es in Jean Genets Gedicht heißt: »[…] ein schwindelerregendes Wort, dem Grund der Welt entstiegen, zerstört die schöne Ordnung.«2
Die Beleidigung ist ein Urteil. Sie ist ein nahezu definitiver Urteilsspruch, eine Verurteilung auf Lebenszeit, mit der man zu leben hat. Gebrandmarkt von der Beleidigung und ihren Auswirkungen, deren wichtigste sicherlich in der Bewusstwerdung jener grundsätzlichen Asymmetrie besteht, die dieser Sprechakt auslöst, erfährt ein Schwuler seine Differenz: Ich entdecke, dass ich jemand bin, zu dem man dies und jenes sagen kann, jemand, der Objekt von Blicken, Diskursen ist und der von diesen Blicken und diesen Diskursen stigmatisiert wird. Die »Benennung« produziert eine Bewusstwerdung seiner selbst als eines »Anderen«, den andere zum »Objekt« machen. Sartre bringt es in Bezug auf Genet, den der Blick des Anderen als »Dieb« ertappt und etikettiert, auf eine schöne Formel: »Alles geschieht so, als wenn plötzlich eine Buchseite bewußt würde und sich mit lauter Stimme gelesen fühlte, ohne sich lesen zu können.«3 Die Beleidigung ist daher Aneignung und Enteignung zugleich. Mein Bewusstsein wird von einem Anderen in Besitz genommen,4 ich bin machtlos gegenüber dieser Aggression. Sartre, abermals über Genet: »[E]in blendender Scheinwerfer durchbohrte ihn mit seinen Strahlen […].« Allein und machtlos, konnte er sich »in dieser Lichtsäule«, die der Blick des anderen und seine Macht zu benennen darstellt, nur winden.5
Die Beleidigung ist nicht nur eine deskriptive Bezeichnung. Sie begnügt sich nicht damit, mir zu verkünden, was ich bin. Wer mich als »dreckige Schwuchtel« (oder »dreckiger Neger« oder »dreckiger Jude«) traktiert, oder auch einfach nur als »Schwuchtel« (oder »Neger« oder »Jude«), versucht nicht, mir eine Information über mich mitzuteilen. Wer mir das Schimpfwort an den Kopf wirft, gibt mir zu verstehen, dass er mich in der Hand hat, dass ich in seiner Gewalt bin. Und diese Gewalt ist zunächst einmal die, zu verletzen. Mein ganzes Wesen durch diese Verwundung zu brandmarken, indem er meinem Geist und Körper tiefste Scham und Angst einschreibt.
Wer hätte treffender als Marcel Jouhandeau den Schock wiedergeben können, den die Beleidigung auslöst, das Drama, das sie darstellt und dem Beleidigten zufügt? Der Insult ist »unaufhörlich«, schreibt er 1939 in seiner außerordentlichen Abhandlung Von der Verworfenheit: Er ist »auf unserer Schulter zu lesen, mit glühendem Eisen neben unserem Namen uns eingebrannt«:
Dem geht ein Licht auf, der sich öffentlich beleidigt, verachtet sieht. Er macht mit gewissen Worten Bekanntschaft, die ihm bisher nur in Verbindung mit tragischen Gestalten geläufig waren und mit denen er sich nun plötzlich behängt, überhäuft sieht. Man ist vielleicht nicht mehr der, der man zu sein glaubte. Man ist nicht mehr der, den man kannte, sondern der, den die Anderen zu kennen, als den oder jenen anzuerkennen glauben. Wenn jemand dies von mir denken konnte, so muß etwas Wahres daran sein. Anfangs versuchst du, dich dessen zu erwehren: es sei nicht wahr, sei nur eine Maske, ein Theaterkostüm, das man dir zum Spott übergeworfen habe, und du willst sie herabreißen, aber nein: sie haften so zäh, daß sie schon dein Gesicht und dein Fleisch geworden sind, und du verletzt dich selbst, wenn du dich ihrer zu entledigen suchst.6
Die Beleidigung ließe sich daher als eine »performative Aussage« analysieren, wie J. L. Austin sie definiert hat. In einem berühmten Werk unterscheidet der englische Philosoph konstative und performative Äußerungen.7 Die ersteren beschreiben eine Situation und können wahr oder falsch sein. Die zweiten schaffen eine Handlung und sind daher weder wahr noch falsch. Ein Beispiel: »Ich erkläre die Sitzung als eröffnet.« Tatsächlich unterscheidet Austin zwei Typen »performativer« Äußerungen.8 Beim ersten Typus stellt der Satz selbst die Handlung dar, die er benennt. Zu sagen: »Ich taufe dieses Schiff auf den Namen Queen Elizabeth«, oder bei der Heiratszeremonie zu antworten: »Ja« (für: »Ja, ich will die Ehe mit dieser Frau eingehen« oder: »Ich will die Ehe mit diesem Mann eingehen«), sind Äußerungen dieser Art.9 Beim zweiten Typus produziert nicht die Aussage als solche die performative Handlung. Sie wird vielmehr von den direkten oder indirekten Folgen hervorgerufen, die die Tatsache, etwas zu sagen, nach sich zieht (Furcht, Gefühle, Gedanken, die ein Satz wie »ich warne dich« auslöst). Man könnte die Beschimpfung zunächst einmal dieser zweiten Rubrik zuordnen. Die Beschimpfung ist ein Sprechakt (oder eine Reihe von Sprechakten), durch den demjenigen, dem sie zugedacht ist, ein bestimmter Platz in der Welt zugewiesen wird. Diese Zuweisung determiniert eine Weltsicht, eine besondere Wahrnehmung. Die Beschimpfung brandmarkt das Bewusstsein eines Individuums tief und dauerhaft, weil sie ihm sagt: »Du wirst gleichgesetzt mit diesem«, »du wirst reduziert auf jenes«. Also werde ich mehr oder weniger »dieses« oder »jenes«. Und zwar umso mehr, als die Beleidigung überall in der Sprache zu Hause ist. Die Linguisten haben es uns gezeigt, indem sie den Begriff »performativ« erweiterten und Anspielungen, Unterstellungen, Ironie, Metaphern usw. mit einbezogen. Und da Austin selbst gegen Ende seines Buchs den Unterschied zwischen konstativen und performativen Aussagen nahezu aufhob, lässt sich die Möglichkeit, dass alltägliche Bemerkungen beleidigenden Sprechhandlungen gleichkommen, tendenziell gar nicht einschränken.
Jedenfalls wirkt die Beschimpfung als performative Aussage: Ihre Funktion besteht darin, den Einschnitt zwischen den »Normalen« und denen, die Goffman »Stigmatisierte« nennt,10 zu verewigen und diesen Einschnitt in den Köpfen der Individuen zu verankern. Die Beleidigung sagt mir, was ich bin, in dem Maße, wie sie mich zu dem macht, was ich bin.
2
Die Flucht in die Stadt
Alle unter Schwulen und Lesben angestellten Untersuchungen bestätigen, dass die Erfahrung, beleidigt worden zu sein (ganz abgesehen von physischer Aggression), eines der am weitesten verbreiteten gemeinsamen Merkmale ist. Gewiss gilt dies je nach Land in unterschiedlichem Maße und innerhalb des jeweiligen Landes in Abhängigkeit vom Aufenthaltsort oder sozialem Milieu. Aber erfahren haben es fast alle. Und das bedeutet, dass sogar diejenigen, die sich heute am freiesten fühlen, nämlich die Bewohnerinnen und Bewohner westlicher Großstädte, jederzeit ihrer Umgebung Rechnung tragen müssen, dass sie wissen müssen, wo man seinem Partner die Hand geben darf, wo man Zuneigung zum gleichgeschlechtlichen Partner andeuten darf und wo man es besser sein lässt. Dieses praktische Wissen ist derart verinnerlicht, dass es nur selten bis zum Bewusstsein vordringt; es braucht nicht expliziert zu werden, um ein angemessenes Verhalten auszulösen und zu steuern. Fehleinschätzungen können sehr schmerzhafte Folgen haben. Körperliche Angriffe oder das eindringliche Gefühl, dass sie drohen, sind im Leben Schwuler derart präsent, dass sie in fast allen autobiographischen Berichten und in zahlreichen Romanen mit schwulen Protagonisten anzutreffen sind.1 Manchmal ist keine bestimmte Gebärde dafür erforderlich: Das Verhalten ganz allgemein, der Gang oder die Kleidung genügen, Hass auszulösen. Für die selbstbewusstesten Schwulen wie auch für die, die es weniger oder gar nicht sind, für diejenigen, die in der Öffentlichkeit keinen Zweifel daran lassen, ebenso wie für die »diskreten« bleibt die Möglichkeit, einer verbalen oder physischen Aggression zum Opfer zu fallen, allgegenwärtig; jedenfalls hat sie oft entscheidenden Einfluss auf die Konstruktion der eigenen Identität, vor allem auf die Herausbildung der Fähigkeit, gefährliche Situationen zu erkennen oder seine Gebärden und Worte strikt zu kontrollieren.
Bei der Beschreibung dessen, was manchen Arbeitnehmern an ihrem Arbeitsplatz widerfährt, ist neuerdings häufig von »Mobbing« die Rede. Seine psychischen Folgen sind erheblich. Man kann sich fragen, ob Schwule nicht permanent einem »Mobbing« ausgesetzt sind, das, ob direkt oder indirekt, in allen Lebenslagen präsent ist: einem sozialen Mobbing; und folglich, ob die Persönlichkeit, die unter solchen Umständen entsteht, die Identität, die dabei geformt wird, nicht entscheidend von den psychologischen Folgen geprägt wird, denen solche Mobbingopfer aufgrund ihrer sozialen Position im alltäglichen Leben (durch Beschimpfung, Spott, Aggression, Feindseligkeit …) ausgesetzt sind. Es liegt auf der Hand, dass eines der strukturierenden Prinzipien schwuler und lesbischer Subjektivitäten in der Suche nach Möglichkeiten besteht, durch Selbstverleugnung oder Emigration an freundlichere Orte Beschimpfung und Gewalt aus dem Weg zu gehen.
Dies bewirkt, dass Schwule sich der Stadt und ihren sozialen Netzwerken zuwenden. Viele verlassen die Orte, an denen sie geboren wurden und ihre Kindheit verbrachten, und lassen sich an gastlicheren Stätten nieder. In ihrem Kommentar zu entsprechenden Studien schreibt Marie-Ange Schiltz, dass »bei einem Vergleich mit Untersuchungen unter der Gesamtbevölkerung deutlich wird, dass junge Homosexuelle ihre Herkunftsfamilie früher verlassen und früher zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit gelangen«.2 Diese Fluchtbewegung führt Schwule und Lesben ebenso wie andere Dissidenten der Sozialordnung in die Großstadt, die ihnen immer schon Zuflucht bot.
Am Ende der sechziger Jahre beschrieb ein Vorkämpfer der Schwulenbewegung San Francisco als ein »Flüchtlingslager«, in das von überall her Menschen strömten, die der feindseligen, ja hasserfüllten Atmosphäre in Kleinstädten entkommen wollten, wo sie daran gehindert wurden, ihr Leben zu leben.3 Tatsächlich geht aus den Schriften von Allen Bérubé oder John D. Emilio deutlich hervor, dass die Geschichte der Entstehung schwuler »Enklaven« in den Großstädten eng mit Diskriminierung und Homophobie verbunden ist. Allen Bérubé zeigt, dass Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs aufgrund ihrer sexuellen Orientierung aus der Armee entlassen wurden, oft an dem Ort ihrer Demobilisierung blieben (in San Francisco zum Beispiel die aus der Marine Entlassenen). Nach dem Ausschluss aus den Streitkräften war es kaum möglich, in die Kleinstadt zurückzukehren, aus der man stammte. Andere wiederum veranlasste die schlichte Tatsache, während der Zeit beim Militär Beziehungen zu anderen Schwulen geknüpft zu haben, zu dem Beschluss, nicht zum Herkunftsort zurückzukehren, wo sie zwangsläufig eine heterosexuelle Ehe erwartete.4 John D’Emilio seinerseits erinnert daran, dass der McCarthyismus zu Beginn der fünfziger Jahre nicht nur Kommunisten verfolgte, sondern auch Homosexuelle, und dass viele von diesen damals aus dem Öffentlichen Dienst entlassen wurden, ihren Beruf aufgeben mussten … Wer durch dieses »Schandmal« gebrandmarkt war, konnte nicht viel anderes tun als in einer Großstadt Zuflucht suchen, wo Schwule und Lesben gewisse Möglichkeiten hatten, sich vor einer feindlichen Umgebung zu schützen, obgleich es äußerst schwierig war, zu einer Zeit, da Gaststätten und andere Treffpunkte einer unermüdlichen und unerbittlichen Repression ausgesetzt waren, ein schwules oder lesbisches »Milieu« aufzubauen.5
Aber schon viel früher, seit Jahrhundertbeginn und schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts, zog der Ruf von Städten wie New York, Paris oder Berlin Wellen von »Flüchtlingen« aus dem ganzen Land und oft auch aus dem Ausland an und verstärkte damit, was die Wanderungsbewegung ausgelöst hatte: Die Existenz einer »Schwulenwelt«, in die sie sich eingliederten und in die sie den Enthusiasmus von Neulingen einbrachten.6
Dies erklärt, warum sich in der Schwulenkultur, in der kollektiven Imagination der Homosexualität seit dem Ende des 19. Jahrhunderts (und gewiss schon viel früher) eine wahre Mythologie der Stadt und der Metropole entfalten konnte: Paris, London, Berlin, Amsterdam, New York, San Francisco wurden zu wundervollen Symbolen einer gewissen Freiheit; sie brachten alle zum Träumen, die Bücher und Zeitschriften lasen (selbst wenn das Bild, das diese vermittelten, pejorativ, ja beleidigend war) oder Berichte von Glücklicheren hörten, die jene Städte oder Metropolen hatten bereisen können (George Chauncey zitiert Zeugnisse Schwuler, die beschlossen, ihre Kleinstadt zu verlassen, nachdem ein Freund von seinem Aufenthalt in New York berichtet hatte).7
Diese Mythologie der Stadt – und mit ihr der Migration in die Stadt – hat lange neben einer allgemeineren bestanden: einer Mythologie der Reise und des Exils, in der nicht die Metropole, sondern andere Länder, andere Kontinente lockten. Es gab und gibt wohl immer noch bei Homosexuellen und anderen »Abweichlern« die Phantasmagorie eines »Anderswo«, in dem Wünsche und Bestrebungen in die Wirklichkeit umgesetzt werden können, die im eigenen Land aus tausend Gründen undurchführbar, unausdenkbar sind.8 Unter anderem wäre dabei an die Anziehungskraft zu denken, die im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Italien ausging (Platen) oder von Deutschland in den zwanziger Jahren (Isherwood, Auden, Spender …), dem Aufenthalt in den Kolonien oder fernen Ländern (Gide im Maghreb, Forster in Ägypten und Indien) oder auch der Verlagerung der Berufstätigkeit ins Ausland (Dumézil in der Türkei, Foucault in Schweden).9
Aber die – reale oder imaginäre – Attraktivität der Stadt bleibt das Phänomen, das die meisten betrifft. Noch heute ist die Migration von Schwulen und Lesben in die Metropolen und Großstädte ungebrochen. Die Homosexualität ist an die Stadt gebunden. Der dänische Soziologe Henning Bech schreibt: »Die Stadt ist die eigentliche soziale Welt des Homosexuellen, sein Lebensraum. Der Einwand, viele Homosexuelle lebten auf dem Lande, verschlägt nicht. In dem Maße, in dem sie als Homosexuelle leben wollen, müssen die meisten von ihnen auf die eine oder andere Weise in die Stadt ziehen …«10 Was natürlich nicht heißt, dass Schwule in Kleinstädten und selbst auf dem Land nicht leben könnten. Im Gegenteil: Hier wie andernorts gibt es (und zwar schon sehr lange) Orte, an denen man sich trifft, Freundeskreise, die sich regelmäßig versammeln, Soireen organisieren. Diese urbanen und halbländlichen Formen von geselligem Umgang und »Subkulturen« sind wenig bekannt und wurden von den Historikern und Soziologen kaum untersucht, und zwar nicht nur, weil Dokumente darüber ziemlich rar und schwer zugänglich sind (es handelt sich dabei oft um Tagebücher und persönliche Korrespondenz), sondern auch, weil die »Unsichtbarkeit« dieser klandestinen Lebensweisen aus naheliegenden Gründen viel besser gewahrt wurde als in den Großstädten: Es ist nicht leicht herauszubekommen, in welcher Gaststätte, in welchem Restaurant Schwule sich gewöhnlich trafen, und noch viel schwerer, in welchen den Blicken entzogenen Privatwohnungen oder Häusern. Eine systematische Durchforschung von Polizeiberichten und Justizarchiven (die nicht immer leicht zu konsultieren sind) würde es gewiss ermöglichen, Lebensformen von Schwulen zu entdecken, die weniger bekannt sind als diejenigen, die in jüngster Zeit von Historikern der Stadtkultur durchgeforstet worden sind.
Nichtsdestoweniger ist es die Großstadt, die schwulen Lebensformen die Möglichkeit bot, sich voll zu entwickeln. Die Stadt ist eine Welt voller Fremder. Und das ermöglicht – anders als in Kleinstädten oder Dörfern, wo jeder jeden kennt und in dem Maße, in dem er sich von der Norm entfernt, verstecken muss, was er ist – Anonymität und damit Freiheit. Wie schon Magnus Hirschfeld in seinem 1904 veröffentlichten und 1908 bereits ins Französische übersetzten Buch Berlins Drittes Geschlecht schrieb, ist die »Millionenstadt« ein Ort, wo »das Individuum nicht der Kontrolle der Nachbarschaft unterliegt, wie in den kleineren Orten, in denen sich im engen Kreise die Sinne und der Sinn verengern. Während dort leicht verfolgt werden kann und eifrig verfolgt wird, wann, wo und mit wem der Nächste gegessen und getrunken hat, spazieren und zu Bett gegangen ist, wissen in Berlin die Leute oft im Vorderhause nicht, wer im Hinterhause wohnt, geschweige denn, was die Insassen treiben.«11
Aber die Stadt ist auch eine soziale Welt, eine Welt möglicher Sozialisation, und sie ermöglicht, die Einsamkeit zu überwinden ebenso wie die Anonymität zu wahren. Ein Schwuler, der beschließt, in einer Großstadt zu leben, kommt dorthin, um sich denen zu gesellen, die sich vor ihm auf diesen Weg gemacht haben und eine Welt aufrechterhalten, die ihn anzieht und von der er oft schon lange geträumt hat. Daraus resultiert bei der Entdeckung all der Möglichkeiten, die die Stadt bietet, anfangs eine Art Überschwang, in den sich natürlich Befürchtungen mischen.12 Magnus Hirschfeld liefert in dem zitierten Werk eine wundervolle Beschreibung des Lebens, das Schwule und Lesben im Berlin des beginnenden 20. Jahrhunderts führten, der Kabaretts, der Bälle, des Nachtlebens – all dessen, was man heute »homosexuelle Subkultur« nennen könnte. Eine Kultur, deren Reichtum, Entwicklung, aber auch Risiken Chauncey in seinem Buch über New York meisterhaft rekonstruiert hat, indem er die Ausdehnung und Dynamik darstellt, die sie trotz aller Überwachung, Kontrolle und Repression seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entfaltete.13 Das ist die Stadt, wie sie Millionen Homosexueller beider Geschlechter im Lauf der Jahrzehnte erlebt, geliebt, erträumt, ersehnt haben, eine Stadt, deren »homosexuelle[r] Einschlag« Hirschfeld zufolge »die Färbung des Bildes im einzelnen und den Charakter des Ganzen wesentlich beeinflußt«.14
Möglicherweise war die Interaktion zwischen den homosexuellen Kulturen und der Stadt in ihrer Gesamtheit im frühen 20. Jahrhundert sowie in den zwanziger und dreißiger Jahren sehr viel intensiver als in den vierziger und fünfziger Jahren. Chauncey zeigt es am Beispiel New Yorks: Große Transvestitenbälle lockten heterosexuelle Schaulustige in Scharen an und die Zeitschriften, namentlich die Massenpresse, widmete ihnen Artikel und Fotos. Im Übrigen waren die Treffpunkte von Homosexuellen (Bars, Saloons, Restaurants) nur selten ihnen vorbehalten. Die Grenze zwischen ihrer Welt und der heterosexuellen Stadt war weniger deutlich gezogen als nach dem Zweiten Weltkrieg, mochten auch Razzien der Polizei, Verhaftungen, Schikanen aller Art Druck auf diese Subkultur ausüben, die sowohl halb geheim war wie auch halb offen gegenüber der Außenwelt. Die Schwankungen in der »Offenheit« gegenüber der Außenwelt können als einer der frappierendsten Aspekte des Bewusstseins – und Selbstbewusstseins – derer gelten, die an dieser Schwulenwelt partizipierten, und als beredtes Zeugnis ihrer Fähigkeit, ihre Identitäten und Lebensweisen zu behaupten, aber auch feindlichen Kräften Widerstand zu leisten, wenn es darum ging, sie zu verteidigen – von den überraschendsten Kühnheiten ging man zum beinahe totalen Rückzug auf sich selbst über und zum fast völligen Verriegeln der Tore dieser Stadt in der Stadt, einem Verriegeln von innen. Es herrschte also ein ständiger Wechsel zwischen Furcht und Wagemut, Verborgenheit und Sichtbarkeit, Schweigen und Öffentlichkeit.15
Offenkundig kam eine »Schwulenwelt« nicht erst 1969 mit den Unruhen von Stonewall zum Vorschein, die eine Polizeirazzia in einer New Yorker Bar ausgelöst hatte und die vom Folgejahr an die Gay-Pride-Bewegung in Gang setzte. Im Gegenteil: Dass diese Subkultur samt allen ihren Diskursen, Organisationen, mehr oder weniger langlebigen Publikationsmedien schon längst bestand, machte derartige Unruhen und das, was aus ihnen folgte, überhaupt erst möglich. Zwar hatten die fünfziger und sechziger Jahre (und vorher schon die vierziger und der Krieg) die homosexuelle Subkultur zu strikterer Klandestinität verurteilt als die zwanziger und dreißiger Jahre. Die Repression war stärker geworden als in der Vorkriegszeit (in Frankreich beschloss das Parlament 1960 eine Gesetzesnovellierung, die Homosexualität neben Alkoholismus und Prostitution als »soziale Geißel« verurteilte). Indessen sollte der Gegensatz nicht allzu krass gesehen werden: Letzten Endes – und das wird George Chauncey im zweiten Band seines Gay New York, das sich mit den Jahren 1940-1975 beschäftigt, gewiss zeigen – ist die Vorstellung von einer unsichtbaren gay culture, ihrem Verschwinden von der Bühne während dieser Periode insofern zu relativieren, als sie in der Presse, im Film, in der Literatur usw. zahlreiche Spuren ihrer Existenz und öffentlichen Präsenz hinterlassen hat.
Was zu Beginn der siebziger Jahre aufgetaucht ist und sich in den achtziger und neunziger Jahren ausgebreitet hat, ist folglich im Rahmen einer umfassenderen Geschichte der urbanen Kultur und als Erbe von Lebensweisen zu verstehen, die schon zu Zeiten der Belle Époque und der années folles den Ruf bestimmter Städte ausmachte (eine Evokation der Treffpunkte, Cafés und Nachtbars im Paris der fünfziger und sechziger Jahre findet sich beispielsweise in dem Roman Giovannis Zimmer von James Baldwin). Heute sticht hervor, dass diese Welt sich immer stärker und markanter nach außen öffnet, sei es auch nur dank ihrer ausgesprochenen Sichtbarkeit: Dass es Schwulencafés und -bars, dass es Schwulenviertel gibt, weiß heute jedermann. Infolgedessen steht diese Subkultur nicht nur in ständigem Kontakt mit der Stadt insgesamt, die Stadt selbst definiert sich auch dadurch, dass diese Schwulenkultur eins ihrer wesentlichen Kennzeichen ausmacht. Denn wenn manche Bars Schwulen vorbehalten sind – allerdings nicht immer –, stehen Cafés und Restaurants jedermann offen, und die entsprechenden Viertel bilden selbstverständlich keine geschlossenen Territorien, sondern Stätten, an denen sich die Sichtbarkeit Schwuler in der Beziehung zu und Interaktion mit anderen Populationen behauptet, mögen diese nun eine geschlossene Gemeinschaft bilden oder nicht (in Paris hat das Schwulenviertel das historische jüdische Viertel zum Nachbarn),16 und darüber hinaus mit der ganzen Stadt, ihren Bewohnern, Besuchern, Touristen … Übrigens sind die Konturen dieser schwulen »Enklaven« in den Großstädten recht verschwommen, sie fluktuieren mit der Öffnung oder Schließung von Bars, Cafés oder Restaurants; im Geschäftsleben bleiben Schwule in der Minderheit, und die Straße steht ohnehin allen offen. Durchmischung herrscht also vor.
Weit davon entfernt, sich von feindseligen Bezeichnungen wie »Kommunitarismus« oder »Separatismus« erfassen zu lassen (wie viele Sottisen, ja Absurditäten wurden in den neunziger Jahren nicht in französischen Büchern und Artikeln vorgebracht, um alte Schlagwörter wie die vom »inneren Feind« und der »Gefahr im Verzuge« aufzuwärmen und die homosexuelle Gefahr für die »innere Einheit« und den Zusammenhalt unserer »desorientierten Gesellschaft« mit den Umtrieben des radikalen Islamismus auf eine Stufe zu stellen!) – weit von alldem entfernt machen Phänomene wie die Gay-Pride-Paraden oder die Entwicklung homosexueller Viertel in den europäischen Großstädten deutlich, dass die »Schwulenwelt« die Tore öffnet, hinter denen sie sich lange Zeit mehr oder weniger verschanzen musste. Was empörte Beobachter beim Anblick eines Schwulenviertels (die sie in ihren zahlreichen Artikeln als »Rückzug auf sich selbst«, »sektiererische Ghettoisierung«, »Ablehnung der gemeinsamen Welt«, »Zurückweisung Anderer« usw. bis zum Überdruss geißeln) so entrüstet, ist die schlichte Tatsache, dass diese breite Sichtbarkeit der Homosexuellen ihre ganze Kultur in unmittelbare und ständige Interaktion mit der Stadt bringt, wie es in verflossenen Zeiten oft – und in gewisser Weise immer – der Fall war, wenn auch in geringerem Maße: nämlich immer dann, wenn beispielsweise die Teilnehmer an einem Kostümball sich in extravaganten Roben oder Aufmachungen unter dem Beifall von Bewunderern und empörten Buhrufen herbeigeströmter Gaffer ihren Weg zum Saaleingang bahnten …
3
Freundschaft als Lebensform
Die Stadt bietet vor allem die Möglichkeit, sich der Beleidigung weitestmöglich zu entziehen, in deren Reichweite es unmöglich ist, als Homosexueller zu leben, ohne sich ständig verstecken zu müssen. In seiner Untersuchung der »Strategien« derer, die er die »Stigmatisierten« nennt, spricht Goffman von der Stadt als Ausweg der Homosexuellen und hebt hervor, dass es für sie nicht nur darum gehe, »anderswo« zu leben, in einer gewissen Anonymität unterzutauchen, sondern um einen echten biographischen Einschnitt;1 nicht bloß um geografische Distanz oder Wege, potentielle Partner zu gewinnen, sondern um die Möglichkeit, seine Subjektivität neu zu definieren, seine persönliche Identität neu zu erfinden. In suggestiven Worten erklärt Eve Kosofsky Sedgwick die Entwicklungslinie von einer isolierten Kindheit und Jugend in der Provinz oder in feindseliger Umgebung hin zur Befreiung durch das Großstadtleben als »Grundnarrativ der modernen Identität zahlreicher amerikanischer und europäischer Schwuler«, das dem Balzac’schen Modell zutiefst verpflichtet sei.2 Die Kleinstadt ist der Ort, wo man sich kaum dem von der Familie – aber auch von der Schule – vorgehaltenen Spiegel entziehen kann, wo man nur schwer den vielfachen Vorhaltungen entgeht, die – stillschweigend oder lautstark – die Individuen auffordern, sich den affektiven, kulturellen, sozialen Modellen der Heterosexualität anzupassen, kurz dem, was Adrienne Rich »Zwangsheterosexualität« genannt hat.3 In der Tat konstituiert die persönliche Identität sich mit dem Grad der Akzeptierung oder Ablehnung dieser »Vorhaltungen« und in der (oft schwierigen, schmerzhaften) Entwicklung, die das Verhältnis von Unterordnung und Auflehnung – oder beider zugleich – im Lauf der Jahre einschlägt. Wie auch immer die Option lautet, zu der man sich entschließt oder der man sich unterwirft: Die Identität muss schrittweise konstruiert werden und bleibt zwangsläufig konfliktbeladen. In dem einen Fall gerät die Unterordnung unter die heterosexuelle Ordnung in Konflikt mit den Regungen, die zu Beziehungen mit Gleichgeschlechtlichen lenken, im anderen die Weigerung sich zu unterwerfen in Konflikt mit den heteronormativen Ordnungsrufen, die permanent von allen gesellschaftlichen Instanzen ausgehen, und mit der gewöhnlichen Gewalt, wie sie in den banalsten Situationen in Familie, Schule, Beruf ausgeübt wird und bis zur traumatisierenden Brutalität von Beleidigungen und Aggressionen reichen kann.4
Darum gründet sich die schwule – oder lesbische – Geselligkeit zunächst und vor allem auf eine Praxis und »Politik« der Freundschaft: Man muss versuchen, Kontakte zu knüpfen, Leuten zu begegnen, aus denen Freunde werden, und allmählich einen Kreis ausgewählter Beziehungen aufbauen. Henning Bech schreibt treffend: »Mit anderen Homosexuellen zusammen sein ermöglicht, sich in ihnen seiner selbst gewahr zu werden. Es erlaubt, seine eigne Existenz mitzuteilen und zu deuten […]. Freundschaftsnetze sind mit Vereinigungen und Bars eine der wichtigsten Institutionen im Leben von Homosexuellen. Nur in diesem Rahmen ist es möglich, als Homosexueller eine konkretere und positivere Identität zu entwickeln.«5 Die entscheidende Bedeutung jener Orte, von denen bekannt ist, dass ihre Hauptfunktion darin besteht, Begegnungen zu ermöglichen, leuchtet damit ein (und folglich auch die Notwendigkeit spezieller Reiseführer oder anderer Informationsquellen, die den »Neulingen« Existenz und Standort signalisieren).
Zu Beginn seines Werks Sodom und Gomorrha stellt Marcel Proust, der große Soziologe und Theoretiker der Sexualität, die homosexuellen »Einzelgänger«, die »ihr Laster für etwas Exzeptionelleres halten, als es eigentlich ist«, und angefangen haben, »ganz für sich allein zu leben von dem Tag an, da sie es entdeckten, nachdem sie es schon lange in sich getragen hatten, ohne es zu kennen«, denen gegenüber, die Freundeskreise ins Leben gerufen haben, deren Zusammenkünfte im Café stark denen von »Berufsverbänden« oder politischen Zönakeln ähneln. Aber er fügt sogleich hinzu: »Und selten genug kommt es tatsächlich vor, daß diese Einzelgänger eines Tages schließlich doch in derartigen Organisationen aufgehen, zuweilen aus bloßer Müdigkeit oder Bequemlichkeit (so wie auch die, die am meisten dagegen waren, schließlich doch Telephon bei sich legen lassen […]).«6 Diese literarische Photographie mag etwas vergilbt wirken und von einer fernen Epoche zeugen. Sieht man jedoch von der Diskretion einmal ab, die solche »Organisationen« sich (mehr oder weniger unbeschränkt) auferlegen mussten, lässt man Prousts Vokabular und seinen entomologischen (bisweilen fast schon teratologischen) Blickpunkt beiseite, dann bleibt immer noch die Frage, ob die Struktur individueller Lebenswege und kollektiver Lebensweisen, wie er sie beschreibt, im Grunde so verschieden ist von dem, was wir in unserer eigenen Welt wahrnehmen, mögen die Situationen und Verhaltensweisen von heute und die von damals sich auch noch so unterschiedlich ausnehmen.7
Denn heute wie damals stellt der Freundeskreis einen der zentralen Brennpunkte dar, um die herum sich das Leben der Schwulen organisiert, und die Grundlage eines psychologischen (und oft geografischen) Parcours, der von einer mehr oder weniger ausgeprägten Vereinzelung zu einer mehr oder weniger intensiven Sozialisierung führt, die an den Orten der Begegnung (ob in Bars oder Parks, oder heute im Internet mit seinen spezialisierten Seiten und sozialen Netzwerken …) und durch deren Vermittlung zustande kommt. Die Lebensweisen der Schwulen beruhen weitgehend auf konzentrischen Freundeskreisen oder dem immer wieder neu begonnenen Versuch, solche Kreise zu schaffen und derartige Freundschaften zu knüpfen. Das Buch von George Chauncey zeigt dies wundervoll auf: Während die politischen Instanzen und die Hüter der sozialen und moralischen Ordnung die Entwicklung der Städte als einen Faktor der »Desorganisation« der herkömmlichen sozialen Bande und also des psychologischen »Strukturverlusts« der Individuen beschrieben haben, stellte sie für die Schwulen zunehmend den Ort einer sozialen Reorganisierung, eine Schaffung neuer sozialer Bande und neuer Formen von Geselligkeit dar, also einer psychologischen Restrukturierung.8 An ein und derselben stigmatisierten Sexualität und der entsprechenden Marginalisierung und Exklusion teilzuhaben bildet die Grundlage der Konstituierung einer spezifischen Welt, die sie in die Topographie der Städte ebenso einschreibt wie in die Persönlichkeit der Individuen, die kommen, um sich ihr einzugliedern, und ihr über Generationen hinweg zu Existenz und Dauer verhelfen. Es wäre daher zutreffender, die Schwulenwelt nicht, wie es noch Michael Pollack tat, als Zwangsgemeinschaft einer »Schicksalsgruppe« zu bezeichnen (er bezeichnete sie so »in Ermangelung eines Besseren« – seltsamerweise ohne sich zu fragen, wie eine adäquatere Definition lauten würde), sondern eher als Prozess einer individuellen und kollektiven Erfindung seiner selbst.
Über die »Kultur« oder die »Gemeinschaft« oder das »Ghetto« von Schwulen (Begriffe, die für andere – ethnische, religiöse – Kategorien definiert und meist unbedacht und unmethodisch auf Schwule und Lesben übertragen wurden) lässt sich nicht sprechen, ohne diese Wörter mit Migrationsprozessen und Befreiungseffekten in Verbindung zu bringen, also mit der ganzen Geschichte des Aufbruchs in die Stadt und der Gründung einer »Schwulenwelt«, die von dieser Geschichte ausgelöst wurden.9 Die Stadt bewirkt, wie der Soziologe Robert Park 1916 schrieb, »ein Mosaik kleiner sozialer Welten«, die nebeneinander existieren.10 Die so entstehende Verschachtelung sozialer Welten bietet den Individuen die Möglichkeit, mehreren von ihnen gleichermaßen anzugehören und infolgedessen über mehrere soziale Identitäten gleichzeitig zu verfügen: Familie, Beruf, Ethnie oder Religion, Sexualität … Folglich kann ein Schwuler an der »Schwulenwelt« teilhaben, ohne deswegen seinen Platz in der heterosexuellen Welt einzubüßen: Er hat dann eben zwei (oder mehrere) Identitäten – und zwei (oder mehrere) »Kulturen« –, von denen die eine mit seiner sozialen oder beruflichen Zugehörigkeit (oder auch seiner ethnischen Herkunft) verbunden sein mag, eine andere mit seiner Freizeitgestaltung, eine mit dem, was er tagsüber macht, eine andere mit dem, was ihn nachts oder an den Wochenenden umtreibt (was oft die von den Schwierigkeiten eines »Doppellebens« ausgehenden Spannungen hervorruft, vielen Homosexuellen aber auch ermöglicht hat, der Unterdrückung und Marginalisierung Widerstand zu leisten).11
Die öffentliche Wahrnehmbarkeit der Schwulen heute bedeutet also nicht, dass eine bestimmte Anzahl von Personen im Lauf der letzten Jahre beschlossen hätte, sich durch ihre Sexualität zu definieren, sondern dass eine immer größere Zahl Schwuler aufgehört hat, die »nächtliche« Seite ihres Lebens zu verschleiern. Nicht weil die Schwulen plötzlich beschlossen hätten, ihre bisher homogenen und bruchlosen sozialen und psychischen Identitäten aufzugeben und einzig ihrer sexuellen Identität zu leben, sondern weil eine große Zahl von ihnen aufhörte, ihre sexuelle Identität zu kaschieren, die sie ebenso definiert wie ihre berufliche oder ethnische oder religiöse, trat diese »Schwulenwelt« offen an den Tag, an der sie (mehr oder weniger) heimlich oder (mehr oder weniger) sichtbar ohnehin Anteil hatte. Einladende Straßencafés mit überfüllten Terrassen und der Regenbogenfahne im Schaufenster traten an die Stelle der in kleinen Gassen versteckten Bars, deren schwere Türen mit einem Guckloch versehen waren, das vor unerwünschten Angreifern oder Eindringlingen schützen sollte. Wer heute untersuchen will, worin die »Gemeinschaft« der Schwulen besteht (ein auffallend unpassender Begriff, außer wenn er zur Mobilisierung oder als Anhaltspunkt für die Sozialisierung dient), muss daher die gesamte Geschichte der von den Schwulen im Verlauf von anderthalb Jahrhunderten aufgebauten Geselligkeit und »Eigenwelt« in Betracht ziehen. Denn diese Soziabilität, deren Mängel anzuprangern heute gewiss erforderlich, aber auch allzu einfach ist – soweit es sie gibt, haben wir es mit Auswirkungen von Uniformierung oder unleugbarer Kommerzialisierung zu tun –, verfügte zunächst einmal über einen emanzipatorischen Wert, den sie für junge Schwule und Lesben bis heute in höchstem Maße bewahrt: ihnen den Prozess der Selbstfindung zu erleichtern; allen anderen bietet sie die Nutzung von Räumen, die jedenfalls nicht durch grundsätzliche und allgegenwärtige Feindseligkeit gekennzeichnet sind.12
Der von der öffentlichen Wahrnehmbarkeit der Homosexuellen ausgehende Befreiungseffekt erstreckt sich vermutlich auch auf diejenigen, die nicht an dieser »Subkultur« partizipieren, sei es, weil sie es nicht können (sie leben nicht in einer Großstadt), sei es, weil sie es nicht wollen (sie ziehen es vor, vom schwulen »Milieu« Abstand zu halten). Fest steht: Das Leben der Schwulen und Lesben insgesamt hat sich aufgrund der öffentlichen Wahrnehmbarkeit einer gewissen Anzahl von ihnen im Lauf der letzten vierzig Jahre insgesamt weiterentwickelt; je nach Nähe zu oder Entfernung von den Stätten subkulturellen Lebens bleibt dieser Befund allerdings zu differenzieren.13 Denn wichtig ist nicht so sehr, ob man sich homosexuell nennt und es zeigt, sondern dass die Homosexualität benennbar und vorzeigbar ist (auch andernorts und von anderen). Ein Schwuler – oder ein Schwulenpaar – braucht nicht zum »Schwulenmilieu« zu gehören, um in den Genuss der durch die Wahrnehmbarkeit und Selbstbehauptung der Homosexuellen erzielten Errungenschaften zu kommen: Für eine ständig wachsende Anzahl von ihnen ist es möglich, unbeschwerter zu leben, nicht mehr völlig zu kaschieren, was sie sind, und ihr Leben nach Maßgabe der grundlegenden rechtlichen Veränderungen einrichten zu können, die in langen Auseinandersetzungen errungen wurden …
Wenn zutrifft, was Foucault in seinem ganzen Werk (jedenfalls in seinem Frühwerk) vertritt: dass eine Gesellschaft oder Epoche sich durch das definiert, was in ihr aussprechbar und sichtbar und also auch denkbar ist, dann darf man behaupten, dass die öffentliche Wahrnehmbarkeit der Schwulen und Lesben die Gesellschaft insgesamt umgestaltet hat, da sie das, was in ihr gesagt, gezeigt und also auch gedacht werden kann, tiefgreifend veränderte. Die homosexuelle Mobilisierung, die Publizität und Intensität, die das »subkulturelle« Leben gewann (nebst all den daraus folgenden und davon ausgehenden Konsequenzen), haben die sexuelle und also soziale, aber auch die »epistemologische« Ordnung der Dinge in unserer heutigen Welt aufs Tiefste in Frage gestellt.
4
Sexualität und Berufe
Biographien Schwuler setzen oft mit zeitlicher Verzögerung ein: nämlich dann, wenn ein Individuum mit seinem Schweigen, seinem schamvollen Versteckspiel bricht oder sich zumindest Räume schafft, in denen es ihm möglich ist zu sein, was es sein möchte, und wo es sich selbst neu erfindet. Wenn es wählt statt hinzunehmen, sich zum Beispiel eine neue Familie aufbaut (aus Freunden, Liebhabern, ehemaligen, zu Freunden gewordenen Liebhabern und Freunden seiner ehemaligen Liebhaber) und auf diese Weise seine Identität rekonstruiert, nachdem es aus dem geschlossenen, erstickenden Raum seiner Herkunftsfamilie und ihrer stillschweigenden oder ausdrücklichen Aufforderungen zu heterosexuellem Verhalten ausgebrochen ist. Es versteht sich, dass eine solche Flucht nicht zwangsläufig einen brutalen Bruch mit seiner Familie voraussetzt, sondern eher die Notwendigkeit, sich von ihr fernzuhalten und auf Abstand zu bleiben. Bevor es so weit ist, ist das Leben Schwuler lediglich ein geborgtes, imaginiertes; es findet in der Vorstellung statt, zwischen Hoffen und Bangen.
Aus der Empfindung all der Verletzungen, die sich im Verlauf dessen ereignen, was Eve Kosofsky Sedgwick prachtvoll als »babylonisches Exil ›abnormaler‹ Kindheiten« geschildert hat,1 beziehen die Schwulen die Energien, mit der sie ihre Persönlichkeit aufbauen oder neu schaffen – dieselben Energien, mit denen schwule »Kultur« oder »Gemeinschaft« aufgebaut oder neu geschaffen werden. Diese schöpferische Energie wurde in erster Linie in der Flucht geschaffen und durch sie. Die Erinnerung, aber auch die Fortdauer, die Beharrlichkeit der in der Kindheit, der Jugend erfahrenen Gefühle strukturieren die persönliche Identität zahlreicher junger Schwuler grundlegend; ihnen entspringen die Fähigkeit und der Wille, sich selbst zu verwandeln, und die Energie, es zu schaffen. Zu Recht betont Eve Kosofsky Sedgwick die »fast unerschöpfliche Quelle transformatorischer Energie« jenes Gefühls der Schmach, das so viele Jungen und Mädchen befällt, wenn ihnen bewusst wird, dass ihr Wünschen und Begehren nicht in den Rahmen des als Normalität Definierten und Bezeichneten passt.2 Viele Autoren haben dies thematisiert; in Jean Genets Werk (vor allem in Wunder der Rose, Notre-Dame-des-Fleurs) ist dieses Thema von wesentlicher Bedeutung, in Jouhandeaus Von der Verworfenheit zentral.3
Wie könnte man denen die Intensität dieser Schmach spürbar machen, die sie nie erfahren haben? Und die Energie, die den Willen erzeugt, dies alles hinter sich zu lassen? Noch zahlreiche andere Emotionen und Verhaltensweisen ließen sich anführen, die von der sexuellen oder affektiven »Dissonanz« innerhalb der Familie produziert werden und als »Energiequelle« bei der Neukonzeption seiner selbst später eine beträchtliche Rolle spielen. Zum Beispiel das diffuse Gefühl, »anders« zu sein oder abseits zu stehen, der Anschluss eher an literarische oder künstlerische Vorbilder – die einzigen verfügbaren Auswege – als an vorgegebene Modelle von Familienleben oder sozialen Mustern. Das schwule Kind – es ist unvermeidbar, hier von »schwuler Kindheit« zu sprechen – oder der schwule Heranwachsende hat sich zunächst einmal abgekapselt; im Zentrum seines Seelenlebens und seiner Beziehung zu anderen steht sein Geheimnis, sein Schweigen. Diesem Innenleben verdankt er seine Fähigkeit zur Verwandlung. Vielleicht erklärt dies die so eigentümliche und so oft beschriebene Beziehung jugendlicher Schwuler – und sozialer Parias im Allgemeinen – zur Welt der Bücher und zur Kultur. In einer ersten Skizze zu Sodom und Gomorrha erhebt Proust den Jungen, »über den sich seine Brüder und Freunde lustig machten«, zu einer paradigmatischen Figur: »Er ging stundenlang allein am Strand spazieren, setzte sich auf die Felsen und blickte mit melancholischen, bereits geängstigten und inständigen Augen auf das blaue Meer, sich fragend, ob er nicht in dieser Landschaft aus Meer und azurnem Himmel, dem gleichen, der schon an den Tagen von Marathon und Salamis leuchtete, Antinous ihm auf einer raschen Barke entgegenschweben und ihn mit sich entführen würde, jener Antinous, von dem er den ganzen Tag träumte und nachts am Fenster der kleinen Villa, wo der späte Passant ihn erblickte, wie er im Mondschein in die Nacht hinausschaute und sich rasch zurückzog, sobald man ihn bemerkt hatte. Zu rein noch, um zu glauben, daß es ein Verlangen, das dem seinen gliche, anderswo als in den Büchern geben könne […].«4
Aber um welche Bücher mochte es sich da handeln? Und wie kommt man ihnen auf die Spur? Durch welchen Zufall? Oder von welcher Notwendigkeit getrieben? Oder wie kommt man mit den Büchern aus, die zu Gebote stehen? Proust beschreibt einen Mechanismus, der nicht nur eine besondere Beziehung jugendlicher Schwuler zu ihrer Lektüre inauguriert, sondern sie auch dazu führt, sich mit weiblichen Personen zu identifizieren, denn das war für sie – behauptet er – das einzige Mittel, mit einem Mann gemeinsam zu empfinden: »Und durch eine unbewußte Transponierung beziehen sie alles, was in der Literatur, in der Kunst, im Leben seit so vielen Jahrhunderten den Begriff Liebe wie einen Strom verbreitert hat, auf ihr fremdartiges Begehren; so natürlich ist ihre Liebe, daß sie schließlich vergessen, dass der Gegenstand es nicht ist. Und ohne daran zu denken, daß allein ein Zwitterwesen wie sie ihre Leidenschaft teilen könnte, erwarten sie mit der Gläubigkeit einer Heldin von Walter Scott das Erscheinen von Rob Roy und von Ivanhoe.«5
Vielleicht rührt daher die Bedeutung, die die Kultur im weiten Sinn und das so oft erwähnte Gefallen an »Divas«, »Stars« des Kinos, der Presse, der Literatur, der Künste als Identifikationsmuster oder Ikonen für Schwule gewonnen haben.6
Auch die Berufswahl lässt sich als Flucht vor der »heterosexuellen Vorhaltung« interpretieren, von der ich weiter oben gesprochen habe, und als Grundelement für die Konstruktion seiner selbst und der persönlichen Identität. Einer Reihe von Arbeiten, und namentlich einem Artikel von Marie-Ange Schiltz, lässt sich die Hypothese einer für Homosexuelle – jedenfalls für männliche Homosexuelle – spezifischen aufsteigenden Mobilität entnehmen. Es scheint nämlich, dass die Umsiedlung in die Stadt statistisch mit einem Wunsch Jugendlicher aus den Unterschichten gekoppelt ist, manuellen Berufen zu entgehen und sich solchen zuzuwenden, von denen angenommen werden kann, dass hier mehr Toleranz herrscht oder zumindest ein Klima, das es erleichtert, seine Sexualität auszuleben; und allgemeiner eine Orientierung auf »künstlerische« Berufe oder die »künstlerischen« Pole handwerklicher Berufe. Dies würde beispielsweise, wie schon Michael Pollack vorschlug, die Orientierung auf Berufe wie Friseur erklären, die am »künstlerischen« Pol manueller Berufe angesiedelt sind.7 Jedenfalls scheint die Emigration in die Stadt sich auch – natürlich statistisch gesprochen – in aufsteigenden Schulkarrieren oder sozialer Besserstellung niederzuschlagen. Allerdings stützt Marie-Ange Schiltz (wie vor ihr bereits Michael Pollack) ihre Ergebnisse auf die Auswertung von Umfragen, die in der Schwulenpresse erschienen sind; es handelt sich daher um spontane Stichproben, die zwangsläufig starke Verzerrungen auslösen (da man sich mehr oder weniger als Schwuler identifizieren muss, um von solchen Publikationen erreicht zu werden, und wohl erst recht, um einen Fragebogen zu beantworten), was die Überrepräsentierung von Großstädtern aus eher privilegierten Schichten erklären mag. Es versteht sich, dass es für Homosexuelle aus Unterschichten, Kleinstädten und ländlichen Gebieten schwieriger ist, sich zur Homosexualität zu bekennen und also in entsprechenden soziologischen Untersuchungen Berücksichtigung zu finden. Schiltz weist jedoch darauf hin, dass der Unterschied zwischen den spontanen Antworten jener Schwulenstichprobe und den Antworten, die mit anderen Methoden bei Umfragen innerhalb der »Gesamtbevölkerung« erzielt wurden, nicht so groß ist, dass diese Verzerrung allein schon das erwähnte Phänomen erklärt.
Was lehren uns solche statistischen Daten? Welche Aufschlüsse lassen sich ihnen entnehmen? Eine Art intergenerationelle Solidarität (die vielleicht nicht als solche erfahren oder reflektiert wird) zwischen älteren und jüngeren Schwulen, denen die Älteren Starthilfe bei dem Versuch leisten, sich ihrem sozialen Milieu oder ihrer Familienherkunft zu entziehen, darf unterstellt werden (ungeachtet des alten Mythos, dass sie sich, wie die Freimaurer, »gegenseitig unterstützen«, zeigt dies insbesondere, dass die unsichtbare, aber vorhandene Kette schwuler Solidarität vor allem aus tausend individuellen Hilfeleistungen resultiert).8