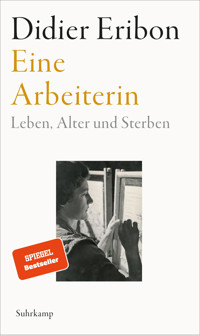19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Autor des Spiegel-Bestsellers Rückkehr nach Reims
Didier Eribons Rückkehr nach Reims gilt bereits heute als Klassiker der Zeitdiagnose. In seinem neuen Buch greift Eribon viele Themen des Vorgängers wieder auf und vertieft seine Überlegungen zu zentralen Fragen. Die Gesellschaft, so der französische Soziologe im Anschluss an Pierre Bourdieu, weist uns Plätze zu, sie spricht Urteile aus, denen wir uns nicht entziehen können, sie errichtet Grenzen und bringt Individuen und Gruppen in eine hierarchische Ordnung. Die Aufgabe des kritischen Denkens besteht darin, diese Herrschaftsmechanismen ans Licht zu bringen.
Zu diesem Zweck unternimmt Eribon den Versuch, die Analyse der Klassenverhältnisse sowie der Rolle zentraler Institutionen wie des Bildungssystems auf eine neue Grundlage zu stellen. Dabei widmet er sich auch Autorinnen und Autoren wie Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, Assia Djebar und Jean-Paul Sartre sowie ihrem Einfluss auf seinen intellektuellen Werdegang. Nur indem wir uns den Determinismen stellen, die unser Leben regieren, können wir einer wahrhaft emanzipatorischen Politik den Weg bereiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
3Didier Eribon
Gesellschaft als Urteil
Klassen, Identitäten, Wege
Aus dem Französischen von Tobias Haberkorn
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Hauptteil
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Ouvertüre
I. Hontoanalyse
1. Erben, Abweichen
2. Das Ich und seine Schatten
3. Paradoxien der Wiederaneignung
II. Beim Lesen von Annie Ernaux
1. Die zwiespältige Kultur
2. Die List des Determinismus
3. Bedingungen des Erinnerns
III. Gedächtnispolitik
1. Klassenkampf
2. Populäre Kultur und soziale Reproduktion
3. Genealogien
Epilog
Einspruch einlegen
Anmerkungen
3
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
260
261
262
263
264
265
Für G., natürlich.
Ouvertüre
Nun muss ich also auf sie zurückkommen.
Vorgehabt hatte ich es nicht. Ich wollte diese Rückkehr nach Reims, die mich so viel Mühe gekostet hatte, hinter mir lassen, sobald sie erschienen war. Veröffentlichen und vergessen, das war mein Wunsch gewesen – und dann endlich jene Arbeiten wiederaufnehmen, die ich, wie ich zuvor gedacht hatte, nur kurz hatte ruhen lassen, um einer Abschweifung nachzugehen.
Hatte ich wirklich geglaubt, so könne das laufen? War das wirklich denkbar gewesen? Bald schon hatte ich begriffen, dass eine »Rückkehr« niemals abgeschlossen, ja gar nicht abzuschließen ist. Dies gilt für die Bewegung im Raum ebenso wie für die Reflexion, die diese begleitet und bis zu einem gewissen Punkt möglich, weil verstehbar macht. Reflexion und Rückkehr sind nicht voneinander zu trennen, sie gehören zusammen und vermischen sich. Aus dieser Reflexivität entstehen Komplexität und Unsicherheit. Anfangs war der Weg, den ich zu beschreiten gehabt hatte, schwierig gewesen – nun war er chaotisch geworden. Schon bald stand fest, dass ich nicht darum herumkommen würde, das, was ich erzählt und analysiert hatte, fortzuschreiben. Dieses Buch zu verfassen war eine Notwendigkeit gewesen. Es weiterzuführen war nun nicht weniger notwendig.
10In einer warmherzigen Besprechung von Rückkehr nach Reims schreibt Annie Ernaux, mein Buch sei eine »bis zum Äußersten getriebene Selbstanalyse«. Dieser Satz hat mich tief berührt. Ich hatte mein Schreibprojekt tatsächlich so angelegt, dass es die Erkundung meines Selbst und damit auch der sozialen Welt meiner Kindheit und Jugend so weit treibt, dass es die Prozesse, die mich auf eine Bahn der Abweichung und des Aufstiegs geführt, die mich von meinem zugewiesenen Schicksal, von meiner Familie und meinem Herkunftsmilieu entfernt hatten, mit größtmöglichem Aufwand untersuchen sollte. Es ging in diesem Buch weniger um »mich selbst« als um die soziale Wirklichkeit, die überall ihre Urteile spricht und ihre Markierungen hinterlässt, das heißt um die Gewalt, die der Gesellschaft innewohnt und sie sogar definiert. Welche Risiken man bei so einem Unterfangen eingeht, kann die Autorin von Büchern wie Gesichter einer Frau, La Honte, L’Événement oder La Femme gelée wohl am besten beurteilen, hat sie doch oft behauptet, sie wolle nur Bücher schreiben, die sie selbst in Gefahr bringen und nach deren Erscheinen man den anderen nicht mehr ins Gesicht zu blicken wagt, weil man weiß, welche Angriffsflächen man geboten hat.
Aber jede Radikalität ist provisorisch. Man erringt sie durch eine geduldige, schmerzhafte Arbeit an sich selbst, man macht Krisen durch, in denen man ans Aufhören denkt oder schon aufgehört hat, bevor man sich doch noch zum Weitermachen zwingt. Und doch wird sie, hat man sie erst einmal erreicht, zu etwas, das es seinerseits zu überschreiten gilt. Man spürt die Verpflichtung, immer weiterzugehen, immer tiefer in die Geheimnisse der sozialen Magie einzudringen, die mit furchtbarer Effizienz dafür sorgt, dass Herrschaftsmechanismen fortbestehen und dass die politische Ordnung sich hält. Man möchte einfach 11verstehen, wie und warum das alles auch weiterhin »funktioniert«. Wenn diese Ordnung besteht, bedeutet das dann nicht auch, dass jeder von uns auf eine bestimmte Weise an ihrer Reproduktion beteiligt ist? Welche Art der Zustimmung zu den ererbten sozialen und mentalen Strukturen, die sich tief in unsere Körper und Subjektivitäten einschreibe, ja die unser soziales Handeln hervorbringen und vorherbestimmen, setzt das voraus? Die Zustimmung mag stillschweigend oder ausdrücklich sein. In jedem Fall ist sie stärker, als man glaubt oder möchte.
Ich muss also auf meine Rückkehr zurückkommen. Dabei werde ich mich erneut auf eine Methode verlassen, die ich, wenn mir dieses Oxymoron gestattet ist, als »soziologische Introspektion« bezeichnen möchte. Meine Befunde erlangen ihren Sinn, wenn sie mit literarischen und theoretischen Texten in Resonanz treten, die sich mit ähnlichen Problemen befasst haben. Begonnen habe ich dieses Buch als einen Dialog mit den Schriften Annie Ernaux’ und Pierre Bourdieus. Bald gesellten sich weitere Autoren dazu. Aus dem Wechselspiel zwischen diesen entschiedensten Stimmen der literarischen und wissenschaftlichen Kultur und den losesten Elementen des gewöhnlichen Lebens ist etwas entstanden, das, so hoffe ich, einer kritischen Erkenntnis recht nahekommt, in der der Wunsch, die soziale Welt zu verändern, erste Mittel zu seiner Realisierung findet.
I. Hontoanalyse
1. Erben, Abweichen
Zwei Bilder habe ich vor mir. Sie sind einander so unähnlich, es ist kaum vorstellbar, dass sie binnen eines Jahres für die Gestaltung der Umschläge verschiedener Ausgaben ein und desselben Buchs verwendet wurden: im Oktober 2009 für die Originalausgabe von Retour à Reims, ein Jahr darauf für das Taschenbuch.[1]Das erste Bild hatte ich sorgsam ausgesucht. Es handelt sich um eine verkleinerte Reproduktion des Gemäldes Die Straße von Uzès von Nicolas de Staël. Man sieht darauf einen Weg, von dem man nicht weiß, wohin er führt, von dem aber zu vermuten steht, dass er in beide Richtungen beschritten werden kann: Aufbrechen und Zurückkehren, zwei Momente des Lebens, oder zumindest meines Lebens, die ich auf den Seiten dieses Buches rekonstruiert hatte. Mit dem Gemälde eines von mir bewunderten Malers wollte 16ich deutlich machen, dass nicht das »Ich« im Mittelpunkt steht, sondern die Strukturen der sozialen Welt. Eine Straße, eine Landschaft, eine Stadt … – und damit Bezüge zu Zeit und Raum, zu Geschichte und Geografie, die zwar situiert, aber keineswegs unbestimmt sind und die es allen ermöglichen, sich darin wiederzuerkennen. Vielleicht, dachte ich, kann die Linie in der Bildmitte – die Straße – die Dissoziierung des Ich oder die Spaltung der Persönlichkeit symbolisieren, von der das Buch insgesamt handelt. Ich wusste außerdem, dass de Staël, der von Kindesbeinen an erlebt hatte, was Verlorenheit und Exil bedeuten, sich kurz nach der Vollendung dieses Gemäldes umgebracht hatte. Dadurch bekam dieses anscheinend so friedliche Bild eine dramatische Note. Sich auf den Weg zu machen, sei es, um fortzugehen, sei es, um zurückzukehren, birgt immer Risiken. Nie kann man sich sicher sein, wohin man steuern, was man entdecken und was aus einem werden wird. Die Gewalt der Welt lauert überall, auch dort, wo sie sich hinter der naturalisierten Ordnung der Dinge versteckt. An einem anderen Bild de Staëls aus der gleichen Schaffensperiode bewundert Ernst H. Gombrich, dass »schlichte aber höchst feinfühlige Pinselstriche sich […] zu überzeugenden Landschaftsbildern zusammenschließen, die den Eindruck von Licht und Weite hervorzaubern«.[2] Diese Atmosphäre des Rätselhaften und Ungewissen schien mir ideal. Meine Wahl passte außerdem perfekt zur Gestaltung der Buchreihe: In einem Rahmen in der Umschlagsmitte, gleich unter dem Titel, sollte ein zeitgenössisches Kunstwerk gezeigt werden (und ich bin froh, dieser Regel beim vorliegenden Buch erneut mit 17einem Gemälde de Staëls aus derselben Serie zu folgen, das ich aus ähnlichen Gründen ausgewählt habe). Ich konnte mit mir zufrieden sein: Das Ergebnis war außerordentlich gelungen.
Wie einfach es doch ist und wie angenehm, seinem eigenen Bildungsnarzissmus zu schmeicheln.
Und das andere Bild? Bei der Taschenbuchausgabe bestand die Lektorin darauf, ein Foto von mir zu bekommen. Die Frage hatte sich schon zu einem anderen Anlass gestellt: Als die Originalausgabe meines Buches erschienen war, hatten einige Journalisten darum gebeten, ihre Buchkritiken mit Fotos aus meiner Kindheit und Jugend bebildern zu dürfen. Meine Antwort war stets dieselbe: »Ich habe gar keine.« Das stimmte nicht, denn meine Mutter hatte mir ein paar Fotos aus einer der Kisten mitgegeben, die wir am Tag nach der Beerdigung meines Vaters in einem ziemlich intensiven Moment ausgepackt hatten. Meine Unaufrichtigkeit zog ein schlechtes Gewissen nach sich. Während die Journalisten meinen Mut priesen, konnte ich nicht umhin, mich für diese ultimative Feigheit zu schämen. Ich tat mich noch immer schwer damit, zu meiner Familiengeschichte zu stehen. Innerhalb eines ausgearbeiteten, konstruierten Diskurses hatte ich es zwar geschafft, sie anzusprechen. Schlicht und einfach zeigen wollte ich sie nicht.
Dabei sind Fotos in meinem Buch alles andere als abwesend, im Gegenteil, ich habe einige ganz genau beschrieben. Sie waren sogar der Auslöser dafür, dass ich überhaupt mit dem Schreiben anfing. Die Rückbesinnung auf eine Familien- und Sozialgeschichte muss sich geradezu auf das Betrachten alter Fotografien stützen. Die Kraft ihrer Evidenz ist ungebrochen: Mit Erinnerungen kann man tricksen, mit Fotos nicht. Egal wie schlecht oder ob man sich gar nicht mehr erinnert, sie zeigen die Welt so, 18wie sie war, nicht als Wille, sondern als Vorstellung: das Reale, wie es gewesen ist. Ich hielt diese Fotografien sorgsam zurück. Martine Sonnet war da anders vorgegangen. Sie hatte ihrer Erzählung Atelier 62 eine Fotografie vorangestellt, die ihren Vater dabei zeigt, wie er, die Hände in den Taschen seiner Arbeitshose, in die Renault-Werke von Boulogne-Billancourt marschiert. Alles darauf Folgende scheint in diesem Bild schon angelegt zu sein, geduldig entfaltet Sonnet seine Bedeutungsschichten. Der Körper dieses Mannes, eines Arbeiters in der Stahlgießerei, in der härtesten Abteilung des Werks, nimmt sich aus wie die Inkarnation eines ganzen Berufstandes, ja eines existenziellen Typus – wie das Urbild einer Klasse oder, möchte ich fast sagen, einer ganzen Welt. Wir blicken auf seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auf seine soziale Identität, die sich in diese Momentaufnahme eingeschrieben hat wie ein dauerhafter Rahmen seines Lebens, wie der unübertretbare Horizont seines Schicksals. Die Autorin hat recht, wenn sie zeigt, worüber sie anschließend sprechen wird. Die Wörter werden stärker, die Sätze dichter, wenn man das, was sie ausdrücken sollen, vor Augen hat. Ich habe die Lektüre dieses Buches sehr genossen. Sein Inhalt bleibt für mich untrennbar mit dem Bild auf dem Umschlag verknüpft.
Die Frage nach einem Foto von mir sollte also einige Monate später wiederkehren und mich in dieselben Nöte stürzen. Meine Antwort lautete weiterhin: »Nein.« Diesmal rechtfertigte ich mich mit dem Argument, dass man den Leser nicht »täuschen« sollte: »Es ist doch kein autobiografischer Essay, es ist eine theoretische Arbeit …« Das war ja auch nicht ganz falsch. Ich fürchtete, die Intention und sogar der Inhalt meines Buches könnten von einem Foto massiv verändert werden. Die Wirkung eines Buch19umschlags kann so stark sein, dass er ein Buch, manchmal gegen seine Intention, einer anderen Gattung zuordnet. Im konkreten Fall schien mir, dass ein Foto die Probleme, von denen ich sprach, zu personalisieren und zu vereinzeln, obwohl mein ganzes Bemühen auf eine Entpersonalisierung, auf das Kollektive, auf eine »soziologisierende« Darstellung gerichtet war. Um die soziale Wirklichkeit sollte es gehen, nicht um meine persönliche. Warum also ein Foto von mir? Ich ließ meine Kenntnisse und Vorlieben in der Gegenwartskunst spielen, um Gegenvorschläge zu machen. Clyfford Still? Barnett Newman? »Das wäre doch nüchtern und elegant!«, insistierte ich. Aber hatte mein Unwille, ein Foto rauszurücken, wirklich nur ästhetische und intellektuelle Gründe? Ein einziges Foto hatte ich, das passen konnte: Mit einem Arm auf die Motorhaube gestützt, stehe ich vor dem schwarzen Auto, das meine Eltern Mitte der sechziger Jahre gekauft hatten und mit dem wir sonntags zum Angeln ans Marne-Ufer fuhren. Neben mir sind einer meiner Brüder und mein Vater zu erkennen. Ich muss zwölf oder dreizehn Jahre alt sein, er also fünf- oder sechsunddreißig. Er sieht jung aus, er hatte lange Sport getrieben – eine Weile spielte er in der Werksmannschaft Basketball, mein älterer Bruder und ich fuhren sonntags oft mit zu den Spielen. Er macht keine schlechte Figur, muss ich sagen, und man sieht ihm an, dass er es weiß. Warum wollte ich dieses Foto partout nicht rausrücken? Was man darauf sieht (das Auto, die Körper, die Frisuren usw.), stellt zweifellos eine soziale Einschreibung her. Sicherlich bringt die schwarz-weiße Einfachheit dieses Bildes mehr unpersönliche und soziologische Wahrheiten zum Vorschein als die subtilen Farbkompositionen der genannten Maler. Aber würde zwischen dem vornehmen Kunstwerk auf dem Umschlag der Erstausgabe und dieser fast schon klischeehaften Darstellung einer urlaubenden 20Arbeiterfamilie nicht ein viel zu großer Gegensatz entstehen? War es nicht albern, den Umschlag so zu ändern?
Solche Gegensätze machen allerdings die Spannung meines Buches aus: die kulturelle Transformation des Selbst als Mittel und zugleich Resultat einer sozialen; der Wille, sich im Übergang in eine andere Welt von derjenigen, aus der man kommt, so gut es geht zu entkoppeln und mit derjenigen, in die man geht, so gut es geht zu verschmelzen. Die »Rückkehr« zwingt einen dazu, den Weg, den man zurückgelegt hat, aufs Neue zu durchdenken und sich zu fragen, was die hergestellte Distanz bedeutet. Eine fotografische Reise in meine persönliche Vergangenheit akzentuiert die Arbeit der politischen Erkundung oder Ausgrabung meines Selbst, die ich mit diesem Buch unternommen habe, noch einmal anders: von der legitimen zur populären Kultur, von dem Menschen, der ich geworden bin (ein Intellektueller, der sich für Bücher von Michel Leiris oder Claude Simon begeistert, der zu Wozzek, Capriccio oder Peter Grimes in die Oper geht und der beim Anblick von Gemälden Nicolas de Staëls ganz gerührt ist), zu demjenigen, der ich vorher war (ein Arbeitersohn, der mit seiner Familie Angelausflüge macht, der am Straßenrand picknickt und der mit seinem Vater, dem er immer unähnlicher zu werden beginnt, für ein Foto posiert). Durch eine Änderung des Umschlags für die Taschenbuchausgabe konnte ich also einen zusätzlichen Schritt der Autosozioanalyse vollziehen oder diese zumindest um ein bildliches Element ergänzen. Bald sah ich, dass dies der für mich vielleicht schwierigste Schritt überhaupt war. Ich konnte mich nicht dazu durchringen. Zeigen, was man geworden ist, ist angenehm und aufwertend. Zeigen, was man einmal war, ist es weniger. Ich war von den alten Fotos fasziniert. Immer wieder holte ich sie hervor und starrte sie an – als sei es eine Frage der Zeit, 21bis sie sich unter meinen Augen beleben und mich in eine Welt transportieren würden, die einmal meine war. Woran dachte dieser Junge, der niemand anderer ist als ich selbst (vorausgesetzt, das »Ich« ist etwas Konstantes und – hier liegt das zu behandelnde politische und soziologische Problem – es behält seine Konstanz auch in allen seinen Varianten und Versionen)? Welche Zukunft hatte dieser Junge vor Augen? Stellte er sich überhaupt eine vor? Was wusste er von seiner Position im Gefüge der sozialen Klassen und davon, wie sie sich auf seine schulische Laufbahn auswirkte? Waren ihm, da er auf diesem Foto (und auf anderen) ein dezentes Lächeln zeigt, alle diese Dinge völlig klar? Soweit ich mich erinnerte, war meine Kindheit schon lange vor der Zeit, in der dieses Foto entstand, von Melancholie und Traurigkeit, von einem unglücklichen Verhältnis zur Welt und zu den anderen durchdrungen gewesen. Verschweigt das Foto also etwas? Oder habe ich mir eine solche Vergangenheit erst zurechtgelegt, als ich, zu jemand anderem geworden, auf meine Jugend zurückblickte? Nein, ich bin mir sicher, dass der unruhige und gequälte Heranwachsende, dessen Bild ich erinnere, wirklich ich selbst gewesen bin. Ein wenig später gab es sogar einen Suizidversuch, den ich damals lieber verschwieg (in meinem Zimmer hatte ich eine Schachtel Tabletten geschluckt und anschließend fünfzehn Stunden geschlafen). Wie so viele junge Schwule, die sich in ihrer Haut nicht wohl fühlen, die keine Vertrauensperson finden und die sich ihre Zukunft nicht anders als angstvoll und unruhig vorstellen können, verfolgten mich viele Jahre Selbstmordgedanken. Mein Lächeln scheint auch nur angedeutet zu sein, wie ein Zugeständnis an den Moment der Fotografie. Und ich frage mich: Was verbindet mich heute mit diesem Jungen? Was in mir kommt von ihm, was in mir hat all die Jahre und Veränderungen überdauert? Diese Begegnung, dieses 22Vier-Augen-Gespräch mit mir selbst, wollte ich für mich behalten, ich wollte es auf keinen Fall veröffentlichen. Oder wollte wenigstens sicher sein, dass es, nachdem ich es in meinem Buch schon öffentlich gemacht hatte, unsichtbar und ungreifbar blieb. »Lest, ohne zu sehen«, war die implizite Botschaft an meine Leser gewesen. Jetzt hatte ich die Wahl. Sollte ich sagen: »Lest und seht?« Nein! Das war mir unmöglich.
Die Lektorin ließ nicht locker: »Es ist für das Taschenbuch, wir richten uns doch an ein breites Publikum …« Ich schwächte meinen Standpunkt etwas ab (»Ich werde mal schauen, was ich für Fotos habe …«) und gab schließlich nach. Aber wer mein Buch gekauft hat, wird es vielleicht bemerkt haben: Ich habe das Foto, das ich weitergab, sorgsam zurechtgeschnitten.
Die Handlung des Films Alles über meine Mutter von Pedro Almodóvar nimmt ihren Ausgang bei einem Foto, dessen eine Hälfte fehlt, weil der Vater weggeschnitten wurde. Der Sohn will wissen, was auf der fehlenden Hälfte zu sehen ist. Er will zurückholen, was seine Mutter vor ihm verstecken wollte, weil sie sich, so versteht er es, dafür schämte: eine Vergangenheit, die sie auslöschen wollte. Die systematische Auslöschung – den Vater hat sie nicht nur aus einem, sondern aus allen Fotos herausgeschnitten – konturiert die Vergangenheit auf eine spezielle Weise. Sie weckt den Wunsch des Sohnes zu wissen. Auch hier ist es der Tod – in diesem Fall des Sohnes, das Generationenverhältnis hat sich umgekehrt –, der bei der Mutter einen Prozess der Rückkehr und Befragung einleitet. Sie will die Vergangenheit untersuchen, die ihr so unangenehm war und die sie von ihrem Sohn hatte fernhalten wollen.
Das Foto spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Mutter 23wollte mit ihrer Vergangenheit brechen und sie um jeden Preis vor ihrem Sohn verbergen. Der Sohn will nur eins: dass sie ihm endlich sagt, was sie ihm bislang verschwiegen hat. Die Macht der »Familie« als Ort und Norm der Wahrheit über einen selbst, ja der Wahrheit des Selbst schlechthin (als ein Dispositiv der Macht, das, wie Foucault gesagt hätte, eine Funktion des »Willens zum Wissen« ist) wirkt selbst dort, wo man glaubte, sie am besten neutralisiert zu haben. Man sieht, wie schwierig es ist, die Logiken der »Norm« und der »Subversion« als radikal antagonistisch zu denken. Tatsächlich sind sie miteinander verschränkt. Unter den Fragen, die Rückkehr nach Reims aufgeworfen hatte, gab es eine, die im Grunde das gesamte Buch enthält: Warum kehrt man zu etwas zurück, dem man um jeden Preis entkommen wollte? Warum geht von der Familie diese magnetische Kraft aus, die in die hintersten Winkel des Unbewussten auch der Menschen vorzudringen scheint, die jede Beziehung zu ihr verweigern? John Edgar Wideman hat ganz recht, wenn er in seinem Essay Bruder und Hüter hervorhebt, dass wir eine Art »Mitgliedsausweis« besitzen, der uns an unsere Familie bindet. Aber was für eine Art Ausweis ist das, der kein Gültigkeits- und kein Ablaufdatum zu haben scheint? Was ist das für eine Entität, der man offenbar auch dann noch angehört, wenn man längst aus ihr ausgetreten ist? Tatsächlich ist es so, dass die Kraft der »Familie als Körper«, wie Bourdieu sie genannt hat, jederzeit jene der »Familie als Feld« widerlegt. Die Kraft der »Familie als Fusion« ist jederzeit aktiv, auch dann noch, wenn die Familie zerbrochen ist. Die desintegrierenden Kräfte innerhalb einer Familie – die abweichenden Laufbahnen der Geschwister zum Beispiel, die verschiedenen Lebensweisen, gegensätzlichen Interessen usw. – sind nur selten stark genug, um nicht doch von den integrierenden eingeholt zu werden: 24von der affektiven Logik, den Schuldgefühlen, der Rücksicht auf bestimmte gesellschaftliche Pflichten, dem permanenten Ruf zur Ordnung, der von allen sozialen oder auch staatlichen Dispositiven ausgeht (Familienfeiern, Feiertagen, Standesamt …).[3]
Almodóvars großer Film verdeutlicht jedenfalls, wie wichtig Fotos in unserem Leben sind. Im Guten – sie lassen uns das Gesicht eines Menschen betrachten, der verschwunden ist – wie im Schlechten: Unnachgiebig gravieren sie die Markierungen des Gewesenen in das ein, was wir jetzt sind und vielleicht nicht mehr sein wollen. Gegen unseren Willen kommt zu uns zurück, wovon wir uns losreißen wollten, und ja, in diesem Fall ist die Vergangenheit die Hölle, genau wie auch die Menschen die Hölle sind, die sie als unsere Vergangenheit festschreiben und dadurch ein soziales Sein, eine feste Identität zuweisen. Für die Vorstellungen von Familie, die wir in uns tragen, scheinen Fotografien ein Marker, eine Spur, aber auch ein Urheber und Operateur zu sein: Sie sind das, zu dem familiäre Beziehungen, von welcher Art sie auch sein mögen, immer wieder zurückführen, ob wir es wollen oder nicht. Dieser soziale Zwang wirkt stark auf unsere Affekte und sorgt für die Freudensprünge und Reuegesten, die mit jeder Selbstverwandlung einhergehen. Es ist also wahr, Fotos will man oft wegwerfen oder zerschneiden. Wer kennt diese Versuchung nicht?
Meine Mutter hatte mir ein ganzes Foto gegeben. Ich habe es verstümmelt. Ich kannte die Vergangenheit doch! Und ich wollte sie auslöschen. Nichts über meinen Vater! Das Ergebnis ist jedoch fast dasselbe: Am Bildrand sieht 25man noch den Zipfel des karierten Hemds, das er an diesem Tag trug. Es zieht die Blicke auf sich wie ein unerklärliches Detail in einem beschädigten Gemälde und gibt demjenigen, den ich abwesend machen wollte, eine insistierende Präsenz. Vielleicht will ich mich mit diesem neuen Buch, das Sie gerade zu lesen beginnen, auf die Suche nach dem begeben, was aus diesem Foto verschwunden ist. Natürlich weiß ich, was auf dem verschwundenen Teil zu sehen war: Ich habe es ja selbst weggeschnitten und in den Mülleimer geworfen, damit mich niemand mehr danach fragen konnte. Aber ich will mehr und will es genauer wissen. Nicht weil ich mich selbst und meinen Vater besser verstehen möchte, sondern weil ich die Ordnung der Welt und der sozialen und politischen Determinismen begreifen will, deren Mechanik sich noch in die geringsten Details unserer beider Existenzen (in mein Leben, in das seine und in die Beziehung zwischen uns) eingeschrieben hat. Aber ist es nicht zu spät? Von meinem Vater kann ich die Auskünfte, die mir zuvor so egal waren und die ich jetzt so gerne besitzen würde, nicht mehr bekommen.
*
Proust hat es gut auf den Punkt gebracht: Der Tod eines anderen Menschen bedeutet die Unmöglichkeit, Antworten auf Fragen zu bekommen, die man immer hätte stellen sollen, die man vor sich hergeschoben hat, weil sie nicht dringend genug erschienen, und die nun für immer unbeantwortet, eine Obsession bleiben werden … Er schickt einen auf eine Reise, bei der man endlich bereit ist, sich zu öffnen und einem Freund die lange verdrängten Fragen zu stellen. Doch die einzige Antwort, die man jetzt noch erhält, ist das Schweigen der gegenüberliegenden Sitzbank.
Kann man dann wenigstens mit einem Foto sprechen? 26Mit vielen Fotos? Auch wenn man weiß, dass sie niemals antworten, dass sie alle unsere Anfragen zurückweisen und mit Stummheit quittieren werden? Man muss sie trotzdem zum Ausgangspunkt der Untersuchung einer sozialen und historischen Vergangenheit machen, die noch immer schwer auf einem lastet.
Proust versucht uns zu erklären, dass die zeitliche Entfernung die von alten Fotografien eingefangenen Klassenidentitäten verschwimmen lässt. Als der Erzähler von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit erfährt, dass der ältere Herr, dem er eben begegnet ist, nicht der Kleinbürger aus Combray, für den er ihn gehalten hat, sondern der Herzog von Bouillon sein soll, sinniert er einen Moment über die »Gleichförmigkeit in der äußeren Erscheinung« zwischen zwei Menschen, die beide sehr alt, aber von unterschiedlichem sozialen Stand sind. Er fühlt sich an eine Daguerreotypie von »Saint-Loups Großvater mütterlicherseits, de[m] Herzog von La Rochefoucauld« erinnert, »auf der er in Kleidung, Miene und Haltung ganz und gar meinem Großonkel glich«, und schließt daraus,
daß die gesellschaftlichen oder auch individuellen Unterschiede von ferne gesehen in der Gleichförmigkeit einer Epoche verschwinden. In Wahrheit ist es so, daß die Ähnlichkeit der Kleidung und auch der Widerschein des Zeitgeistes auf dem Gesicht einer Person einen viel wichtigeren Platz einnehmen als die Kaste, die einen großen Raum nur in der Eigenliebe des Betreffenden und der Einbildung der anderen beansprucht […].[4]
27Doch dieser Eindruck täuscht. Er entsteht nur deshalb, weil Proust Aristokraten und Bürgerliche, das heißt Mitglieder der wohlhabenden Klassen, miteinander vergleicht. Hätte man auf einer anderen Daguerreotypie einen Arbeiter oder Bauern gesehen, dann wären diese ganz anders angezogen gewesen und der »Widerschein des Zeitgeists« hätte ihr Gesicht nicht auf eine Weise erhellt, die ihre Lebensumstände und ihren beruflichen Rang bis zu dem Punkt vergessen lässt, wo man sie mit dem Industriellen oder Grundbesitzer verwechselt, für den sie arbeiten. Je länger man in Prousts Recherche liest, desto deutlicher dementiert der Roman die These von der sozialen Angleichung realer Personen im Lauf der Zeit. Stattdessen beschreibt er, wie die physischen und psychischen Züge, welche die Milieuzugehörigkeit ausdrücken, von einer Generation zur nächsten vererbt werden. Dabei formuliert er seine Theorie nicht in sozialen, sondern in physiologischen Begriffen: Das biologische Erbe wird von den Eltern an die Kinder weitergegeben und bringt mit der Zeit eine fast absolute Ähnlichkeit zwischen beiden hervor. Deutlich wird das etwa an der im ganzen Roman immer wieder nachdrücklich geäußerten Behauptung, dass die Kinder die Physiognomie und den Charakter ihrer Eltern übernehmen bzw. dass sie diese nach deren Tod geradezu ersetzen. Gültig scheint mir diese Behauptung allerdings nur dort zu sein, wo es eine gesellschaftliche Kontinuität zwischen Müttern und Töchtern, Vätern und Söhnen gibt. In einer berühmten Stelle erkennt der Erzähler, wie seine Großmutter in den Gesten und Haltungen, ja im gesamten Wesen seiner Mutter weiterlebt: »Besonders aber bemerkte ich, sobald ich sie in ihrem Crêpemantel eintreten sah – was mir in Paris immer entgangen war –, daß ich nicht mehr meine Mutter vor Augen hatte, sondern meine Großmutter.« Proust entwickelt eine Theorie des Fortbe28stehens der Vergangenheit in der Gegenwart durch die Reproduktion der mütterlichen Attribute in der Tochter und der väterlichen im Sohn:
Wie in königlichen oder herzoglichen Familien in dem Augenblick, da das Oberhaupt des Hauses stirbt, der Sohn dessen Titel annimmt und aus dem Herzog von Orléans, dem Prinzen von Tarent oder dem Fürsten des Laumes der König von Frankreich, der Herzog von La Trémoille, der Herzog von Guermantes werden, so wird oft durch eine Inthronisation ganz anderer Art und viel tieferen Ursprungs der Lebende von dem Toten ergriffen, folgt ihm nach, wird ihm ähnlich und führt sein unterbrochenes Leben fort.[5]
Man müsste die gesamte Seite und insbesondere die Bemerkungen darüber lesen, wie der »große Kummer, der bei einer Tochter, wie Mama es war, auf den Tod der Mutter folgt, nur um so früher die Hülle [zerreißt]« und »die Metamorphose und das Hervortreten eines Wesens [beschleunigt], das man in sich trägt und das ohne diese Krise, die alle Zwischenphasen ausläßt und mit einem Schlag ganze Zeitabschnitte überspringt, sich nur langsam vollzöge«. Es scheint, dass die Trauer »auf unseren Zügen Ähnlichkeiten zum Vorschein bringt, die virtuell schon in uns vorhanden waren«. Sie organisieren eine historische Erbfolge, die in einem besonders ursprünglichen und archaischen Atavismus begründet ist. Die Zeit scheint aufgehoben oder besser auf eine zyklischen Wiederholung des Gleichen reduziert worden zu sein (natürlich mit gewissen Variationen, auf die der Erzähler immer wieder zurückkommt, wenn er von sich selbst spricht). Es ist frappierend, wie sehr die Vorstellung einer Quasi-Reinkarnation der Mutter (der 29Großmutter des Erzählers) im Leib und in der Seele der Tochter (seiner Mutter) oder vielmehr der offensichtlichen Entfaltung der in der Tochter schon immer vorhandenen und erst durch den Tod der Mutter, für deren Weiterleben sie nun zuständig ist, freigesetzten Potenziale jedem einzelnen Individuum einen Platz in einer langen Kette des Seins und des Erbens, der Genetik und der Geschichte zuweist. Proust beschreibt diese Logik als noch älter und fundamentaler als die des dynastischen Prinzips. In Ernst Kantorowiczs Lehre von den zwei Körpern des Königs ist der politische Körper vom irdischen getrennt und überdauert ihn: »Der König ist tot, es lebe der König.« Bei Proust sind beide Körper eins. Der biologische und der genealogische, der sterbliche und der unsterbliche Körper gehen ineinander über und erhalten sich gegenseitig.
Die Vorstellung der Unveränderlichkeit der Welt ist (zumindest in diesem Zusammenhang) verbunden mit einer ziemlich rigiden Auffassung der geschlechtlichen Rollen im gesellschaftlichen und im Arbeitsleben. Die Tochter verkörpert und ersetzt die Mutter, der Sohn den Vater. Was die Mutter des Erzählers »von ihrem Vater hat« (den »gesunden Menschenverstand«, die »spöttische Heiterkeit«), wird von den Attributen der Mutter, die ihre gesamte Person ausfüllen sollen, überdeckt. Indem die Tochter die Mutter verkörpert, wird sie ausschließlich zu dieser. Prousts so überaus treffende Beschreibung muss eigentlich nach einem anderen als dem von ihm vorgeschlagenen Schema gelesen werden: Es sind die sozialen und sexuierten Dispositionen, die den Körper bis in seine kleinsten Gesten hinein prägen. Das Staunen des Erzählers gilt im Grunde der Tatsache, dass verkörperte, gewissermaßen naturalisierte Dispositionen nicht weniger erblich sind als Titel und Güter. An einer späteren Stelle im Text scheint er die Ansicht, dass bestimmte Merkmale nur 30den Frauen und andere nur den Männern vererbt werden, etwas abzuschwächen, denn dem Erzähler wird auf einmal bewusst, dass er seinen Vorfahren ähnlich ist (»es war auch ganz natürlich, daß ich so war, wie meine Eltern gewesen waren«[6]). Mit den »Eltern« sind hier nicht nur der Vater und die Mutter, sondern auch die Großmutter, Tante Leonie und andere gemeint. Der Erzähler verkörpert nicht mehr nur seinen Vater, sondern besitzt jetzt auch Attribute aus dem anderen Familienzweig, wenn auch bisweilen – etwa in Bezug auf seine Großtante – auf eine mehrfach vermittelte Weise. Wir sehen ein Gesetz der familiären Vererbung, das sich, wie er schreibt, »allmählich« an ihm oder besser in ihm durchsetzt. Seine Gesten und Worte, sein »fleischlicher Ausdruck« werden davon bestimmt, sein Körper verhält sich spontan wie der seiner Vorfahren. Es ist, als bliebe »uns nichts anderes übrig, als alle unsere Verwandten bei uns zu empfangen, die, von weither gekommen, sich um uns versammeln«.[7]
Die Prämisse dieser Theoreme über soziale Vererbung, Reproduktion und Klassenteilung bleibt zwar (zumindest in den hier kommentierten Passagen) implizit, ist deshalb aber nicht weniger klar: Die von Proust beschriebenen Phänomene können sich nur innerhalb eines bestimmten Milieus ereignen. Die Weitergabe des Klassenhabitus von einer Generation zur nächsten erscheint uns lediglich deshalb als ein biologisches oder physiologisches Gesetz, weil das Milieu alles daransetzt, sich unverändert zu erhalten. Nur weil jede Klasse (oder jeder Teil einer Klasse) und innerhalb dieser jedes Geschlecht ihr bzw. sein eigenes We31sen verstetigen will, können Trägheit und Wiederholung über den Wandel, die Evolution, die Abweichung obsiegen; nur deshalb kann der Anschein entstehen, dass »der Lebende von dem Toten ergriffen wird« – und nur deshalb kann er ihn auch tatsächlich ergreifen. Diese soziale Logik beruht ebenso sehr auf dem historischen Unbewussten wie auf dem Selbstbewusstsein und dem eigenen Willen, ganz egal, welche Veränderungen diese durchlaufen. Die verkörperte Geschichte – das heißt die Familiengeschichte als Sozialgeschichte und als Reproduktion der Position im Raum der sozialen Klassen – definiert, was die Individuen sind und werden, sie prägt ihren »fleischlichen Ausdruck« oder, wenn man so will, ihren habitus, ihre hexis oder ihren ethos. Daher der Eindruck einer gewissen Zeitlosigkeit oder besser der Replizierung des Immergleichen im Lauf der Zeit.
Wenn man nun aber denjenigen oder diejenige, der oder die verschwunden ist, nicht verehrt hat oder wenn einen die gesellschaftliche Laufbahn von ihm oder ihr entfernt, ja, wenn man sich alle Mühe gibt, ihm oder ihr auf keinen Fall zu ähneln, wird man dann trotzdem zu dem, was er oder sie gewesen ist? Und wenn der Lebende nicht, wie Proust es so drastisch formuliert, »von dem Toten ergriffen« wird, kann man dann trotzdem davon ausgehen, dass unser Sein die zugleich sozialen und biologischen Markierungen dessen behält, was unsere Vorfahren gewesen sind, das heißt die Markierungen unserer Kindheit und der Zeit, die wir gemeinsam mit ihnen in ihrem Milieu verbracht haben? Wie verhält es sich dann mit der Kraft der »Nachahmung« und den »Erinnerungsassoziationen«, die den Erzähler der Recherche so sehr staunen machen, mit den Redeweisen und Ausdrücken, die wir mit den Eltern teilen, mit der »geheimnisvollen Macht des Sippenerbes«, 32die uns ganz unbewusst denselben »Tonfall« in den Mund legt, die gleichen »Haltungen«, aus denen wir doch eigentlich längst »hervorgegangen« waren?[8]
Natürlich gibt es eine physische Ähnlichkeit. Wer von uns hat noch nie hervorgehoben, dass die Stimme, der Blick, das Lächeln, die Körperhaltung, der Gang, die Gestik eines Menschen denen seiner Mutter oder seines Vaters, manchmal auch seiner Großmutter oder seines Großvaters ähnelt? Jedes autobiografische oder auch nur autoanalytische Unterfangen muss sich früher oder später mit dem Atavismus der eigenen Qualitäten und Fehler, der eigenen körperlichen und charakterlichen Züge befassen. Was aber bleibt von diesen Ähnlichkeiten bei einem Klassenflüchtigen? Wie ist das bei einem sozialen Überläufer, bei dem sich die Unterschiede so stark herausgebildet haben, dass sie sich anschicken, die Ähnlichkeiten zu verdrängen?
Spricht Nietzsche am Anfang von Ecce homo nicht über die Schmerzen der physiologischen Vererbung? Er sei exakt so wie sein Vater, sagt Nietzsche. Sein philosophisches Werk habe in der ererbten schwachen Gesundheit seinen Ausgangspunkt. »Mein Vater starb mit sechsunddreissig Jahren«, schreibt Nietzsche, »er war zart, liebenswürdig und morbid, wie ein nur zum Vorübergehn bestimmtes Wesen […]. Im gleichen Jahre, wo sein Leben abwärts gieng, gieng auch das meine abwärts: im sechsunddreissigsten Lebensjahre kam ich auf den niedrigsten Punkt meiner Vitalität.« Alle seine Charaktereigenschaften habe er von seinem Vater, »das Leben, das große Ja zum Leben nicht eingerechnet«. Seine Philosophie der Behauptung 33und der Gesundheit hat Nietzsche also mit dem und gegen das Erbe der schwachen physischen Konstitution entworfen, die er von seinem Erzeuger geerbt hat. Immer wieder kommt er darauf zurück, dass er »bloß [s]ein Vater noch einmal und gleichsam sein Fortleben nach einem allzufrühen Tode« sei.[9] Bei dem Versuch, sich selbst zu verstehen und der zu werden, der man ist, spielt die Genetik für Nietzsche eine entscheidende Rolle. Man braucht gar kein großer Nietzscheaner zu sein, um sich den Wahrheiten anzuschließen, die dieser Gedanke enthält: Das genetische Erbe bestimmt viele Aspekte der Persönlichkeit, und sei es nur die Körpergröße, die Farbe der Haare oder der Augen oder irgendeine andere »körperliche« Eigenschaft, die den Blick der anderen auf einen selbst und damit zumindest partiell auch die Selbstwahrnehmung orientiert. Es ist bekannt, welche Bedeutung diese physischen »Qualitäten«, die nichts mit Selbstinszenierung zu tun haben, im täglichen Leben besitzen – auch wenn der Körper zu großen Teilen von der sozialen Zugehörigkeit konstituiert und markiert und wenn die Physis nicht selten von ganz und gar sozialen Faktoren – und von der sozialen Wahrnehmung – produziert wird.
Die von Nietzsche angesprochene genetische Kontinuität könnte sich jedenfalls ohne eine soziale nicht entfalten. Und auch nicht ohne eine geschlechtliche, sollte man hinzufügen. Als ich neulich eine alte Fernsehsendung sah, in der ich als Gast aufgetreten war (jemand hatte sie »gepos34tet«), kam mir der Gedanke, dass ich bei der Aufzeichnung etwa so alt gewesen sein muss wie mein Vater auf dem zerschnittenen Foto. Nichts, nicht einmal die geringste Ähnlichkeit lässt darauf schließen, dass es zwischen den beiden jungen Erwachsenen eine Verwandtschaft geben könnte. Mein Vater Mitte der sechziger Jahre auf dem abgeschnittenen Teil des Schwarz-Weiß-Fotos, ich selbst in den späten Achtzigern in einem farbsatten Video: ein heterosexueller Arbeiter, ein schwuler Intellektueller.
Besonders eindrückliche Beispiele für die Unähnlichkeiten zwischen Kindern, die zum Wandel entschlossen sind, und Eltern, die bleiben wollen, wie und was sie sind, finden sich in Abdelmalek Sayads Studien über Einwandererfamilien. Schule und Studium führen zum Bruch, wenn die einen Zugang zu dem bekommen, was den anderen stets verwehrt geblieben ist. Den Eltern missfällt es, wenn sich die Söhne und, schlimmer noch, die Töchter von einer Tradition lösen, von der sie glauben, dass sie noch immer den Lebenshorizont der Familie bestimmen sollte. Die Söhne und Töchter hören auf, den Vätern und Müttern zu ähneln, ganz allgemein bestehen zwischen Kindern und Eltern oder Großeltern kaum noch Gemeinsamkeiten. Am Ende sehen die Eltern ihre Kinder gar als »Verräter« oder »Feinde« an, die insgeheim die Zerstörung der Familie betreiben, weil sie die kulturelle Identität, deren Grundlage die Familie ist, vergessen.[10]
Eine andere, abweichende Einstellung zum Schulsystem, das heißt zur gesamten Kultur und insbesondere zu den als wählbar wahrgenommenen Berufen, durchbricht 35die identische Reproduktion dessen, was die Eltern waren und noch immer sind. Zwischen Eltern und Kindern entsteht ein Graben; man versteht sich nicht mehr, jeder Bezug zueinander – besonders der affektive – wird erschwert. Das Phänomen verstärkt sich weiter, wenn die Kinder allmählich in andere gesellschaftliche Sphären eintreten, wenn sie Umgang mit Leuten pflegen, die sich von ihrem angestammten Familienkreis und dessen Umfeld in so vielen Hinsichten unterscheiden.
*