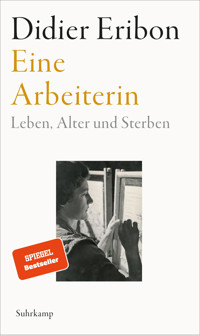
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Das ist also das Leben meiner Mutter gewesen, dachte ich, das Leben und das Alter einer Arbeiterin. Noch wusste ich nicht, dass ich dieser Aufzählung bald ein drittes Wort würde hinzufügen müssen.«
Eigentlich hatte Didier Eribon sich vorgenommen, ab jetzt regelmäßig nach Fismes zu fahren. Doch seine Mutter stirbt wenige Wochen nach ihrem Umzug in ein Pflegeheim in dem kleinen Ort in der Champagne. Wie in Rückkehr nach Reims wird dieser Einschnitt zum Ausgangspunkt für eine Reise in die Vergangenheit. Eribon rekonstruiert die von Knappheit und Zwängen bestimmte Biografie einer Frau, die an einen brutalen Ehemann gekettet blieb und sich sogar in ihren Träumen bescheiden musste. »Meine Mutter«, hält er fest, »war ihr ganzes Leben lang unglücklich.«
Didier Eribons neues Buch ist hochpolitisch: Er legt schonungslos dar, wie sehr die Politik, aber auch die Philosophie, ja wir alle die skandalöse Situation vieler alter Menschen lange verdrängt haben. Zugleich erweist er sich erneut als großer Erzähler: Anhand suggestiver Episoden und berührender Erinnerungen zeigt er, wie wichtig Familie und Herkunft für unsere Identität sind. Er kauft ein Dialekt-Wörterbuch, um noch einmal die Stimme seiner Mutter im Ohr zu haben. So entfaltet der Soziologe das Porträt einer untergegangenen Welt: des Milieus der französischen Arbeiterklasse – mit ihren Sorgen, ihrer Solidarität, ihren Vorurteilen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Didier Eribon
Eine Arbeiterin
Leben, Alter und Sterben
Aus dem Französischen von Sonja Finck
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem TitelVie, vieillesse et mort d’une femme du peuplebei Flammarion (Paris).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5476.
© der deutschsprachigen AusgabeSuhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© 2023 Didier Eribon© Editions Flammarion, Paris, 2023Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Textund Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagfoto: Daniel Frasnay/akg-images
eISBN 978-3-518-77866-1
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
III
1
2
3
4
5
6
Alltagsszenen
IV
1
2
3
Fußnoten
Informationen zum Buch
Eine Arbeiterin
I
1
Am Ende bin ich also nur zwei Mal in Fismes gewesen. Und dies zu einer Zeit, als ich noch dachte, dass dieser dreißig Kilometer nordwestlich von Reims gelegene Ort mit seinen paar tausend Einwohnern über Monate oder sogar Jahre hinweg einer der Bezugspunkte meines Lebens sein würde.
Damals nahm ich mir vor, irgendwann das Rathaus zu besichtigen, das 1912 errichtet, wenig später im Ersten Weltkrieg fast vollständig zerstört und in den zwanziger Jahren im selben Stil der Spätrenaissance wiederaufgebaut worden war. Ich würde hinter diesem merkwürdig imposanten Gebäude durch eine halb dörfliche, halb städtische Kulisse spazieren, würde den Marktplatz mit seinen Geschäften und hohen Häusern überqueren, von denen manche stolz die gleichen Art-déco-Fassaden zur Schau stellten wie die Häuser im Zentrum von Reims, die in derselben Epoche und unter denselben Umständen erbaut worden waren. Ich malte mir aus, wie ich den Zeitungsladen betrat, in dem man auch Bücher, Schreibwaren und Geschenkartikel kaufen konnte und in dessen Schaufenster in einem heillosen Durcheinander die jüngsten Bände der in der Bibliothèque de la Pléiade erschienenen Faulkner-Gesamtausgabe standen, ein Pappaufsteller von Gallimard, auf dem eine Neuerscheinung beworben wurde, sowie zahlreiche Selbsthilfebücher, Reise- und Restaurantführer, Landkarten und Unterhaltungsromane, die mit ihren grellen Covern den Blick auf sich zogen; wie ich dort vielleicht für meine Mutter eine Illustrierte oder die Regionalzeitung kaufen und mich dann während ihres Mittagsschlafs für ein, zwei Stunden in das Café gegenüber setzen würde, um darin zu blättern, bevor ich das Buch las, das ich dabeihatte. Ich stellte mir vor, wie ich den Straßen folgte, die recht bald und übergangslos zu Landstraßen wurden; wie ich zu Fuß zum Pont de Fismette ging, weil ich bei meinen Recherchen zur Ortsgeschichte und -geografie gelesen hatte, dass die Brücke 1918 bei schweren Kämpfen zwischen den deutschen Truppen und einem Bataillon der US-Streitkräfte zerstört worden war, Mann gegen Mann mit Bajonetten und sogar Flammenwerfern, mit erschreckend hohen Opferzahlen auf beiden Seiten. 1928 hatte der Bundesstaat Pennsylvania eine neue Brücke mit zwei großen Statuen auf Säulen gestiftet, als Denkmal – eines von vielen in der Region – für die Opfer dieses mörderischen Wahns. Unvorstellbar, dass dieser heute so ruhige, friedliche Ort, an dem an diesen beiden Sommernachmittagen eine nahezu vollkommene Stille herrschte, nur hin und wieder unterbrochen vom Motorengeräusch eines Autos, Lkws oder Traktors, ein Jahrhundert zuvor Schauplatz einer solchen Entfesselung von Lärm und Wut, Gewalt und Grauen gewesen war, über Jahre hinweg, bis zu den letzten Monaten, letzten Tagen, letzten Stunden eines Gemetzels, das der große Jean Jaurès vergeblich zu verhindern versucht hatte, bevor er seine Hellsichtigkeit und sein mutiges Engagement mit dem Leben bezahlte. Die Gedenkbrücke wurde ihrerseits beim deutschen Einmarsch 1940 zerstört und in den fünfziger Jahren identisch wiederaufgebaut. Ich musste mir dieses Monument, das auf Fotos gleichzeitig sehr schön und sehr traurig wirkt, unbedingt einmal ansehen. Ob historische Dokumente oder Bücher existierten, die einen Überblick über die Geschichte dieses großen Dorfs und der umliegenden Orte gaben? Beim nächsten Mal würde ich mich im Zeitungsladen danach erkundigen.
All diese Pläne blieben Träumereien. In gewisser Hinsicht ist Fismes für mich nur ein Name. Ein flüchtiger Ort in meinen Gedanken. Ich habe es bereits gesagt: Ich bin nur zwei Mal dort gewesen. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Es war im August. Damals glaubte ich, ich würde von nun an regelmäßig hinfahren, um meine Mutter zu besuchen, nachdem meine Brüder und ich endlich einen Platz in einem Pflegeheim für sie gefunden hatten. Wir hielten es für die einzige Lösung. Wir sprachen bereits seit einer ganzen Weile davon. Anfangs war es um ein kleines Apartment gegangen, in dem Flügel eines Seniorenheims, in dem alte Menschen lebten, die ihre Selbstständigkeit und Mobilität noch nicht eingebüßt hatten. Meine Mutter willigte ein. Einer meiner Brüder begleitete sie, damit sie das Heim besichtigen und entscheiden konnte, ob es ihr zusagte, nachdem der für die Einrichtung zuständige Arzt sein Einverständnis gegeben hatte. Das Heim lag am Rand eines noch unfertigen Neubaugebiets neben dem großen alten Dorf Bezannes mit seiner wunderschönen romanischen Kirche aus dem 11. Jahrhundert in der Ortsmitte. Kurz zuvor war hier mitten auf dem Feld ein neuer TGV-Bahnhof entstanden, als regionaler Haltepunkt für alle Schnellzüge, die von Paris-Est aus nach Straßburg oder Luxemburg fuhren. Das Altenheim und die wenigen anderen Gebäude, die man in seiner Umgebung aus dem Boden gestampft hatte, waren modern, aber sie lagen abseits und bildeten – zumindest damals – eine kalte, unmenschliche Kulisse (wie aus einem Film von Jacques Tati). Meine Mutter weigerte sich: »Da will ich nicht hin!«, was mich nicht überraschte.
Mein Bruder war wütend. Er hatte sich um den Papierkram gekümmert, fehlende Dokumente besorgt, stapelweise Formulare ausgefüllt (bevor man es nicht selbst erlebt, hat man keine Vorstellung, mit wie viel Bürokratie so ein Umzug ins Altenheim verbunden ist) und war mit meiner Mutter zur Besichtigung gefahren. Ich wandte ein, dass sie diejenige war, die dort leben müsse, und es deshalb ihre Entscheidung sei.
Zwei Jahre später änderte meine Mutter ihre Meinung. Jetzt war sie einverstanden mit dem Umzug, den sie zuvor abgelehnt hatte. Doch so einfach war das nicht: Erst musste der Arzt wieder sein Einverständnis geben. Er merkte gleich, dass ihr Zustand sich stark verschlechtert hatte und dass sie, trotz ihrer verzweifelten Bemühungen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen – sie versuchte krampfhaft, den absurden Aufforderungen meines Bruders zu folgen –, nur noch mit Mühe gehen konnte. Diesmal war der Arzt derjenige, der ablehnte. Und damit meine Mutter im anderen Teil des Seniorenheims unterkommen konnte, dem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, waren nicht nur weitere bürokratische Schritte nötig, sondern es musste auch ein freies Zimmer geben. Es gab keins. Wir redeten nicht mehr davon. Oder besser gesagt, wir redeten ständig davon, beschäftigten uns ständig damit, ohne zu einer Entscheidung zu kommen. Dabei ging es nicht anders! Was war die Alternative? Meine Mutter konnte das Haus nicht mehr verlassen und sich nur noch mit großen Schwierigkeiten durch die Wohnung bewegen. Schon mehrmals war sie nachts auf dem Weg zur Toilette oder morgens in der Dusche gestürzt. Von Mal zu Mal wurde es schlimmer.
An einem Sonntag war ich auf dem Weg zu ihr und rief sie nach meiner Ankunft am Bahnhof an. Sie ging nicht dran. Im Bus auf dem Weg nach Tinqueux, der an Reims angrenzenden Kleinstadt, in der sie damals lebte, versuchte ich es erneut. Vor dem vergitterten Tor, hinter dem schön gestaltete, fast neue Mietshäuser mit Sozialwohnungen um einen Hof gruppiert waren, klingelte ich an der Gegensprechanlage. Wieder keine Antwort. Irgendwann machte mir ein Nachbar auf. Ich stieg die Treppen hoch zu ihrer Wohnung im dritten Stock und klingelte an der Tür. Ich hörte sie rufen: »Ja, fünf Minuten!«, aber sie machte mir nicht auf. Ich rief durch die Tür: »Mach auf! Was ist los? Ist alles in Ordnung?« Sie antwortete immer wieder, mit seltsamer Stimme: »Ja, ja, fünf Minuten.« Irgendwann sagte ich: »Wenn du nicht aufmachst, rufe ich die Feuerwehr.« – »Fünf Minuten.« Nach einer halben Stunde verständigte ich die Feuerwehr. Die Tür war abgesperrt, der Schlüssel steckte von innen im Schloss. Die Feuerwehrleute konnten die Tür nicht aufbrechen: zu schwer, zu massiv. Sie hätten den Rahmen aus der Wand schlagen müssen. Daraufhin fuhren sie die Drehleiter an der Außenwand aus und verschafften sich Zugang zur Wohnung, indem sie die Scheibe der Balkontür einschlugen. Dann öffneten sie mir von innen. Meine Mutter lag auf dem Boden. Sie war gestürzt und nicht wieder hochgekommen. Als ich geklingelt hatte, war sie in den Flur gerobbt, aber es war ihr nicht gelungen, sich aufzurichten oder hinzuknien, um den Schlüssel im Schloss zu drehen. Sie war nackt. Ich wandte den Blick ab: Die eigene Mutter nackt zu sehen, die eigene alte Mutter nackt zu sehen, war schon unangenehm genug, aber sie nackt auf dem Boden liegen zu sehen, mit verwirrtem Blick, als wäre sie nicht ganz da, war nahezu unerträglich. Ich lief ins Schlafzimmer, holte ein Kleidungsstück und gab es einem der Feuerwehrmänner, der sie zudeckte.
Ich rief den Hausarzt meiner Mutter an. Die Feuerwehrleute betteten sie aufs Sofa, und nach einigen Formalitäten – wenn ich mich richtig erinnere, musste ich eine Art Einsatzprotokoll unterschreiben – verließen sie die Wohnung. Der Arzt traf zwei Stunden später ein, nach seiner Sprechstunde. Er rief den Rettungsdienst und ließ meine Mutter ins Krankenhaus bringen. Sie hatte zu lange auf dem Boden gelegen, er erklärte mir, dies könne Herz-Kreislauf-Probleme nach sich ziehen und zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustands führen. Ich übernachtete in einem Hotel in Reims, um sie am nächsten Tag zu besuchen. Sie verbrachte vierzehn Tage im Krankenhaus: Die Untersuchungen ergaben, dass sie eine massive Entzündung im Körper hatte, die behandelt werden musste. Nach der Entlassung kehrte meine Mutter in ihre Wohnung zurück. Die Szene wiederholte sich regelmäßig: Sie stürzte nachts oder frühmorgens und blieb hilflos liegen. Die Altenpflegerin, die mittlerweile jeden Tag kam, um ihr Spritzen zu geben und sich zu vergewissern, dass sie ihre Medikamente nahm – sie hatte einen Schlüssel –, fand sie Stunden später auf dem Boden und rief die Feuerwehr, weil sie es nicht schaffte, meiner Mutter aufzuhelfen. Dies passierte so oft, dass die Feuerwehrleute irgendwann sagten, derartige Einsätze gehörten nicht zu ihrem Aufgabengebiet und beim nächsten Mal würden sie uns eine Rechnung stellen. Ich erfuhr, dass es dafür sogar einen Namen gab: »Aufstehhilfe nach Sturz«, zu einem Pauschalpreis. Das soll keine Ironie sein, keine Kritik. Im Gegenteil, ich bewundere die Einsatzbereitschaft und Effizienz der Feuerwehrleute. Aber so konnte es nicht weitergehen.
Also begannen meine Brüder mit der Suche nach einem anderen Heim. Einem, das meine Mutter mit ihrer eingeschränkten Mobilität aufnahm; in das sie in absehbarer Zeit einziehen könnte; mit dem sie einverstanden wäre; und, kein unwesentlicher Aspekt, einem Heim, das nicht zu teuer war. Das waren sehr viele Bedingungen. Zuvor hatte meine Mutter davon geträumt, in die Nähe von Rochefort im Südwesten Frankreichs zu ziehen, wo mein jüngster Bruder mit Frau und zwei Kindern lebt, da meine Mutter ihre Enkel sehr liebte. Ich scherzte: »Du willst also eine Demoiselle von Rochefort werden!« Ich weiß nicht, ob sie den Film Les demoiselles de Rochefort von Jacques Demy gesehen hatte, aber den Titel hatte sie sicher schon einmal gehört. Auch das berühmte Lied, das Catherine Deneuve und Françoise Dorléac im Film singen (beziehungsweise mimisch darstellen, denn die Gesangsszenen sind synchronisiert), kannte sie bestimmt: »Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux …« Meine Mutter lachte: »Du kannst so albern sein!« Man muss sagen, dass die Idee bei meinem Bruder auf keine große Begeisterung gestoßen war und er ihr zu verstehen gegeben hatte, dass seine Arbeit ihn voll in Anspruch nahm und er keine Zeit hätte, sie zu besuchen, geschweige denn, sich um sie zu kümmern. Und was die Enkel anging, hatte meine Mutter sich Illusionen über ihre Zuneigung gemacht: Für die Kinder war ein Besuch bei der Oma eine lästige Pflicht, zu der sie sich nur selten überreden ließen. Das alles wurde nicht in dieser Härte gesagt, aber irgendwann war die Idee vom Tisch.
Mein großer Bruder, der mit seiner Lebensgefährtin in Belgien in der Nähe von Charleroi wohnt, schlug meiner Mutter vor, zu ihnen zu ziehen. Das wollte sie auf keinen Fall: In dem Haus war es zu unruhig – die Söhne und Töchter der Lebensgefährtin kamen ständig mit ihren Kindern vorbei, es gab mehrere Hunde, also viel Trubel, viel zu viel Trubel … Sie würde es nicht ertragen, in solch einem Lärm zu leben. Außerdem war sie schon mehrmals dort zu Besuch gewesen und fand die Gegend trist. »Potthässlich ist es da«, erklärte sie mir, neben den persönlicheren Argumenten. Ich übersetzte: Es hatte sie große Anstrengung gekostet, aus den ärmeren Wohngegenden und Arbeitervierteln, in denen sie lange gelebt hatte, wegzukommen, da wollte sie nicht zurück in eine »Zechensiedlung«, wie es sie überall in der Wallonie und in Nordfrankreich am Rand der Städte gibt, nicht zurück zu den dicht an dicht stehenden Reihenhäusern, die alle gleich aussahen und in denen heutzutage die prekarisierten Bevölkerungsschichten leben und früher die Bergleute und Fabrikarbeiter wohnten. Zola hat diese Siedlungen zum unvergesslichen Schauplatz seines Romans Germinal gemacht.
Ich schlug meiner Mutter vor, im Großraum Paris nach einem Heim für sie zu suchen. Sie wollte nichts davon wissen. Offenbar hatte sie die Idee mit Rochefort längst vergessen, denn sie brachte ein so seltsames wie unwiderlegbares Argument vor: »Ich bin in Reims zu Hause.« Ich versuchte es weiter: »Wenn du in Paris oder einem Vorort wohnen würdest, könnte ich dich öfter besuchen.« Ich malte mir die Situation bereits aus. Nicht weit von meiner Wohnung gibt es ein Seniorenheim, dessen schmutzig weiße Fassade dringend gestrichen werden müsste, dessen Foyer aber von außen sehr einladend wirkt. Oft beobachte ich an der Straßenecke eine Szene, die sich bei schönem Wetter fast jeden Tag zu wiederholen scheint: Ein sehr alter Mensch, fast immer eine Frau, hat an einem der Tische vor dem Café Platz genommen, ein Gehstock lehnt an dem Stuhl, und gegenüber sitzt ein Mann oder eine Frau aus der nachfolgenden Generation, vermutlich der Sohn oder die Tochter. Man kann sich denken, wer die beiden sind. Eine Bewohnerin des Altenheims, die sich noch fortbewegen kann, und sei es nur ein paar Dutzend Meter, hat das Gebäude in Begleitung eines ihrer Kinder verlassen, um einen Saft oder Tee zu trinken und sich ein wenig zu sonnen. Und genauso würde ich dann mit meiner Mutter nachmittags vor diesem Café sitzen oder vor einem ähnlichen in einem anderen Stadtteil, nachdem ich sie besucht und ihr vorgeschlagen hätte, ein paar Schritte zu gehen, damit sie das schöne Wetter genießen konnte und für kurze Zeit noch einmal mit der Außenwelt und der Betriebsamkeit der Stadt in Kontakt kam.
Meine Mutter blieb stur: »Ich bin in Reims zu Hause.« Fürchtete sie, in Paris noch einsamer zu sein als in Reims, abgeschnitten von den wenigen Bekannten und Verwandten, die sie noch hatte, nachdem so viele um sie herum gestorben waren und sie sich mit anderen zerstritten hatte, vor allem mit den Schwestern meines Vaters, denen sie in einem ihrer berüchtigten Wutanfälle schreckliche Dinge an den Kopf geworfen hatte, woraufhin diese den Kontakt abgebrochen hatten? In Wahrheit war sie unsterblich verliebt und fand den Gedanken unerträglich, den Mann, für den sie so rettungslos, so obsessiv schwärmte, nicht mehr wiederzusehen (darauf werde ich später noch einmal zurückkommen). Wenn sie schon nicht bei ihren Enkeln in Rochefort sein konnte, wollte sie zumindest in der Nähe des Mannes bleiben, der sie in den letzten Jahren glücklich gemacht hatte. Ohnehin erwiesen sich die Dinge in Paris als kompliziert, denn nach einigen Erkundigungen stellte sich heraus, dass die Wartelisten lang waren und die Preise abschreckend hoch: Sie lagen deutlich über den finanziellen Möglichkeiten meiner Mutter und auch deutlich über unseren kollektiven finanziellen Möglichkeiten. Vielleicht hätte ich in einem Vorort von Paris ein preiswerteres Heim finden können, aber da meine Mutter nicht aus ihrer Region wegwollte, war es sinnlos, systematisch danach zu suchen. Folglich blieb nur Reims oder die nähere Umgebung. Im Zentrum von Reims sah es schlecht aus: Die Plätze waren rar, erzählte mir mein Bruder nach mehreren Versuchen, und die Wartezeiten lang, zwei bis drei Jahre. Also blieb nur Fismes, das EHPAD in Fismes. Ein umgebautes, restauriertes ehemaliges Krankenhaus, vorne ein hübsches altes Gebäude mit einer Fassade aus Sand- und Backsteinen, überragt von einem kleinen Glockenturm, dahinter erst kurz zuvor fertiggstellte moderne Neubauten mit Innenhöfen und Rasenflächen.
EHPAD ist die Abkürzung für Établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes, Einrichtung zur Unterbringung hilfsbedürftiger alter Menschen. Ein Pflegeheim also. Meine Mutter war mit Sicherheit ein »hilfsbedürftiger alter Mensch«. Mittlerweile erforderte ihr Gesundheitszustand eine Betreuung rund um die Uhr.
2
Ich hatte meiner Mutter versprochen, dass ich an ihrem ersten Tag im Heim da sein würde. Um nach Fismes zu gelangen, musste ich zunächst den Zug von Paris nach Reims nehmen: Ich habe kein Auto, nicht einmal einen Führerschein, was, wie ich immer wieder feststelle, unter Pariser Schwulen ein verbreitetes Phänomen ist. »Die gleichen Ursachen haben die gleichen Wirkungen«, machte sich eine Freundin früher über die Tatsache lustig, dass keiner der Schwulen in ihrer Bekanntschaft Auto fahren konnte. Mit dem TGV war die Fahrt nicht lang: fünfundvierzig Minuten. Als ich nach Paris gezogen war, dauerte sie noch viel länger, anderthalb Stunden, dafür hatte man mehr vor der Landschaft, von den berühmten Weinbergen der Champagne und den malerischen Dörfern. Da die Regionalzüge Sommerpause hatten, nahm ich einen Bus des regionalen Verkehrsverbunds, der von Reims nach Soissons fuhr und unterwegs mehrere Zwischenhalte einlegte, unter anderem in Fismes; dort war ich vor dem Altersheim, in dem meine Mutter von nun an leben würde, mit einem meiner (jüngeren) Brüder, der ein Auto gemietet hatte, und mit meiner Mutter verabredet.
Ich traf vor ihnen ein und wartete eine Viertelstunde. Als der Mietwagen mit meinem Bruder am Steuer durchs Tor fuhr und vor dem Empfangsbüro zum Halten kam, ließ meine Mutter das Fenster herunter, um mich zu begrüßen: Sie weinte. Verzweiflung hatte sie gepackt. Zwischen zwei Schluchzern konnte sie kaum sprechen. Mein Herz zog sich zusammen. Was taten wir ihr an?
Mein Bruder hatte alles, was meine Mutter brauchte oder behalten wollte, in das Auto geladen: neben ihrer Kleidung natürlich den Fernseher mit dem DVD-Player, das Radio mit dem CD-Player, ein paar Bücher und stapelweise Illustrierte, zwei Umzugskartons voller Fotos und ein paar Bilderrahmen mit Reproduktionen von Gemälden, die wir an den Wänden aufhängen wollten … Unsere Mutter sollte sich heimisch fühlen, denn, wie wir ihr im Laufe des Tages immer wieder sagten, hier wohnte sie jetzt, das war jetzt ihr »Zuhause«, wogegen sie resigniert protestierte: »Nein, das wird nie mein Zuhause sein«, dann: »Nein, das ist nicht mein Zuhause«, bevor sie es leid war, dass wir sie scheinbar nicht verstanden, und sagte: »Ja, ja, ich weiß, aber es ist nicht dasselbe.«
Zwei Pflegekräfte halfen meiner Mutter in einen Rollstuhl und schoben sie in ihr Zimmer, das sie, genau wie wir, zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Unser jüngster Bruder, der aus Rochefort, hatte das Heim zuvor besichtigt. Er hatte es für gut befunden. Die Heimleitung hatte gesagt, es werde sicher einige Monate dauern, bis ein Zimmer »frei« wird. Das kam uns lang vor, und wir verschwendeten keinen Gedanken daran, was eine kürzere Zeitspanne bedeutet hätte: dass ein anderer Mensch starb. Wenigstens würde unsere Mutter so die Möglichkeit haben, sich auf die radikale Veränderung in ihrem Leben vorzubereiten. Doch dann bekam mein Bruder bereits nach wenigen Wochen einen Anruf: Ein Zimmer war früher als erwartet »frei« geworden. Wenn wir es haben wollten, mussten wir sofort zusagen. Schließlich waren wir nicht die einzige Familie auf der Warteliste, bei Weitem nicht! Von da an ging alles sehr schnell.
Meine Mutter fühlte sich nicht bereit für den großen Schritt. Wäre das einige Monate später anders gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Erst sagte sie, sie habe es sich anders überlegt und wolle nicht mehr von zu Hause weg. Das war ein Reflex, eine Panikreaktion auf diese unmögliche, aber notwendige Entscheidung, die ihr mindestens genauso schwerfiel wie uns. Was antwortete man auf so etwas? Natürlich sollte sie das selbst entscheiden. Aber eine Lösung musste her: Sie konnte nicht mehr allein leben. Die Diskussion begann von vorn. »Du musst vernünftig sein, es geht nicht anders«, beharrte ich, als bringe es etwas, mit Vernunft gegen ihre beklemmende Angst zu argumentieren, die alles andere als irrational war. Sie antwortete: »Ich weiß, aber versteh doch …«
Oh ja! Ich verstand. Ich verstand sogar sehr gut. Aber wir mussten »vernünftig« sein. Nach einer Weile gab meine Mutter klein bei: »Du hast recht, ich muss vernünftig sein.«
Diese furchtbaren Sätze, mit denen man sich der Macht der Umstände unterwirft, verfolgen mich bis heute. Mir fiel ein, wie fieberhaft ich während meines Philosophiestudiums Descartes gelesen hatte und mit welcher Heftigkeit ich, geprägt vom Marxismus meiner Jugend, seinen moralischen Stoizismus abgelehnt hatte, weil er für mich eine Negierung jedes politischen Denkens und Handelns darstellte. Ich fand das Buch mühelos in meinem Regal, neben den anderen Werken Descartes', mit unzähligen Notizen und Unterstreichungen, so auch an folgender Stelle, einer der bekanntesten Passagen aus Discours de la méthode:
Mein dritter Grundsatz war, stets bemüht zu sein, eher mich zu besiegen als das Schicksal, eher meine Wünsche als die Ordnung der Welt zu verändern und mich überhaupt an den Glauben zu gewöhnen, dass nichts als unsere Gedanken ganz in unserer Macht sei, sodass, nachdem wir unser Bestes hinsichtlich der Dinge außerhalb von uns getan haben, alles, was uns zum Gelingen fehlt, in Hinsicht auf uns völlig unmöglich ist.
Daraus schließt Descartes:
[U]nd indem wir, wie man sagt, aus der Notwendigkeit eine Tugend machen, werden wir ebenso wenig wünschen, gesund zu sein, wenn wir krank sind, oder frei zu sein, wenn wir im Gefängnis sind, wie wir uns wünschen, einen Körper aus einem ebenso wenig zerstörbaren Material wie Diamanten oder Flügel zum Fliegen wie Vögel zu haben.[1]
Und nun machte ich gegenüber meiner Mutter eine extrem vereinfachte Version dieses »Grundsatzes« geltend, der mich früher abgestoßen hatte, ganz so, als hätte ich eingesehen, wie richtig und weise er war und in manchen Situationen auch unmittelbar einleuchtend, zum Beispiel in der Situation, in der wir feststeckten. Die Krankheit meiner Mutter war das hohe Alter, das Pflegeheim würde ihr »Gefängnis« sein, und sie musste sich von dem Wunsch nach Gesundheit und Freiheit verabschieden, denn sie war nicht mehr gesund und würde sich nie wieder frei bewegen, würde nie mehr frei entscheiden können.
Die »Ordnung der Welt«, im Fall meiner Mutter die Unausweichlichkeit des Älterwerdens, die Folgen der schweren körperlichen Arbeit und der damit einhergehenden Lebensbedingungen, die Realität moderner Familienstrukturen, die Geschichte von Wohnungsbau und Stadtplanung, der gesellschaftliche und politische Umgang mit Alter, Krankheit, Hilfsbedürftigkeit etc., all das also, was die Vergangenheit und Gegenwart einer Gesellschaft ausmacht, kam in diesem schicksalhaften Moment zusammen, in dem wir vor einer unaufschiebbaren Entscheidung standen, bedrängte uns, bedrängte meine Mutter, wischte ihre Bedürfnisse und Wünsche beiseite und machte jeden Widerstand und Handlungsspielraum zunichte. Daran sieht man, welches Gewicht historische und gesellschaftliche Determinierungen haben und wie sie bei einem banalen Gespräch zwischen zwei Menschen unterschwellig mitlaufen und ihm eine bestimmte Richtung geben können. Meine Mutter musste sich dem Unvermeidlichen fügen und konnte ihren Protest nur durch Tränen zum Ausdruck bringen. Ich kannte die Grenzen ihrer Willens- und Entscheidungsfreiheit, ihrer Handlungsfähigkeit: Diese Grenzen sind jedem von uns eingeschrieben, durch das, was uns ausmacht, durch das, was ich als »gesellschaftliches Urteil« bezeichnet habe. Ich kannte diese Grenzen sehr gut, sie waren mir vertraut, ich hatte sie nicht nur, wie wir alle, mein Leben lang am eigenen Leib erfahren, sondern sie auch in meinen Büchern beschrieben, entschlüsselt, analysiert. Dennoch gibt es in der Maschinerie der Zwänge immer etwas »Spiel«, einen Raum für individuelle und kollektive Transformationen, so klein und eng abgesteckt er wegen der Trägheit der Strukturen auch sein mag. Obgleich die Zwänge, die unsere Sehnsüchte begrenzen, äußerst mächtig sind – angefangen bei der Selbstbeschränkung dieser Sehnsüchte durch die Setzung von Lebenszielen, die von sozialer Zugehörigkeit und Herkunft (im weitesten Sinne) vorgegeben und beeinflusst sind, von Klasse, Geschlecht, Rassifizierung etc. sowie von dem ökonomischen, kulturellen und sozialen »Kapital«, über das wir verfügen oder nicht verfügen –, sind Determinanten und Determinierungen niemals absolut. Das versteht sich eigentlich von selbst, und wer meint, man könne den »Determinismus« kritisieren, indem man ihm diese naive Wahrheit entgegenstellt, nimmt weder die Realität großer historischer und gesellschaftlicher Veränderungen zur Kenntnis noch die Realität individueller beziehungsweise kollektiver Lebensverläufe im Kleinen, bei denen Permanenz und Transformation, Zwang und Freiheit immer miteinander einhergehen, nur in unterschiedlicher Kombination und mit unterschiedlichen Akzentuierungen, abhängig vom Individuum und von den Umständen. Die Gespräche mit meiner Mutter machten mir deutlich, dass Alter und körperliche Gebrechlichkeit einen Kontext darstellen – eine Fessel, ein »Gefängnis« –, der die Möglichkeit, seinem Schicksal, und sei es mit letzter Kraft, zu entfliehen, zunichtemacht: Man will vielleicht, aber man kann nicht mehr. Und weil man nicht mehr kann, will man irgendwann auch nicht mehr.
In Fukazawa Shichirōs Erzählung »Die Narayama-Lieder«, die in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts in einem japanischen Dorf spielt, werden alle Bewohner im Alter von siebzig Jahren auf einen Berg geschickt, um dort auf den Tod zu warten.[2] Sie müssen sich also an einen Ort zurückziehen, den sie nicht mehr verlassen, von dem sie nicht mehr zurückkehren werden. Der älteste Sohn trägt sie auf dem Rücken, die Alten halten sich an einem Brett fest oder sind daran festgebunden. Manche sind einverstanden oder haben sich ihrem Schicksal zumindest gefügt: Zum Sterben auf den Berg zu gehen, gehört zum Kreislauf des Lebens. Andere wehren sich und müssen gezwungen werden, manchmal sogar mit Gewalt. Man darf das Buch nicht als historisches oder ethnografisches Zeugnis lesen: Es handelt sich um ein fiktives Werk, um eine Parabel, nicht um die Beschreibung einer Realität. Der literarische Text (verfilmt 1958 von Keisuke Kinoshita und 1983 von Shōhei Imamura unter dem Titel Die Ballade von Narayama) ist eine Allegorie der gesellschaftlichen Ausgrenzung – und Absonderung – alter Menschen sowie eine Beschreibung der zwei möglichen Reaktionen der Betroffenen: Sie können entweder die Regeln befolgen, sich ihnen freiwillig unterwerfen und sich innerlich auf das, was sie erwartet, vorbereiten, oder aber die Regeln ablehnen, sich ihnen zu entziehen, ihnen zu entfliehen versuchen – nur um dann doch von ihnen eingeholt zu werden beziehungsweise von denjenigen, die die Regeln durchsetzen. Gewiss gibt es auch eine Mitte zwischen diesen beiden Polen oder fließende Übergänge: eine Resignation, die von kurzen Momenten des Aufbegehrens unterbrochen wird, eine strikte Weigerung, die mit der Zeit an Kraft verliert, geschwächt von der unleugbaren Tatsache, dass die Bewegungen immer schwerer fallen, eine Weigerung, die nach vielen Widerständen und Ausflüchten einer zaghaften Zustimmung Platz macht, einer halbherzigen, zögerlichen, traurigen Einwilligung.
Natürlich hat sich das Alter, in dem man die Reise antritt, nach hinten verschoben, das Holzbrett wurde vom Auto abgelöst, und es sitzt nicht mehr unbedingt der älteste Sohn am Steuer, aber ich kann meine Mutter und ihre Söhne – mich eingeschlossen – in eine Konstellation einordnen, die analog zu dieser symbolischen Erzählung funktioniert, die wir der japanischen Literatur zu verdanken haben. In dieser Konstellation ist das EHPAD in Fismes der Berg Narayama, und meine Mutter verkörpert nacheinander oder gleichzeitig die verschiedenen Reaktionen der alten Menschen (Ablehnung und Protest; Akzeptanz; Resignation und Unterordnung), während wir Brüder die verschiedenen Verhaltensweisen der Söhne verkörpern: so tun, als wäre es ein ehernes Gesetz, Teil der natürlichen Ordnung (ich erinnere mich, wie meine Urgroßmutter voller Fatalismus sagte: »Das ist der Lauf der Welt«, auch wenn ich als Kind nicht genau verstand, was sie damit meinte), und den Elternteil mit vernünftigen Argumenten und beharrlicher Überzeugungsarbeit dazu bewegen, sich dieser Tatsache, diesem Naturgesetz zu unterwerfen – mit sanfter Gewalt, die unsere Mutter aber natürlich trotzdem als Gewalt empfand. Sie war zur Unfreiheit verdammt. Was sie wollte, spielte keine Rolle mehr: Sie hatte ein paar Jahre herausgeschlagen, hatte den Einzug ins Heim um ein paar Monate oder Wochen hinauszögern können, aber gegen seine Alternativlosigkeit kam sie nicht an.
Da waren wir also. Durchs Fenster blickte man auf einen schmalen Rasenstreifen, der am Fuß einer Mauer endete. Jenseits der Mauer, die die Gebäude des Heims umgab, erstreckte sich eine ländliche Gegend mit kleinen Häusern, einer Straße, Bäumen und Feldern … Insgesamt eine hübsche Aussicht, zumindest für jemanden, der Spaziergänge unternehmen oder auch nur am Fenster stehen und in die Ferne schauen konnte. Aber was hatte meine Mutter davon, die bald weder zu dem einen noch zu dem anderen in der Lage sein würde?
Damit das Zimmer dem Ort, den sie am Morgen verlassen hatte, ähnelte, und sei es nur entfernt, hängten wir einige gerahmte Familienfotos und Gemäldereproduktionen aus ihrer Wohnung auf (ländliche Szenen und Bilder vom Meer, typisch für den Geschmack der Arbeiterklasse). Wir stellten den Fernseher (der viel zu groß für das Zimmer war) gegenüber vom Bett auf, den CD-Player daneben, räumten ihre Kleider und die anderen Habseligkeiten, die mein Bruder in einem großen Koffer transportiert hatte, in den Schrank. Er machte die ganze Zeit unpassende Kommentare, schimpfte leise vor sich hin: »Warum muss ich ihre Klamotten in den Schrank räumen, das ist Frauenarbeit.« Ich seufzte und dachte: »Was für ein Idiot«, reagierte aber lieber nicht. Die Situation war schon angespannt genug, da musste ich nicht auch noch einen Streit vom Zaun brechen, aber mir wurde wieder einmal bewusst, wie befremdlich und nahezu unerträglich das sein kann, was man gemeinhin »Familienbande« nennt. Was verband uns? Nichts. Rein gar nichts. Außer der Tatsache, dass wir hier waren, um uns um unsere Mutter zu kümmern, dass wir hier sein mussten. Wir liefen geschäftig im Zimmer hin und her. Sie lag auf dem Bett und fragte sich wahrscheinlich besorgt, wie ihr Leben jetzt, da sie, von der Außenwelt abgeschnitten, in diesem Zimmer im zweiten Stock wohnte, verlaufen würde. Sie wirkte erschöpft, wie gelähmt von all den Gefühlen, die sie überwältigten.
Mein Bruder fuhr zurück nach Reims zu seiner Frau und seinen Kindern (sie waren ein paar Tage vorher aus La Réunion im Indischen Ozean eingetroffen, wo sie leben), zurück in die Wohnung, die meine Mutter gerade erst verlassen hatte und in der noch ihre Möbel standen. Ich war erleichtert, als er ging. Ich konnte sein dummes Geschwätz nicht mehr hören. Zum Abschied sagte ich: »Lass es dir gut gehen. Bis bald.« Er antwortete sarkastisch: »Du meinst wohl, bis in dreißig Jahren?« Tatsächlich lag unser letztes Treffen dreißig Jahre zurück, und ich habe ihn seither nicht mehr wiedergesehen. Ich blieb bis zum späten Nachmittag allein bei meiner Mutter. Dann musste ich den letzten Bus nach Reims nehmen. Ich stellte fest, wie unpraktisch so ein Heim außerhalb der Stadt war. Ich hing von den Fahrplänen des regionalen Verkehrsverbundes ab, und abends fuhren keine Busse mehr. In Fismes gab es kein Hotel. Ich hatte mich danach erkundigt, für die nächsten Besuche, die ich meiner Mutter abstatten wollte: Bis vor Kurzem hatte ein Restaurant in der Nähe des Altenheims einige Zimmer vermietet, doch der Besitzer hatte den Hotelbetrieb vor sechs Monaten eingestellt. Diesmal hatte ich ohnehin vorgehabt, in Reims zu übernachten. Ich wollte die Gelegenheit nutzen und mir wieder einmal die Kathedrale ansehen, mit ihren legendären Statuen – dem lächelnden Engel –, mit ihrem erzbischöflichen Palast, in dem man die Krönungsinsignien und Festgewänder des französischen Königshauses besichtigen kann, und mit ihren Kirchenfenstern, denen von Knoebel aus den neunziger Jahren und denen von Chagall aus den Sechzigern. (Der Sohn des Glasermeisters, der die Chagall-Fenster gefertigt hatte, war in der Oberstufe in meine Klasse gegangen, und ich war sehr beeindruckt gewesen, man könnte fast sagen, ergriffen, als er mich und ein paar Mitschüler eines Tages in das große bürgerliche Haus in der Innenstadt eingeladen hatte, in dem er mit seinen Eltern wohnte, und uns Hefte mit Skizzen des berühmten Malers gezeigt hatte. Er lebte eindeutig in einer anderen Welt als ich; in meiner Familie war Kunst kein Thema, und niemand kannte Chagall.)
Auf dem Rückweg nach Reims fuhr der Bus erneut durch all die Orte, die ich mittlerweile gut kannte: Erst durch Muizon, wo meine Mutter und mein Vater zwanzig Jahre lang gewohnt hatten, dann durch weitere Dörfer und Ortschaften, durch mehr oder weniger dünn besiedelte Gebiete, vorbei an Feldern und Gewerbegebieten, in denen sich kleinere Betriebe, größere Fabriken und die Lagerhallen bekannter Firmen abwechselten, und schließlich durch Tinqueux, den Vorort von Reims, wo meine Mutter nach einem kurzen Intermezzo in der Innenstadt die vergangenen drei, vier Jahre gelebt hatte; in Reims hatte sie einige Monate in einer Sozialbausiedlung hinter dem Bahnhof gewohnt, nachdem sie aus ihrem Häuschen in Muizon hatte ausziehen müssen, aber dort hatte sie sich nicht wohlgefühlt, weil sie sich von dem Lärm der Jugendlichen auf der Straße und von den Autos, die spätabends in die Tiefgarage unter ihrem Fenster fuhren, belästigt fühlte (da auch ich die Stille liebe, konnte ich gut verstehen, wie sehr sie das störte). Noch schlimmer fand sie jedoch die hohe Anzahl von »Ausländern«, die in diesem neuen Viertel lebten, und es war sinnlos, mit ihr darüber diskutieren zu wollen, weil sie jedes Gespräch mit Sätzen wie diesem abwürgte: »Mir gefällt es hier nicht, man hat gar nicht mehr das Gefühl, in Frankreich zu sein.« Was soll man zu so etwas sagen? Sie bestand darauf, noch einmal umzuziehen. Also zog sie noch einmal um. In Tinqueux lebte sie gern. Trotzdem bedauerte sie, dass sie nicht nach Muizon hatte zurückkehren können, in dieses große Dorf, das sie sehr liebte und von dem sie voller Wehmut sprach. Dazu hätte das Wohnungsamt ihr allerdings ein einstöckiges Haus zuteilen müssen, da sie keine Treppen mehr steigen und deshalb kein zweistöckiges Haus beziehen konnte wie das, in dem sie früher gewohnt hatte, das Haus, das ich am Anfang von Rückkehr nach Reims beschreibe. Die Treppen waren im Übrigen auch der Grund gewesen, warum sie dort hatte ausziehen müssen. In Muizon gab es kein passendes Haus. Zumindest kein freies. Im Rathaus hieß es, man sei dabei, neue Häuser zu bauen. Doch das würde dauern, und meine Mutter hatte keine Zeit: Sie wollte schnell weg aus der Innenstadt von Reims, wo sie sich unwohl fühlte, sobald sie vor die Tür ging oder auch nur das Fenster aufmachte. Also wurde es Tinqueux. Dort bot man ihr eine Wohnung an, die ihr zusagte. Der Umzug setzte ihrem Abstecher nach Reims ein Ende: Sie empfand ihn als Rückkehr »nach Frankreich«, als Rückkehr »in die Heimat«, nach Monaten, die sie über einer Tiefgarage »unter Fremden« verbracht hatte. In Tinqueux bezog sie eine Wohnung im dritten Stock, aber zum Glück hatte das Haus einen modernen Aufzug. Und als sie dann nicht mehr allein in Tinqueux wohnen konnte, kam sie nach Fismes ins Heim: ein Ort, den sie wahrscheinlich ebenfalls als Exil empfand, als ein Leben »unter Fremden«, auch wenn der Modus der Fremdheit, an die sie sich gewöhnen musste, ein anderer war: Diesmal konnte sie nicht sagen, dass es ihr dort nicht gefalle und sie umziehen wolle. Es würde keinen weiteren Ortswechsel geben. Unwillkürlich fragte ich mich, wie viel Zeit ihr wohl noch blieb, schob den Gedanken aber immer sofort beiseite; wie lange sie wohl in diesem Heim wohnen würde, in diesem Zimmer; über welchen Zeitraum hinweg ich sie an diesem Ort, den wir für sie ausgesucht hatten, besuchen würde. Damals rechnete ich mit mehreren Jahren. Würde sie die Kraft haben, die Energie aufbringen, sich dort einzuleben? Wie würde ihr Alltag organisiert sein, wie würde ihr Tagesablauf aussehen, an diesem Ort, an dem sie für den Rest ihres Lebens – man kann es leider nicht anders sagen – eingesperrt sein würde? Ich nahm mir vor, so oft wie möglich zu ihr zu fahren, damit sie sich nicht allzu allein fühlte. Ich bereitete mich gedanklich darauf vor. Meine Überlegungen sahen so aus: »Einmal im Monat ist nicht genug; einmal die Woche wäre ideal, ist aber nicht realistisch …« Der Gedanke, in Zukunft öfter nach Fismes zu fahren, missfiel mir nicht: Wenn ich meine Mutter zuvor in Muizon oder Tinqueux besucht hatte, hatte ich diese Kurzaufenthalte immer als sehr angenehm empfunden, die Zugfahrt nach Reims, wo ich zwei, drei Nächte blieb, die Stadt mit ihren mir einst so vertrauten Straßen und Plätzen, mit ihren Sehenswürdigkeiten, Cafés und Restaurants. Wenn Geoffroy, mein Lebensgefährte, mich begleiten konnte, zeigte ich ihm meine Lieblingsorte: die Kapelle von Foujita, die Art-déco-Gebäude, die Abtei Saint-Remi, die traditionellen Brasserien rings um die Markthallen (und abends die Champagnerbars, falls wir uns von einem allzu deprimierenden Nachmittag bei meiner Mutter erholen mussten). Genauso würde es sein, wenn ich sie in Fismes besuchen ging. Für mich änderte sich nur der Name ihres Wohnorts. Für sie änderte sich alles.
Die ganze Busfahrt über blickte ich aus dem Fenster. Unzählige Fragen, auf die ich keine Antwort wusste, Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart, so viele Ungewissheiten schwirrten mir im Kopf herum, prallten aufeinander. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich war verwirrt und traurig. Und ich sagte mir, dass ich Das Alter von Simone de Beauvoir und Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen von Norbert Elias noch einmal lesen sollte, um die Situation besser zu verstehen und besser darauf reagieren zu können.[3]
Die Endhaltestelle in Reims befand sich auf einem Platz, der als Busbahnhof dient, keine hundert Meter hinter der Kathedrale. Die Apsis von Notre-Dame de Reims im Sonnenuntergang: was für ein grandioser Anblick in einem so dunklen Moment!
Beim Abschied von meiner Mutter hatte ich zu ihr gesagt: »Morgen komme ich wieder.« Am nächsten Tag legte ich den Weg von Reims nach Fismes in umgekehrter Richtung zurück, wieder mit dem Bus, um den Nachmittag mit ihr zu verbringen. Ich öffnete die beiden Kartons mit Fotos, die mein Bruder am Vortag hergebracht hatte. Als er sie mir gezeigt hatte, hatte er in einem Ton, den ich, vielleicht zu Unrecht, als unterschwellig aggressiv oder zumindest verächtlich empfunden hatte, gesagt: »Da sind Schätze für dich drin, für dein nächstes Buch.« Jetzt holte ich die Fotos hervor – ich hatte sie natürlich noch nie gesehen – und zeigte sie meiner Mutter. Sie kommentierte die Bilder: »Das bin ich mit deinem Vater, in der Türkei.« – »Da sind wir in Tunesien.« Es hatte sich um Gruppenreisen gehandelt, organisiert vom Betriebsrat der Fabrik, in der mein Vater arbeitete oder gearbeitet hatte (meine Eltern konnten das Angebot nach seinem Renteneintritt weiter nutzen): Auf den Fotos sieht man sie oft mit der Reisegruppe beim Abendessen in einem Restaurant. Neben den Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten gab es auf diesen Touren immer ein gemeinsames Abendessen mit Musik und Animation. Auf einer Reise nach Andalusien hatte in Granada ein Gitano[4] , der in einem Restaurant Gitarre spielte, zu meiner Mutter gesagt: »Du bist eine von uns, das weiß ich.« Sie wusste es auch, denn sie erzählte immer mit einem gewissen Stolz von ihrer Gitano-Herkunft, obwohl sie sonst so rassistisch war.
Es wurde spät. Ich musste los: der letzte Bus! Ich versprach, bald wiederzukommen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich würde die nächsten Wochen in Italien verbringen. Der Aufenthalt war seit Langem geplant, ich hatte alles zu einer Zeit reserviert, als ich noch glaubte, der Umzug ins Altenheim würde erst Monate später anstehen. Ich konnte den Urlaub schwer absagen, vor allem, da ich nicht allein reiste.
Natürlich würde ich meine Mutter gleich nach meiner Rückkehr besuchen gehen.





























