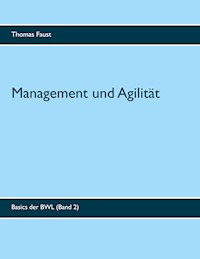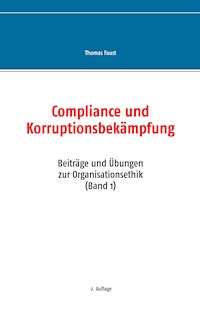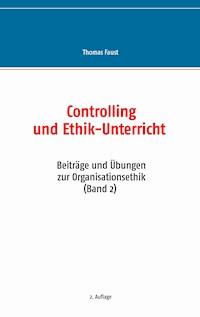Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch gibt einen Überblick über grundlegende Zusammenhänge der Betriebswirtschaftslehre. Vor allem werden die Themen Businessplan, Zielbildung, Rechtsform- und Standortwahl, Leistungserstellung, Kooperation, Unternehmenssanierung und Liquidation behandelt. Komplettiert wird das Buch durch Übungsaufgaben mit Lösungs- und Literaturhinweisen sowie durch ein kleines BWL-Lexikon und ein ausführliches Stichwortverzeichnis. Das Buch wendet sich an Lehrende und Lernende an - Akademien, - Wirtschaftsgymnasien, - Berufskollegs und - (Fach-)Hochschulen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis:
Der Autor geht davon aus, dass die Angaben, Daten und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Jedoch übernimmt der Autor keinerlei Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Ferner übernimmt der Autor keinerlei Gewähr für den Inhalt der Websites, auf die in diesem Buch verwiesen wird.
Wenn Warenbezeichnungen, Gebrauchs- und Handelsnamen etc. in diesem Werk wiedergegeben werden, dann berechtigt dies auch ohne eine besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen und Namen als frei im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Vorwort
Betriebswirtschaftliche Basiskenntnisse zählen zunehmend zum allgemeinen Grundwissen. So werden z. B. in vielen Medienberichten Betriebswirtschaftskenntnisse oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Zudem finden Fachbegriffe wie „Joint Venture“ und „Shareholder Value“ immer mehr Einzug in das Alltagsleben.
Aber auch in Schule und Studium erhält die Betriebswirtschaftslehre seit Jahren ein stärkeres Gewicht. So eilt die Zahl der BWL-Studierenden an Akademien und Hochschulen von Rekord zu Rekord. Und in der Berufsbildung stellt die Betriebswirtschaftslehre traditionell in vielen Bereichen ein Kernfach dar.
Nicht zuletzt hängt der berufliche Erfolg zunehmend von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Kompetenzen ab. So sind auch Mediziner, Ingenieure, Juristen und Naturwissenschaftler gefordert, ökonomische Aspekte bei ihrem täglichen Handeln zu berücksichtigen. Dies gilt für sämtliche Hierarchiestufen – unabhängig, ob als Sachbearbeiter, Abteilungsleiter oder als Geschäftsführer.
Vor diesem Hintergrund vermittelt das vorliegende Buch wichtige, einführende Grundlagen über das Wirtschaften von Betrieben bzw. Unternehmen. Dies geschieht in einer kompakten und strukturierten Form. Hierdurch empfiehlt sich das Buch insbesondere auch für eine gezielte Prüfungsvorbereitung. Dabei ist das Buch sowohl in einer Print-Version als auch in einem elektronischen Format verfügbar.
Der Aufbau dieses Buchs stellt sich folgendermaßen dar: Im ersten Kapitel wird zunächst die Einordnung der BWL in das System der Wissenschaften behandelt. Ferner werden betriebliche Aufgabenbereiche, Unternehmensabläufe sowie die unterschiedlichen Zielsetzungen von Betrieben thematisiert. Nicht zuletzt sollen die unternehmerische Leistungserstellung und verschiedene betriebswirtschaftliche Grundsätze fokussiert werden.
Das zweite Kapitel beleuchtet zunächst die Gründungsphase von Unternehmen. Sodann werden konstitutive Entscheidungen, vor allem zu Rechtsform, Standort, Leistungsprogramm und Unternehmensverbindungen dargestellt. Abschließend sollen die Entwicklung, die Krise und die Liquidation von Unternehmen behandelt werden.
Zur Übung und Vertiefung finden sich zu den beiden Kapiteln zahlreiche Fragen mit Lösungs- und Literaturhinweisen. Beispiele, Abbildungen und ein ausführliches Stichwortverzeichnis helfen dabei, die Zusammenhänge zu verstehen. Nicht zuletzt enthält das Buch ein kleines BWL-Lexikon, in dem über 170 wichtige Fachbegriffe erläutert werden. Auf dieser Basis können Leser einen zielgerichteten, erfolgreichen Einstieg in die Betriebswirtschaftslehre finden.
Generell werden in diesem Buch wichtige Schlüsselbegriffe in Fettdruck hervorgehoben. Und aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form verwendet. Der Autor legt Wert auf die Feststellung, dass hiermit sämtliche Geschlechter einbezogen werden.
Weitere Bände der Buchreihe Basics der BWL befinden sich derzeit in Vorbereitung. Sie werden sich den übrigen betriebswirtschaftlichen Feldern zuwenden – ebenfalls in einer kompakten und strukturierten Form.
Für Fragen und konstruktive Anregungen ist der Autor jederzeit dankbar. Eine Kontaktaufnahme kann gern über die folgende E-Mail-Adresse erfolgen: tf100[at]gmx[dot]net
Frankfurt am Main, April 2019
Thomas Faust
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Grundlagen der Betriebswirtschaft
1.1 Lernziele dieses Kapitels
1.2 Wirtschaftswissenschaften
1.2.1 Volkswirtschaftslehre
1.2.2 Betriebswirtschaftslehre
1.3 Wirtschaftseinheiten
1.3.1 Betriebe und Unternehmen
1.3.2 Haushalte
1.3.3 Non-Profit-Organisationen
1.4 Ziele von Unternehmen
1.4.1 Grundlagen
1.4.2 Monetäre und nicht-monetäre Ziele
1.4.3 Ober-, Zwischen- und Unterziele
1.4.4 Formal- und Sachziele
1.4.5 Zielbeziehungen
1.5 Abläufe und Aufgabenbereiche
1.5.1 Betriebliche Prozesse
1.5.2 Betriebliche Funktionen
1.6 Betriebliche Leistungserstellung
1.6.1 Produktionsfaktoren und -ergebnisse
1.6.2 Produktivität
1.7 Betriebswirtschaftliche Grundsätze
1.7.1 Wirtschaftlichkeit
1.7.2 Rentabilität und Liquidität
1.8 Zusammenfassung der Lerninhalte
1.9 Fragen zur Übung und Vertiefung
1.10 Weiterführende Literatur
Unternehmensgründung und -entwicklung
2.1 Lernziele dieses Kapitels
2.2 Unternehmensgründung
2.2.1 Gründungsmotive
2.2.2 Geschäftsidee
2.2.3 Geschäftsmodell
2.2.4 Businessplan
2.3 Rechtsformen von Unternehmen
2.3.1 Einzelunternehmen
2.3.2 Personengesellschaften
2.3.3 Kapitalgesellschaften
2.3.4 Sonstige privatrechtliche Rechtsformen
2.3.5 Öffentliche Unternehmen und Wirtschaftsbetriebe
2.4 Unternehmensstandort und Aktionsradius
2.4.1 Standortfaktoren
2.4.2 Geografische Ausrichtung
2.5 Betrieblicher Leistungsprozess
2.5.1 Ressourcenbeschaffung
2.5.2 Leistungserstellung
2.5.3 Angebotspalette
2.6 Unternehmensverbindungen
2.6.1 Unternehmenszusammenschlüsse
2.6.2 Unternehmensverbände
2.6.3 Kammern
2.7 Unternehmensentwicklung
2.7.1 Entwicklungsfaktoren
2.7.2 Entwicklungsrichtungen
2.8 Unternehmenskrise
2.8.1 Sanierung
2.8.2 Insolvenz
2.9 Unternehmensliquidation
2.9.1 Grundlagen
2.9.2 Verfahren
2.10 Zusammenfassung der Lerninhalte
2.11 Fragen zur Übung und Vertiefung
2.12 Weiterführende Literatur
Kleines BWL-Lexikon
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Abkürzungsverzeichnis
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
AKV
Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung
AO
Abgabenordnung
ARGE
Arbeitsgemeinschaft
BAB
Betriebsabrechnungsbogen
BDA
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BSC
Balanced Scorecard
BWL
Betriebswirtschaftslehre
bzw.
beziehungsweise
CEO
Chief Executive Officer
DCGK
Deutscher Corporate Governance Kodex
d. h.
das heißt
DHKT
Deutscher Handwerkskammertag
DIHK
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
eG
eingetragene Genossenschaft
e. K.
eingetragener Kaufmann
EStG
Einkommensteuergesetz
etc.
et cetera
EUR
Euro
e. V.
eingetragener Verein
f.
folgende
ff.
fortfolgende
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GenG
Genossenschaftsgesetz
ggf.
gegebenenfalls
GKV
Gesamtkostenverfahren
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG
Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB
Handelsgesetzbuch
HRM
Human Resource Management
Hrsg.
Herausgeber
IAS
International Accounting Standards
IFRS
International Financial Reporting Standards
IG
Interessengemeinschaft
IHK
Industrie- und Handelskammer
InsO
Insolvenzordnung
IT
Informationstechnologie
KG
Kommanditgesellschaft
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KLR
Kosten- und Leistungsrechnung
KMU
Kleine und mittelgroße Unternehmen
LKW
Lastkraftwagen
M&A
Mergers & Acquisitions
Mio.
Millionen
Mrd.
Milliarden
NGO
Non-Governmental-Organisation
NPO
Non-Profit-Organisation
o. g.
oben genannt
OHG
Offene Handelsgesellschaft
PartGG
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PKS
Planungs- und Kontrollsystem
PKW
Personenkraftwagen
PR
Public Relations
PublG
Publizitätsgesetz
RAP
Rechnungsabgrenzungsposten
ROI
Return on Investment
S.
Seite
s. o.
siehe oben
s. u.
siehe unten
u. a.
unter anderem
UKV
Umsatzkostenverfahren
UmwG
Umwandlungsgesetz
US
United States
USP
Unique Selling Position
usw.
und so weiter
VAG
Versicherungsaufsichtsgesetz
vs.
versus
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VWL
Volkswirtschaftslehre
z. B.
zum Beispiel
ZDF
Zweites Deutsches Fernsehen
1 Grundlagen der Betriebswirtschaft
1.1 Lernziele dieses Kapitels
In diesem Kapitel erfahren Sie zunächst, womit sich die Betriebswirtschaftslehre befasst und wie sie in das System der (Wirtschafts-)Wissenschaften eingeordnet ist. Sodann wird erläutert, was Unternehmen, Betriebe, Haushalte und Non-Profit-Organisationen sind.
Ferner lernen Sie, welche unterschiedlichen Arten von Zielen diese Wirtschaftseinheiten verfolgen. Außerdem soll gezeigt werden, welche Aufgabenbereiche (Funktionen) und Abläufe (Prozesse) es in Unternehmen gibt. Nicht zuletzt lesen Sie, wie betriebliche Leistungserstellung erfolgt und was betriebswirtschaftliche Grundsätze sind.
Im Einzelnen ist Ihr Lerninhalt des ersten Kapitels in folgender Weise gegliedert:
1.
Grundlagen der Betriebswirtschaft
1.1 Lernziele dieses Kapitels
1.2 Wirtschaftswissenschaften
1.2.1 Volkswirtschaftslehre
1.2.2 Betriebswirtschaftslehre
1.2.2.1 Strömungen in der BWL
1.2.2.2 Nachbardisziplinen der BWL
1.3 Wirtschaftseinheiten
1.3.1 Betriebe und Unternehmen
1.3.1.1 Privatwirtschaftlicher Sektor
1.3.1.2 Öffentlicher Sektor
1.3.1.3 Fazit
1.3.2 Haushalte
1.3.3 Non-Profit-Organisationen
1.4 Ziele von Unternehmen
1.4.1 Grundlagen
1.4.2 Monetäre und nicht-monetäre Ziele
1.4.3 Ober-, Zwischen- und Unterziele
1.4.4 Formal- und Sachziele
1.4.5 Zielbeziehungen
1.5 Abläufe und Aufgabenbereiche
1.5.1 Betriebliche Prozesse
1.5.2 Betriebliche Funktionen
1.6 Betriebliche Leistungserstellung
1.6.1 Produktionsfaktoren und -ergebnisse
1.6.2 Produktivität
1.7 Betriebswirtschaftliche Grundsätze
1.7.1 Wirtschaftlichkeit
1.7.2 Rentabilität und Liquidität
1.8 Zusammenfassung der Lerninhalte
1.9 Fragen zur Übung und Vertiefung
1.10 Weiterführende Literatur
1.2 Wirtschaftswissenschaften
Zur Einführung soll zunächst skizziert werden, wie die Betriebswirtschaftslehre (BWL) in das System der Wissenschaften bzw. Wirtschaftswissenschaften eingeordnet ist.
So zeigt die obige Abbildung, dass sich die Wissenschaften untergliedern lassen in
die Formalwissenschaften (z. B. Logik, Mathematik) und
die Realwissenschaften (Erfahrungswissenschaften).
Zu den Realwissenschaften wiederum zählen die Naturwissenschaften (z. B. Physik, Chemie, Biologie) und die Sozialwissenschaften. Diesem Bereich der Sozialwissenschaften werden die Psychologie, die Soziologie und die Wirtschaftswissenschaften zugeordnet. Ebenso wie die Volkswirtschaftslehre (VWL) gilt die Betriebswirtschaftslehre als ein Teil dieser Wirtschaftswissenschaften (Ökonomie).
Der Betrachtungsgegenstand der Ökonomie ist die Wirtschaft. Dies ist jener Bereich, in dem ein zweckmäßig gestalteter Tausch knapper Güter, also beschränkt verfügbarer Produkte und Dienstleistungen, stattfindet. Dieser rationale Gütertausch ist erforderlich, da die Wirtschaftswissenschaften prinzipiell von unbegrenzten Bedürfnissen des Menschen ausgehen.
Nach dieser Sichtweise ist hinsichtlich freier Güter ein rationales Wirtschaften nicht erforderlich. Denn diese Güter sind grundsätzlich unbegrenzt verfügbar. Zu diesen freien Gütern werden in den Wirtschaftswissenschaften z. B. Wind, Sonnenlicht, Meer- und Regenwasser gezählt.
Allerdings bewirken Umweltprobleme, wachsende Bedürfnisse und die zunehmende Weltbevölkerung, dass freie Güter immer mehr zu knappen Gütern werden. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens eine zunehmende Relevanz. Hierauf wird in dieser Buchreihe noch zurückzukommen sein.
1.2.1 Volkswirtschaftslehre
Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften beleuchtet die VWL vor allem gesamtwirtschaftliche Phänomene und Zusammenhänge. Im englischsprachigen Raum wird für die VWL der Begriff „Economics“ verwendet.
Ihren Ursprung hat die VWL in der Philosophie der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Noch bis zum 19. Jahrhundert wurde sie im deutschsprachigen Raum als Nationalökonomie bezeichnet. Die VWL kann hierzulande damit auf eine deutlich längere Historie als die BWL zurückblicken.
Im Allgemeinen wird die VWL zumeist in die folgenden vier Bereiche gegliedert.
Volkswirtschaftslehre
Makroökonomik
Mikroökonomik
Ökonometrie
Finanzwissenschaft
Die Makroökonomik untersucht wirtschaftliche Größen auf einer aggregierten Ebene (z. B. in einem Bundesland, in der Europäischen Union). Zu diesen Größen zählen Inflation, Beschäftigungsniveau, Volkseinkommen, Wirtschaftswachstum, Zinsniveau, Geldvolumen, Zahlungsbilanz und Wechselkurse.
Demgegenüber analysiert die Mikroökonomik die Aktivitäten und Beziehungen der einzelnen Wirtschaftssubjekte (insbesondere Haushalte und Unternehmen). Auf dieser Basis hat die Mikroökonomik eine Reihe von Modellen entworfen, die das Verhalten dieser Wirtschaftssubjekte erklären und voraussagen können.
Zunehmend bedeutsam wird die Zusammenführung dieser mikro- und makroökonomischen Analysen. So hat die Ökonometrie zum Ziel, eine quantitative, zumeist empirische Untersuchung des gesamten Wirtschaftsgeschehens vorzunehmen. Dazu sammelt, analysiert und interpretiert sie Daten über die Wirtschaftssubjekte.
Nicht zuletzt beschäftigt sich die Finanzwissenschaft mit der Wirtschaftstätigkeit des öffentlichen Sektors. Hierbei haben die Theorie und Praxis der Staatsausgaben, der Besteuerung und der Staatsverschuldung eine zentrale Bedeutung.
Insgesamt versucht die VWL auf Basis ihrer Analysen und Berechnungen auch, konkrete Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik zu geben. Ziel dabei ist, praxisbezogene Impulse für die Gestaltung ökonomisch-gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu liefern.
1.2.2 Betriebswirtschaftslehre
Wie ausgeführt gehört auch die BWL zum Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Sie befasst sich insbesondere mit der Analyse und Steuerung kleinerer Wirtschaftseinheiten. Diese werden als Betriebe bzw. als Unternehmen bezeichnet. Im englischsprachigen Raum wird für die BWL der Begriff „Business Administration“ verwendet.
Hierzulande ist die BWL erklärtermaßen eine relativ junge Disziplin; sie ist vor allem deutlich neuer als die VWL. So entwickelte sich die BWL erst ab dem Beginn des 20. Jahrhundert. Eine wichtige Initialzündung hierfür war die Gründung mehrerer Handelshochschulen, etwa in Leipzig, Köln, München und Frankfurt am Main.
In der Zwischenzeit ist die BWL zu einem der beliebtesten Ausbildungs- und Studiengänge in Deutschland geworden. So werden ihre Absolventen in nahezu allen Funktionen, Wirtschaftszweigen und Unternehmensbereichen eingesetzt.
1.2.2.1 Strömungen in der BWL
Die Betriebswirtschaftslehre stellt sich nicht als ein monolithisch festgefügter Block dar. So können innerhalb der hiesigen BWL drei wichtige Strömungen unterschieden werden: die Funktionale, die Institutionelle und die Genetische BWL.
Betriebswirtschaftslehre
Funktionale BWL
auf betriebliche Aufgabenbereiche fokussiert
Institutionelle BWL
auf einzelne Wirtschaftszweige ausgerichtet
Genetische BWL
am „Lebenslauf“ von Unternehmen orientiert
Die Funktionale Betriebswirtschaftslehre wendet sich einzelnen betrieblichen Aufgabenbereichen (Funktionen) zu. Hierzu zählen vor allem Beschaffung, Produktion und Absatz sowie Finanzierung, Investition, Organisation, Management, Personal- und Rechnungswesen.
Ferner haben sich verschiedene Wirtschaftszweiglehren bezüglich einzelner Branchen herausgebildet (Institutionelle Betriebswirtschaftslehre). Hierzu gehören z. B. die Immobilienwirtschaft, das Sportmanagement, die öffentliche Betriebswirtschaftslehre, die Bank-, die Handels- und die Industriebetriebslehre.
Schließlich befasst sich die Genetische Betriebswirtschaftslehre mit dem „Lebenslauf“ von Unternehmen. So starten die Betrachtungen bei der Gründung, sie setzen sich fort über die Entwicklungs- bzw. die Krisenphase, und sie enden bei der Liquidation von Unternehmen. Das zweite Kapitel dieses Buchs wird dieser Sichtweise weitgehend folgen.
1.2.2.2 Nachbardisziplinen der BWL
In der BWL geht es also um komplexe, vielschichtige Phänomene. Es dreht sich dabei vor allem um wirtschaftliche Fragen.
Aber es werden z. B. auch juristische, technische, soziologische und psychologische Themen berührt. Letztgenannte Felder gehören an sich zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Aus Sicht der BWL sind dies Nachbarwissenschaften. Hierzu zählen vor allem die Mathematik, Ingenieurwissenschaft, Soziologie, Informatik und die Rechtswissenschaft. Auf die zunehmenden Verflechtungen der BWL mit ihren Nachbardisziplinen weisen z. B. die Fächer Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftsmathematik hin.
Psychologie
Ingenieurwissenschaft
Mathematik
Betriebswirtschaftslehre
Rechtswissenschaft
Informatik
Soziologie
Schließlich stehen auch betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Phänomene nicht isoliert nebeneinander. Vielmehr sind Unternehmensentscheidungen und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen in wechselseitigem Zusammenhang zu sehen. So kann etwa die Investitionsentscheidung eines Großunternehmens die wirtschaftliche Entwicklung einer ganzen Region beeinflussen. Und umgekehrt tangiert z. B. ein geändertes Zinsniveau die Investitionsentscheidungen eines Unternehmens in erheblichem Maße.
1.3 Wirtschaftseinheiten
In diesem Abschnitt sollen die Wirtschaftseinheiten beleuchtet werden, mit denen sich die BWL hauptsächlich beschäftigt. So werden Betriebe, Unternehmen, Haushalte und Non-Profit-Organisationen im Folgenden näher betrachtet.
Wirtschaftseinheiten
Betriebe, Unternehmen
Haushalte
Non-Profit-Organisationen
1.3.1 Betriebe und Unternehmen
Der schwerpunktmäßige Fokus der BWL liegt auf Betrieben bzw. Unternehmen. Unter einem Betrieb (Produktionswirtschaft) versteht die BWL eine planvoll organisierte Wirtschaftseinheit. Hier werden Sachgüter produziert bzw. Dienstleistungen bereitgestellt. Die Aktivitäten eines Betriebs dienen vor allem der Bedürfnisbefriedigung Dritter, also der Fremdbedarfsdeckung. Hierdurch generieren die Betriebe entsprechende Entgeltzahlungen ihrer Kunden.
Traditionell haben Überlegungen des Ökonomen Erich Gutenberg (1897–1984) in der hiesigen BWL prägenden Einfluss. Für alle Betriebe identifizierte Gutenberg drei wesentliche Merkmale; diese werden im Folgenden dargestellt.
1. Kombination von Produktionsfaktoren
Jeder Betrieb kombiniert menschliche Arbeit und Güter, so dass eine Leistung entsteht.
2. Finanzielles Gleichgewicht
Jeder Betrieb muss in der Lage sein, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen.
3. Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
Jeder Betrieb beachtet bei sämtlichen seiner Aktivitäten das ökonomische Prinzip.
1.3.1.1 Privatwirtschaftlicher Sektor
Betriebe, die sich in Privateigentum befinden, werden in der BWL oft als Unternehmen bezeichnet. Diese privaten Unternehmen werden von anderen Betrieben meist ebenfalls anhand von drei Kriterien unterschieden; dies sind die folgenden Grundsätze.
Autonomieprinzip: Die Unternehmen sind bei der Planung, Entscheidung und Durchführung grundsätzlich eigenständig (vor allem unabhängig von staatlichen Organen).
Erwerbswirtschaftliches Prinzip: In Unternehmen werden Entscheidungen so getroffen, dass das eingesetzte Kapital einen möglichst hohen