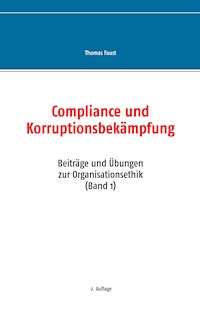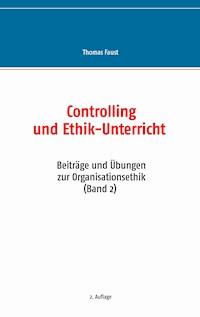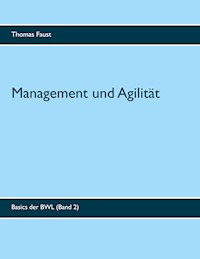
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch gibt Lesern einen kompakten Überblick über grundlegende Themenfelder der Unternehmensführung und der agilen Management-Methoden. Vor allem werden die Themen Planung, Entscheidung, Motivation, Nachhaltigkeit, Corporate Identity, Compliance, Governance und Projekt-Organisation behandelt. Im Rahmen der Agilität werden die Konzepte VUCA, Scrum, Kanban und Design Thinking vorgestellt. Komplettiert wird das Buch durch Übungsaufgaben mit Lösungs- und Literaturhinweisen sowie durch ein kleines BWL-Lexikon und ein ausführliches Stichwortverzeichnis. Das Buch wendet sich an Leser, die rasch und zielgerichtet betriebswirtschaftliches Basiswissen erwerben möchten. Angesprochen sind vor allem Lehrende und Lernende an Akademien, Berufskollegs, Wirtschaftsgymnasien und (Fach-)Hochschulen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hinweis:
Der Autor geht davon aus, dass die Angaben, Daten und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Jedoch übernimmt der Autor keinerlei Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Ferner übernimmt der Autor keinerlei Gewähr für den Inhalt der Websites, auf die in diesem Buch verwiesen wird.
Wenn Warenbezeichnungen, Gebrauchs- und Handelsnamen etc. in diesem Werk wiedergegeben werden, dann berechtigt dies auch ohne eine besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen und Namen als frei im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Vorwort
Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse zählen zunehmend zum allgemeinen Basiswissen. So wird z. B. in vielen Medienberichten ein Grundlagen-Knowhow der Betriebswirtschaftslehre als selbstverständlich vorausgesetzt. Zudem finden Fachbegriffe wie „Profit Center“ oder „Shareholder Value“ immer mehr Einzug ins Alltagsleben.
Aber auch in Schule und Studium erhält die Betriebswirtschaftslehre seit Jahren ein stärkeres Gewicht. Ein Beleg hierfür ist, dass die Zahl der BWL-Studierenden an Akademien und Hochschulen Rekordstände erreicht hat. Und in der Berufsbildung stellt die Betriebswirtschaftslehre traditionell in vielen Bereichen ein Kernfach dar.
Nicht zuletzt hängt der berufliche Erfolg zunehmend von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Kompetenzen ab. So sind auch Mediziner, Ingenieure, Juristen und Naturwissenschaftler gefordert, ökonomische Aspekte bei ihrem täglichen Handeln zu berücksichtigen. Dies gilt für sämtliche Hierarchie-Ebenen – unabhängig, ob als Sachbearbeiter, Abteilungsleiter oder als Geschäftsführer.
Wie der Band 1 dieser Reihe vermittelt das vorliegende Buch wesentliche Grundlagen über das Wirtschaften von Unternehmen. Dies geschieht in einer kompakten und strukturierten Form. Hierdurch empfiehlt sich das Werk insbesondere auch für eine gezielte Prüfungsvorbereitung. Dabei ist das Buch sowohl in einer Print-Version als auch in einem elektronischen Format verfügbar.
Der Aufbau dieses Buchs stellt sich folgendermaßen dar: Das erste Kapitel zeigt zunächst die sach- und die personenbezogenen Aufgaben der Unternehmensführung auf. Auf dieser Basis sollen verschiedene Management-Techniken vorgestellt werden. Nicht zuletzt werden spezifische Führungskonzepte behandelt – vor allem Corporate Identity, Responsibility und Governance sowie Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Projekt-, Krisen- und Compliance-Management.
Das zweite Kapitel beleuchtet zunächst, was sich hinter VUCA verbirgt und welche Chancen bzw. Risiken hiermit verbunden sind. Zudem werden das Agile Manifest und seine Handlungsprinzipien vorgestellt. Ferner soll das Scrum-Konzept mit seinen Rollen, Artefakten und Ereignissen skizziert werden. Außerdem ist darzustellen, was sich hinter Kanban und Design Thinking verbirgt. Zum Abschluss des Kapitels soll der Ansatz der Agilität einer kritischen Würdigung unterzogen werden.
Zur Übung und Vertiefung finden sich zu den beiden Kapiteln zahlreiche Fragen mit Lösungs- und Literaturhinweisen. Bitte benutzen Sie für die Übungen die Notiz- oder Kommentarfunktion Ihres E-Book Readers oder bearbeiten Sie die Übungsaufgaben auf einem extra Blatt Papier. Beispiele, Abbildungen und ein ausführliches Stichwortverzeichnis helfen dabei, die Zusammenhänge zu verstehen. Nicht zuletzt enthält das Buch ein kleines BWL-Lexikon, in dem über 170 wichtige Fachbegriffe erläutert werden. Auf dieser Basis können Leser einen erfolgreichen Einstieg in die Betriebswirtschaftslehre finden.
Generell werden in diesem Buch wichtige Schlüsselbegriffe in Fettdruck hervorgehoben. Und aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form verwendet. Der Autor legt Wert auf die Feststellung, dass hiermit stets sämtliche Geschlechter einbezogen sind.
Weitere Bände der Buchreihe Basics der BWL befinden sich derzeit in Vorbereitung. Sie werden sich anderen betriebswirtschaftlichen Feldern zuwenden – ebenfalls in einer kompakten und strukturierten Form.
Für Fragen und konstruktive Anregungen ist der Autor jederzeit dankbar. Eine Kontaktaufnahme kann gern über die folgende E-Mail-Adresse erfolgen: tf100[at]gmx[dot]net
Frankfurt am Main, Mai 2020
Thomas Faust
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Management und Unternehmensführung
1.1 Lernziele dieses Kapitels
1.2 Einleitung
1.2.1 Führungsebenen
1.2.2 Führungsbereiche
1.3 Sachbezogene Führung
1.3.1 Grundlagen
1.3.2 Planung
1.3.3 Entscheidung
1.3.4 Umsetzung
1.3.5 Ergebniskontrolle
1.3.6 Rückkopplung
1.4 Personenbezogene Führung
1.4.1 Grundlagen
1.4.2 Information und Kommunikation
1.4.3 Mitarbeitermotivierung
1.4.4 Führungsstil
1.4.5 Fazit
1.5 Management-Techniken
1.5.1 Grundlagen
1.5.2 Management by Delegation (MbD)
1.5.3 Management by Exception (MbE)
1.5.4 Management by Systems (MbS)
1.5.5 Management by Objectives (MbO)
1.6 Spezifische Führungskonzepte
1.6.1 Corporate Identity
1.6.2 Werteorientiertes Management
1.6.3 Interorganisationales Management
1.6.4 Krisenmanagement
1.6.5 Corporate (Social) Responsibility
1.6.6 Compliance-Management
1.6.7 Umweltmanagement
1.6.8 Nachhaltigkeitsmanagement
1.6.9 Corporate Governance
1.6.10 Projektmanagement
1.7 Zusammenfassung der Lerninhalte
1.8 Übungsfragen
1.9 Weiterführende Literatur
VUCA und Agilität
2.1 Lernziele dieses Kapitels
2.2 Die VUCA-Welt
2.2.1 Herausforderungen
2.2.2 Handlungsansätze
2.2.3 Führungsstrategien
2.3 Das Agile Manifest
2.3.1 Grundlagen
2.3.2 Handlungsprinzipien
2.4 Agile Rahmenwerke
2.4.1 Scrum
2.4.2 Kanban
2.4.3 Design Thinking
2.5 Agilität in der Diskussion
2.6 Zusammenfassung der Lerninhalte
2.7 Übungsfragen
2.8 Weiterführende Literatur
Kleines BWL-Lexikon
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Abkürzungsverzeichnis
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
AKV
Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung
AO
Abgabenordnung
ARGE
Arbeitsgemeinschaft
BAB
Betriebsabrechnungsbogen
BDA
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BSC
Balanced Scorecard
BWL
Betriebswirtschaftslehre
bzw.
beziehungsweise
CEO
Chief Executive Officer
DCGK
Deutscher Corporate Governance Kodex
d. h.
das heißt
DHKT
Deutscher Handwerkskammertag
DIHK
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
DIN
Deutsche Industrienorm
DSS
Decision Support System
eG
eingetragene Genossenschaft
e. K.
eingetragener Kaufmann
EStG
Einkommensteuergesetz
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EUR
Euro
e. V.
eingetragener Verein
f.
folgende
ff.
fortfolgende
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GenG
Genossenschaftsgesetz
ggf.
gegebenenfalls
GKV
Gesamtkostenverfahren
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GND
Gemeinsame Normdatei
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG
Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB
Handelsgesetzbuch
HRM
Human Resource Management
Hrsg.
Herausgeber
IAS
International Accounting Standards
IFRS
International Financial Reporting Standards
IG
Interessengemeinschaft
IHK
Industrie- und Handelskammer
InsO
Insolvenzordnung
ISIC
International Standard Industrial Classification
IT
Informationstechnologie
KG
Kommanditgesellschaft
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KI
Künstliche Intelligenz
KLR
Kosten- und Leistungsrechnung
KMU
Kleine und mittelgroße Unternehmen
LKW
Lastkraftwagen
M&A
Mergers & Acquisitions
MbD
Management by Delegation
MbE
Management by Exception
MbO
Management by Objectives
MbS
Management by Systems
Mio.
Millionen
MIS
Management-Informationssystem
Mrd.
Milliarden
NACE
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
NGO
Non-Governmental-Organisation
NPO
Non-Profit-Organisation
o. g.
oben genannt
OHG
Offene Handelsgesellschaft
PartGG
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PKS
Planungs- und Kontrollsystem
PKW
Personenkraftwagen
PR
Public Relations
PublG
Publizitätsgesetz
RAP
Rechnungsabgrenzungsposten
ROI
Return on Investment
S.
Seite
SDG
Sustainable Development Goals
s. o.
siehe oben
s. u.
siehe unten
u. a.
unter anderem
UKV
Umsatzkostenverfahren
UmwG
Umwandlungsgesetz
US
United States
USP
Unique Selling Position
usw.
und so weiter
VAG
Versicherungsaufsichtsgesetz
VIAF
Virtual International Authority File
vs.
versus
VUCA
Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VWL
Volkswirtschaftslehre
WiP
Work in Progress
z. B.
zum Beispiel
ZDF
Zweites Deutsches Fernsehen
1 Management und Unternehmensführung
1.1 Lernziele dieses Kapitels
In diesem Kapitel erfahren Sie zunächst, welche Führungsebenen und -bereiche es in Unternehmen gibt. Anschließend werden die sach- und die personenbezogenen Führungsaufgaben vorgestellt. Außerdem sind verschiedene Management-Techniken zu thematisieren. Schließlich lernen Sie spezifische Führungskonzepte wie Corporate Identity, Responsibility und Governance sowie Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Projekt-, Krisen- und Compliance-Management kennen. Dabei sollen auch Aspekte der Werteorientierung und interorganisationalen Zusammenarbeit behandelt werden.
Im Einzelnen ist Ihr Lerninhalt des ersten Kapitels in folgender Weise gegliedert:
Management und Unternehmensführung
1.1 Lernziele dieses Kapitels
1.2 Einleitung
1.2.1 Führungsebenen
1.2.2 Führungsbereiche
1.3 Sachbezogene Führung
1.3.1 Grundlagen
1.3.2 Planung
1.3.3 Entscheidung
1.3.4 Umsetzung
1.3.5 Ergebniskontrolle
1.3.6 Rückkopplung
1.4 Personenbezogene Führung
1.4.1 Grundlagen
1.4.2 Information und Kommunikation
1.4.2.1 Allgemeines
1.4.2.2 Mitarbeitergespräch
1.4.2.3 Mitarbeiterbesprechung
1.4.3 Mitarbeitermotivierung
1.4.3.1 Allgemeines
1.4.3.2 Motivationstheorie von A. Maslow
1.4.3.3 Motivationstheorie von F. Herzberg
1.4.4 Führungsstil
1.4.4.1 Allgemeines
1.4.4.2 Eindimensionales Modell
1.4.4.3 Zweidimensionales Modell
1.4.4.4 Situatives Modell
1.4.5 Fazit
1.5 Management-Techniken
1.5.1 Grundlagen
1.5.2 Management by Delegation (MbD)
1.5.3 Management by Exception (MbE)
1.5.4 Management by Systems (MbS)
1.5.5 Management by Objectives (MbO
)
1.5.5.1 Zielbeschreibung
1.5.5.2 Zielvereinbarung
1.6 Spezifische Führungskonzepte
1.6.1 Corporate Identity
1.6.1.1 Grundlagen
1.6.1.2 Corporate Design
1.6.1.3 Corporate Communications
1.6.1.4 Corporate Behaviour
1.6.1.5 Fazit
1.6.2 Werteorientiertes Management
1.6.2.1 Grundlagen
1.6.2.2 Unternehmensphilosophie
1.6.2.3 Unternehmensleitbild
1.6.2.4 Unternehmenspolitik
1.6.3 Interorganisationales Management
1.6.3.1 Gelegenheitsgesellschaft
1.6.3.2 Kartell
1.6.3.3 Strategische Allianz
1.6.3.4 Joint Venture
1.6.3.5 Konzern
1.6.3.6 Fusion
1.6.4 Krisenmanagement
1.6.4.1 Allgemeines
1.6.4.2 Sanierungsprozess
1.6.4.3 Insolvenzverfahren
1.6.5 Corporate (Social) Responsibility
1.6.5.1 Allgemeines
1.6.5.2 Ziele und Handlungsansätze
1.6.6 Compliance-Management
1.6.6.1 Allgemeines
1.6.6.2 Risikofaktoren
1.6.6.3 Organisatorische Compliance
1.6.6.4 Persönliche Compliance
1.6.6.5 Diskussion
1.6.7 Umweltmanagement
1.6.7.1 Allgemeines
1.6.7.2 Ziele und Handlungsansätze
1.6.8 Nachhaltigkeitsmanagement
1.6.8.1 Allgemeines
1.6.8.2 Ziele und Handlungsansätze
1.6.9 Corporate Governance
1.6.9.1 Allgemeines
1.6.9.2 Ziele und Handlungsansätze
1.6.10 Projektmanagement
1.6.10.1 Allgemeines
1.6.10.2 Rollen im Projekt
1.6.10.3 Projektablauf
1.6.10.4 Diskussion
1.7 Zusammenfassung der Lerninhalte
1.8 Übungsfragen
1.9 Weiterführende Literatur
1.2 Einleitung
Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff Management sehr schillernd und vielschichtig ist. Seine genaue Herkunft ist umstritten; wahrscheinlich leitet er sich ab von den lateinischen Wörtern „manus“ (Hand) und „agere“ (führen, tätig sein).
Vor diesem Hintergrund kann der Terminus „Management“ durchaus unterschiedliche Bedeutungen annehmen:
als eine Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre (BWL), in der es um Inhalte und Methoden der Unternehmensführung geht oder
als eine Personengruppe im Unternehmen (Manager bzw. Leitungskräfte), die mit Führungsaufgaben befasst ist (Management-Institutionen) oder
als Tätigkeiten und Aufgabenstellungen, die diese Führungskräfte zu erfüllen haben (Management-Funktionen).
Traditionell haben in der hiesigen BWL die Überlegungen von Erich Gutenberg (1897–1984) eine grundlegende Bedeutung. Er hat die folgenden Produktionsfaktoren unterschieden:
Betriebsmittel (Maschinen, Werkzeuge, Grundstücke, Gebäude),
Werkstoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, zugekaufte Fertigteile),
ausführende menschliche Arbeit (direkt am Produkt),
dispositiver Faktor (Unternehmensführung, Organisation, Planung, Kontrolle).
Dieser dispositive Faktor (also auch die Unternehmensführung) hat, so Gutenberg, die drei anderen Produktionsfaktoren in zweckmäßiger, wirtschaftlich sinnvoller Weise zusammenzufügen. Hierbei sind stetige Anpassungen aufgrund technischer Neuerungen, politisch-gesellschaftlicher Entwicklungen und sonstiger Umfeldveränderungen erforderlich.
Im Folgenden sollen die Führungsbereiche, aber auch die unterschiedlichen Führungsebenen im Unternehmen näher betrachtet werden.
1.2.1 Führungsebenen
Als Management werden also u. a. alle Personen(-Gruppen) im Unternehmen verstanden, die Führungsaufgaben ausüben und die mit Kompetenzen zur Entscheidung und Anordnung ausgestattet sind. „Geschäftsleitung“, „Management“ und „Unternehmensführung“ werden dabei oft als Begriffe mit gleichem Inhalt verwendet.
Diese Unternehmensleitungen haben meist grundlegende, langfristig wirkende Entscheidungen zu treffen. Dem Management stehen die übrigen Unternehmensmitarbeitenden als vorwiegend ausführende Kräfte gegenüber.
Bei einer genaueren Betrachtung können Führungspersonen – zumal in Großunternehmen – grundsätzlich drei Hierarchie-Ebenen zugeordnet werden. Die Abbildung zeigt, dass sie der oberen, der mittleren bzw. der unteren Management-Ebene angehören können. In kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) reduziert sich die Anzahl der Management-Ebenen entsprechend – bis hin zu den Einzelunternehmen.
Führungsebenen in (Groß-)Unternehmen
• Obere Führungsebene (Top Management)
(z. B. Vorstand oder Geschäftsführer (CEO)) trifft zumeist grundlegende, langfristig relevante Entscheidungen im Unternehmen
• Mittlere Führungsebene (Middle Management)
(z. B. Abteilungs- oder Bereichsleiter) setzt Vorgaben des Top Management um, entscheidet oft mit mittlerem Zeithorizont
• Untere Führungsebene (Lower Management)
(z. B. Gruppen- oder Werkstattleiter) trifft meist kurzfristig wirksame Entscheidungen über ausführende Tätigkeiten
1.2.2 Führungsbereiche
Zum Management-Begriff zählt, wie ausgeführt, aber auch eine aufgaben- bzw. bereichsbezogene Perspektive. So werden in der Unternehmenspraxis z. B. folgende Managementfelder unterschieden, die auf betriebliche Funktionen fokussiert sind:
Beschaffungsmanagement,
Fertigungsmanagement,
Absatzmanagement,
Personalmanagement sowie
Cash Management.
Darüber hinaus existiert eine Reihe an bereichsübergreifenden Führungsfragen. Als wichtige Beispiele für solche betrieblichen Querschnittsthemen seien angeführt:
Projektmanagement,
Change Management,
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement,
Qualitätsmanagement sowie
Krisen-, Risiko- und Sicherheitsmanagement.
Auf einzelne dieser bereichsübergreifenden Führungsthemen wird im weiteren Verlauf zurückzukommen sein.
Management und Unternehmensführung
sachbezogene Führung
personenbezogene Führung
Management-Techniken
spezifische Führungskonzepte
Ferner soll gezeigt werden, dass das Management zwei Hauptaufgabenfelder abzudecken hat: die sachbezogene und die personenbezogene Führung. Zudem sind Management-Techniken sowie spezifische Führungskonzepte (z. B. Corporate Responsibility) wesentlich. Dies wird in den folgenden Abschnitten erläutert.
1.3 Sachbezogene Führung
Zunächst sind also die sachbezogenen Management-Funktionen zu behandeln. Diese Aufgaben werden in der Regel aus den grundlegenden Betriebszielen abgeleitet. Die Zielbildung wurde bereits in Band 1 dieser Buchreihe behandelt. So geht es beim sachbezogenen Management um rationale Maßnahmen, die ein Unternehmen auf seine übergeordneten Gesamtziele ausrichten.
1.3.1 Grundlagen
Bei der sachbezogenen Führung fokussiert werden vor allem das Geschäftsmodell sowie die grundlegende Gestaltung der betrieblichen Strukturen und Prozesse. Dabei sind speziell auch die folgenden Parameter einzubeziehen:
Einflüsse von Technik, Politik und Gesellschaft,
Wettbewerbsposition und Kundenpräferenzen,
relevante Märkte bzw. Kundengruppen,
Leistungs- bzw. Fertigungsarten,
Kooperationspartner und
Unternehmensstandort(e).
Oft wird diese Unternehmensfunktion auch als strategisches Management bezeichnet. Hierdurch werden langfristig wirksame, konstitutive Weichenstellungen im Unternehmen vollzogen. Daraus abzuleiten sind Fragen vor allem der Ressourcen, des Umsatzes und des Gewinns.
In einer generellen Betrachtung können die folgenden Führungsarten unterschieden werden.
Gesamtführung: Sie bezieht sich auf das komplette Unternehmen, z. B. durch einen Einzelunternehmer oder den Geschäftsführer einer GmbH.
Bereichsführung: Sie fokussiert einen Unternehmensteil, z. B. durch den Leiter der Logistik, Fertigung oder Personalwirtschaft.
Gruppenführung: Sie bezieht sich auf das Management eines Arbeitsteams, z. B. durch einen Büroleiter, Meister oder Vorarbeiter.
Individualführung: Sie betrifft die Beeinflussung eines einzelnen Mitarbeitenden durch eine Führungskraft, z. B. im Rahmen eines Jahresgesprächs.
Immer wichtiger werden spezielle, auf den Informationsbedarf von Führungskräften zugeschnittene IT-Anwendungen. Sie werden meist als Management-Informationssysteme (MIS) bezeichnet. Oft kommen dabei multidimensionale Datenbanken zum Einsatz. Sie ermöglichen rasche, flexible Analysen auf Basis von Informationen aus unterschiedlichen betrieblichen Bereichen.
In der BWL werden die sachbezogenen Management-Funktionen in unterschiedlicher Weise gegliedert und abgegrenzt. Eine häufig herangezogene Gliederung orientiert sich am Prozess der Führungsaufgaben. Insoweit wird differenziert zwischen Planung, Entscheidung, Umsetzung und Ergebniskontrolle. Aus dieser Ergebniskontrolle erfolgt schließlich eine Rückkopplung, so dass ein Kreislauf-Schema entsteht. Dies soll in den nächsten Abschnitten erläutert werden.
Sachbezogener Führungsprozess
Planung →
Entscheidung →
Umsetzung →
Ergebniskontrolle
← Rückkopplung ←
1.3.2 Planung
Eine wichtige Ausgangsbasis für die Planung bildet, wie angedeutet, das bestehende Zielsystem eines Unternehmens. Eine Kernfunktion des sachbezogenen Managements – und damit eine wichtige Führungsaufgabe – ist also die an Zielen orientierte Planung.
Planung wird in der BWL meist definiert als Entwurf einer systematischen Ordnung, nach der sich kommendes Geschehen vollziehen soll. Hierdurch werden zukünftige Daten bzw. Ereignisse in die Unternehmensperspektiven einbezogen. Mithilfe dieser Planung sollen rationale, strukturierte Überlegungen an die Stelle von Intuition und Improvisation treten.
Wichtige Ziele der Planung sind der Schutz vor unerwünschten Ereignissen sowie die Begrenzung von Risiken kommender Entwicklungen. Zudem legt die Planung eine Basis für die betriebliche Information, Koordination und Kontrolle. So eröffnet sich mit einer systematischen Planung die Chance, die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten. Wichtige Schritte der Planung sind
zunächst die Problemanalyse, wobei der angestrebte Zustand beschrieben und untersucht wird, und
darauf aufbauend die Alternativen-Suche zwecks Zielerreichung, wobei häufig Kreativitätstechniken (z. B. Brainstorming) und Prognoserechnungen (z. B. Extrapolation) eingesetzt werden.
Generell ist die Planung zum einen nach räumlichen Aspekten gliederbar, beispielsweise in Märkte und Organisationsbereiche. Zum anderen lässt sie sich nach zeitlichen Gesichtspunkten unterteilen, etwa in eine Monats- oder Quartalsplanung.
Die Planung kann außerdem nach Reichweiten gegliedert werden. Im Einzelnen sind hierbei die folgenden Horizonte zu unterscheiden.
Strategische Planung: Sie ist eine Grobplanung auf Basis „weicher“ Parameter (z. B. Chancen, Risiken, Potenziale). Die strategische Planung findet meist auf der oberen Führungsebene statt, und sie erstreckt sich auf einen Zeithorizont von mehr als fünf Jahren.
Taktische Planung: Sie basiert auf der strategischen und bildet ein Bindeglied zur operativen Planung. Die taktische Planung ist oft Aufgabe der mittleren Führungsebene, und sie umfasst einen Zeitraum von einem bis zu fünf Jahren.
Operative Planung: Sie setzt zumeist die Vorgaben der taktischen Planung auf der unteren Führungsebene um. Die operative Planung ist Detailarbeit auf Basis „harter“ Größen (z. B. Stückzahlen, Umsatz, Gewinn, Liquidität). Sie erstreckt sich auf einen Zeithorizont von bis zu einem Jahr.
Vor allem in mittleren und großen Unternehmen wird das Management bei der Planung oft durch das Controlling entlastet. So gilt das Controlling als eine wichtige Management-Unterstützungsfunktion. Häufig werden dabei Details zur Planung in einem entsprechenden Handbuch dargelegt.
Allerdings bleibt selbst bei einer detaillierten, aufwändigen Planung ein Rest Unsicherheit bestehen. Ursachen hierfür sind vor allem, dass