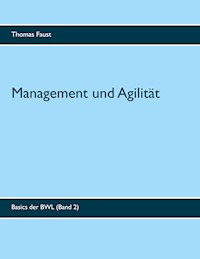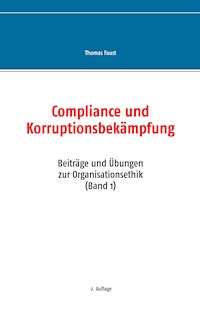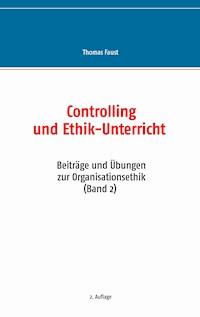
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beiträge und Übungen zur Organisationsethik
- Sprache: Deutsch
Das Buch behandelt zum einen das aktuelle Thema Performance Management. Controlling und Unternehmensethik werden dabei im Rahmen einer innovativen Konzeption zusammengeführt. Zum anderen nimmt das Buch den Wirtschafts- und Unternehmensethik-Unterricht in den Blick. Am Beispiel des Whistleblowing wird reflexions- und kompetenzorientiertes Lehren und Lernen vorgestellt. Die beiden Beiträge zeichnen sich durch eine kompakte und strukturierte Form aus. Sie enthalten jeweils Übungsfragen inklusive Lösungs- und Literaturhinweisen. Dies ermöglicht eine gezielte Wiederholung und Vertiefung der behandelten Themenfelder. Zielgruppen: - Führungskräfte in Unternehmen, Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen - Fachkräfte in den Bereichen Controlling, Revision, Compliance, Consulting, Personal- und Organisationsentwicklung - Lehrende und Lernende in der Sekundarstufe II, an Hochschulen sowie in der Fort- und Weiterbildung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor geht davon aus, dass die Angaben, Daten und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Der Autor übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Gebrauchs- und Handelsnamen etc. in diesem Werk berechtigt auch ohne eine besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen und Bezeichnungen als frei im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Vorwort zur zweiten Auflage
Die erste Auflage dieses Buchs war auf dem Markt der Wirtschafts- und Unternehmensethikliteratur recht erfolgreich. Der Autor möchte sich auf diesem Weg zudem für die Hinweise und Anregungen bedanken, die ihm zu diesem Werk zugegangen sind.
Nun wird nach gut einem Jahr die Gelegenheit genutzt, eine grundlegend überarbeitete und erweiterte zweite Auflage des Buchs herauszubringen. Auch zu diesem Werk sind Fragen und Hinweise herzlich willkommen. E-Mail: tf100(at)gmx.net
Die vorliegende Auflage ist in einer verbesserten Einband- und Papierqualität erschienen. Hierdurch konnten u. a. einige der Abbildungen übersichtlicher gestaltet werden. Ferner wurden die beiden Fragenkataloge ausgebaut und ein Stichwortverzeichnis eingefügt. Außerdem sind aktuelle Beispiele und neue Literaturhinweise zu den behandelten Themen integriert worden.
Neu hinzugekommen ist bei dieser zweiten Auflage auch ein Verzeichnis mit wichtigen Internet-Ressourcen zur Organisationsethik. Leser erhalten somit zielgerichtete Hinweise auf Recherchemöglichkeiten zu weiteren (aktuellen) Aspekten der angesprochenen Themenfelder.
Schließlich ist das Buch neben der klassischen Print-Version nun auch als E-Book verfügbar. Der Autor verbindet damit die Hoffnung, dass das Buch sich hierdurch neue Leserkreise und alternative Einsatzoptionen erschließt.
Hagen (Westf.), März 2017
Thomas Faust
Vorwort zur ersten Auflage
Seit Veröffentlichung des ersten Bands dieser Buchreihe ist fast ein Jahr vergangen. In dieser Zeit ist die Organisationsethik noch mehr in den Fokus des allgemeinen Interesses gerückt. Insbesondere auch der Bereich der Verbände und Non-Profit-Organisationen wendet sich nun diesem Thema zu. Ursachen hierfür sind u. a. fragwürdige Vorkommnisse, die 2015 von dort an das Licht der Öffentlichkeit gelangten, insbesondere von bedeutenden Sportorganisationen.
Aber es mehren sich auch die Bestrebungen, fragwürdigen Handlungen und Missständen Einhalt zu gebieten – sei es durch Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen (NRO) oder durch internationale Übereinkünfte, etwa zum Schutz von persönlichen Daten und unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Vor diesem Hintergrund widmet sich der erste Beitrag dieses Bands dem Controlling im Kontext der Organisationsethik. Er ist auf der Basis von Impulsen entstanden, die ich durch den Gesprächskreis „Unternehmensethik in der Praxis“ an der Akademie Rabanus Maurus, Frankfurt am Main, erhalten habe. Für anregende Diskussionen danke ich vor allem Frau Prof. Dr. Gotlind Ulshöfer, Tübingen, und Herrn Dr. Georg Horntrich, Frankfurt am Main.
Der zweite Beitrag befasst sich mit dem aktuellen Thema Whistleblowing. Inspiriert wurde er durch das Projekt „ethos – Wirtschafts- und Unternehmensethik in der ökonomischen und politischen Bildung“, zu dem ich zwei Lehr- und Lernbausteine beisteuern durfte. Für wertvolle Hinweise geht ein herzlicher Dank an Herrn Prof. Dr. Tilman Grammes, Hamburg, Herrn Prof. Dr. Thomas Retzmann, Essen sowie Herrn Prof. Dr. Hansrudi Lenz, Würzburg.
Die beiden Beiträge werden jeweils durch einen Fragenkatalog inklusive Lösungs- und Literaturhinweisen komplettiert. Auf dieser Basis kann eine gezielte Wiederholung und Vertiefung der behandelten Themenfelder erfolgen. Insoweit schließt das Werk nahtlos an die Konzeption des ersten Bands dieser Buchreihe an.
Rückmeldungen, Kritik und Anregungen zu dem Buch sind jederzeit herzlich willkommen. E-Mail: tf100(at)gmx.net
Frankfurt am Main,
im Februar 2016
Thomas Faust
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur ersten Auflage
Abkürzungsverzeichnis
Controlling, Ethik und Integrität – Perspektiven des Performance Measurement
1 Controlling und Unternehmensethik
1.1 Controlling-Konzeptionen
1.2 Unternehmensethik und Integrität
1.2.1 Die Konzepte von Homann et al. und Ulrich et al
1.2.2 Das Konzept von Paine
1.3 Zum Verhältnis von Controlling und Integrität
1.4 Integritätscontrolling
1.5 Weiteres Vorgehen
2 Integritätsdefizite: ein Drei-Ebenen-Modell
2.1 Empirische Befunde
2.2 Integritätsdefizite: das Beispiel Korruption
2.2.1 Ursachen von Korruption
2.2.2 Schäden durch Korruption
2.2.3 Synopse
3 Integritätsmanagement und Controlling: die Meso-Ebene
3.1 Risikomanagement und integritätsorientierte Organisationsentwicklung
3.2 Integritätsfokussiertes Personalmanagement
3.3 Performance Measurement
3.3.1 Nicht-monetäre Kenngrößen
3.3.2 Monetäre Kenngrößen
4 Persönliche Integrität und Selbstmanagement: die Mikro-Ebene
4.1 Tugenden und persönliches Ethos
4.2 Performance Measurement
4.2.1 Allgemeine Kenngrößen
4.2.2 Spezifische Kenngrößen
5 Integrität in der Rahmenordnung: die Makro-Ebene
5.1 Aktivitäten in Staat und Zivilgesellschaft
5.2 Performance Measurement
5.2.1 Allgemeine Kenngrößen
5.2.2 Spezifische Kenngrößen: BPI und CPI
6 Ausgestaltung des Integritätscontrollings
7 Integritätscontrolling – ausgewählte Spannungsfelder
7.1 Reliabilität versus Validität
7.2 Transparenz versus Datenschutz
7.3 Zweck- versus Wertrationalität
8 Zusammenfassung und Ausblick
Fragen zur Übung und Vertiefung
Lösungshinweise zu den Fragen
Literaturhinweise
Wirtschafts- und Unternehmensethik-Unterricht: das Beispiel Whistleblowing
1 Einführung
1.1 Aktuelle Herausforderungen
1.2 Leistungsfähigkeit des Wirtschafts- und Unternehmensethik-Unterrichts
2 Zum Phänomen Whistleblowing
2.1 Begriff und Kontext
2.2 Individualethische Gesichtspunkte
2.3 Strukturelle und prozedurale Aspekte
2.4 Whistleblower-Situation: Deutschland versus USA
2.5 Legitimität des Whistleblowing
2.6 Neue „Orte“ der Ethik
2.6.1 Die Seite der Arbeitnehmer
2.6.2 Die Seite der Arbeitgeber
3 Whistleblowing im Wirtschafts- und Unternehmensethik-Unterricht
3.1 Whistleblowing und die Prinzipien wirtschaftsethischer Bildung
3.1.1 Kontextualität
3.1.2 Historizität
3.1.3 Komplexität
3.1.4 Kontroversität
3.2 Unterrichtsziele
3.3 Lernvoraussetzungen
3.4 Lehrvoraussetzungen
3.5 Unterrichtsablauf und -materialien
3.6 Zusammenschau
4 Fazit und künftige Herausforderungen
Fragen zur Übung und Vertiefung
Lösungshinweise zu den Fragen
Literaturhinweise
Internet-Ressourcen zur Organisationsethik
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Abs.
Absatz
ADAC
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
al.
alii
AMLE
Academy of Management Learning & Education
ArbSchG
Arbeitsschutzgesetz
BBG
Bundesbeamtengesetz
Bd.
Band
BeamtStG
Beamtenstatusgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BPI
Bribe Payers Index
BSE
Bovine Spongiforme Enzephalopathie
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CPI
Corruption Perceptions Index
CR
Corporate Responsibility
CSR
Corporate Social Responsibility
DeGöB
Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung
DFB
Deutscher Fußball-Bund
DVFA
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse
und Asset Management
etc.
et cetera
f.
folgende
FCPA
Foreign Corrupt Practises Act
ff.
fortfolgende
FIFA
Fédération Internationale de Football Association
GG
Grundgesetz
ggf.
gegebenenfalls
GPJE
Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung
GRI
Global Reporting Initiative
Hrsg.
Herausgeber
IACA
International Anti-Corruption Academy
IALANA
International Association of Lawyers against Nuclear Arms
IIRC
International Integrated Reporting Council
IT
Information Technology
KPMG
Klynveld Peat Marwick Goerdeler
Mrd.
Milliarden
NDR
Norddeutscher Rundfunk
Nr.
Nummer
NRO
Nichtregierungsorganisation
NSA
National Security Agency
o. ä.
oder ähnlich
OLAF
Office Européene de Lutte Anti-Fraude
S.
Seite
TNS
Taylor Nelson Sofres
Ts.
Taunus
u. a.
unter anderem
VDW
Vereinigung Deutscher Wissenschaftler
vgl.
vergleiche
Vol.
Volume
WDR
Westdeutscher Rundfunk
z. B.
zum Beispiel
z. T.
zum Teil
Quelle: eigene Illustration
Lord Kelvin
(1824–1907)
Controlling, Ethik und Integrität – Perspektiven des Performance Measurement
I often say that when you can measure
what you are speaking about,
and express it in numbers,
you know something about it.
Lord Kelvin
Integrität ist offenkundig ein knappes Gut. Denn sie ist immer noch (und immer wieder) durch Wirtschaftsdelikte und andere Missstände bedroht. Aktuell sind hier beispielsweise Fälle von Preisabsprache, Steuerhinterziehung, Zins- und Abgaswertmanipulation, aber auch Bestechung und Bestechlichkeit zu nennen (vgl. etwa Slodczyk 2017, Rogert 2017).
Doch Unternehmen und andere Organisationen unterschätzen oft noch die Gefahren, die aus diesen Integritätsdefiziten resultieren: einerseits die hohen finanziellen Schäden, andererseits die enormen Verluste an Vertrauen, Reputation und Handlungslegitimität. Dass Organisationen sich insoweit allzu oft in trügerischer Sicherheit wiegen, zeigt etwa eine aktuelle Studie von KPMG in Zusammenarbeit mit TNS Emnid (vgl. KPMG 2014).
Aus dieser Studie geht zudem hervor, dass die befragten Unternehmen vergleichsweise wenig in eine zielgerichtete Prävention investieren. So sind in diesem Kontext offenbar auch Investitionen in den Bereich des Controllings Mangelware. Überhaupt wurde im deutschsprachigen Raum bislang kaum diskutiert und erprobt, inwieweit das Controlling einen Beitrag zur Prävention bzw. Überwindung von Integritätsdefiziten leisten kann.
Vor diesem Hintergrund stellt sich somit in Forschung und Praxis die Frage, auf welche Weise der Bedrohung von Integrität wirksam begegnet werden kann. Was kann die strategische Organisationsentwicklung zur Integritätssicherung beitragen? Welche moralische Verantwortung tragen die handelnden Menschen? Welche Anforderungen stellen Staat und Zivilgesellschaft? Und vor allem: Inwieweit ermöglicht ein Controlling, welches das Performance Measurement einbezieht, die Abbildung und Steuerung von Integrität?
1 Controlling und Unternehmensethik
Gleichermaßen zählen Unternehmensethik und Controlling seit längerem zu den am meisten diskutierten Themenfeldern; dies gilt sowohl für die philosophische und wirtschaftswissenschaftliche Literatur als auch für die Praxis von und in Organisationen. Die beiden Themenfelder können somit jeweils als ausgebaute Wissenschaftsbereiche gelten.
Die Ethik blickt dabei auf eine Jahrtausende währende Tradition zurück. Als wichtige Wegweiser gelten etwa Aristoteles, Seneca und Thomas von Aquin. Demgegenüber erscheint das Controlling als ein geradezu jugendliches Fachgebiet; hierzulande hat es erst seit den 1980er Jahren Aufschwung genommen. Wichtige Controlling-Promotoren, gerade in dieser Anfangsphase, waren z. B. Péter Horváth und Thomas Reichmann.
1.1 Controlling-Konzeptionen
Im Bereich des Controllings ist zunächst ein sehr heterogenes Begriffsverständnis zu konstatieren: Es herrscht eine durchaus unübersichtliche, teils widersprüchliche Vielfalt der Termini, Blickwinkel und Interpretationen. Immerhin werden die Aufgaben der Koordination, Informationsversorgung und Führungsunterstützung meist zum Kernbereich des Controllings gezählt (vgl. Göbel 2013, S. 251).
Darüber hinaus gibt es immer wieder Versuche, Fortentwicklungen bzw. grundlegende Neuausrichtungen des Controllings zu initiieren. Ein wesentlicher Ausdruck hiervon sind zum einen die zahlreichen „Bindestrich-Controllings“; sie sind in den letzten Jahren mit dem Blick auf verschiedene betriebliche Funktionsbereiche entstanden – beispielsweise in Gestalt des Finanz-, Personal- und Marketing-Controllings (vgl. etwa Mensch 2008, Wunderer/Schlagenhaufer 1994, Ehrmann 2015).
Zum anderen zählen die Versuche grundlegender theoretisch-konzeptioneller Controlling-Neuausrichtungen zu diesem Kontext. Anzuführen ist hier in jüngerer Zeit beispielsweise der Ansatz des Rationalitätssichernden Controllings von Jürgen Weber und Utz Schäffer. Diese Konzeption fokussiert die Gewährleistung einer zielgerichteten Führung von Unternehmen und anderen Organisationen (vgl. Schäffer/Weber 2004). So werden vor allem zweckrationale, an Gewinn- und Rentabilitätszielen orientierte Handlungen in den Blick genommen; wertrationale Aspekte bleiben hingegen weitgehend ausgeblendet. Demzufolge hat das Controlling ein ethisch orientiertes Handeln situationsabhängig zu begrenzen – nämlich dann, wenn es sich für die jeweilige Organisation nicht rechnet (vgl. Weber/Schäffer 2014, S. 56).
Anzuführen ist in diesem Kontext aber auch das Reflexionsorientierte Controlling von Ewald Scherm und Gotthard Pietsch. Dieses Konzept rückt insbesondere kritisch-konstruktive Denkprozesse in Unternehmen und anderen Organisationen in den Blick. Im Zentrum des Ansatzes steht die sog. perspektivenorientierte Reflexion, die vor allem auch als ein Impulsgeber für Innovationen fungiert (vgl. Pietsch/Scherm 2004). Reflexionsbasierte Diskurse sind insbesondere zwischen Controllern und Managern essenziell. Auf diese Weise können die Controller, so die Autoren, zum kritisch-konstruktiven Counterpart der Manager werden (vgl. Pietsch/Scherm 2001, S. 310).
1.2 Unternehmensethik und Integrität
Ein ähnlich heterogenes Bild wie im Controlling zeigt sich in der Wirtschafts- und Unternehmensethik. Allgemein gilt Ethik als die kritische Hinterfragung von Werten und Normen sowie die Gestaltung „guter“ Praxis (vgl. Holzmann 2015). Die wissenschaftlichen Diskussionen in der Wirtschafts- und Unternehmensethik hierzulande waren lange durch hitzige Debatten und einen fast lähmenden Schulen-Streit geprägt.
1.2.1 Die Konzepte von Homann et al. und Ulrich et al.
Auf der einen Seite haben bei diesem Disput Karl Homann et al. ihr Konzept der Ökonomischen Ethik vertreten (vgl. Homann/Blome-Drees 1992). In ihrem Ansatz fokussieren sie die Nutzen- und Gewinnkalküle des unternehmerischen Handelns. Dieses individuelle Gewinnstreben erfüllt einen sozialen Zweck, da es das bislang beste Mittel zur Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt ist. Wenn es einseitige moralisch motivierte Vorleistungen erbringt, dann stellt dies laut Homann et al. eine Überforderung des Unternehmens dar. Denn in der Marktwirtschaft sind diese Vorleistungen jederzeit durch die Wettbewerber ausbeutbar („Trittbrett fahren“). Hierdurch ist das integer handelnde Unternehmen ernsthaft in seiner Existenz bedroht. Die Moral hat daher, so die Autoren, ihren systematischen Ort in der Rahmenordnung, um dort wettbewerbsneutral zur Geltung zu kommen.
Wichtige Basisideen für den Theoriezugang von Homann et al. lieferte der britische Moralphilosoph Jeremy Bentham (1748–1832). Er vertrat eine Konzeption, die auf einem utilitaristischen, Nutzen und Konsequenzen fokussierenden Ethikverständnis beruht (vgl. Bentham 2003). Damit wird eine gewisse konzeptionelle Nähe Benthams und Homanns zu dem auf Zweckrationalität ausgerichteten Controlling-Ansatz von Schäffer und Weber deutlich.
Auf der anderen Seite der Debatte stehen Peter Ulrich et al. als Verfechter der Integrativen Wirtschaftsethik (vgl. Ulrich 2001, Thielemann 1996). Ihnen geht es vor allem um eine grundlegende Hinterfragung wirtschaftsliberaler Positionen. Insbesondere werden die reine ökonomische Logik mit ihren (vermeintlichen) Sachzwängen sowie ihre Blindheit gegenüber Maximen der Menschenwürde und Gerechtigkeit kritisiert. So postulieren Ulrich et al. eine Legitimation unternehmerischen Handelns durch einen idealen Diskurs unter allen Handlungsbetroffenen. Auf diese Weise kann, so die Autoren, das Handeln von und in Unternehmen reflexiv einsichtig werden.