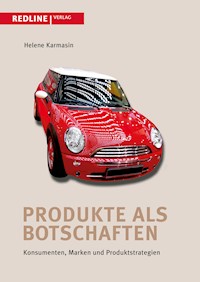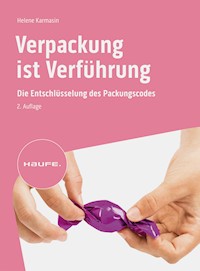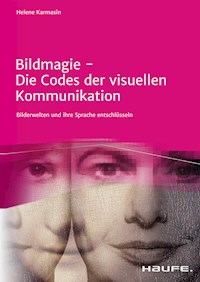
38,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Gerade die visuelle Kommunikation spielt in unserer mediatisierten und stark vernetzten Kultur eine hochrelevante Rolle. In diesem Buch erfahren Sie, wie Bilder und andere visuelle Elemente es schaffen, Bedeutungen aufzubauen und zu vermitteln. Relevante visuelle Strategien werden anhand vieler Beispiele aus verschiedenen Epochen nachvollziehbar erklärt. Eine gekonnte Handhabung des visuellen Codes ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil - er kommuniziert Bedeutungen, die in dieser Form verbal nicht möglich sind. Inhalte: - Darstellungsverfahren: Perspektive, Platzierung im Raum, Format, Lichtführung, Farbgebung und mehr - Kombinationsverfahren: rhetorische Figuren, Erzählstrategien, Kombinationsmöglichkeiten von Text und Bild - Konstruktion spezifischer Codes: bestimmte Bedeutungen - sakral, elitär, intim etc. - schnell und überzeugend abrufen - Einsatz: mit visuellen Codes eine differenzierte Identität erzeugen - Spezifische Bereiche: visuelle Codes im Netz, in der Politik und im Raumdesign
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
[5]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumEinführung: Die Wirkmacht der BilderPrinzipien der BildanalyseDie magischen Qualitäten von BildernAufbau des BuchesTeil 1: Verfahren der Darstellung und Kombination von Bildelementen1 Visuelle Basisverfahren1.1 Die Perspektive: Perspektivische Bilder oder Montagebilder1.2 Der Raumausschnitt: Weitwinkel, Normalsicht, Nahaufnahme1.3 Point of View: Die Blickrichtung des Betrachters2 Verfahren und Gestaltungsprinzipien der Bedeutungsvermittlung2.1 Das Bildformat2.2 Geometrische Basisformen2.3 Die Lichtführung2.4 Der Farbcode3 Die Anordnung der Elemente im Raum des Bildes3.1 Die zentralen Dimensionen3.2 Die Anordnung von Personen im Raum4 Kombinationsverfahren der Bedeutungsvermittlung4.1 Die Syntax von Sprachen und Bildern4.2 Bedeutungszuschreibung durch Handlung im Bild: Vektoren und Achsen4.3 Bedeutungszuschreibung über den Aufbau von visuellen Kontexten4.4 Alleinstellung ohne Kontext5 Die Kombination von Bild und Text5.1 Der Text als Hauptträger der Botschaft5.2 Die Koordination von Bild und Text5.3 Können Bilder Geschichten erzählen?5.4 Rhetorische Verfahren des visuellen Codes5.5 Kulturelles Wissen – die Voraussetzungen beim BetrachterExkurs: Salienz – Verfahren zur Hervorhebung von BildelementenTeil 2: Die Konstruktion spezifischer visueller Codes6 Die Konstruktion charakteristischer Codes6.1 Der Code des Sakralen6.2 Der elitäre Code6.3 Der Code der Nähe und Intimität6.4 Der Code der Weite und Raumtiefe 6.5 Der Code des Männlichen und Weiblichen6.6 Der wissenschaftliche und der bürokratische Code7 Bildtypen, die bestimmte Reaktionen hervorrufen7.1 Aufforderungsbilder bzw. Demand Pictures7.2 Angebotsbilder bzw. Offer Pictures7.3 Pathosbilder Teil 3: Visuelle Codes zur Positionierung von Marken und Unternehmen8 Positionierung von Marken und Unternehmen über den visuellen Stil8.1 Der Raum des Abenteuers – die Marke Red Bull8.2 Das Bukolische – die Marke Landlust8.3 Sakralisierung des Alltäglichen – die Marke Hornbach 8.4 Der Begriff des kulturellen Kapitals8.5 Darstellung des neuen Luxus8.6 Terrestrische und ozeanische MarkenTeil 4: Einsatzbereiche der visuellen Kommunikation9 Politische Kommunikation9.1 Die Visualisierung ideologischer Konzepte9.2 Die Inszenierung des Politikers als Amtsträger und Mensch10 Raumsemiotik: Die Sprache des Raumes10.1 Intime Distanz10.2 Persönliche Distanz10.3 Soziale Distanz10.4 Öffentliche Distanz10.5 Die Bedeutung von räumlichen Codes für den Bildaufbau11 Visualität im Netz11.1 Bildkommunikation in den sozialen Medien11.2 Visuelle Gestaltung von WebsitesLiteraturverzeichnisAbbildungsverzeichnisVerzeichnis der BildquellenStichwortverzeichnisDie AutorinDanksagungHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[4]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-15558-5
Bestell-Nr. 10675-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-15559-2
Bestell-Nr. 10675-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-15560-8
Bestell-Nr. 10675-0150
Dr. Helene Karmasin
Bildmagie
1 Auflage, März 2022
© 2022 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): © Tina Dietz
Produktmanagement: Judith Banse
Lektorat: Peter Böke
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/ Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Einen Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
[9]Einführung: Die Wirkmacht der Bilder
Abb. 1: Tiffany Hsu, Parisian Breakfast
Das Bild stammt aus dem Blog einer bekannten Influencerin, Tiffany Hsu, die täglich Bilder aus ihrem Leben postet. Tiffany ist Einkäuferin in einem Onlineshop für Luxusmode, Mytheresa, und naturgemäß trägt sie auf jedem Bild die Outfits und die Accessoires, die man in dem Shop kaufen kann. Darauf weist sie aber nicht hin, sondern sie zeigt sich in Situationen, in denen sie selbst diese Kleider trägt, so dass man sieht, wie großartig man darin wirken kann.
Bei dem oberen Bild geht es um die Handtasche, die auf dem Tisch liegt – eine sehr teure Tasche des Luxuslabels Bottega Veneta Tiffany hatte geschrieben, dass sie jetzt in Paris ist, und aus Paris postet sie dieses Bild: Parisian Breakfast Die meisten Frauen, denen man dieses Bild zeigt, betrachten es mit Vergnügen und fühlen sich in eine Situation versetzt, in der sie gern sein möchten – und die Tasche hätten sie auch gern. Sie sind auch imstande, zu dem Bild eine kleine Geschichte zu erzählen: Tiffany hat offenbar in einem Outdoorcafé auf einem Boulevard in Paris ein Frühstück geordert und zu essen begonnen, dann hat sie ihre Handtasche weggelegt, fotografiert und gleich wird sie weiteressen.
Wie schafft es das Bild, diese Geschichte zu erzählen, ein spezifisches Lebensgefühl auszulösen und Lust auf die Tasche zu machen? Es sind ja nur eine Tasse, ein Croissant und eine Tasche abgebildet. Ganz einfach: Es wählt aus möglichen Zeichenrepertoires die richtigen Zeichen, es arrangiert sie in bestimmter Weise und es wählt sie so, dass ein bestimmtes kulturelles Wissen abgerufen wird. Es ist ein semiotisches Ensemble, das durch die Selektion und Kombination von Zeichen, die es in bestimmter Weise an[10]ordnet, seine Botschaft transportiert. Es verwendet eine kluge Kombination visueller und verbaler Codes. Erschrecken Sie nicht, wir werden diese Begriffe gleich erklären.
In diesem Buch geht es um visuelle Kommunikation, also um die Frage, wie Bilder oder andere visuelle Elemente es schaffen, Bedeutungen aufzubauen und zu vermitteln.
Welche Strategien verwendet diese visuelle Sprache?
Visuelle Elemente können statische Bilder sein, bewegte Bilder, aber auch Statuen, Inszenierungen von Ereignissen, architektonische Ensembles etc., alles was eben visuell, »bildlich«, seine Botschaften vermittelt. Das Visuelle spielt in unserer zeitgenössischen Kommunikation eine wichtige Rolle. Nach manchen Autorinnen und Autoren sind wir derzeit überhaupt eine bilddominierte Kultur, was in dem Begriff des Iconic Turns zum Ausdruck kommt.1 Am besten zeigt sich dies in der Kommunikation, die im digitalen Raum abläuft – dieser ist ein bilddominierter Raum. Allein auf Facebook werden jeden Tag ca. 350 Millionen Fotos hochgeladen – eine beträchtliche Menge.2
Dennoch: Wenn man die Geschichte unserer und anderer Kulturen betrachtet, so sieht man, dass Bilder zu allen Zeiten eine hochrelevante Rolle in der Kommunikation gespielt haben, vor allem in der gemeinschaftsorientierten Kommunikation. Vor der Zeit, als unsere Gesellschaft alphabetisiert wurde, was durchgehend erst im 18 Jahrhundert der Fall war, wurden wichtige politische und ideologische Botschaften durch Bilder verbreitet.
Der visuelle Code ist ein äußerst effizienter Code
»Bilder erzählen, unterhalten, dokumentieren, werben, überzeugen, konservieren, animieren und sie vermögen das in einer äußerst effizienten, schnellen und anschaulichen Weise. Bildern haftet der Anschein universeller Verstehbarkeit und Eindeutigkeit an.«3
Visueller Kommunikation wird auch eine hohe manipulative Kraft zugeschrieben. Wie aber gelingt das Bildern? Wie vermitteln sie ihre Botschaften? Welche visuellen Verfahren lassen sich feststellen?
Wir fassen Bilder als semiotische Ensembles auf und wollen der Frage daher auf den Boden der Semiotik, also der Lehre von den Zeichensystemen, den Sprachen, die wir zur Kommunikation verwenden, nachgehen. Diese Sprachen beruhen auf verschiedenen [11]Zeichen. Die wichtigsten davon sind Worte und Bilder. Man kann Botschaften übermitteln, indem man sich auf Worte oder auf bildliche Elemente stützt, man kann also einen verbalen oder visuellen Code wählen oder natürlich auch beide kombinieren.
Der verbale Code ist sehr gut erforscht. Die Linguistik beschäftigt sich eingehend mit den Regeln, die dazu führen, dass man durch Worte kommunizieren kann. Die Fähigkeit, den verbalen Code zu handhaben, also zu schreiben und zu lesen, gehört zu dem Ausbildungsprogramm unserer Gesellschaft. Ohne diese Kulturtechniken, also ohne lesen und schreiben zu können, ist man kein vollgültiges Mitglied der Gesellschaft.4
Die Handhabung des visuellen Codes wird nur ansatzweise in dieser Form gelehrt, sie ist Spezialisten überlassen, sie wird aber spontan und ohne jede Überlegung von den vielen Menschen verwendet, die sie täglich einsetzen. Das Funktionieren dieses visuellen Codes ist auch weit weniger systematisch erforscht. Hier gibt es viele unterschiedliche und widersprüchliche Ansätze, obwohl sich alle einig sind, dass visuelle Kommunikation in unserer mediatisierten und stark vernetzten Kultur eine hochrelevante Rolle spielt.
In diesem Buch geht es um die Beschreibung wichtiger visueller Strategien, also Strategien, die eingesetzt werden, um zu kommunizieren und oft auch um Wirkungen auszulösen. Viele der Beispiele stammen aus meiner Arbeit als Marktforscherin: Ich untersuche seit vielen Jahren Konzepte von Marken, Werbungen, Produkten, Dienstleistungen, Programmen – empirisch, aber auch semiotisch. Ich kenne daher die Effizienz, die visuelle Kommunikation haben kann, aber auch die zahlreichen Defizite, die bei der Nichtbeachtung wesentlicher Strategien entstehen.
In diesem Buch finden Sie auch viele Beispiele aus anderen Zeiten und Feldern. Beispiele aus der klassischen Kunst, Beispiele aus verschiedenen historischen Epochen. Es zeigt sich, dass es einige Strategien gibt, die eine lange Geschichte haben und dadurch einen festen Bestandteil unseres kollektiven Bewusstseins bilden dürften. Grundsätzlich behandle ich nur gegenständliche Bilder, also Bilder, die darauf abzielen, Objekte realistisch abzubilden bzw. realistisch zu wirken. Ich lasse also den ganzen Bereich der abstrakten Bilder aus, die weite Teile unserer Gegenwartskunst prägen.
Der zentrale Punkt, auf den dieses Buch Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist folgender: Viele Arbeiten, die sich mit visueller Kommunikation beschäftigen, beschreiben in erster Linie den Inhalt von Bildern, also das Dargestellte, allenfalls bestimmte Darstellungsverfahren, die sich aus der Wahrnehmungspsychologie herleiten. Dies [12]ist zweifellos ein wichtiger Punkt. Man muss sich gut überlegen, was man darstellen will, um zu rühren, zu überzeugen oder zu imponieren etc. Es gibt jedoch zahlreiche Möglichkeiten, wie man einen bestimmten Inhalt darstellen kann: aus Obersicht oder Untersicht, im Zentrum oder an der Peripherie, links oder rechts, durch Lichtsetzung akzentuiert oder nicht, rund oder eckig gerahmt etc. Man muss notwendigerweise eine dieser Möglichkeiten wählen, sonst ergibt sich kein Bild. Ein visuelles Element bildet ja nie unmittelbar Realität ab, sondern immer vermittelt durch den Blick einer Kamera oder das Auge eines Malers.
Wir wollen im ersten Teil des Buches also beschreiben, welche Verfahren es gibt, um durch die Art der Darstellung Bedeutungen zu vermitteln, die über die bloße Wirkung des Inhalts hinausgehen. Jedes dieser Verfahren kennt eine feste Anzahl von Optionen – eine davon muss ich wählen. Tue ich das, so übernehme ich automatisch die Bedeutungen, die damit verknüpft sind. Dies ist noch aus einem anderen Grund wichtig. Viele visuelle Elemente werden ja mit der Absicht eingesetzt, zu beeinflussen, zu rühren, zu überzeugen, sie sind also Teil der persuasiven Kommunikation. Die subtilen Möglichkeiten der Kommunikation und der Beeinflussung liegen auch in der Art, wie ein Inhalt dargestellt wird.
Der Philosoph Robert Pfaller zitiert in seinem Buch Die blitzenden Waffen den antiken Rhetoriker Quintilian, der die Kunst des Redners, also einer Person, die zu beeinflussen sucht, so definiert: »Der Redner muss nicht nur mit scharfen Waffen kämpfen, sondern auch mit blitzenden«.5 Um dieses »Blitzen« geht es: Wie richtet man eine Botschaft so her, dass sie nicht nur rational richtig, sondern emotional »einleuchtend« ist? Dies ist ohne die geschickte Handhabung der Formen, derer sich visuelle (und jede) Kommunikation bedient, nicht möglich.
Visuelle Kommunikation – wie jede Sprache, wie jeder Code – kennt Regeln und Verfahren, aus denen sie wählt und die sie zur Vermittlung von Botschaften einsetzt.6 Begabte Kommunikatoren handhaben diese Regeln unbewusst, es ist aber immer nützlich, sie zu kennen und sie als Optionen zur Gestaltung oder Beurteilung vor Augen zu haben.
Wir wollen im Folgenden zuerst diese Basisverfahren beschreiben und dann darlegen, wie sie eingesetzt werden, um bestimmte Codes zu etablieren – den Code des Sakralen, den Code der Intimität etc. – oder um visuelle Identitäten aufzubauen.
[13]Um noch einmal die Position des Buches zu beschreiben: Es ist kein Buch, das sich mit der Wirkung auf Rezipienten beschäftigt, das also feststellt, dass bestimmte Zeichenarrangements nachweislich bestimmte Wirkungen auf Rezipienten haben, die etwa über experimentelle Verfahren festgestellt werden können. Ich referiere hier zwar aus meinen Erfahrungen, stelle aber die eigentlichen Prüfverfahren nicht dar. Rezeption ist ein komplexes Phänomen: Rezipienten können die intendierte Botschaft explizit entnehmen oder nur vorbewusst, sie können sie nur zum Teil entnehmen oder sie können auch widerständige Lesarten wählen, sie können sie positiv oder negativ bewerten etc.
Ich stelle vielmehr dar, ob ein visueller Text sinnvoll oder raffiniert konstruiert ist, wenn er eine bestimmte Bedeutung vermitteln möchte. Liegen hier Fehler vor oder werden Optionen nicht beachtet, so werden wesentliche Mechanismen der Kommunikation außer Acht gelassen, noch bevor sich Rezipienten dazu äußern.
Das Kommunikationsmodell Sender – Text – Rezipient
Um unser Anliegen in ein ganz einfaches Kommunikationsmodell einzuordnen: Sender – Text – Rezipient In dieser Kette, die in dieser Einfachheit des Einwickelns und Auswickelns naturgemäß so nicht stimmt, konzentrieren wir uns weitgehend auf den visuellen Text, also auf den Teil, in dem der Sender seine Botschaft gestaltet. Text meint hier die Nachricht, die kommunikative Einheit, in der Marktkommunikation z. B. Anzeige, Film, Website etc., die sich verschiedener Zeichensysteme bedient: verbaler Text, Bilder, visuelle Gestaltung allgemein.
Der Sender ist derjenige, der den Text verantwortet. In der Marktkommunikation können das zwei Instanzen sein: der Auftraggeber, also z. B. das Unternehmen, das ein bestimmtes Produkt verkaufen will, und die Agentur, die dazu eine Anzeige oder eine Website entwirft. Die Person, die den Text beauftragt, muss wissen, was sie eigentlich kommunizieren und aussagen will. Sie legt fest, welche Bedeutung vermittelt werden soll. Der Gestalter des Textes überlegt sich, wie er diese Botschaft kommuniziert. Dabei ist es wesentlich, sich immer wieder an eine elementare Tatsache zu erinnern: Was zählt, ist nicht die Absicht des Senders, das, was er mitteilen möchte, sondern was zählt, ist die Art, wie es dargestellt wird. Nur das nimmt der Rezipient wahr, nicht die Absicht des Senders.
Abb. 2: Das neue Logo von Berlin, 2020
Dieses Logo für die Stadt Berlin wurde 2020 zusammen mit einer Imagekampagne entwickelt, um die Werte, die die Stadt Berlin kennzeichnen, zu kommunizieren. Michael Müller, [14]bis 2021 der Regierende Bürgermeister von Berlin, stellte diese Werte in einer Pressekonferenz vor: »Berlin ist eine Stadt der Freiheit, der Toleranz und Vielfalt. Im neuen Markenauftritt des Landes geht es darum, neben der gelebten individuellen Vielfalt auch das zu betonen, was uns Menschen in Berlin miteinander verbindet. Und weiter: Es geht nicht nur um ein Logo, sondern um die Haltung der Stadt ihren Bürgern und Bürgerinnen gegenüber.«
Vermittelt dieses Logo, das aus eingegrenzten, voneinander getrennten Elementen besteht, auch nur annähernd diese Werte?
In vielen Unternehmenskommunikationen gibt es ähnliche Beispiele. So untersuchten wir vor Kurzem ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, für seine Keksprodukte ausschließlich naturbelassene Rohstoffe zu verwenden und diese in sehr behutsamen Verfahren weiter zu verarbeiten. Die zentralen Werte, die in allen Broschüren propagiert wurden, waren Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Natürlichkeit. Und was zeigte der Unternehmensfilm? Fast ausschließlich die Maschinen und die Förderbänder, auf denen die Produkte wie in der industriellen Produktion üblich nacheinander über die Bänder liefen.
Die Rezipienten der Botschaften kommen aber in vielfältiger Weise ins Spiel, auch abgesehen von ihren konkreten Bewertungen eines Textes. Ich kann bei jeder visuellen Darstellung feststellen, auf welches Wissen von Rezipienten angespielt wird, was ich also bei einem Rezipienten voraussetzen muss, damit er ein Bild versteht. Dies ist nicht nur das faktische Wissen. So wird in unserem Foto Parisian Breakfast (Abb. 1) z. B. allgemein angenommen, dass die Handtasche einer Frau gehört, obwohl diese nicht abgebildet ist. Nur Frauen tragen in unserer Kultur Handtaschen. Ebenso wissen wir, dass der Gast das Croissant mit Marmelade bestrichen hat, Kellner tun das meist nicht.
Rezipienten »wissen« aber natürlich viel mehr – im Grunde ruft jede kommunikative Äußerung, jeder »Text« die Denkmuster einer Gesellschaft ab. Wir haben ziemlich feststehende Vorstellungen davon, was profan ist oder elitär, was weiblich oder männlich ist, was oben oder unten in unserer Gesellschaft bedeutet. Texte können diese Vorstellungen bestätigen oder sie können ihnen widersprechen, aber dieser ideologische Unterbau ist immer vorhanden und er bietet eine wichtige Quelle, um visuelle Äußerungen zu gestalten. Wir werden diesen Punkt ausführlich in Kapitel 5.5 über kulturelles Wissen behandeln. Wir wollen unsere Interpretationen an diesem Punkt auch nicht weiter vertiefen und die Mechanismen beschreiben, die hier natürlich auch die Machtmechanismen unserer Gesellschaft betreffen. Wem dient es, wenn bestimmte Sachverhalte in bestimmter Weise dargestellt werden? Diesem Punkt wenden sich umfangreich die Cultural Studies zu.7
[15]Kommunikationswissenschaftler würden sagen, dass sich die Bedeutung eines Textes erst dann ergibt, wenn die gesamten Interpretationen von Rezipienten einbezogen werden, dass sich also Bedeutung in der Interaktion zwischen Text und Rezipient herstellt. Wir behandeln davon jedoch nur den ersten Teil des Arrangements: Welche Möglichkeiten haben Bilder, ihre Botschaften zu formulieren? Aus welchen Repertoires können sie schöpfen? Sind einige Repertoires vielleicht geeigneter als andere, um bestimmte Botschaften zu transportieren? Diese Botschaft kann der Sender verbal und visuell eben ganz verschieden gestalten, es gibt glücklichere Lösungen und unglücklichere. Dies ist durch semiotische Analyseverfahren zu beschreiben, noch bevor ein Rezipient befragt wird.
Semiotische Analysen
In diesem Buch wird immer wieder die Rede von Codes sein, von Zeichen, von syntaktischen Verfahren etc. Dies sind Begriffe, die aus der Disziplin der Semiotik stammen, also der Lehre von den Zeichensystemen. Viele Analysen, die wir im Folgenden durchführen, sind semiotische Analysen. Sie beschreiben, welche Bedeutung vermittelt wird, indem bestimmte Zeichen ausgewählt und kombiniert werden, gleich ob der Sender diese Bedeutungen vermitteln möchte oder nicht und oft auch unabhängig davon, ob Rezipienten diese Bedeutung voll bewusst entnehmen. Dennoch besteht sie. Und in Experimenten konnte auch gezeigt werden, dass Zeichen sehr wohl wirken, auch wenn man sie nicht explizit wahrnimmt.8
Zunächst eine kurze Erklärung zum Begriff der Semiotik Wir kommunizieren nicht durch Gedankenübertragung. Um miteinander zu kommunizieren, müssen wir eine Sprache benutzen. Wir müssen sprechen oder lesen oder etwas zeigen etc., wir müssen in jedem Fall wahrnehmbare Elemente austauschen. Jede Sprache stützt sich auf beobachtbare Elemente, Worte, Bilder, Geräusche etc. Dies sind die Zeichen, die zur Kommunikation benutzt werden. Dass dies überhaupt möglich ist, dass wir also z. B. als Konsequenz der Lautfolge »Bitte mach die Tür zu« hingehen und eine Tür schließen, liegt daran, dass diese Einzelzeichen auf höchst komplizierte Weise zu Systemen geordnet sind, die strikte Regeln kennen. Regeln, die der Einzelne nicht verändern kann.
Mit dem Aufbau dieser Systeme beschäftigt sich die Semiotik, also die Lehre von den Zeichensystemen. Die natürliche Sprache, die wir sprechen, ist eine besonders gut erforschte Variante eines solchen Zeichensystems. Die Zeichen sind hier Laute, Silben, Buchstaben, Worte. Es handelt es sich also um die Beschreibung des verbalen Codes. Semiotik aber untersucht jedes Zeichensystem, gleich auf welchen Zeichen es beruht.
Nehmen wir ein Beispiel für ein ganz einfaches Zeichensystem, die Verkehrsampel. Sie beruht auf drei Zeichen: der Farbe Rot, der die Bedeutung halten zugeordnet ist, Grün [16]mit der Bedeutung fahren und Gelb mit der Bedeutung warten Erlaubt ist die Abfolge: rot-gelb-grün, aber nicht rot-rot-gelb-grün.
Die Bedeutungen müssen in diesem System strikt in Verhalten umgesetzt werden, bei Rot muss man anhalten, bei Grün fahren.
Dies zeigt die drei zentralen Aspekte von Zeichensystemen:
Semantik: Was bedeuten die Zeichen?Syntax: Wie kann ich sie kombinieren?Pragmatik: Was muss ich beim Empfänger voraussetzen?In unserem Fall muss ich voraussetzen, dass Fahrer nicht farbenblind sind, aber auch, dass sie alle Schulungen durchlaufen haben, die ihnen die Besonderheit dieses Zeichensystems gelehrt haben, und ebenso ist dies ein System, in dem die Teilnehmer gezwungen werden, die Bedeutungen direkt in Verhalten umzusetzen, sonst funktioniert es nicht. Die Verkehrsampel benutzt die Farben als Zeichen, und sie kann nur eine sehr eingeschränkte Anzahl von Botschaften vermitteln.
Wenn wir im Folgenden visuelle Codes betrachten, also die Möglichkeiten, durch Bilder generell Bedeutungen zu vermitteln, so betreten wir ein höchst komplexes Gebiet, das sich aber dennoch beschreiben lässt und das klar macht, welche raffinierten Möglichkeiten es bereithält, durch Auswahl und Kombination von Zeichen Bedeutungen zu vermitteln, ohne dass sich Rezipienten darüber rational im Klaren sind.
1 Dieser Begriff wurde durch den Literaturwissenschaftler W. J. T. Mitchell in die wissenschaftliche Debatte eingebracht und bezeichnet die Allgegenwart und die zunehmende Macht des Visuellen (vgl. Mitchell, W. J. T.: Bildtheorie, Frankfurt 2008, und Böhm, Gottfried: Was ist ein Bild?, München 2001 Ebenso Maar, Christa; Burda, Hubert: Iconic Turn, Köln 2004.
2 Schankweiler, Kerstin: Bildproteste/Digitale Bildkulturen, Berlin 2020, S. 11.
3 Borstnar, Nils; Pabst, Eckhard; Wulff, Hans Jürgen: Einführung in die Film- und Fernsehwissenschaft, UTB, Stuttgart 2002.
4 Kress, Gunter; van Leeuwen, Theo: Reading Images, Routledge, New York 2006.
5 Pfaller, Robert: Die blitzenden Waffen, Frankfurt a. M., 2020.
6 Im Sinne der Semiotik wird hier das Phänomen Langue und Parole beschrieben. Dieses Konzept geht auf Ferdinand de Saussure zurück: Langue bezeichnet die Menge der Regeln, Repertoires und Verfahren, die eine bestimmte Sprache kennt, also das ganze System der Sprache, Parole stellt die Wahl aus diesen Repertoires dar, sie ist die einzelne Äußerung (vgl. Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1967 (original 1916).
7 Hönig, K.; Winter, R. (Hrsg.): Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Voraussetzung, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1999 Stuart Hall u. a.: Representations and Signifying Practices, Sage 1997.
8 Kahneman, D.: Schnelles Denken, langsames Denken, München 2012, S. 78.
Prinzipien der Bildanalyse
Von dem Kunstwissenschaftler Erwin Panofsky stammen drei Fragen, die er an den Anfang jeder Bildanalyse stellt.9 Sie lauten in vereinfachter Form:
Was wird dargestellt?Wie wird es dargestellt?Was ist zum Verständnis notwendig?In unserem Bild Parisian Breakfast wird eine Frühstücksszene dargestellt: Wir wissen das, weil die Zusammenstellung einer Tasse mit Kaffee und einem Croissant mit Marmelade abruft, dass es sich hier um ein Frühstück handelt und nicht etwa um ein Abendessen. Sowohl Kaffee wie Croissant sind die visuellen Trigger, also die charakteristischen Zeichen, welche die Situation charakterisieren. Der verbale Code bestätigt [17]diesen Eindruck: Es ist ein Parisian Breakfast Dass es in einem Outdoorcafé stattfindet, sehen wir an dem kleinen Kaffeehaustisch und vor allem an den Korbsesseln, die im Innenraum eher unüblich sind.
Das ganze Bild enthält auch eine Dimension, die Hochwertigkeit signalisiert. Neben der Kaffeetasse steht eine Flasche mit Wasser, das Croissant liegt auf einem kleinen Porzellantablett, das von einer Serviette bedeckt ist, und natürlich die Handtasche – auch wenn man nicht weiß, wie viel sie wirklich kostet, ahnt man: Sie ist schön und sie ist besonders. Oder anders gesagt: Die Hochwertigkeit der Umgebung strahlt auf die Handtasche aus.
Und wie erkennen wir die kleine Geschichte, die dieses Bild erzählt? Nämlich die Tatsache, dass dieses Bild ein Vorher und ein Nachher besitzt? Aus dem angebrochenen und halb bedeckten Croissant. Jemand muss es beschmiert haben und er wird es dann wohl auch verzehren.
In einer zweiten Schicht wird noch eine andere Geschichte erzählt: Die Handtasche ist ein Attribut von Tiffany, sie vertritt Tiffany am Tisch und sie deutet auf eine sehr geschmackvolle Person hin, das wissen wir aus einer ganzen Reihe von Bildern, die sie laufend postet.
Damit wird ein Verfahren angesprochen, das im Bereich der Kommunikation in den sozialen Netzwerken eine große Rolle spielt: Viele Bilder werden dort in der Absicht gepostet, Follower zu generieren, d. h. eine besondere Beziehung zwischen dem Sender des Bildes und dem Betrachter herzustellen, den Eindruck zu erzeugen, man würde unmittelbar an dem Leben der abgebildeten Person teilnehmen. Wir werden die Verfahren, die dabei angewandt werden, in Kapitel 11.1 behandeln.
Auch über das Wie der Darstellung lässt sich einiges aussagen: Das Bild ist in einer leichten Obersicht aufgenommen, es zeigt einen stark akzentuierten Vordergrund und lässt auf der Hinterbühne eine Fortsetzung des vorderen Ensembles vermuten. Es ist von runden Formen dominiert, nur das Tablett und die Handtasche, die leicht verschoben im Mittelpunkt steht, sind eckig. Das Bild ist im Stil einer Gelegenheitsfotografie oder Reportage, jedenfalls einer Amateurästhetik fotografiert, was ihm Authentizität gibt.
Und warum vermittelt das Bild ein so attraktives Lebensgefühl? Weil es Parisian Breakfast heißt. Diese wesentliche Information ist dem verbalen Code überlassen, die visuell gezeigten Croissants sind zwar auch ein Zeichen von Paris, aber Croissants gibt es ja inzwischen überall.
[18]Und warum ist das so nett? Weil Paris immer noch eine Fülle positiver Assoziationen abruft: Die Stadt der Eleganz, des Lebensstils, der Liebe – Paris ist die Bühne, die Cafés und Plätze bereithält, auf denen sich schicke Frauen präsentieren können.
Wir haben hier alle Aspekte versammelt, die in den Kommunikationsstrategien von Bildern eine Rolle spielen: Diese Strategien wählen auf einer vertikalen Achse aus möglichen Zeichenrepertoires diejenigen, denen sie ihre spezifische Botschaft anvertrauen: Man hätte das Wasser auch in einem Plastikglas zeigen und das Croissant auf einen einfachen Teller legen können. Und sie kombinieren sie auf einer horizontalen Achse zu einem Ensemble, sie stellen sie in einen Kontext: eine Frühstücksszene in einem Straßencafé. Darin ist ein Element eingefügt, das ein Vorher und Nachher vermittelt, also eine Geschichte erzählt: das angebrochene Croissant.
Kommunikationsstrategien verwenden eine spezifische Kombination von verbalem und visuellem Code. Der verbale Code fügt dem Bild eine Bedeutung hinzu, reichert es an: Parisian Breakfast. Dass diese Kombination eine Wirkung entfaltet, ein spezifisches Lebensgefühl vermittelt, liegt daran, dass dadurch an kulturelles Wissen angeknüpft wird, an die Wissensbestände, die Frames und Rahmungen, über die wir als Angehörige dieser Kultur verfügen und die über geeignete Trigger abgerufen werden können – der Rahmen ist hier Paris.
Selbstverständlich gibt es hier keinen »Autor«, der sich das alles überlegt und alles so arrangiert hat. Tiffany hat einfach ein Foto geschossen. Aber genau das ist das Wesentliche an semiotischen Analysen: Es geht nicht darum, was sich der Autor oder »Sender« denkt, sondern es geht darum, was das Zeichenensemble zeigt – was freilich nicht heißt, dass man sich nicht bewusst überlegen kann, wie man etwas kombinieren könnte, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Dazu sollen die folgenden Ausführungen einen Beitrag leisten.
9 Panofsky, E.: Ikonographie und Ikonologie. In: Kaemmerling, E. (Hrsg.): Bildende Kunst als Zeichensystem. Ikonographie und Ikonologie. Band 1: Theorien – Entwicklung – Probleme. Köln 1994, S. 207 – 225.
Die magischen Qualitäten von Bildern
Eine spezifische Besonderheit des visuellen Codes, also der Vermittlung durch visuelle Elemente bzw. Bilder, ist es, dass ihm eine hoch manipulative Kraft zugeschrieben wird und zwar als Code per se. Diese Behauptung findet sich dem verbalen Code gegenüber nicht, dort nimmt man dies erst bei spezifischen Ausformungen an.
»Bilder verleiten Menschen dazu, Unvernünftiges zu tun«, sagt etwa William John Thomas Mitchell (2008). Der behauptete Iconic Turn (vgl. Maar, Burda 2004) beruht ja darauf, dass immer mehr versucht wird, wesentliche Inhalte durch Bilder, nicht durch verbale Ausführungen zu vermitteln. Die dadurch bedingte Bilderflut bzw. die Reduktion wesentlicher Inhalte auf Bilder, so wird von Kulturkritikern immer wieder beklagt, [19]führt dazu, dass wir immer unfähiger zur Reflexion werden und der Suggestivkraft von Bildern zunehmend unterliegen.
In diesen Diskussionen wird also das Bild dem Wort gegenübergestellt und dem Bild wird die Rolle des Verführers und Manipulators zugewiesen, der eine große Wirkmacht besitzt, da er sich offenbar an Gefühle wendet und glauben macht, hier werde etwas unmittelbar gezeigt (»Ich habe es mit eigenen Augen gesehen«).
Wie wir sehen werden, ist der visuelle Code tatsächlich schwer in der Lage, Argumentationsfiguren anzubieten: Er kann nicht Verneinungen darstellen, Fragen, Befehle, Bedingungen, spezifische Zeitzustände etc., er besitzt ganz andere Möglichkeiten. Diese bestehen im Kern darin, dass gut gemachte Bilder Emotionen ansprechen, dass sie selten rational zergliedernd dekodiert, sondern ganzheitlich emotional verarbeitet werden. Auf dieser Ebene kommt ihnen tatsächlich eine besondere Wirkmacht zu. Diese kann geradezu magische Aspekte annehmen, wie wir weiter unten ausführen werden. Bilder sind aber auch geeignet, kollektive Reaktionen auf ein soziales, politisches oder gesellschaftliches Problem herbeizuführen, das erst in einer spezifischen visuellen Verdichtung Betroffenheit auslöst und etwas verdeutlicht, das verbale Appelle allein nie leisten könnten.
Kia Vahland in der Süddeutschen Zeitung vom 17 März 2021 beschreibt das so: »Ein Skandal ohne Bild erscheint Medienbenutzern vielleicht als real, aber nicht als relevant.« Man wusste, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertranken, aber erst das Bild des ertrunkenen Buben am Strand machte emotional betroffen. Man wusste, dass Trump Flüchtlinge an der mexikanischen Grenze unmenschlich behandelte, aber erst das Bild des schreienden kleinen Mädchens stimmte selbst seine Anhänger um.
Es gibt die Meinung, dass das Bild des nackten kleinen Mädchens, das schreiend flieht, eigentlich den Vietnamkrieg beendete (Foto: Nick Ut, Napalm Girl, 08.06.1972).
Jeder, der auf dem Markt der Aufmerksamkeit agiert, weiß, dass er sich um diese Wirkmacht der Bilder bemühen muss. Diese Diskussion und diese Zuschreibung einer besonderen visuellen Wirkmacht haben eine lange Geschichte, ebenso wie die Ablehnung von visueller Kommunikation.10
Bildern und visuellen Darstellungen wurden in vielen Gesellschaften und in vielen Epochen magische Wirkungen zugeschrieben. Dabei sind zwei Aspekte zu unterscheiden: Das Bild selbst ist »beseelt« und es hat eine besondere Wirkmacht. Stammesgesellschaften bezeichneten diese Kraft, die dem Bild innewohnt, mit einem eigenen [20]Namen, Mana oder Orenda. Die Felsenbilder in den Höhlen von Lascaux sind nicht künstlerische Darstellungen oder nette Gestaltungen von Innenräumen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit ein magischer Jagdzauber. Die Darstellung des Wildes zitiert quasi das reale Bild herbei.
Wir kennen aus vielen Gesellschaften Totems, Fetische, Götterstatuen, die kultische Verehrung genießen. Ausgebaut ist dieser Kult etwa in den ägyptischen Götterstatuen, die in den Tempeln wie reale Körper gesalbt, gebadet, gespeist wurden und die dadurch den Gläubigen ihre Gnade zukommen ließen. Ebenso kannte das Mittelalter Bildnisse von Heiligen, speziell der Mutter Gottes, die wie lebende Personen verehrt und in Kriegszeiten und Krisen in einer Prozession durch die Stadt getragen wurden, um Unheil von der Stadt abzuwenden, so etwa die Ikone Nicopeia in Venedig.11
Wir finden dies in vielen europäischen Gnadenbildern, den Ikonen, und auf politischer Ebene in den antiken Kaiserkulten. Das Bild bzw. die Statue des Kaisers wurde im ganzen Römischen Reich verbreitet und die Untertanen hatten ihm Verehrung zu zollen, sonst wurden sie nicht als Staatsbürger anerkannt. Die Statue war gleichsam der Kaiser. Was Christen dann in große Bedrängnis brachte, weil sie nur Gott verehren durften. Diesem Phänomen liegt ein gemeinsamer Mechanismus zugrunde: Man nimmt an, dass das Abgebildete im Bild gegenwärtig ist. Semiotisch gesehen, werden Zeichen und Bezeichnetes vermischt.
In der Semiotik, also der Lehre von den Zeichensystemen, unterscheidet man zwischen dem Objekt in der Realität (dem Bezeichneten, dem Referenten) und dem visuellen oder verbalen Zeichen, mit dem es bezeichnet wird. Die Lautfolge HUND ist das verbale Zeichen, das ein Objekt der Realität signalisiert: ein Säugetier, das bellt, mit dem Schwanz wedelt, in verschiedenen Rassen vorkommt – ein Hund eben. Dass dieses Tier im Deutschen mit der Lautfolge HUND bezeichnet wird, ist rein willkürlich, es ist eine Festsetzung des deutschen Sprachcodes. Im Englischen wird es mit der Lautfolge DOG benannt. Ebenso kann man das Tier mit einem Bild verdeutlichen.
Der Referent, das Tier Hund, bleibt immer gleich, nur die Zeichen ändern sich, und es ist allen Beteiligten klar, dass Zeichen und Hund etwas ganz Verschiedenes sind. Niemand würde glauben, die Lautfolge HUND sei ein Hund oder das Bild eines Hundes sei ein Hund und müsse demnach gefüttert werden. Im Fall der Bilder mit Wirkmacht geschieht aber genau das. Das Bild ist die heilige Person, Zeichen und Referent sind eins.12
Dies sei kurz an dem Beispiel der Ikonen erläutert. Ikonen sind frühe religiöse Bilder, denen eine besondere kultische Verehrung zukam und die als wundertätig betrachtet [21]wurden. Besonders bekannt sind russische Ikonen.13 Ikonen werden als Vera Icon betrachtet. Man nimmt an, dass die dargestellte Heilige oder die Gottesmutter die Hand des Künstlers geführt hat bzw. dass sie bei dem Akt der Darstellung in das Bild eingetreten ist, dass ein Teil des Göttlichen also dem Bild innewohnt und das Bild heilig, lebendig und mächtig ist und eben eine besondere Wirkmacht, hier eine Gnadenwirkung entfaltet. Diese Vorstellung geht auf das Mandylion zurück, von dem man glaubte, es zeige das Gesicht Christi.
Auch das Turiner Grabtuch knüpft an diese Vorstellung an. Es wurde angenommen, dass dieses Leinentuch das wahre Gesicht Christi zeigte. Er selbst hatte sein Gesicht in das Tuch gedrückt und die heilige Veronika hatte das Tuch aufbewahrt. Dies bedeutet, dass dieses Bild nicht gemalt wurde, sondern dass es eine direkte Wiedergabe des Göttlichen war, dass ein Teil des Göttlichen darin lebte. Daher konnte es im Übrigen auch mehrfach reproduziert werden, das Göttliche übertrug sich quasi durch Berührung.
Einer Ikone wurde immer die Aura des »Authentischen, Wahren und Wundertätigen« zugeschrieben.14 Heutige Bildproduzenten würden sich wünschen, Bilder mit einer solchen Wirkmacht zu schaffen, aber naturgemäß fehlt uns die kultisch-magische »Grundeinstellung« Wie wir in Kapitel 6.1 sehen werden, ist es aber möglich den Code des Sakralen zu benutzen, der darauf abzielt, Gegenstände visuell so zu inszenieren, dass sie an diese magischen Wirkungen anknüpfen. Dass wir Bildern aber eine sehr spezifische Abbildungsfunktion zuschreiben, zeigt sich an der Tatsache, dass sich die meisten Menschen scheuen, dem Bild einer bekannten Person die Augen auszustechen.
Auch die Vorstellung, dass Bilddarstellungen gefährlich sind, Denken verhindern und dass man mit der Zerstörung von Bildern auch das Dargestellte, den Referenten, zerstört, hat eine lange Geschichte und findet sich bis in die Gegenwart. Wir sehen auch heute diese Akte der Bildzerstörung, etwa in den Handlungen des IS oder dem Umstürzen der Statuen von Saddam Hussein oder von Sklavenhaltern oder den Fahnenverbrennungen.
Exemplarisch für diese Argumentation ist die Geschichte von Moses und Aaron. Aaron fertigt das Goldene Kalb an, eine visuelle Darstellung der göttlichen Kraft, wogegen Moses dem Verbot Gottes folgt: »Du sollst Dir kein Bildnis von mir machen!« – Er hat Gott auf seiner Seite.
Der Bilderstreit beschäftigte die Theologie über Jahrzehnte. Darf man sich ein Bild Gottes machen?15 Dieser Bilderstreit hat in der Auffassung Luthers für unsere Gesell[22]schaft bedeutende Konsequenzen. Nur das Wort allein, also das Studium der Schrift, führt nach Luther zum wahren Glauben, nicht die Überwältigung durch sinnliche Eindrücke, durch die suggestiven, visuellen Inszenierungen des Katholizismus. Diese Auffassung stellte für die Kirchenausstattung der protestantischen Kirchen ein ziemliches Problem dar – etwas musste man ja auf den Altären darstellen. Dabei erfand man sogenannte Textaltäre. Schrift ersetzte hier das Bild.
Abb. 3: Textaltar – Schrift ersetzt das Bild
Wir finden diese Textaltäre heute noch in der (werblichen) Kommunikation von Berufen oder Instanzen, die sich als reine Vertreter von vernunftgesteuerten Entscheidungen definieren, also Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Ämter, Steuerberater (vgl. dazu Kapitel 6.6, in dem der wissenschaftliche und der bürokratische Code analysiert wird). Sie alle vermeiden strikt, einen wesentlichen Teil ihrer Botschaft dem visuellen Code anzuvertrauen.
Wenn ein solches Verfahren für die Darstellung von Luxusuhren verwendet wird, so soll damit signalisiert werden, dass sich diese Anzeige an Connaisseurs wendet, die [23]an den technischen Funktionen einer Uhr interessiert sind, nicht an ihrem Prestigewert. Auch Unternehmen, die im Kern auf hedonistische Werte setzen, greifen dann schwerpunktmäßig zu verstärkter verbaler Kommunikation, wenn es darum geht, sich als verantwortungsbewusst zu präsentieren.
Die heutigen Klagen der Kulturkritiker haben also eine lange Vorgeschichte, aber diese Diskussion zeigt auch, dass in dieser Dimension von Bildern, sich nicht an die Reflexion zu wenden (wozu sie aufgrund ihrer Zeichenkonstruktion auch schwer in der Lage sind), eine große Chance liegt, wenn man visuelle Inszenierungen von besonderer Suggestionsmacht schaffen möchte – man kann durch den visuellen Code Bedeutungen vermitteln, die man in dieser Form nie verbal kommunizieren könnte. Andrerseits ergibt sich dadurch auch eine spezifische Chance für den verbalen Code. Wird er bewusst anstelle des Visuellen gesetzt, so weist er automatisch auf Seriosität, Reflektiertheit, Rationalität hin.
Es gibt jedoch noch eine andere Seite dieses Iconic Turns Visuelle Einheiten sind ja nicht nur Bilder, die dem Diktat der betörenden Suggestion folgen, sondern auch sehr einfache Bildzeichen – und diese nehmen in dem Typ der Kommunikation, der im Internet erfolgt, einen breiten Raum ein. Einerseits über die zahllosen Fotos, die pausenlos gepostet werden – und zwar um miteinander zu sprechen, um Follower zu generieren, um Authentizität zu signalisieren (vgl. Kapitel 11), andererseits über den breit eingesetzten Bereich der Emoticons. Dafür gibt es sogar eine eigene Abteilung am Mobiltelefon. Man verwendet sie, um einer Botschaft eine kleine emotionale Komponente hinzuzufügen. Sie sind also Affektschablonen, die es uns ersparen, Gefühle verbal auszudrücken, was viel mehr Geschicklichkeit erfordern würde.
Christoph Türcke schließt an diese Gegebenheit eine interessante Analyse an. In unserer abendländischen Geschichte kannten wir ja schon einmal eine Schrift, die sich ausschließlich auf Bildzeichen stützte – die sumerische und dann ägyptische Bilderschrift, die also etwa Schaf nicht alphabetisch abbildete, sondern über das schematisierte Bild eines Schafes.16
Warum wurde diese Schrift aufgegeben und durch alphabetische Schriften ersetzt? Genau aus dem Grund, weil dieser einfache visuelle Code eben etwas nicht kann: Er kann nicht per se Handlungen und Sachverhalte ausdrücken wie etwa gebieten, aushandeln, verwalten