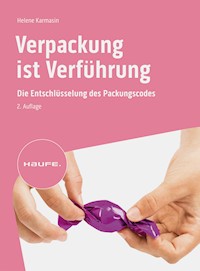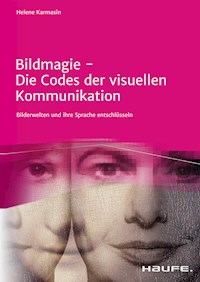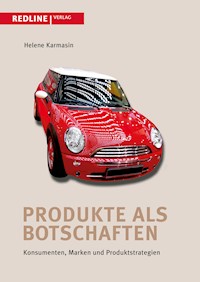
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bedeutungsaufbau statt leerer Worte: gehaltvoller Ideengeber rund um Produkt-Messages. Was macht Produkte erfolgreich? Wer kein klares Profil für seine Ware vor Augen hat, braucht diesen Marketingklassiker: Jetzt neu aufgelegt mit aktuellen Markt- und Medienanalysen sowie verblüffenden Erkenntnissen aus der Motivationspsychologie. Helene Karmasin zeigt, wie Vermarktungsprofis ihre Objekte einmalig... mehr Bedeutungsaufbau statt leerer Worte: gehaltvoller Ideengeber rund um Produkt-Messages. Was macht Produkte erfolgreich? Wer kein klares Profil für seine Ware vor Augen hat, braucht diesen Marketingklassiker: Jetzt neu aufgelegt mit aktuellen Markt- und Medienanalysen sowie verblüffenden Erkenntnissen aus der Motivationspsychologie. Helene Karmasin zeigt, wie Vermarktungsprofis ihre Objekte einmalig gestalten, ihnen einen starken Auftritt verschaffen und sie von der Konkurrenz abheben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Helene Karmasin
Produkte als Botschaften
Helene Karmasin
Produkte als Botschaften
Konsumenten, Marken und Produktstrategien
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Nachdruck 2012
© 1998 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Ina Spross, Landsberg am Lech
Satz: Jürgen Echter, Landsberg am Lech
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN Print 978-3-86881-409-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-371-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-795-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
eBook by ePubMATIC.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Teil A Der Konsument
1 Zum Verhältnis Marketing-Marktpsychologie Einflussgrößen des Konsumentenverhaltens
2 Der Zugang der Psychologie
2.1 Homo oeconomicus und das Konsumäffchen Implizite Psychologie und Anthropologie
2.2 Verhaltenstheorien und Motivationspsychologie
3 Verhaltensabläufe und Verhaltensmechanismen Prozessorientierte Modelle
3.1 Allgemeine Annahmen und Ergebnisse
3.2 Die Reizsummenregel Antriebe und Anreize
3.3 Exkurs: Psychologie des Wohlstandes
3.4 Pleasure stamps in, pain stamps out Konditionierungstheorien
3.5 Erwartungs-Werttheorien
3.6 Lernen am Modell Imitationsverhalten
3.7 Zusammenfassung: ein Verhaltensmodell
4 Inhaltsorientierte Motivtheorien
4.1 Einleitung
4.2 Die Theorie Freuds
4.3 Maslow: die Bedürfnispyramide
4.4 Das Motivkonzept der Psychologie
5 Schubkräftige Motive und Werte im Bereich der Konsumkultur
5.1 Einleitung
5.2 „Ich möchte geliebt werden“ Der Wunsch nach einem emotionalen Partner
5.3 Erotik, sexuelle Attraktivität
5.4 Angst
5.5 Leistung
5.6 Kognitive Bedürfnisse
6 Zielgruppen
6.1 Wer ist meine Zielgruppe?
6.2 Merkmale zur Beschreibung von Zielgruppen
6.2.1 Merkmale, die nahe an der Produktverwendung liegen
6.2.2 Soziodemographische Merkmale
6.2.3 Merkmale, die soziodemographische Merkmale ergänzen: Werthaltungen, Lebensstile und Lebenswelten
6.3 Zusammenfassung und Folgerungen
Teil B Methoden
1 Bestimmung der Methode
2 Verfahren, Befragungsinventare, Beispiele
2.1 Befragungsabhängige Verfahren
2.2 Befragungsunabhängige Verfahren
3 Exkurs: Werbemittelanalysen
Teil C Das Phänomen der Bedeutung Semiotik, kognitive Psychologie, Sprachpsychologie
1 Der Beitrag der kognitiven Psychologie
2 Grundbegriffe der Semiotik
3 Verstehen – Abspeichern – Abrufen von Bedeutung Die Grenzen des Bewusstseins
4 Verstehen, Merken, Abrufen aus der Sicht der kognitiven Psychologie und der Linguistik/Semiotik
5 Typen von Wissensrepräsentationen
5.1 Hierarchische Modelle, Prototypen
5.2 Frame of reference Selegieren, Benützen und Kombinieren von Bezugsrahmen
5.3 Der Begriff des Paradigmas
6 Der Begriff der Kohärenz
7 Vernetzung durch multidimensionale Codierung, Bild-Text-Relationen, Imagery und Labeling
8 Zusammenfassung Günstige Verarbeitungsprinzipien
Teil D Produkte als Botschaften
1 Einleitung Produkte als Botschaften. Was bedeutet das?
2 Produkte als Ausdruck kultureller und ideologischer Werte und Ordnungsmuster
2.1 Der Zugang der Kulturanthropologie
2.2 Der Zugang des Strukturalismus Die Mythenanalysen/Claude Lévi-Strauss
2.3 Der Zugang der Handlungs- und Systemtheorie
2.4 Die Psyche des Konsumenten Welchen Menschen braucht die Konsumkultur?
3 Funktionen auf dem Markt Positionierung und Profilierung
3.1 Gebrauchswerte und Tauschwerte
3.2 Profilierungsstrategien
4 Bedeutungen und Funktionen von Produkten
4.1 Was können Produkte bedeuten? Ein Beispiel: Der Geburtstagskuchen
4.2 Funktionen von Produkten
4.2.1 Die instrumentelle Funktion
4.2.2 Die ökonomische Funktion Der Code des cleveren Konsumenten
4.2.3 Expressive, distinktive, soziale Funktionen „Die feinen Unterschiede“
4.2.4 Die normative Funktion
4.2.5 Die ästhetische Funktion
4.2.6 Stabilisierende und stimulierende Funktionen
4.3 Erläuterung der Funktionen am Beispiel des Zahnpflegemarktes
5 Strategien der Wertsteigerung
5.1 Prime value – labor value – symbolic value
5.2 Ein Beispiel: Positionierung einer Marke im Bereich vorgefertigter Backwaren
6 Produkte als Träger kultureller Klassifikationen Basiscodes
6.1 Funktionen von kulturellen Klassifikationen
6.2 Zentrum – Peripherie
6.3 Nähe und Ferne
6.4 Das Endogame und das Exogame
6.5 Zeitpositionen Lineare und zyklische Zeit
6.6 Der Analyserahmen
6.7 Grenzziehungen/Klassifikationen: Natur – Kultur
6.8 Grenzziehungen/Klassifikationen: das Sakrale – Profane – Tabuisierte
6.9 Die Funktion des Mediators
6.10 Elementare Gruppierungen und Klassifikationen
6.11 Der elitäre Code
6.12 Vom Sein zum Design Signalwerte von Stil/Packungen
7 Produkte als Ideologieträger Drei zentrale Wertsphären und ihre Vermittlung durch Produkte
7.1 Einleitung
7.2 Die Kultur der Disziplinierung
7.3 Die Kultur des Hedonismus
7.4 Die Kultur der Solidarität
7.5 Das ideale Produkt
8 Analysebeispiele: Du darfst, Dany + Sahne, Obstgarten, Schlankerl
9 Sensitive Codes Die Mikrostruktur von Produkten
9.1 Sensorische Inventars
9.1.1 Produktvariablen als Indikatoren von Produktleistungen
9.1.2 Verstärkung der Gesamtbedeutung des Produktes
9.2 Polysensualistische Produkte
10 Verfahren der Bedeutungszuordnung in der Werbung
10.1 Werbung als Überzeugungsstrategie Rhetorische und argumentative Verfahren
10.1.1 Der Beitrag der Rhetorik/rhetorische Sprachverwendung
10.1.2 Argumentationsverfahren und Diskurstheorien
11 Beispiele semiotischer Analysen
11.1 Entscheidung zwischen zwei Filmkonzepten: Aquarel von Nestlé
11.2 Persil „Landregen“
Teil E Das Konzept der Marke
1 Die grundsätzlichen Fragen: Was sind Marken? Wozu brauchen wir Marken? Was macht Markenstärke aus?
2 Merkmale von Marken
3 Der Markencode
4 Strategien, die Markenstärke fördern
5 Funktionen von Marken für Konsumenten
6 Die Verdeutlichung der Markenprinzipien am Beispiel von TV-Sendern und Sendungen
6.1 TV-Sender als Marken: das Beispiel RTL und die RTL-Group
6.2 Sendungen als Marken: das Beispiel ORF
7 Die Entwicklung zeitgenössischer Wertfelder
8 Markenkontinuität und Produktdifferenzierung Marken und Submarken
9 Marken als Ausdruck kultureller Orientierungen
9.1 Vier Grundorientierungen
9.2 Markenwelten als kulturelle Orientierungen
9.2.1 Hierarchistische Markenwelten
9.2.2 Individualistische Markenwelten
9.2.3 Egalitäre Markenwelten
9.2.4 Fatalistische Markenwelten
10 Rezessive, dominante und innovative Codes Die Angleichung von Marken an ihre Umfelder
10.1 Die A-Klasse von Mercedes-Benz
10.2 Smart
11 Der Markenraum erweitert sich Die Marke im Bereich der Investitionsgüter
Teil F Der soziokulturelle Tiefenstrom
Wo stehen wir in der heutigen Zeit?
Dank
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Autoreninformation
Einleitung
Ich möchte in diesem Buch die Ergebnisse meiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der empirischen, speziell der qualitativ orientierten Marktforschung und meiner Lehrtätigkeit im Bereich der Wirtschaftsuniversität sowie den theoretischen Hintergrund, vor dem diese Ergebnisse gewonnen worden sind, vorstellen.
Die zentrale Frage, die hinter meinen Ausführungen steht, ist die, die vermutlich stets auch die Frage meiner Auftraggeber ist: Was macht Produkte erfolgreich?
Die Frage scheint naiv gestellt – aber letztlich ist es der Wunsch nach wirtschaftlichem Erfolg, der Märkte vorantreibt, und es gibt zahlreiche Abhandlungen der verschiedenen Disziplinen, die sich dieser Frage zuwenden. Naturgemäß kann es darauf keine einfache Antwort geben; jede wissenschaftliche Disziplin wird die Frage anders beantworten, und jede Wissenschaft kann bestenfalls einen Teilaspekt behandeln, eine generelle Antwort im Sinne eines Patentrezeptes ist also weder angestrebt noch möglich.
Wenn man der Frage genauer nachgeht, so wird sofort klar, welche hoch komplizierten Mechanismen Marktgeschehen leiten: ökonomische, psychologische, soziale, kulturelle. Viele dieser Mechanismen/Theorien/Erfahrungen sind schon beschrieben worden; ich möchte also zunächst meinen spezifischen Zugang darlegen. Dieser lässt sich als ein interdisziplinärer Ansatz charakterisieren, der Marktgeschehen aus dem Blickwinkel mehrerer Theorien zu erfassen und zu beschreiben sucht:
aus der Sicht der Psychologie,
aus der Sicht der Soziologie,
aus der Sicht der Kulturwissenschaften,
aus der Sicht der Kommunikationswissenschaften, speziell der Semiotik.
Ich möchte nicht behaupten, eine Spezialistin in allen diesen Disziplinen zu sein; auch benütze ich jeweils nur bestimmte Theorien, und nur diese möchte ich hier darlegen. Wesentlich erscheint mir jedoch, die Denkmodelle dieser Disziplinen auf einen Untersuchungsgegenstand anzuwenden und dadurch den Rahmen der Fragestellungen und der Analyseverfahren zu erweitern.
Heutige Märkte sind Nachfragermärkte – es wird auf ihnen nicht unter der Maxime produziert: „Verkauft wird, was produziert werden kann“, sondern unter der Maxime: „Verkauft wird, was den Bedürfnissen und Wünschen von Konsumenten entspricht“. Deshalb ist es klar, dass größere ökonomische Projekte nicht ohne eine diffizile Analyse des Konsumenten auskommen, also nicht ohne einen Rekurs auf Psychologie und Sozialpsychologie.
Produkte können noch so hoch in ihrer Produktqualität, noch so angemessen in ihren Preisen, noch so gut in ihrer Distribution, noch so raffiniert in ihrem ökonomischen Kalkül sein – nur wenn es ihnen zusätzlich gelingt, die Aufmerksamkeit von Konsumenten zu erregen, für sie interessant zu sein, von ihnen als wünschenswert, nützlich und befriedigend betrachtet zu werden, sind sie erfolgreich. Und dieser Erfolg ist eben nicht nur die Konsequenz einer guten technologischen Planung, eines guten ökonomischen/betriebswirtschaftlichen Kalküls, einer Konkurrenzstrategie – einer Produzentenstrategie also –, sondern er umfasst weit mehr.
Dies ist keineswegs neu. Gebräuchliche Definitionen von Marketing beziehen sich genau auf diesen Aspekt:
„Marketing ist eine Strategie, Bedürfnisse und Wünsche von Konsumenten durch Austauschprozesse zu befriedigen und Produkte besser und wirkungsvoller anzubieten als die Konkurrenz.“1
Dieses Erfassen individueller Bedürfnisse, Wünsche, Motivationen, die höchst unterschiedlich von Person zu Person sind, die Mechanismen, die Verhalten, Lernen und Wahrnehmen beeinflussen, sind wichtig. Und die adäquaten Disziplinen, die hierzu einen Beitrag leisten können, sind Psychologie und Sozialpsychologie. Die Theorien, Methoden, Resultate dieser Disziplinen sind daher von größter Bedeutung, wenn es darum geht, zu erforschen, wie geplante Marketingmaßnahmen wirken, wie sie aus der Sicht des Konsumenten erlebt werden, und ebenso, wodurch sich Konsumenten unterscheiden und warum der eine so handelt und der andere anders.
Dieser Zugang über die Marktpsychologie soll im ersten Teil des Buches geschildert werden; er beschäftigt sich im Wesentlichen mit Motivtheorien.
Ich möchte diesen Zugang durch eine Gruppe weiterer Theorien ergänzen. Denn je mehr man fragt, je mehr Hypothesen man einbringt, desto reichhaltigere Ergebnisse bekommt man (wonach man nicht fragt, das wird man auch nicht erfahren), desto genauer wird man auch Ergebnisse interpretieren. „Man sieht nicht, was man sieht, man sieht, was man weiß“, heißt es bei Goethe.
In diesem Sinn scheint es mir wichtig, Disziplinen heranzuziehen, die das Verhalten von Gesellschaftsteilnehmern/Konsumenten anders beschreiben als über das Konzept des Individuums und seiner bewussten oder unbewussten Bedürfnisse und Wünsche. Diese Disziplinen beziehen eine Ebene mit ein, die sich über der des subjektiven Bewusstseins befindet. Das ist wichtig für alle Aspekte der Konzeptbildung, der Positionierung und Optimierung, die kaum direkt vom Konsumenten erfragt werden können.
Ich erweitere diesen Ansatz, indem ich, ergänzend zu Theorien der Psychologie und Sozialpsychologie Theorien heranziehe, die sich damit beschäftigen, wie Bedeutung aufgebaut und vermittelt wird. Dafür gibt es praktische und theoretische Gründe.
Das Konzept des Bedeutungsaufbaus und der Bedeutungsvermittlung ist für mich ein zentrales Konzept. Das, was Produkte/Dienstleistungen auf dem Markt interessant und unterscheidbar, „einzigartig“ macht, ist eigentlich ihre Bedeutung, ihr „semantischer Mehrwert“. Bedeutung kann nun aber nur über Zeichen und Zeichensysteme vermittelt werden. Ich behaupte, dass der Erfolg auf künftigen Märkten nicht nur von der geschickten Produktion und Vermarktung von Produkten abhängen wird, sondern auch und vielleicht sogar vorrangig von der Effizienz im Bereich des Zeichenmanagements. Was darunter genauer zu verstehen ist, wie dies ermittelt und überprüft wird, soll im Folgenden dargelegt werden.
Es gibt jedoch auch einen theoretischen Grund. Ich bin der Meinung, dass bisher benützte Konzepte sehr oft von zwei Sichtweisen ausgehen:
Sie betrachteten Produzenten und Konsumenten als völlig autonome Größen, die isoliert handeln und planen – die Produzenten nach einem ökonomischen Kalkül, die Konsumenten nach ihrem subjektiven Nutzen- und Bedürfniskalkül.
Sie betrachteten relativ starre und punktuell wirksame Verbindungen zwischen einem Input und einem Output. Also etwa: Das Bild eines Babys führt zu Reaktion X. Oder: Eine Schlange bedeutet Sexualität. Oder: Der Einsatz von Farbe bringt einen Aufmerksamkeitswert X.
Moderne wissenschaftstheoretische Erkenntnisse sowie Entwicklungen in verschiedenen Disziplinen haben jedoch gezeigt, dass beide Annahmen nicht mehr beibehalten werden können und dass es sowohl realitätsangemessener wie fruchtbarer ist, nicht punktuelle Verbindungen und isolierte Größen zu analysieren, sondern Systeme, Kontexte, Wechselwirkungen, Beziehungen. Das gilt besonders für den Bereich der Gesellschaftswissenschaften, in dem zunehmend zwei Sachverhalte in den Blick rücken:
Die Rolle, die die
Kultur
in der Formung der menschlichen Psyche spielt: Es ist die Kultur, die menschliche Bedürfnisse, Wünsche formt und fordert – gemäß den Anforderungen eines soziokulturellen Systems, das diese Psyche „braucht“, um funktionieren zu können. Die individuellen Konzeptionen des Wünschenswerten stehen in enger Korrelation zu den kulturellen Konzeptionen des Wünschenswerten. Einem einzelnen Gesellschaftsteilnehmer steht keineswegs zu allen Zeiten offen, was er sich wünschen kann und zwischen welchen Mentalitäten er wählen kann. Seine eigene Kultur setzt vielmehr fest, was überhaupt gewünscht werden kann und welche Mentalitäten möglich sind. Als Beispiele: Erst die Entwicklung einer methodisch sich selbst kontrollierenden Person ermöglichte den Aufbau moderner Staats- und Wirtschaftssysteme; die moderne Kleinfamilie etablierte sich parallel zu der Entwicklung von Gefühlskulturen; Leistung als zentrales Motiv des Einzelnen, Überlegenheit im Leistungswettbewerb war offenbar auf der Motivebene der Personen in den ehemaligen Ostblockstaaten am Anfang schwach ausgebildet. Anstelle von invarianten menschlichen Bedürfnissen ist daher von kulturell geformten und damit von historisch veränderbaren Bedürfnissen auszugehen: von Bedürfnissen, so wie sie gerade jetzt, in diesem Augenblick, bei diesem Stand einer Gesellschaft erscheinen. Dies ist insofern wichtig, als sich die Definition von zentralen Werten historisch ändert; sie ändert sich laufend, vor unseren Augen sozusagen. Die Definition von Elite – und damit die Zeichen, durch die man übermitteln kann: „Ich bin Elite“ – war im 19. Jahrhundert oder auch um 1960 ganz anders als heute.
Menschen sind nicht nur
reagierende Wesen
, sondern sie sind vor allem
interpretierende Wesen
– sie versuchen, ihren Handlungen, ihrer Umgebung, ihrer Umwelt, ihrer Welt Bedeutung und Sinn zu geben; sie möchten ihre eigene Gesellschaft und ihre Welt verstehen. Dies scheint ein tatsächlich universales Bedürfnis zu sein. Und genau diesem Bedürfnis antwortet die Kultur, indem sie Modelle der Sinnstiftung und kulturelle Ordnungsmuster anbietet, jeweils entsprechend dem technischen, ökonomischen, sozialen Stand einer Gesellschaft. Alle materiellen Objekte einer Kultur – und damit auch Produkte – spiegeln diese kulturellen und ideologischen Ordnungsmuster wider. Diese befinden sich jedoch oberhalb der Ebene des individuellen Bewusstseins.
Sowohl Produzenten wie Konsumenten handhaben laufend diese Bedeutungen und die Regeln der Bedeutungsübermittlung, und zwar ohne dass ihnen diese Tatsache bewusst ist und dass sie die Regeln explizit kennen. Ähnlich nehmen wir wahr, ohne die Regeln der Wahrnehmungstheorie zu kennen, ähnlich sprechen wir, ohne die Regeln der Linguistik zu kennen. Diese Regeln können jedoch erforscht und bewusst gemacht werden.
Was hier eigentlich erforscht wird, sind Strukturen der Intersubjektivität, Systeme, die nach eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten funktionieren – anders kann Bedeutung nicht übermittelt werden. Es geht im Einzelnen daher um zwei Aspekte:
Welche ideologischen Ordnungsmuster oder Mentalitäten oder kollektiven Vorstellungen finden sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft? Wie beeinflussen diese Vorstellungen Alltagskulturen und die Objekte, also Produkte, die in diesen Alltagskulturen eine Rolle spielen und die mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen werden?
Wie kann Bedeutung vermittelt werden?
Beide Fragen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von modernen Konzepten im Bereich von Kulturwissenschaften gestellt, die sich zunehmend der Frage der Mentalitäten, der Denkstile, der kollektiven Vorstellungen, dem gesellschaftlich Imaginierten (den representations collectives, wie sie Durkheim genannt hat) zuwenden. Im Bereich dieser Vorstellungen ist jeweils die Frage zu stellen, wessen Interessen durch die Entwicklung bestimmter Vorstellungen gedient wird, aber auch, welche Kategorien entwickelt und benützt werden und wie diese Vorstellungen in Metaphern, in Bilder und eben auch in die Artefakte der Produktkultur übersetzt werden. Zu fragen ist nicht nur, was die Leute denken, sondern auch, wie sie denken.2
Die Erforschung von Phänomenen dieser Art hat eine lange Geschichte (Durkheim, Marx, Max Weber), sie wurde in der Gegenwart neben den Ansätzen der Kulturwissenschaften über ethnologische, semiotische, linguistische, strukturalistische Theorien weiterentwickelt. Sie ist mit den Namen von de Saussure, Jakobson, Trubetzkoi, Chomsky verknüpft, die die moderne Linguistik und Semiotik begründet haben, mit Piaget, mit Geertz, mit Claude Lévi-Strauss, der zum ersten Mal strukturalistischsemiotische Methoden bei der Erforschung von kultur- und sozialanthropologischen Problemen, so vor allem der Mythenanalyse, verwendet hat. Ich werde mich im Folgenden auf die Ansätze dieser Autoren stützen, sowohl in der Theorie wie in der Methode.
Ergänzend werden wichtige kulturwissenschaftliche Analysen herangezogen, vor allem die Zivilisationstheorie von Norbert Elias und die Schichtungstheorie von Pierre Bourdieu. Auch moderne Theorien der Informationsverarbeitung, Theorien zum Verstehen, Speichern, Abrufen, zur Repräsentation von Wissen werden benützt.
Schließlich soll kurz auf eine Theorie eingegangen werden, die davon ausgeht, dass selbst die Dichotomie zwischen objektiv gegebenen Objekten/Produkten und davon geschiedenen Konsumenten – also letztlich die zwischen Objekt und Subjekt – zu reflektieren ist: Objekte werden erst im Zuge einer Verbindung zwischen verschiedenen Akteuren konstruiert. Es handelt sich um die von Bruno Latour entwickelte Actor Network Theory (ANT).3
Das zentrale Anliegen dieses Buches ist es, Produkte/Dienstleistungen als einen autonomen Bereich aufzufassen ihn nicht nur aus der Sicht der Produzenten und nicht nur aus der individuellen Sicht der Konsumenten zu beschreiben, sondern als ein System mit eigenen Regeln, in dem vielfältige Prozesse des Bedeutungsaufbaus und der Bedeutungsübermittlung eine Rolle spielen.
Das genau meint der Titel „Produkte als Botschaften“. Darauf gründet sich meine zentrale These: Produkte sind dann erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, ihre Botschaft richtig zu konstruieren und eine relevante Bedeutung aufzubauen. Dies betrifft nicht nur die Werbung, Packung, die Kommunikation, sondern es betrifft jeden einzelnen Aspekt eines Produktes, auch dessen physisch beobachtbare Merkmale.
„Produkte als Botschaften“ meint somit zweierlei:
Das Glücken des Kommunikationsaktes zwischen Produzenten und Konsumenten. Produkte sind dann gleichsam Elemente einer „Sprache“, die unter Produzenten und Konsumenten zirkuliert. Ein erfolgreiches Produkt ist ein geglückter Kommunikationsakt.
Die Anreicherung des Produktes mit „Mehrwert“, mit „Tauschwert“ über seinen Gebrauchswert hinaus, die Ausgestaltung des Produktes als ein einzigartiges, unverwechselbares, nicht imitierbares Objekt.
Im Folgenden spreche ich von Produkten, verstehe darunter aber auch Dienstleistungen, allgemein alle Güter, die auf Märkten gehandelt werden.
Um meine Hauptthesen zusammenzufassen – ein Produkt ist ein höchst komplexes Objekt:
es ist das Ergebnis eines ökonomischen Kalküls;
es ist das Ergebnis einer technologischen Leistung;
es ist das Ergebnis einer organisatorischen Leistung;
es erfüllt subjektive Bedürfnisse des Einzelnen, es steht vielleicht kompensatorisch für Wünsche, die sonst nicht erfüllt werden, es ermöglicht ihm, subjektiv gesetzte Ziele zu erreichen;
es dient dazu, den Einzelnen von anderen Gesellschaftsteilnehmern zu unterscheiden, ihm Status, Rang, sozial erwünschte Eigenschaften, Identität zuzuordnen;
es dient dazu menschliche Gemeinschaften zu ermöglichen, zu verfestigen, Menschen in Gruppen einzubeziehen oder auszuschließen;
es benützt kulturelle und ideologische Ordnungsmuster, es stabilisiert und verändert sie aber auch;
es teilt etwas über unsere Kultur als Ganzes mit, es propagiert die Werte, die diese zu einem gegebenen Zeitpunkt als wünschenswert setzt und als wünschenswert setzen muss, um zu funktionieren;
es ist ein Kulturprodukt, ein Ensemble von Zeichen, ein Element in einer „Rede der Gesellschaft, die keinen Sprecher hat“,
4
und es ist damit mit anderen Kulturprodukten zu vergleichen: Filmen, Bildern, Romanen, Mythen.
Einleitung zur zweiten Auflage
Markt- und Produktkulturen leben unter anderem von dem Bedürfnis nach Neuerungen. Neuheit/Innovation ist in unserer Gesellschaft ein wichtiger Wert – so wie die Eskimos 50 Ausdrücke für Schnee kennen, weil Schnee für ihre Kultur eine wichtige Bedeutung hat, so entwickeln wir eine umfangreiche Semantik des Neuen: „in“ sein, Trends setzen, das Allerneueste, die faszinierendste Innovation, das Surfen auf der letzten Welle etc.
Wenn man also ein Buch zur Hand nimmt, das 1993 auf den Markt gekommen ist und sich Produkten und Marken zuwendet, so wird sich jeder Leser nach der Relevanz fragen: Ist so ein Buch noch zeitgemäß? Sind die Prozesse, die in diesem Buch beschrieben wurden, heute noch gültig? Decken sie noch etwas von unserer zeitgemäßen Realität ab, und können sie zur Steuerung und Planung von Zukunftsprozessen dienen?
Ich meine, dass dies sehr wohl der Fall ist.
Die grundsätzlichen Überlegungen, von denen das Buch ausgeht, haben heute vermutlich noch eine gleiche, wenn nicht höhere Gültigkeit, und die Methoden und Analyseverfahren, die beschrieben werden, sind nicht an eine Zeit gebunden – die Verfahren, die Menschen benützen, um miteinander zu kommunizieren, die Regeln von Sprachen also, sind so schnell nicht veränderbar.
Anders steht es um die Bedürfnisse und Wünsche, die Menschen auf Märkten entwickeln. Zum einen handelt es sich auch hier um zeitübergreifende Wünsche und Bedürfnisse: Die Wünsche nach Ansehen in der umgebenden sozialen Gruppe, die Wünsche, geliebt zu werden, die Wünsche, ein sinnvolles Leben zu führen, sind zeit- und kulturübergreifend.
Was sich aber ändert, sind die Strategien, durch die man dies erzielen kann. Gesellschaften belohnen und bestrafen für höchst unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Zeitpunkten: Sich richtig und angemessen zu verhalten, bedeutet heute tatsächlich etwas anderes als in den 1980er Jahren. Ebenso ist es mit den Konzeptionen und den Wertewelten, die Produkte transportieren und signalisieren.
Eine lebendige Gesellschaft wie die unsere, die Fortschritt und Innovation schätzt, befindet sich immer im Fluss: Sie stützt sich zu verschiedenen Zeitpunkten auf unterschiedliche Konzeptionen des Wünschenswerten, und diese sind nie von dem abgekoppelt, was es an allgemeinen Entwicklungen in einer Gesellschaft gibt.
Eine strikte Berücksichtigung dieser Gegebenheiten würde bedeuten, das Buch in vielen Beispielen umzuschreiben, und zwar so stark, dass man kaum mehr von einer zweiten Auflage sprechen könnte.
Ich habe mich also zu folgendem Vorgehen entschlossen: Der Text der ersten Auflage sollte weitgehend bewahrt bleiben, an der grundsätzlichen Gültigkeit der Annahmen hat sich ja auch nichts geändert. Die Beispiele sind jetzt also „alte“ Beispiele, aber sie belegen gut die dahinter stehenden Thesen.
Dem Neuen soll durch die Hinzufügung eines neuen Teils E Rechnung getragen werden: Welchen Herausforderungen sehen sich Produkte und Marken heute gegenüber, und welche exemplarischen Lösungen finden sie? Dabei sollen folgende Themenkreise behandelt werden, die sich mit dem Konzept der Marke beschäftigen:
die Funktionen und Leistungen von Marken generell;
dann im Einzelnen:
Dachmarken und Submarken,
Marken als Ausdruck kultureller Grundorientierungen,
die Anpassung von Marken an die aktuelle Entwicklung ihres Feldes.
Einleitung zur dritten Auflage
Die erste Auflage dieses Buches erschien 1993, also vor mehr als zehn Jahren. Als mich der Verlag aufforderte, die dritte Auflage zu aktualisieren, ging ich den theoretischen Bezugsrahmen und die Beispiel durch, die in der ersten und der zweiten Auflage geschildert wurden. Ich war sehr zufrieden mit dem theoretischen Bezugsrahmen. Er hatte sich seitdem in einer Vielzahl von Projekten bewährt und wurde auch von den Unternehmen, mit denen ich weiterhin zusammenarbeite – so DaimlerChrysler, Ferrero, Henkel, Nestlé –, in ihrer alltäglichen Arbeit benützt und von neu hinzugekommenen Kunden so der RTL-Gruppe in der Planung ihrer Projekte berücksichtigt. Aber die Beispiele! Sie schienen hoffnungslos veraltet: Ein Teil der Produkte und Marken existiert gar nicht mehr, bestimmte Wert- und Nutzensbehauptungen würde heute niemand mehr in dieser Form aufstellen, manche Märkte hatten sich völlig gewandelt was sollte ich da aktualisieren? Es schien mir zunächst klüger, das Buch auslaufen zu lassen und etwas Neues zu schreiben.
Als ich aber noch einmal nachdachte, erkannte ich, dass genau dieses Faktum ein guter Beweis für die Richtigkeit meiner Theorie darstellte: Es kommt eben nicht von ungefähr, dass sich heute wenig Beispiele für Produkte mehr finden lassen, die Solidarität in einer naiven Form propagieren oder dass bestimmte Formen der Statusdemonstration und -legitimation verschwunden sind. Das bedeutet, dass sich unsere Gesellschaft geändert hat: Heute sind uns andere Dinge wichtig als im Jahr 1993.
Wenn wir die These für richtig halten, dass wir Produkte und die sie begleitende Kommunikation nicht (nur) über ihre funktionalen Nutzen schätzen, dass wir Produkte nicht „brauchen“, weil sie „nützlich“ sind, sondern dass sie für Konzeptionen des Wünschenswerten stehen, dass wir sie brauchen, weil sie die symbolische Ordnung unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringen, dass sie kulturelle Ideale inszenieren, dass sie in vielfältiger Weise in das soziale Leben der Menschen einbezogen sind, dass wir mit ihrer Hilfe Werte verhandeln, Distinktion erwerben, Identitäten aufbauen, Menschen ein- und ausgrenzen können, so wäre es eher erstaunlich, wenn wir das mit denselben Konzepten tun können wie vor mehr als zehn Jahren.
Das, was fehlt, und das, was hinzugekommen ist, ist ein interpretierenswerter Tatbestand, der etwas über den kulturellen Tiefenstrom aussagt, der unsere Gesellschaft trägt.
Ich habe mich daher entschlossen, den theoretischen Bezugsrahmen beizubehalten, eine Reihe von Beispielen zu aktualisieren, aber einige Beispiele unverändert zu belassen: einerseits besonders illustrative Beispiele und andererseits Beispiele, die zeigen, was uns vor einiger Zeit noch wichtig war.
Ich habe dafür ein Kapitel hinzugefügt (Teil F), das kurz schildert, was wir an Wertdemonstrationen aufgegeben haben, was neu hinzugekommen ist und wie wir diese neuen Wertfelder derzeit in Produkte, Marken und Kommunikationen umsetzen. Im Text werden jeweils neue Beispiele gebracht, die die ursprünglichen Beispiele ergänzen. Dieses Kapitel kann also auch den Anfang der Lektüre bilden, um die Beispiele jeweils an den neuesten Stand anzubinden.
Einleitung zur vierten Auflage
Viele Kulturkritiker beklagen immer wieder die Schnelllebigkeit unserer Zeit, den rasanten Wechsel der Reize, die Tendenz Kontinuität und Bewahrung gering zu achten. Dies stimmt sicher in vielen Feldern, auch auf dem Markt der Bücher. Umso erstaunlicher ist es, dass Produkte als Botschaften nun seine vierte Auflage erfährt. Sollten sich die Kulturkritiker irren?
Vielleicht wie alle, die pauschale Urteile fällen, vielleicht aber auch, weil durchaus das Bewusstsein wächst, dass es nicht klug ist, dauernd alles neu zu erfinden. Es gibt einige gesicherte Resultate, die es sich zur Kenntnis zu nehmen lohnt, und die als Grundlage dienen können, um etwas Neues zu entwickeln.
Ebenso zeigt sich, dass mehr soziale Tatbestände, als man denkt, durch die Kombination von invarianten Aspekten und variablen Aspekten gekennzeichnet sind – so etwa starke Marken, die oft eine große Vergangenheit und gleichbleibende Aspekte besitzen, ebenso wie sie immer wieder stimulierendes Neues erfinden. Nicht, dass ich das Buch mit diesen wertvollen Marken vergleichen möchte, aber es basiert im Kern auf ähnlichen Prinzipien.
Das Kapitel, das für die vierte Auflage neu konzipiert wurde, beschäftigt sich daher auch mit Markenprinzipien. Das Feld der Marken ist inzwischen ein außerordentlich differenziertes Feld geworden. Es gibt Marken in allen Produktfeldern und in allen Ausformungen: Unternehmensmarken, Produktmarken, Destinationsmarken, Personenmarken, Medienmarken, Marken für Investitionsgüter und andere mehr. Es gibt daher auch kein One-Size-fits-all-Konzept für Marken. Jede dieser spezifischen Marken besitzt andere Bedingungen für Erfolg. Diese sollen beschrieben werden, aber eben vor dem Hintergrund der Theorien und Resultate, die im Lauf des Buches dargelegt werden.
Leseanleitung
Der erste Teil des Buches (Teil A) behandelt zentrale Konzepte der Psychologie, vor allem aus dem Bereich der Motivationspsychologie, und deren Anwendung in Marketing- und Werbekonzepten. Leser, die gut mit dem Stand des psychologischen Wissens über diesen Bereich vertraut sind, können Teil A übergehen.
Teil B gibt einen Überblick über Methoden.
Teil C bringt einige theoretische Grundlagen zum Problem des Bedeutungsaufbaus, ist also eine kleine Einführung in zentrale Begriffe der Semiotik und der kognitiven Psychologie. Naturgemäß ist dies ein etwas spröder theoretischer Teil.
Teil A und C bilden die theoretische Grundlage für Teil D, in dem Beispiele für die Anwendung dieser Konzepte gegeben werden. Diese Beispiele sind aber auch ohne ihre theoretische Begründung verständlich.
Teil E wurde neu für die zweite Auflage (1998) verfasst, Teil F für die dritte Auflage (2004). Beide Teile stellen eigenständige Beiträge dar; es ist aber natürlich hilfreich, wenn man über das Hintergrundwissen verfügt, das die erste Auflage vermittelt.
Teil A
Der Konsument
1 Zum Verhältnis Marketing – Marktpsychologie
Einflussgrößen des Konsumentenverhaltens
Alle Ergebnisse, die im Folgenden geschildert werden, beziehen sich in irgendeiner Form auf Marketingaktivitäten bzw. auf Prozesse der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen. Es wird um den Konsumenten gehen, um sein Verhalten, seine Betrachtung von Märkten und Produkten, seine Wünsche, Bedürfnisse, Motive, Entscheidungskriterien – keineswegs um jeden Aspekt dieses vielfältigen und gut erforschten Gebietes,5 sondern um einige Aspekte, die sich primär im Bereich qualitativer Forschung als relevant erweisen. Herangezogen werden im Wesentlichen Ergebnisse und Theorien der Psychologie und Sozialpsychologie.
Mit Konsumentenverhalten beschäftigen sich eine Reihe von Disziplinen: Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und eben auch Marketing, dessen Handlungsmaxime ja lautet, Produkte so anzubieten, dass sie den Bedürfnissen und Wünschen von Konsumenten entsprechen. Die meisten Marketingbücher beziehen daher ansatzweise Ergebnisse und Annahmen psychologischer oder sozialpsychologischer Theorien mit ein, wenn auch in rudimentärer und in sehr selektiver Form – fast immer treten die Bedürfnistheorie von Maslow, das Dissonanzkonzept oder das Einstellungskonzept in Erscheinung, andere Theorien werden dagegen ausgeblendet.
Unbestritten ist dagegen die Rolle, die Psychologie und Soziologie spielen, wenn es um die Entwicklung von Methoden der empirischen Forschung, speziell der Wirkungsforschung, geht. Tatsächlich können Psychologie und Soziologie einen erheblich größeren Beitrag zur Planung und Optimierung von Marketingmaßnahmen liefern, und zwar deshalb, weil sie einen von dem einzelnen Anbieter nicht kontrollierbaren Bereich aufhellen.
Marketing hat bekanntlich vier Größen zur Verfügung, die seiner Steuerung und Kontrolle unterliegen – die vier P des Marketing:
Produkt,
Platzierung/Distribution,
Preis,
Promotion/Werbung.
Es gibt jedoch mindestens zwei wichtige Marktgrößen, die nicht seiner Kontrolle unterliegen: die Mitbewerber und der Konsument. Viele Beispiele zeigen, dass selbst strategisch hervorragend geplante Produkte, die alle vier Ps gut erfüllen, keineswegs erfolgreich sind – einmal, weil Mitbewerber wirksame Gegenmaßnahmen entwickelten, dann wiederum, weil Konsumenten letztlich doch ein geringes Interesse hatten.
Die Prognose und Beeinflussung des Konsumentenverhaltens ist nun tatsächlich etwas außerordentlich Schwieriges. Es kann daher auf keine Wissenschaft verzichtet werden, die einen Beitrag zur Erhellung dieses Verhaltens liefert.
Wie jedes menschliche Verhalten ist auch Konsumverhalten komplex, individuell variierend, von einer Fülle von Einflussgrößen bestimmt. Handlungen können durch ethische oder religiöse Prinzipien determiniert sein, durch ökonomische Prinzipien, durch ein Nutzenskalkül, durch psychologische Prinzipien. Handeln steht im Dienst bestimmter Motive, man erfüllt sich bewusste oder unbewusste Bedürfnisse oder Wünsche:
durch funktionale Prinzipien: man versucht bewusst bestimmte Ziele zu erreichen;
durch biologische Prinzipien: man handelt im Dienste des Überlebens;
durch soziale Prinzipien: man handelt, weil man Ähnliches tun oder erreichen möchte wie andere Gesellschaftsteilnehmer oder weil es Rollenvorschriften nahe legen;
durch kulturelle Mechanismen: weil bestimmte Handlungen zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt von der Kultur als geboten/verboten/möglich gesetzt sind.
Viele Handlungen, auch die Entscheidungen, die Marktteilnehmer treffen, lassen sich unter mehreren/allen diesen Prinzipien beschreiben.
Wenn es um die Erklärung und Steuerung von Handlungen und von Verhalten geht, ist zusätzlich zu bedenken, dass die Gründe, die dem Einzelnen für die Erklärung seines Verhaltens und seiner Handlungen bewusst sind, keineswegs gleichbedeutend sind mit den Gründen, die dieses Verhalten wirklich erklären.6
Das bedeutet einerseits, dass der Handelnde die Gründe seines Handelns nicht kennt; er wird durch nicht bewusste/unbewusste Wünsche/Faktoren gesteuert, die er rationalisiert und legitimiert. Dies ist im Wesentlichen der Zugang der Tiefenpsychologie. Es bedeutet andererseits aber auch, dass Verhalten/Handlungen anders erklärt werden können, wenn man die Ebene des Einzelakteurs und seines subjektiven Bewusstseins verlässt und die Faktoren betrachtet, die auf der Ebene der Gesellschaft und der Kultur Handlungen erklären. Mit diesen Phänomenen beschäftigen sich Ansätze der Soziologie und der Kulturanthropologie, die ich in Teil D 2 beschreiben werde.
Ebenso zentral wie der Begriff des Motivs für die Psychologie ist für diese Ansätze der Begriff des Wertes. Werte sollen dabei als Konzeptionen des Wünschenswerten definiert werden, die gleichermaßen auf der Ebene der Kultur wie auf der Ebene des Individuums wirksam werden. Der Kultur wird dabei eine steuernde Funktion zugeordnet: Sie formt die Psyche des Einzelnen, indem sie die Werte, die sie zu ihrem Funktionieren braucht, als subjektive Bedürfnisse des Einzelnen erscheinen lässt.
Das Konzept der Kultur nimmt dadurch eine ähnliche Stelle ein wie das Konzept des Unbewussten. Diesen Aspekten wird in Teil D weiter nachgegangen.
Als Einflussgrößen lassen sich solcherart zunächst schematisch festhalten:
Jede Disziplin, die zur Analyse benützt wird, beschäftigt sich schwerpunktmäßig nur mit ganz bestimmten Einflussgrößen des obigen Schemas.
2 Der Zugang der Psychologie
Die Psychologie wendet sich im Wesentlichen der Einzelperson, dem Individuum zu: seinen Motivationen, seiner Lerngeschichte, den allgemeinen Mechanismen des Wahrnehmens, Lernens, Denkens, Entscheidens, Verhaltens, teilweise auch jenen Mechanismen, die biologische Grundlagen haben und die auch bei anderen Lebewesen anzutreffen sind.
Das Konzept, das als wesentlicher Beitrag hier diskutiert wird, ist das Motivkonzept: Gefragt wird nach den Gründen, nach den Motiven und Antriebskräften, die sich ergeben, wenn man vom Konsumenten als einem autonomen Individuum ausgeht.
2.1 Homo oeconomicus und das Konsumäffchen
Implizite Psychologie und Anthropologie
Jeder, der auf dem Markt agiert, hat bestimmte Vorstellungen darüber, wie Menschen »sind«, wie sie sich beeinflussen lassen, was sie sich wünschen, was ihnen gefällt. Diese Vorstellungen bilden sich durch Sozialisation, Intuition, Erfahrung; sie können in einem spezifischen Fall richtig sein, müssen es aber natürlich nicht, und sie werden keineswegs immer bewusst gemacht und zur Diskussion gestellt. Ein wichtiger Bereich dieser Vorstellungen ist die Frage, »wie der Mensch auf dem Markt« ist: kalkulierend, rational, emotional, verantwortungslos hedonistisch, launisch, leicht manipulierbar, vernünftigen Argumenten zugänglich?
Viele Entscheidungen, die in dem Prozess der Erstellung von Marketingaktivitäten und der Planung von Werbung von Entscheidungsträgern gefällt werden, basieren auf solchen impliziten psychologischen, oft auch ästhetischen Theorien, ohne dass diese Theorien bewusst reflektiert oder einer Prüfung durch Forschung unterzogen werden. Der Produktmanager, der argumentiert: »Ohne Pfand bringt kein Mensch die Flasche zurück, andere Möglichkeiten brauchen wir gar nicht in Betracht ziehen«, rekurriert auf die Theorie des Konditionierens – er nimmt an, dass eine Verhaltenssteuerung primär durch Belohnung und Bestrafung erfolgt.
Deutlich wird das bei Entscheidungen, die die Werbewirkung betreffen. In diese Entscheidungen fließen von Seiten der Produzenten und Auftraggeber viele Annahmen darüber ein, wie Werbung »prinzipiell« wirkt – vornehmlich in der Phase, in der noch vor einem Test über Konzepte entschieden wird. Die Wahl zwischen drei Werbekonzepten, von denen eines in den Test geht, muss ja nach irgendwelchen Kriterien erfolgen. Meist sind es implizite Wirkungstheorien, an denen man sich orientiert – je nachdem, von welcher Wirkung man eben überzeugt ist: emotionale Werbung; originelle Werbung; Werbung, die dem Produkt einen klar erkennbaren Produktvorteil zuschreibt; leicht verständliche Werbung. Nur jenes Konzept, das der Überzeugung entspricht, wird dann einer empirischen Prüfung unterzogen.
Ebenso wird diese Selektion Annahmen darüber beinhalten, wie sich Menschen beeinflussen lassen und welche Werte für sie wichtig sind. Besonders bekannt sind fünf Modellannahmen in Bezug auf Konsumentenverhalten geworden:
1. Der »homo oeconomicus«Seine Verhaltensmaximen sind strikte Rationalität, Nutzensmaximierung. Erforderlich für diese Modellannahme sind totale Markttransparenz und vollständige Informationsübersicht.7
2. Der passiv und automatisch reagierende Mensch, in der extremsten Ausformung: das »Konsumäffchen«Der Mensch oder Marktteilnehmer wird dabei als ein primär emotional ansprechbares Wesen gesehen, begehrlich, »triebgeschüttelt«, verspielt, nach hedonistischen Prinzipien reagierend, fast unbegrenzt manipulierbar, sofern die richtigen Signale/Stimuli verwendet werden. Zu dieser Modellannahme gehört meist die Überzeugung von der hohen Wirksamkeit von Massenkommunikation/Werbung.
3. Der Konsument als primär soziales WesenEr richtet sich nach anderen, nach Leitbildern/sozialen Referenzgruppen; er versucht, soziale Forderungen, vermittelt vor allem durch das Konzept der sozialen Rolle, zu erfüllen; er strebt nach Prestige- und Statusgewinn.
4. Der »psychoanalytische« KonsumentDem Menschen sind die eigentlichen Gründe seines Handelns nicht bewusst er agiert gemäß unbewussten Motiven und Wünschen. Produkte können kompensierend für Wünsche stehen, die einem die Realität nicht erfüllt oder die Gebote des Über-Ichs einem verwehren. Es ist dieses Modell, das, basierend auf der Theorie Freuds, durch Ernest Dichter popularisiert, im öffentlichen Bewusstsein oft mit Marktpsychologie überhaupt gleichgesetzt wird und das einen irrationalen Glauben an die Allmacht der Psychologie nährt.
5. Der kognitive KonsumentDie Anteile kognitiver Prozesse bei der Steuerung menschlichen Verhaltens sind beträchtlich.8 Menschen bedenken die Folgen möglicher Entscheidungen, sie beziehen Erfahrungen mit ein, sie richten ihr Verhalten nach vorgestellten Erwartungen und Interpretationen anderer Menschen aus, sie entscheiden aktiv, was sie wahrnehmen und lernen wollen, sie sind in vielfältiger Weise in Prozesse der Informationsverarbeitung eingebunden, die das Bewerten von Verhaltensalternativen und die autonome Steuerung des Verhaltens erlauben. Was zählt, sind nicht (nur) die objektiv feststellbaren Merkmale von Ereignissen/Objekten, sondern die Bedeutung, die diese Ereignisse/Objekte für den einzelnen haben. Legt man dieses Bild zugrunde, so bezieht man sich meist auf die Resultate der Entscheidungspsychologie.9
Ich möchte diese fünf Bezugsrahmen um einen sechsten erweitern:
6. Der Konsument ist ein semiotisches WesenDas heißt der Konsument ist ein Lebewesen, das – anders als die Tiere – differenzierte Systeme zur Übermittlung von Bedeutung entwickelt hat, dem das Bedürfnis unterstellt werden muss, mit Angehörigen der Kultur, in der er sich befindet, über Zeichensysteme zu kommunizieren, und zwar nicht nur zum Austausch funktionaler Nachrichten. Menschen streben danach, die Welt, in der sie leben, zu verstehen, sinnvoll zu handeln; es geht ihnen um Bedeutung und Sinn.
Die Frage, welche dieser Modellannahmen richtig ist, ist falsch gestellt. Jedes Modell hat einen bestimmten Gültigkeitsbereich – es stimmt für einige Bereiche, Situationen, Voraussetzungen, für andere nicht. Es liegt am Geschick oder theoretischen Verständnis des Forschers, zu entscheiden, welches Modell er in einem gegebenen Fall zur Hypothesenbildung und -erklärung heranziehen soll.
Das entspricht im Übrigen dem Stand der psychologischen Theoriebildung. Man strebt nicht mehr die Entwicklung von Makrotheorien an, die das ganze menschliche Verhalten universal erklären, was älteren Theorien eigen ist, sondern entwickelt Minitheorien, Theorien mittlerer Reichweite, die einen bestimmten Verhaltensbereich präzise untersuchen.10
Meine eigene forschungsleitende Maxime schließt hier an: Ich gehe davon aus, dass zunächst so viele theoretische Ansätze als möglich zur Erklärung, Prognose oder Interpretation eines bestimmten Sachverhaltes herangezogen werden sollen. Menschliches Verhalten ist prinzipiell komplex und fällt unter den Gültigkeitsbereich vieler Disziplinen. Welchem Menschenbild man nun auch immer zuneigt – man sollte sich zumindest bewusst machen, dass die Wahl eines Menschenbildes bedeutet, die anderen nicht zu wählen.
Ich möchte zum Schluss noch auf eine Frage eingehen, die sehr oft vom Marketing an die Psychologie gestellt wird: Entscheiden Konsumenten eigentlich primär rational oder emotional?
Zunächst wäre dazu anzumerken, dass schon der Begriff »rational« sehr verschieden definiert werden kann. Selbst wenn wir dieses Problem aussparen, ist klar, dass an jedem Verhalten rationale und emotionale Komponenten beteiligt sind. Dies betont zum Beispiel auch das Einstellungskonzept. Dennoch gibt es die Tendenz anzunehmen, dass die emotionalen Komponenten überwiegen – unter dem »Konsumenten« stellt man sich meist eine eher emotional/irrational handelnde Person vor, die man auch primär auf dieser Ebene ansprechen kann.
Die generellen Befunde der Psychologie zu der Frage »Ist der Mensch ein rationales oder ein irrationales, emotionales Wesen?« sind klar: Menschen besitzen beide Fähigkeiten, die spezifische Situation legt fest, welche in welchem Ausmaß aktiviert werden.
2.2 Verhaltenstheorien und Motivationspsychologie
Hier soll die Ebene des Individuums erfasst werden, und zwar seine Prädispositionen, seine Beweggründe, seine subjektiven Motive/Bedürfnisse/Wünsche, seine Werthaltungen, Entscheidungskriterien, all das, wodurch wahrscheinlich wird, dass jemand beispielsweise Produktgattung A und nicht Produktgattung B wählt und innerhalb der Produktgattung A Marke 1 und nicht Marke 2.
Wenn also ein Anbieter die Absicht hat, eine medizinisch orientierte Mundspülung herauszubringen, hat er eine Fülle von Determinanten zu bedenken, die das Verhalten, nämlich den Kauf von Mundwasser, steuern: Preis, Platzierung, Werbedruck, Distribution. Er kann es über eine Vielzahl von theoretischen Modellen zu erfassen suchen: über das Einstellungskonzept, über das Konzept eines idealen Produktes, über das Aktivierungskonzept, über Kaufentscheidungsmodelle etc.
Durch welche Theorie nun auch immer dieser Planungsprozess gesteuert wird – an einem bestimmten Punkt muss die Frage gestellt werden: Warum kaufen Personen eigentlich ein Mundwasser? Was erwarten und versprechen sie sich davon?
Natürlich wird Letzteres zunächst ein instrumenteller Nutzen sein: Hygiene; frischer Atem; erreicht Zonen, die Zahncreme nicht erreicht; beseitigt Bakterien etc. Aber das ist wohl nicht alles. Kaufen Konsumenten ein Mundwasser vielleicht deshalb, weil sie Angst haben: Angst vor den Bakterien in ihrer Mundhöhle, Angst, ihre Zähne zu verlieren, Angst vor sozialer Missbilligung wegen schlechten Atems, Angst vor der Missbilligung eines erotischen Partners? Kaufen sie es, weil sie dadurch ausdrücken wollen, dass sie sozial elitäre Personen sind, die verantwortungsbewusst, planend und informiert sind, gegenüber sozial tiefer stehenden Personen, die leichtsinnig, uninformiert, nur der Gegenwart verhaftet sind? Spielen alle diese Gründe eine Rolle oder einer mehr als der andere, oder spielen einige für bestimmte Gruppen eine besonders wichtige Rolle? Lassen sich dahinter möglicherweise ideologische Muster ausmachen, etwa das der Vorsorge, der Selbstverantwortung des Einzelnen, der in Langzeitbezügen zu denken hat, oder der Besiegung der »schlechten Natur«?
Im Bereich des instrumentellen Nutzens, also des direkten Produktnutzens, werden sich die einzelnen Marken kaum voneinander unterscheiden, sie können jedoch an verschiedene Beweggründe appellieren. Der Erfolg der Marke wird unter anderem auch davon abhängen, wie gut es den Produktentwicklern gelingt, Prozesse dieser Art zu verstehen.
Wie später zu zeigen sein wird, bestimmt ein Verständnis dieser Art noch viele weitere Aspekte des Produktes: Soll es rot oder grün gefärbt sein? Soll es vor oder nach dem Zähneputzen angewendet werden? Soll es an eine bekannte Zahncrememarke angeschlossen werden oder eine eigene Marke darstellen?
Die oben erwähnten Prädispositionen von Individuen, die Beweggründe des Handelns, lassen sich aus dem Blickpunkt mehrerer Theorien beschreiben. Zunächst in ganz allgemeiner Form: Warum verhalten sich Personen auf spezifische Weise? Warum handelt Person A anders als Person B, warum gibt es zum Beispiel Raucher und Nichtraucher? Warum wirkt die gleiche Situation oder das gleiche Objekt auf Person 1 anders als auf Person 2? Warum kaufen zum Beispiel manche Personen sehr gern in Diskontgeschäften ein, während andere es hassen?
Die Wissenschaft, die sich in erster Linie diesen Determinanten des Verhaltens zuwendet und traditionellerweise das Individuum, den individuellen Akteur, in das Zentrum ihrer Betrachtung stellt, ist die Psychologie. Die Psychologie hat allerdings keine allgemeine Verhaltenstheorie entwickelt, sondern mehrere unterschiedliche, je nach theoretischem Ansatz und nach dem historischen Zeitpunkt ihres Erklärungsversuches.
Hierbei lässt sich auch eine Abhängigkeit vom jeweiligen Stand unseres Gesellschaftssystems erkennen: Verhaltenstheorien, die im frühen 20. Jahrhundert entwickelt wurden – also zu einer Zeit, in der es starke hierarchische Unterschiede und strikte normative Regelungen gab und wo im ökonomischen Bereich keineswegs der heutige Stand einer Wohlfahrtsgesellschaft erreicht war –, gingen von anderen Antriebskräften des Verhaltens aus als Verhaltenstheorien der Gegenwart. Generell lässt sich feststellen, dass mit zunehmendem ökonomischem Entwicklungsstand und mit zunehmenden Individualisierungstendenzen innerhalb der Gesellschaft ein höherer Anteil von kognitiven, expressiven und kommunikativen Determinanten des Verhaltens postuliert wird. Im Folgenden werden einige wichtige Verhaltenstheorien vorgestellt.
Prinzipiell lassen sich im Bereich der Verhaltenstheorien zwei Fragestellungen unterscheiden:
Wie kommt Verhalten in Gang? Welche Verhaltensmechanismen, welche Verhaltensprozesse und -abläufe gibt es?
Prozessorientierte Modelle
Welche Antriebskräfte existieren? Welche Motive lassen sich inhaltlich voneinander abgrenzen?
11
Inhaltliche Motivtheorien
3 Verhaltensabläufe und Verhaltensmechanismen
Prozessorientierte Modelle
3.1 Allgemeine Annahmen und Ergebnisse
Eine Verhaltenstheorie muss drei Fragen beantworten:
Wie kommt Verhalten in Gang?
Annahme 1: Der Organismus ist im Prinzip passiv, auf Gleichgewicht bedacht – Verhalten kommt dann in Gang, wenn ein Mangelzustand vorliegt. Der Organismus stellt diesen Mangel ab, er »befriedigt das Bedürfnis«, stellt das Gleichgewicht wieder her.
Annahme 2: Der Organismus ist im Prinzip aktiv – Verhalten wird durch Anreize, Ziele, positive Systemzustände ausgelöst, die man zu erreichen sucht, ohne dass ein Mangel vorliegt.
Wie
verfestigt
sich Verhalten? Wie kommt es zu stabileren Verhaltensdispositionen?
Wie wird zwischen mehreren Verhaltensoptionen
entschieden
?
Im Folgenden werden einige wichtige Modelle näher vorgestellt.
3.2 Die Reizsummenregel
Antriebe und Anreize
Menschliches Verhalten ist immer eine Konsequenz von Innensteuerung und Außensteuerung, es wirken Faktoren zusammen, die im Individuum oder in der Umwelt zu lokalisieren sind. Im ersten Fall lässt sich von Antrieben sprechen, im zweiten Fall von Anreizen. Die zwischen Antrieben und Anreizen bestehenden Zusammenhänge beschreibt die so genannte Reizsummenregel:
Je niedriger der Antrieb ist, desto höher muss der Anreiz sein.
Je höher der Antrieb ist, desto niedriger kann der Anreiz sein.
Wenn jemand ziemlich satt ist, muss ein Gericht schon sehr appetitlich und reizvoll sein, damit er noch davon isst; wenn jemand wirklich Hunger hat, wird er nur irgendetwas zum Essen suchen. Diese Wechselbeziehung von Antrieben und Anreizen muss auch bei der Untersuchung von Konsumentenverhalten berücksichtigt werden: Mit welcher Stärke von Antrieben kann ich rechnen? Wie hoch müssen die Anreize sein?
Der Zusammenhang Antrieb – Anreiz spielt vor allem bei Verhalten eine Rolle, das nach dem Modell eines Reglerkreises befriedigt wird. Bei diesem Modell wird folgender Prozess angenommen: Es besteht innerhalb des Organismus ein Sollwert, der erreicht sein muss; sinkt der Zustand des Systems unter diesen Sollwert, wird aktives Verhalten ausgelöst – der Organismus sucht den Sollwert wieder zu erreichen, und damit endet dann die Verhaltenssequenz.
Jeder Organismus hat einen bestimmten Kalorienbedarf; sinkt die Kalorienzufuhr unter einen bestimmten Wert, wird Hungergefühl ausgelöst – der Organismus sucht Nahrung aufzunehmen. Ist der Sollwert erreicht, endet die Sequenz. Nahrungsaufnahme spielt sich also in festen Grenzen ab: Ab einem bestimmten unteren Punkt wird das Verhalten Nahrungsaufnahme ausgelöst, ab einem bestimmten oberen Punkt endet es – man kann nicht unbegrenzt Nahrung aufnehmen.
Die Vorstellung vom Organismus, der zwangsläufig etwas tun muss, kommt nicht von ungefähr – die Theorie ist vor allem im Bereich des elementaren Verhaltens abgesichert, das Menschen und Tieren gemeinsam ist. Die Antriebe werden daher oft unter dem Konzept des Triebes beschrieben, weshalb man auch von Triebreduktionstheorien spricht.
Die wesentliche Annahme dieser Theorien ist, dass der Organismus einem Gleichgewichtszustand zustrebt – Verhalten kommt dann in Gang, wenn dieser Zustand gestört ist, wenn also ein Mangel auftritt. Dieser Mangel kann im Bereich menschlichen Verhaltens auch mit »Bedarf«, »urgent gefühltes Bedürfnis«, »Problem« umschrieben werden, wenn man die engen Grenzen der Triebreduktionsmodelle verlässt. In dieser Formel lässt sich das Modell zur Analyse einer Reihe von Verhaltensprozessen auf dem Markt benützen.
Im konkreten Fall ist also zu fragen: Kann ich damit rechnen, dass es eine Antriebskraft gibt, einen Mangel, ein gefühltes Problem, einen akuten Bedarf, sodass etwas aufgesucht oder gern getan wird – dass es also eine wie auch immer geartete Antriebskraft gibt, oder kann ich das nicht?
Wenn ja, brauche ich die Höhe des Anreizes nicht allzu hoch anzusetzen, ich muss nur klarmachen, dass ein Produkt exakt die Merkmale hat, die den Mangel beheben oder Befriedigung verschaffen; wenn nein, muss ich den Anreiz deutlich erhöhen, um überhaupt Verhalten in Gang zu setzen.
Beispiele
Es gibt Produktfelder, in denen ich damit rechnen kann, dass – jedenfalls in der Zielgruppe, an die ich mich wende – gewisse Antriebskräfte bestehen. Das ist im Wesentlichen dann der Fall, wenn es um die Beseitigung eines deutlich erlebten Mangels geht oder wenn eine generell erhöhte Disposition oder Aufmerksamkeit für diesen Bereich besteht. Beispiele hierfür wären etwa der Markt für Schuppenshampoos oder für Mittel gegen Haarausfall oder gegen unreine Haut. Personen, die an diesen Problemen leiden, erleben tatsächlich einen Leidensdruck, sie suchen aktiv nach einer Möglichkeit, ihr Problem zu beheben. Produkte dieser Art brauchen daher nicht besonders verführerische Anreizqualitäten zu haben, sie müssen hingegen sofort signalisieren, dass sie die geforderte Leistung in einem möglichst hohen Ausmaß erbringen, also besonders effizient im Bereich ihres instrumentellen Nutzens sind.
So verspricht etwa ein Schuppenmittel: »Crisan ist sauteuer, aber es wirkt!« Hier wird ein weiterer Motivationsmechanismus benützt, nämlich einerseits die Gleichsetzung »mehr Geld – mehr Wirkung«, andererseits eine noch tiefer liegende Überzeugung, nämlich dass man ein Opfer bringen müsse, um bei »Schicksalsschlägen«, stigmatisierenden Krankheiten (als solche können Schuppen erlebt werden), Hilfe zu erhalten. Skinclair, ein Mittel gegen unreine Haut, trägt sein Versprechen schon im Namen.
Ähnlich starke Antriebskräfte gibt es auch im positiven emotionalen Bereich: Konsumenten sind dann förmlich »heiß« auf diese Produkte – dies ist etwa in jungen Gruppen bei manchen Produkten der Unterhaltungselektronik der Fall, bei Mode, bei Make-up-Artikeln oder auch bei Autos, prinzipiell also bei Produkten, die mit Ego-Involvement verbunden sind.
Die meisten Produzenten wünschen sich, dass Konsumenten, quasi aus einem natürlich gefühlten Bedürfnis heraus, heftig nach ihren Produkten verlangen. Dies ist aber eher selten der Fall. Es gibt zahlreiche Produktfelder, auf die niemand »heiß« ist: Waschmittel, Klebeprodukte, Grundnahrungsmittel, Versicherungen etwa. Die Antriebskräfte, die darauf drängen, diese Produkte haben zu müssen, sind schwach.
In diesem Fall müssen beträchtliche Anstrengungen unternommen werden, um die Anreizqualitäten der Produkte zu stärken und gleichzeitig an die Antriebskraft zu appellieren – also etwa darzustellen, welche Probleme Waschmittel lösen, welche Mangelzustände sie aufheben, aber auch, dass diese Mangelzustände tatsächlich Probleme bringen. Das Bedürfnis nach Waschmitteln etwa muss durch gezielte Kommunikationsstrategien immer auf einem gewissen Niveau gehalten werden.
Davon zu unterscheiden sind die Fälle, in denen Produkte so hohe Anreizqualitäten haben, dass sie Verhalten auslösen, auch wenn weder ein Mangel noch ein Problem vorliegt. Auf diese Weise funktionieren Produktkategorien, die in hohem Ausmaß von Impulskäufen leben: der Eismarkt etwa oder der Riegelmarkt.
Es muss hier zwar eine generelle Verhaltensdisposition vorausgesetzt werden, die keineswegs in allen Zielgruppen gegeben ist – so wirken Anreizqualitäten dieser Art zum Beispiel sehr viel schwächer auf ältere Leute, diese Disposition ist aber ganz einfach zu aktivieren, nämlich schon durch die optische Präsentation des Produktes. Später soll erläutert werden, dass dieser Prozess doch nicht ganz so einfach abläuft, da auch Lernerfahrungen vorliegen müssen. Dennoch handelt es sich um einen wichtigen Mechanismus.
Dieser kann im Übrigen auch über Sprache vermittelt ablaufen. So stellte eine erfolgreiche Kampagne für Hamburger das verführerische Bild eines Hamburgers unter die Überschrift: »Are you hungry?« – was bei jungen Konsumenten, also der Hauptzielgruppe dieser Produkte, fast automatisch Hungergefühle und das Bedürfnis entstehen ließ, diese durch einen Hamburger zu befriedigen. Dass bei diesen Zielgruppen so leicht Verhalten dieser Art ausgelöst werden kann, liegt auch daran, dass sie eine permanente Aufmerksamkeit für den oralen Bereich übrig haben – sie sind fast immer leicht hungrig und »gefräßig«.
Zusammenfassung
Als allgemeine Frage, die am Anfang jeder Beschäftigung mit Verhalten steht, ist zu klären und zu erforschen, wie weit man sich auf die inneren Antriebskräfte der Person – auf die Innensteuerung also – verlassen kann (zum Beispiel extremer Mangel, Bedarf, Leidensdruck, »Trieb«, relativ invariante Orientierung auf ein Ziel), und wie weit auf die Anreizqualitäten der Objekte, also auf die Außensteuerung. Dabei gilt:
Je stärker die Antriebskräfte sind, desto geringer können die Anreize sein.
Je niedriger die Antriebskräfte sind, desto höher müssen die Anreize sein.
Die Frage, an welchen Merkmalen Konsumenten erkennen, dass ein Produkt vorliegt, das ein bestimmtes Problem löst, oder dass Anreize dieser Art von Produkten überhaupt entfaltet werden können, kann im Rahmen psychologischer Theorien nicht beantwortet werden. (Diese Frage wird weiter hinten im Buch näher behandelt werden.)
Beim heutigen Stand unserer Gesellschaft ist davon auszugehen, dass Mangelzustände/Bedürfnisse/Antriebe sehr schnell und einfach befriedigt werden können; wir befinden uns insgesamt auf einem hohen Sättigungsniveau. Das bedeutet, dass die Anreizqualitäten immer merkbarer erhöht werden müssen: auf das »noch nie da Gewesene«, das Neueste, das Schönste, das Schnellste – ein Prozess, der sich in vielen Produktfeldern feststellen lässt – oder, wenn dies im genannten Sinne nicht mehr möglich ist, durch das Umschalten auf andere Appellebenen: auf das ethisch Richtige, das ästhetisch Geformte.
3.3 Exkurs: Psychologie des Wohlstandes
Dieses von Scitovsky 1977 entwickelte Konzept stellt einen Versuch dar, ökonomische und psychologische Theorien miteinander zu verbinden und daraus eine Motivationstheorie zu entwickeln, die den Stand unseres sozioökonomischen Systems mit einbezieht. Da diese Theorie an das Konzept von Antrieb und Anreiz anschließt, soll sie an dieser Stelle beschrieben werden.
Scitovsky beschäftigt sich vor allem mit dem Begriff der Bedürfnisbefriedigung. Er geht von einem hedonistischen Menschenbild aus, das einen elementaren Motivationsmechanismus voraussetzt: Menschen streben nach Lust und versuchen Unlust zu vermeiden. Ein elementarer Mechanismus des Lustgewinns besteht darin, ein urgent gefühltes Bedürfnis zu befriedigen: zu essen, wenn man wirklich Hunger hat, zu schlafen, wenn man wirklich müde ist etc. Ebenso kann man sagen, dass es sich bei Individuen, die sich in einem Spannungszustand befinden, da ständig hohe Antriebe gegeben sind, um aktivierte, aktive Individuen handelt.
Scitovsky stellt nun zweierlei fest: Erstens hat unsere Gesellschaft im Zuge der Industrialisierung schrittweise das Niveau der Antriebskräfte reduziert, indem sie zahlreiche wirkungsvolle Strategien entwickelte, um Bedürfnisse schnell und mühelos zu erfüllen, um alles, was lästig, mühsam, anstrengend ist, zu erleichtern, Arbeit und Denken einzusparen, Mangel zu beheben. Dadurch geschieht Folgendes:
Die Antriebskräfte – oder übertragen formuliert – das drängende Bedürfnis, etwas haben zu müssen – sind schwach ausgebildet. Um Verhalten in Gang zu setzen, bedarf es einer deutlichen Erhöhung der Anreize.
Und: Wenn sich jemand oder eine Gesellschaft als Ganzes daran gewöhnt hat, dass Bedürfnisse auf einem bestimmten Niveau befriedigt werden, ist es nahezu unmöglich, wieder zu früheren, weniger perfekten Befriedigungsniveaus zurückzukehren – man ist verwöhnt und tut sich schwer, Bedürfnisse oder die Ansprüche auf bestimmte Niveaus der Bedürfnisbefriedigung wieder zurückzuschrauben.
12
Das bedeutet zum Beispiel, dass sich Konsumniveaus steigendem Einkommen sehr leicht anpassen, dass eine Einschränkung des Konsumniveaus aber außerordentlich schwer fällt. Dies ist auch bei umweltbezogenem Verhalten zu bedenken: Wird dadurch eine Einbuße an Convenience, an »Annehmlichkeit« verlangt, wird es nur unter ganz bestimmten Umständen geleistet.
Die zweite Behauptung von Scitovsky beschäftigt sich mit der Art, in der ein Antrieb befriedigt wird: Diese kann einmal vom Typ »Behaglichkeit« (comfort) sein, ein andermal vom Typ »Genuss« (pleasure). Der erste Typ bedeutet, dass ein Bedürfnis »ordentlich« befriedigt ist, es herrscht kein Mangel mehr, aber es wird auch nicht mehr geboten; der zweite Typ bedeutet, dass zusätzlich ein bisschen mehr geboten wird, etwas Unfunktionales/Raffiniertes/ein bisschen Luxus, auch wenn man das eigentlich nicht braucht.
Scitovsky behauptet nun, dass die amerikanische Konsumkultur Produkte im Hinblick auf comfort produziert; sie bietet die perfekte Befriedigung eines Bedürfnisses, aber auch nicht mehr. Dies entspricht in vielen Fällen der dem Alltagsverhalten immer noch zugrunde liegenden puritanischen Ethik, die sich gegen Unfunktionales, gegen Genuss/Luxus sträubt – wie etwa die Art der Küche oder die Art der Selbstpräsentation in der Öffentlichkeit zeigen.
Das entsprechende europäische Verhalten würde genau jenen Genuss, jenes Raffinement, eben das Unfunktionale zulassen. Dies würde europäischen Produkten eine ganz besondere Chance geben, da sie von einer kulturell anders geformten Qualitätsdefinition ausgehen.
Diese kulturelle Vorprägung findet sich zum Beispiel im Bereich der Küche.
So setzt etwa die traditionelle amerikanische Küche gutes Essen mit einfachen, unverfälschten Zutaten gleich (das große Steak), sie präsentiert Nahrungsmittel gleichsam ohne Geheimnis. Die französische Küche definiert gutes Essen genau konträr: die raffiniert gewürzte Sauce, zu der viel Fleisch verwendet wird, das aber nicht sichtbar ist.13
Von diesem Ansatz können für marktpsychologische Überlegungen zwei Gedanken übernommen werden:
Von welchem Ausmaß der Bedürfnisbefriedigung ist in einem Produktfeld auszugehen? – In sehr vielen Produktfeldern sind Konsumenten inzwischen sehr »verwöhnt«, sie setzen ein hohes Ausmaß an Leistung und Convenience voraus. So haben sich zum Beispiel Pumpsprays im Bereich der Haarlacke nur in geringem Ausmaß durchgesetzt, obwohl die meisten Konsumenten davon ausgehen, dass sie umweltverträglicher sind. Dennoch sind Aerosolsprays wesentlich beliebter – sie sprühen feiner und sind leichter und spielerischer zu bedienen, sie bieten also Vorteile in Leistung und Convenience.
Befriedigung eines Bedürfnisses heißt nicht nur einfach: Abstellen des Mangels
(comfort)
, es ist zu versuchen, darüber hinaus noch
pleasure
zu bieten. – Diese Entwicklung ist in vielen Produktfeldern festzustellen, sie zeigte sich etwa am Erfolg von Parfümdeos, die neben ihrer
comfort-
Leistung, die verhindert, dass man schwitzt, dass man nicht gut riecht, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch parfümartigen Geruch boten.
3.4 Pleasure stamps in, pain stamps out
Konditionierungstheorien
Konditionierungstheorien, wie sie von Forschern wie Pawlow, Skinner oder Hull, um die wichtigsten zu nennen, entwickelt wurden, stützen sich auf eine umfangreiche experimentelle Basis. Die Tragfähigkeit dieser Theorien wurde in zahlreichen Experimenten an Tieren und Menschen bewiesen.14
Konditionierungstheorien betrachten, summarisch gesehen, Verhalten als eine Konsequenz von Belohnung und Bestrafung. Wird ein bestimmtes Verhalten belohnt (positiv verstärkt), dann wird es beibehalten und tritt häufiger auf, wird es bestraft (negativ verstärkt), dann wird es unterlassen: »Pleasure stamps in, pain stamps out« (Thurstone). Anders formuliert: Ein Lebewesen lernt, sein Verhalten je nach Belohnung oder Bestrafung an seine Umwelt anzupassen.
In der klassischen Formulierung dieser Theorie wird nicht angenommen, dass individuelle Varianten auftreten, sondern es wird davon ausgegangen, dass ein relativ starrer Mechanismus vorliegt, dem sich das einzelne Lebewesen kaum entziehen kann – man erlernt auf diese Weise ein Verhalten, ob man will oder nicht und unabhängig davon, was in der Black Box des Bewusstseins/des individuellen Akteurs vorgeht. Genau dies macht die Attraktivität dieser Theorien für Beeinflussungsversuche auf dem Markt aus: Wenn Verhalten tatsächlich so automatisch erzielt werden könnte, ginge es nur darum, die richtigen Stimuli zu erkennen, und das »Konsumäffchen« müsste dann darauf reagieren.
Wie immer: So einfach ist das nicht. Dennoch handelt es sich hier um eine interessante Gruppe von Theorien, die in vielen Fällen einen relevanten Analyserahmen bieten.
Die zentrale Prämisse dieser Theorien: Positiv verstärktes Verhalten nimmt zu, negativ verstärktes nimmt ab. Oder: Menschen wählen eher die Alternative, von der sie sich eine »Belohnung« versprechen, als die, von der sie sich keine Belohnung versprechen oder die eine Bestrafung darstellt. Dies ist auch für das Marktgeschehen gültig.
Zuerst ein typisches Experiment:
1. Durchgang
Hungrige Tauben werden in einen Käfig gelassen, in dem sich eine Wand mit bunten Scheiben befindet.
Sie picken wahllos auf jede Scheibe.
Aus jeder blauen Scheibe fällt ein Futterkorn.
1. Wiederholung
2. Wiederholung
3. bis 10. Wiederholung
11. Wiederholung
Hungrige Tauben werden in einen Käfig gelassen, in dem sich eine Wand mit bunten Scheiben befindet.
Sie picken gezielt auf alle blauen Scheiben
Aus jeder blauen Scheibe fällt ein Futterkorn.
Die Tauben haben ihr ursprüngliches Verhalten modifiziert, sie haben die Häufigkeit, mit der sie auf blaue Scheiben picken, gesteigert – sie haben gelernt, gezielt blaue Scheiben vor grünen/gelben/roten zu bevorzugen. Dieser Mechanismus erklärt einen großen Bereich sozialen Lernens und Verhaltens, wenn auch selbstverständlich nicht den gesamten.
Daher ist auch für weite Bereiche des Marktgeschehens gültig: Wenn aus der »blauen Scheibe«, die mein Produkt repräsentiert, kein »Futter« fällt, werden Konsumenten nicht »lernen«, diese vor anderen zu bevorzugen. Wenn ich andererseits gelernt habe, dass mich die Verwendung von Marke X »belohnt«, werde ich sie wiederholt kaufen.
Die Annahme scheint simpel und einleuchtend. Es gibt aber genügend Fälle in der Planung von Produkten und Strategien, wo genau diesem Punkt wenig Überlegung geschenkt wird: Warum sollen die Leute das tun, was man von ihnen erwartet? Warum soll ein junges Mädchen eine Pflegecreme kaufen – was hat sie davon? Warum soll jemand Müll trennen – was hat er davon?
Betrachten wir diese Theorien nun etwas genauer. Sie gehören in den Bereich der bekannten S-R-Modelle, die lediglich an dem Zusammenhang zwischen einem Input (einem Stimulus) und einem Output (einer Reaktion) interessiert waren und die all das, was sich im Inneren des Organismus, der Person abspielt, außer Acht ließen. Naturgemäß kann damit also nur ein bestimmter Verhaltensausschnitt erklärt werden, dieser aber sehr genau.
Eine Konditionierungstheorie geht davon aus, dass Organismen nach einfachen hedonistischen Prinzipien funktionieren: Sie versuchen Wohlgefühl/Lust/positive Zustände zu erreichen und Unangenehmes/Schmerz/negative Zustände zu vermeiden – eine weithin, wenn auch nicht uneingeschränkt gültige Annahme, die einfachste Motivtheorie eigentlich, die schon in der Antike bekannt war.
Weitere Annahmen dieser Theorie sind: Es wird besser gelernt, das heißt, das verlangte Verhalten wird schneller aufgenommen, wenn der Zustand der Befriedigung/Belohnung besonders intensiv erlebt wird. Dies ist der Fall, wenn:
die Verstärker/Belohnungen besonders attraktiv sind, wenn also massiv belohnt wird;
wenn schnell, unmittelbar danach belohnt wird (optimal ist ein Zeitraum von drei Sekunden); und/oder wenn
ein Mangelzustand vorliegt, der durch den Verstärker aufgehoben wird; das heißt: Hungrige Tiere lernen schneller als gesättigte. (Die Theorie wurde im Wesentlichen über Triebreduktionsmodelle geprüft.)
Die Begriffe dieser Theorie lassen sich daher auch folgendermaßen darstellen:
drive
cue
gratification
Mangelzustand
nicht befriedigtes Bedürfnis
hungrige Tauben
Schlüsselreiz, der den Verstärker ankündigt
blaue Scheiben
Verstärker
Belohnung
Futter
Durch Wiederholungen dieser Abfolge bildet sich ein bestimmtes Verhalten, etwa das Bevorzugen der blauen Scheibe; man nennt das auch das Ausbilden von habits. Das Modell funktioniert unter mehreren Bedingungen:
Beispiele
Positiven Reiz geben: Belohnen
Jemand ist hungrig und kauft sich einen Schokoladeriegel. Der Riegel schmeckt sofort beim ersten Bissen wunderbar und stillt den Hunger schnell und anhaltend, die Person erlebt Wohlgeschmack und Sättigung. Sie beschließt, sich den Namen des Riegels zu merken und ihn beim nächsten Mal, wenn sie Hunger hat, wieder zu kaufen.
drive:
Hunger
cue:
Name des Riegels
gratification:
Wohlgeschmack/Sättigung
habit:
Kauf des Riegels X
Negativen Reiz nehmen: Belohnen
Jemand hat Kopfschmerzen. Er verwendet die Kopfschmerztablette X, sie nimmt sofort den Kopfschmerz, er fühlt sich besser. Er beschließt, sich den Namen der Tablette zu merken und sie das nächste Mal wieder zu kaufen.
drive:
Kopfschmerz
cue:
Name der Tablette
gratification:
Schmerzfreiheit
habit:
Kauf von Tablette X
Positiven Reiz nehmen: Bestrafen
Konsumenten dürfen den Müll nicht einfach in den Kübel werfen, sie büßen damit Convenience-Vorteile ein, die sie bisher hatten. Oder: Diätkuren verlangen das Aufgeben gewohnten Essverhaltens. Mütter verbieten ihren Kindern, ein bestimmtes Getränk zu trinken.
Negativen Reiz geben: Bestrafen
Wenn man Autogurte nicht anlegt, zahlt man Strafe. Wenn man Pfandflaschen nicht zurückbringt, verliert man Geld.
Umweltbewusste Produkte »bestrafen«, indem sie gewohnte Leistungen oder Convenience-Vorteile nicht bieten.
Wenn man Raten nicht zurückzahlt, bezahlt man eine Gebühr.
Wenn man Waschmittel X nicht benützt, bleiben Flecken – man zieht sich soziale Missbilligung zu.
Wenn Handelsorganisationen im Bereich der Frischeabteilung schlechtes Gemüse anbieten, werden sie von Konsumenten bestraft – man kauft das Gemüse woanders.
Die Benützung dieses Mechanismus auf dem Markt ist oft problematisch und verlangt besondere Planung. Sobald man sich darüber im Klaren ist, dass ein gefordertes Verhalten eigentlich eine Bestrafung ist oder dass eine Bestrafung in Aussicht gestellt wird, muss sofort ein Gegenwert kompensierend angeboten werden.
Also: »Gesunde« Produkte scheinen zunächst zu bestrafen – man erwartet, dass sie nicht gut schmecken, dass man auf Genuss und Sättigung verzichten muss, was auch tatsächlich manchmal der Fall ist. Man braucht daher eine Kompensation: Man verzichtet auf Genuss und erhält dafür Schönheit/Jugend oder das Gefühl, als verantwortungsvoller Mensch zu handeln. Oder: Wenn in einem Werbefilm Angst gemacht wird (»Die Zecken lauern« oder »So befleckt könnte Sie jemand sehen«), muss sofort eine Bewältigungsstrategie, eine so genannte Coping-Strategie geboten werden, und zwar sofort, also ähnlich wie bei der Belohnung. Das heißt, man muss sofort erkennen: Aber die Zeckenimpfung schützt dagegen.
Lassen wir die Bestrafungsfälle zunächst einmal außer Acht und wenden wir uns den Belohnungsstrategien zu: Die Erfolge, die sich mit ihnen auf der Ebene der Zuwendung und der Gewöhnung an Produkte erzielen lassen, sind beträchtlich. Dies betrifft zunächst die Ebene der wahrnehmbaren beobachtbaren Produktmerkmale, also das, was man bei der Verwendung des Produktes erlebt. Gerade für diese Ebene ist dieser Mechanismus von hoher Relevanz. Es gibt dafür zwei Voraussetzungen:
Das positive Erlebnis, die Verstärkung, muss sofort erfolgen und möglichst intensiv sein.
Der
cue