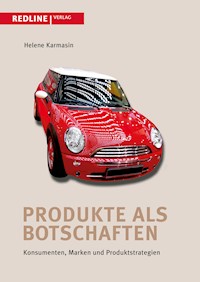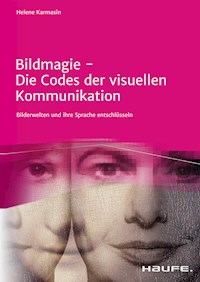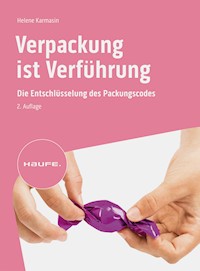
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Kund:innen kaufen Packungen, nicht Produkte. Packungen sollen die Attraktivität von Produkten steigern, den rationalen und emotionalen Nutzen signalisieren und zum Kauf verführen. Entdecken Sie in diesem Buch die Möglichkeiten der verschiedenen Verpackungscodes und nutzen Sie deren Potenzial. Die Autorin beruft sich auf Erkenntnisse der Psychologie für die Verpackungsgestaltung und beschreibt die Verfahren, die gewählt werden, um Waren zu verpacken und mit Bedeutungen aufzuladen. Bekannte Beispiele aus der Konsumgüter- und Nahrungsmittelindustrie illustrieren die Wertsteigerung, die mit der richtigen Packung erreicht werden kann. Inhalte: - Materielle und soziale Basiscodes: Material, Größe, Form, männlich, weiblich etc. - Gestaltungs- und Inszenierungsmöglichkeiten für Verpackungen - Wirksamkeit von Packungen: Ästhetik, Differenzierung, Faszination, Nutzen - Erkenntnisse der kognitiven Psychologie für die Verpackungsgestaltung - Exkurs in die Semiotik: Wie kommunizieren wir? - Checkliste für die Analyse des Packungscodes Neu in der 2. Auflage: - Der Code der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusstseins - Traum von ewiger Jugend – Nahrungsergänzungsmittel - Gesundheitlich verantwortliche Süßigkeiten (Proteinriegel etc.) und Darstellung in der Packungsgestaltung Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - E-Book direkt online lesen im Browser - Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumEinleitung1 Verpackungsgestaltung im kulturellen Rahmen1.1 Packungen und Marketing1.2 Packungen als Teil der symbolischen Ökonomie1.3 Packungen inszenieren zentrale soziale Konzepte1.4 Packungen als Teil der ästhetischen Ökonomie2 Die Sprache der Packungen2.1 Langue und Parole – die Basiscodes2.2 Die Kommunikationsflächen des Mediums Packung2.3 Das Nackte und das Bekleidete2.4 Die Funktion von materiellen Basiscodes2.4.1 Materialien2.4.2 Farbcodes2.4.3 Größe2.4.4 Form2.4.5 Haptik2.5 Die Funktion von sozialen Basiscodes2.5.1 Männlich und weiblich2.5.2 Cool und cute2.5.3 Kindlich, jung und alt2.5.4 Zeit und Raum3 Konzeptionen des Wünschenswerten und Verpackungsgestaltung3.1 The idea of a home – Haushaltsprodukte3.2 Creating the perfect body – Kosmetik3.3 Der Traum von ewiger Jugend – Nahrungsergänzungsmittel3.4 The experience economy – Körperpflege3.5 Fein bleiben – Süßigkeiten4 Die Funktion des Geschmacks für die Verpackungsgestaltung4.1 Sozialisation von Geschmacksvorlieben – Pierre Bourdieu4.2 Gliederung der Gesellschaft nach Geschmacksvorlieben4.3 Geschmacksgruppen zeitgenössischer Gesellschaften – taste regimes4.3.1 Niveaumilieu4.3.2 Selbstverwirklichungsmilieu4.3.3 Harmoniemilieu4.3.4 Unterhaltungsmilieu5 Zentrale Codes – Gestaltungs- und Inszenierungsmöglichkeiten für Verpackungen5.1 Der elitäre Code5.2 Der Code der Gegenwelten5.3 Der Code der Wissenschaft5.4 Der Code der (staatlichen) Institutionen5.5 Der Code der Verantwortung und des moralischen Konsums5.6 Der Code der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusstseins6 Exkurs in die Semiotik: Wie kommunizieren wir?6.1 Die semiotische Ausstattung der Packung6.2 Grundbegriffe semiotischer Kommunikation6.3 Der Einsatz von rhetorischen Figuren6.4 Visuelle und verbale Kommunikation6.5 Der Nutzen von semiotischen Analysen6.6 Packungsentwicklung mithilfe von semiotischen Analysen – ein Beispiel7 Erkenntnisse der Psychologie für die Verpackungsgestaltung7.1 Klassische und moderne Kommunikationsmodelle7.2 Ergebnisse der Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie7.3 Die Ergebnisse der Psychophysik7.4 Packungsgestaltung unter dem Aspekt der Informationsverarbeitung7.5 Ergebnisse der Neuropsychologie8 Checkliste: Die Analyse des PackungscodesAbbildungsverzeichnisLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisDie AutorinDigitale ExtrasHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem Sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[6]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-16954-4
Bestell-Nr. 10409-0002
ePub:
ISBN 978-3-648-16955-1
Bestell-Nr. 10409-0101
ePDF:
ISBN 978-3-648-16956-8
Bestell-Nr. 10409-0151
Dr. Helene Karmasin
Verpackung ist Verführung
2. Auflage, Mai 2023
© 2023 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): © iStock.com/Elena_Rudyk
Produktmanagement: Kerstin Erlich
Lektorat: Peter Böke
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
[9]Einleitung
Gestern haben sich die Kinder in unserer Familie wieder einmal mit einem Joghurt namens Lyttos vergnügt. Das ist derzeit eine ihrer beliebtesten Zwischenmahlzeiten. Lyttos ist in einem Plastikbecher abgefüllt, der 160 Gramm enthält: 120 g bestehen aus griechischem Joghurt, 32 g aus ungefähr einem Löffel Honig und 8 g aus einem Teelöffel klein geriebener Pekannüsse. Jeder dieser Bestandteile befindet sich in einer separaten Kammer, im Deckel sind die Knusperbestandteile.
Jeder isst aus seinem kleinen Töpfchen und mischt sich die Bestandteile zusammen, wobei es immer aufgeregte Diskussionen gibt, ob es besser sei, sofort alles zu mischen, was praktisch ist, aber die Knusperbestandteile durchweichen lässt, oder ob man, was die kleinen Genießer tun, sich jeden Löffel frisch mischt und das Knuspererlebnis genießt.
Abb. 1: Joghurt der Marke Lyttos
[10]Die Packung ist blau-weiß, Lyttos ist in griechisch anmutenden Buchstaben geschrieben, sie zeigt die Bestandteile, die Lyttos enthält und zwar keine Milchbestandteile, sondern dominant den Honig, der unmittelbar aus einer Wabe geschöpft wird und die ganzen Pekannüsse, über die er geträufelt wird.
Auf der Packung befinden sich verschiedene Aufschriften, vor allem die Beschreibung des Produktes: Griechischer Joghurt mit Honig und Pekannüssen, 10% Fett im Milchanteil, Qualität aus Griechenland, dann auf der Rückseite noch einmal die Bestandteile, wobei über den Honig gesagt wird, dass er eine Mischung aus Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern darstellt, das Ablaufdatum und den Hersteller.
Was verkauft diese Packung eigentlich?Worin besteht ihre Attraktivität?Warum werden genau diese Textaussagen und diese Bilder gewählt?Warum werden die Bestandteile in dieser Form verpackt?Geht man diesen Fragen im Einzelnen nach, so zeigt sich, dass dieses kleine Alltagsprodukt an eine Vielzahl von Diskussionen bzw. Diskursen in unserer Gesellschaft anschließt, dass es sich auf weit verbreitete Überzeugungen stützt, dass es kollektives Wissen ausnutzt, Denkkategorien abbildet, wichtige Konzeptionen des Wünschenswerten zugrunde legt – es bildet einen Zeichenmikrokosmos, der eine Fülle von Botschaften sendet: durch seine Größe, sein Material, die Anordnung der Kammern im Inneren, die eine bestimmte Art des Verzehrs nahelegt, die Namensgebung, den Farbcode, die Abbildungen, die nicht die Bestandteile abbilden, sondern eine Hierarchisierung des Honigs vornehmen, die Beschreibung der Herkunft.
Die Hersteller hätten auch ganz anders verfahren können, andere Größen, Namen, Abbildungen usw. wählen können. Indem sie diese und nicht andere nehmen, senden sie ihre Botschaft, und sie tun es natürlich, weil sie überzeugt sind, dass sich so ein Maximum an Attraktivität ergibt – der Markt für Joghurts mit Zusätzen ist ein hart umkämpfter Markt.
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Konzepte und die kollektiven Überzeugungen, an die hier angeschlossen wird. Diese werden später erläutert.
Lyttos präsentiert sich als Hinweis auf eine archaisch ursprüngliche Natur, mit wertvollen Bestandteilen, Milch, Honig, Nüssen, gesund und natürlich, das einen hedonistisch aufgeladenen Verzehrvorgang für ein einzelnes Individuum verspricht: Knusperbestandteile in einem Meer von Honig und Milch, verbunden mit dem Mythos der Frische.
Es ist sicher und staatlich kontrolliert, bezieht sich also auch auf einen institutionellen Rahmen. Die Tatsache, dass es aus ökologisch anfechtbaren Bestandteilen besteht und zum Wegwerfen bestimmt ist, auch dass es natürlich nicht ohne Kalorien ist, wird nicht kommuniziert.
Abb. 2: Konzepte und kollektive Überzeugungen, an die die Marke Lyttos anknüpft
Nähe und Ferne
Gespielt wird auch mit verschiedenen Konzepten von Nähe und Ferne: Lyttos ist kein Produkt der Nähe, wie es etwa die Gattung der heimischen Fruchtjoghurts darstellt, aber auch keines der exotischen Ferne. Es ist in dem touristisch und durch die Populärkultur aufgeladenen Sehnsuchtsraum Griechenland angesiedelt, der der Industriekultur entgegengesetzt wird. Nur sein Material verweist auf diesen Raum und im Übrigen auch die sehr klein geschriebene und staatlich vorgeschriebene Deklaration, dass ein Teil des Honigs nicht aus dem EU-Raum stammt.
Wir lassen hier einmal den Aspekt beiseite, ob dies eine unter ästhetischen Gesichtspunkten gut gestaltete Packung ist.
Ganz offensichtlich lassen sich hier sehr deutliche Steigerungsformen denken. Dieses interessante Konzept hätte auch in einer wirklich atemberaubenden Ästhetik realisiert werden können. Dies werden wir im Übrigen bei vielen Beispielen des Buches feststellen: die Möglichkeiten, Packungen formal gut und ästhetisch eindrucksvoll zu gestalten, werden sehr oft nicht ausgeschöpft.
Packungen als Medium der verdichteten Kommunikation
Packungen als Medium der Kommunikation leisten Beträchtliches: Ihre raffinierte Verdichtung von Botschaften durch die Wahl von Materialien, Namen, Bildern, Farbcodes macht Packungen zu bemerkenswerten Objekten. Sie sind gezwungen, auf kleinem Raum eine Fülle von kommunikativen Leistungen zu erbringen: Aufmerksamkeit an[12]zuziehen, Produkte zu differenzieren, Marken zu etablieren, Begehrlichkeiten zu wecken, und sie müssen diese Leistungen blitzschnell erbringen: Ein durchschnittlicher Betrachter verwendet Sekunden, um eine Packung zu fixieren.
Beachten Sie
Packungen stellen exemplarische Beispiele für das Phänomen der verdichteten Kommunikation dar: verdichtet in Raum und Zeit. Dies können sie nur, weil sie in großem Umfang von unserem kulturellen Wissen Gebrauch machen: also von unserer Art zu denken, zu klassifizieren, zu bewerten, von unseren Überzeugungen, Erfahrungen, Sehnsüchten, Konzeptionen des Wünschenswerten, von dem, was wir wissen und zu wissen glauben. Sie sagen also viel über die Gesellschaft aus, in der wir leben, und sie sind ein sehr interessantes Medium, weil sich hinter ihrer einfachen Oberfläche eine hoch komplexe Tiefenstruktur verbirgt.
Dies ist ein aus der Linguistik gut bekanntes Phänomen. Dass wir die einfache Lautfolge »Halt!« als den Befehl, eine Handlung zu stoppen, verstehen, ist nur möglich, weil wir eine sehr komplexe grammatikalische Struktur im Kopf haben, die uns nicht bewusst ist.
Dieser Typ der verdichteten Kommunikation ist eine zunehmend wichtige Kommunikationsstrategie: In der Überfülle an Botschaften, die wir in unserer Gesellschaft zu bewältigen haben, haben diese Typen der hoch verdichteten Kommunikation einen großen Wettbewerbsvorteil: einfach an der Oberfläche, aber raffiniert macht die Botschaft Gebrauch von vielfältigen Rahmungen (frames), die im Hintergrund bestehen.
Verpackungen sind also hoch komplexe semiotische Objekte, gewissermaßen »Texte«, die sich verschiedener Codes bedienen, um ihre Botschaften zu vermitteln, und sie machen umfangreich Gebrauch von unseren Überzeugungen, Sehnsüchten und Ängsten, Klassifikationen, Bewertungen, Denkkategorien. Sie geben also auch Auskunft über die Art, wie wir denken und die Welt wahrnehmen. Letztlich sind sie eine Antwort auf die Frage: In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Packungen lassen sich auch als ein Medium betrachten. Diesem Medium wird in Zukunft eine große Bedeutung zukommen. Es wird erwartet, dass sich Marktkommunikation in Zukunft verstärkt von den klassischen Medien Zeitung, Fernsehen fort in Richtung Internet verlagern wird.
Packungen müssen ihre kommunikative Kraft also immer stärker aus sich selbst entwickeln und sie stellen in der zunehmend medialisierten Welt ein konkretes und physisch erlebbares Medium dar, solange wir in Supermärkten einkaufen auf jeden Fall. Der Supermarkt ist im Kern ein Raum der Packungen, also ganz realer Objekte, die dann als Abbildungen natürlich auch im Internet und beim Internethandel eine Rolle spielen.
[13]Dennoch: Betrachtet man die Debatten in der Marktkommunikation, so sollte man denken, dass es in erster Linie darauf ankommt, Social Media gut zu bedienen, Datamining zu betreiben, sich vorteilhaft in seinem Internetshop zu präsentieren. Das ist zweifellos wichtig, aber man sollte eben nicht vergessen, dass es einen Bereich gibt, in dem ganz reale, physisch präsente Objekte eine hochrelevante Rolle spielen: Kurz bevor man eine Kaufentscheidung trifft, sieht man eine Packung, man nimmt sie mit nach Hause, man öffnet sie, stellt sie auf seinen Tisch oder ins Badezimmer, man lebt ein bisschen mit ihr und man wird sie wieder kaufen oder auch nicht.
Beachten Sie
Das Buch wendet sich dem Bereich der Packungen zu. Es beschreibt die Verfahren, die gewählt werden, um Waren zu verpacken und sie mit Bedeutungen aufzuladen. Ein Hersteller ist ja prinzipiell frei, wie er das bewerkstelligt: Er kann die Ware sichtbar machen oder sie hermetisch vom Blick des Betrachters abschließen, er kann verschiedene Formen, Größen, Materialien, Farben, Bildprogramme, Aufschriften und Typografien wählen.
Wenn er sich aber für eine Möglichkeit entscheidet, so übernimmt er zwingend eine bestimmte Bedeutung, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Denn alle diese Elemente sind Bestandteile von Codes, von Sprachen, die wir alle kennen und die tief, wenn auch nicht voll bewusst, in unserer Gesellschaft verankert sind. Diese Codes wollen wir im Folgenden beschreiben und mit vielen Beispielen belegen.
[15]1Verpackungsgestaltung im kulturellen Rahmen
1.1Packungen und Marketing
Kunden kaufen Packungen, nicht Produkte
Packungen sind auf unseren Märkten allgegenwärtig: Sie finden sich in allen Bereichen, am deutlichsten aber auf dem Markt der sich schnell drehenden Konsumgüter, die in Super- und Drogeriemärkten verkauft werden. Aus diesem Gebiet stammen auch die meisten unserer Beispiele.
Ein durchschnittlicher Supermarkt führt Tausende Artikel und mit Ausnahme der Frischeabteilungen sind diese Artikel in Verpackungen abgefüllt. Jede Produktgattung erstreckt sich in meterlangen Reihen und präsentiert Inhalte, die sich meist nur geringfügig unterscheiden in Verpackungen, die die eigentlichen Unterschiede demonstrieren – zwischen diesen Packungen wählt der Konsument. Er tut dies natürlich nicht aufgrund der Packung allein, sondern mit den Bildern der Werbung im Kopf, mit seinem Wissen um die Marke und aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Produkt, geleitet durch Preise usw. Dennoch spielen Packungen in diesen Entscheidungsprozessen am Regal, die der Kaufentscheidung vorangehen, eine wichtige Rolle. Packungen lassen sich daher zunächst vor allem unter dem Marketing-Gesichtspunkt beschreiben.
Die Funktion der Verpackung im Marketingprozess
Packungen sind Teil von Marketingprozessen. Sie haben die Aufgabe, Produkte in ihrer Attraktivität zu steigern, rationalen und emotionalen Nutzen zu signalisieren, zum Kauf zu veranlassen und die Positionierung der Marke zu dokumentieren.
Packungen spielen eine hochrelevante Rolle in den Prozessen der Markenbildung. In dem kurzen Augenblick, in dem der Konsument vor dem Zugreifen im Regal Packungen fixiert, müssen diese die Essenz der Marke kommunizieren: wofür sie steht, wodurch sie sich von anderen unterscheidet und was sie emotional anziehend macht. Packungen müssen ihre Gestalt auch für eine längere Zeit beibehalten – Kampagnen lassen sich schnell wechseln, Packungen nicht: Wenn der Konsument seine Marke nicht schnell wiedererkennt, wird er eine andere nehmen. Packungen werden daher von Unternehmen sorgfältig geplant und in empirischen Tests auf ihre Wirksamkeit geprüft.
[16]Untersuchungen zur Wirksamkeit von Packungen
Als Bedingungen für die Wirksamkeit von Packungen werden dabei im Allgemeinen angenommen:
Fallen sie auf?Differenzieren sie?Sind sie in der Lage zu emotionalisieren, zu faszinieren?Vermitteln sie die richtigen Informationen?Kommunizieren sie die Positionierung der Marke?Überzeugen sie?Signalisieren sie einen rationalen und emotionalen Nutzen?Bereiten sie den Entschluss zum Kauf vor?Es bestehen unterschiedliche Theorien zu der Frage, wie man diese Effekte bei Packungen erzielen und messen kann. Wir wollen auf diese Literatur hier nicht eingehen und nur einige empirische Untersuchungen zu der Wirkung von Packungen schildern, obwohl dies natürlich einen großen Teil unserer empirischen Arbeit darstellt.
Mein Unternehmen wird beauftragt, Entscheidungshilfen zu liefern, wenn es darum geht, ein neues Produkt zu verpacken, zwischen mehreren Packungsalternativen zu entscheiden, eine Packung zu optimieren, einer vorgegebenen Markenpositionierung besser zu entsprechen. Wir führen dazu empirische Tests mit qualitativen und quantitativen Verfahren durch, aber wir ergänzen diese Verfahren durch andere Methoden, vor allem durch semiotische Analysen.
Semiotische Analyse der Packungsgestaltung
Wir untersuchen eine Packung immer auch daraufhin, welche Bedeutung sie eigentlich mitteilt, welchen Code sie verwendet, auch wenn dies weder dem Unternehmen noch dem Konsumenten voll bewusst ist. Wir betrachten sie dazu wie einen »Text« und analysieren sie auch wie einen Text, der nicht nur an der Oberfläche einen Inhalt kommuniziert, sondern auch »zwischen den Zeilen« vieles mitteilt.
Die Methode der semiotischen Analysen, die wir hier verwenden, sind in Kapitel 6, dem Semiotik-Kapitel, beschrieben, beziehen aber immer auch die Analysen von Codes mit ein, so wie in Kapitel 2 dargestellt. Weitere Beispiele und detaillierte Analysen finden sich in Karmasin 2007.1
Da Packungen eine so hoch verdichtete Form von Kommunikation darstellen, ist es notwendig, zunächst einmal die verschiedenen Rahmen anzugeben, die Packungen [17]benutzen und die bei der Planung, Optimierung und Wirkung von Packungen eine Rolle spielen. Dies sind im Wesentlichen:
Packungen sind Teil der cultural economy, der symbolischen Ökonomie. Sie übersetzen die eigentlichen Bedeutungen von Produkten und Produktfeldern vor allem in den Prozessen der Markenbildung.Packungen drücken gesellschaftlich wichtige Sachverhalte aus: thinking through things.Packungen sind Teil der ästhetischen Ökonomie: In ihnen spiegeln sich Vorstellungen vom »Schönen«, sie folgen Stilen und Ästhetiken.Packungen fallen unter die Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungspsychologie.Diese Gesichtspunkte werden uns durch das ganze Buch beschäftigen. Zunächst sollen die wichtigsten Bezugsrahmen dargestellt werden.
1.2Packungen als Teil der symbolischen Ökonomie
»Culture is the sea in which business swims.«
Grant Mc Cracken
Packungen sind ein wesentlicher Teil unserer cultural economy, unserer symbolischen Ökonomie. Dies meint im Wesentlichen die Tatsache, dass wir in unserer zeitgenössischen Gesellschaft Produkten eine besondere Rolle zuweisen, die dann die Prozesse der Markenbildung lenken.
Wir brauchen Produkte nicht nur in einem rein funktionalen Sinn, sondern wir gebrauchen sie auch zu ganz anderen Zwecken. Diese Funktionen werden am deutlichsten in den Marken, die wir zur Vermarktung dieser Produkte geschaffen haben.
Produkte können affektive Befindlichkeiten erzeugen: Sie machen uns stolz, sie verschaffen uns Lust, sie trösten uns, sie geben uns schöne Erlebnisse usw.Produkte zeigen die soziale und ideologische Position einer Person an: Sie führen zu Ansehen und Distinktion.Produkte tragen zur Identitätsbildung bei: Wer ich bin und nicht bin.Produkte stabilisieren die Beziehungen zwischen Menschen.Produkte schließen Menschen zu Gruppen zusammen: Sie grenzen ein und sie grenzen aus.Produkte stehen für Konzeptionen des Wünschenswerten, also das, was wir in dieser Gesellschaft als wichtig und erstrebenswert ansehen: Heimat, Mutterliebe, Abenteuer, perfektes Aussehen, Fortschritt, moralisches Empfinden usw. »Culture is licked into shape«, wie die Anthropologin Mary Douglas sagt.Produkte machen unsere Denkkategorien klar: Was wir als das Männliche und das Weibliche betrachten, das Profane und das Elitäre, das Heimische und das Fremde usw.[18]Produkte machen also Gebrauch von unseren kollektiven Denkmustern, Wunschvorstellungen, Bewertungen, unseren kulturellen Rahmungen und Klassifikationen. Sie schwimmen gewissermaßen im Meer unserer Kultur, wie es der Kultursoziologe Grant Mc Cracken mit dem oben zitierten Satz formuliert hat.2 Diesen Sachverhalt habe ich ausführlich in meinem Buch »Produkte als Botschaften« beschrieben.3
Unter diesem Aspekt geht es um zweierlei:
Welche Bedeutungen und kulturelle Rahmungen nutzen Packungen aus?Wie gelingt es ihnen, diese Bedeutungen in so kurzer Zeit und auf so kleinem Raum abzurufen?Dies gelingt durch semiotische Strategien: Sie verwenden Zeichen, die zu Codes geordnet sind: verbale Codes, visuelle Codes, Farbcodes, Materialcodes usw. Sie wählen aus vorgegebenen Repertoires/Codes Positionen aus und kombinieren sie: aus möglichen Materialien, Größen, Formen, Farben, Bildern, Schriften usw. Sie tun dies jedoch nicht regellos, sondern sie entscheiden sich für solche Kombinationen, Zeichenkomplexe, die wir in unserem gewohnten Verständnis mit bestimmten Bedeutungen verknüpfen.
Sie beziehen sich also auf das kulturelle Wissen der Wählenden, sie nutzen unsere Art zu denken und zu bezeichnen aus: Wie wir das Weibliche und das Männliche denken, das Profane und das Elitäre, das Künstliche und das Authentische, was für uns Schönheit bedeutet, Wissenschaft, die »Segnungen der Natur«, die Idee eines Heimes, das Festliche, das Geschenk, wahre Mutterliebe, Heimat und die lockende Ferne – kurz: aus ihnen lässt sich erschließen, wie wir denken, wie wir die Welt strukturieren, was wir für wünschenswert halten und was nicht und durch welche Zeichenkomplexe und Codes wir das jeweils repräsentiert sehen.
Beachten Sie
Packungen sind ein zentraler Bestandteil der cultural economy und belegen exemplarisch die These, dass Marken für Konsumenten nur dann bedeutungsvoll sind, wenn sie an ihre subjektiven Motive appellieren, aber auch, wenn sie etwas repräsentieren, das in unserer Kultur sehr wünschenswert ist, und wenn sie unsere Denkkategorien bestätigen.
Abschied vom methodischen Individualismus
Neben dem praktischen Nutzen dieser Analysen, die empirische Untersuchungen ergänzen, gibt es auch einen wissenschaftstheoretischen Grund, der diese Art der Analyse von Packungen interessant macht: Mit ihr wird das Konzept des methodischen Individualismus verlassen. Was ist damit gemeint? In vielen geisteswissenschaftlichen [19]Disziplinen sucht man Erklärungen nicht mehr nur auf der Ebene des einzelnen Individuums, seiner individuellen Bedürfnisse und Wünsche. Man betrachtet vielmehr die Bedingungen, die diese Bedürfnisse und Wünsche formen, also die sozialen, institutionellen und eben auch die kulturellen Systeme, die an diesen Prozessen beteiligt sind. Auch Konsumtheorien gehen von dieser Sicht aus. So führt Lucy Holt aus: »Consumers draw on cultural frameworks in order to make sense of their experiences.«4
Marketingstrategien haben also viel mehr mit dem Verständnis unserer Kultur zu tun, als man dies im Allgemeinen glaubt. Es lohnt sich daher, die kulturellen Rahmungen zu rekonstruieren, auf die sich Packungen beziehen – viel von den Spielregeln unserer Kultur wird in ihnen sichtbar. Der Empfänger dieser in Packungen realisierten Botschaften ist daher das cultural self, der Repräsentant kulturellen Wissens.5
Der Begriff des kulturellen Wissens
Genauso wie wir im Bewusstsein eine Landkarte unserer realen Umwelt, unseres Körpers haben, verfügen wir auch über eine mentale Repräsentation unserer Kultur, über Denkkategorien, Klassifikationssysteme, bewertende Gliederungen usw. Dies zählt zu dem Bereich des tacit knowledge: Dinge, die wir wissen, aber nicht explizit benennen können.6 Noch genauer mit diesem Phänomen beschäftigt sich Michael Titzmann über das von ihm entwickelte Konzept des kulturellen Wissens. Der Begriff des kulturellen Wissens bezeichnet nach Titzmann alle Aussagen, welche die Mitglieder einer Kultur in einem bestimmten Zeitraum für wahr halten:7
»Der Begriff kW [gemeint ist »kulturelles Wissen«] bezeichnet nach Titzmann alle Aussagen, welche die Mitglieder einer Kultur in einem bestimmten Zeitraum als wahr glauben und mit ›ich denke, meine, glaube, weiß‹ einleiten können. Das kW einer Epoche ist als Ganzes eine Abstraktion aus den Texten einer Kultur, in denen es sich manifestiert, und umfasst unterschiedliche Wissensmengen, die als Alltagswissen (beispielsweise das Realitätskonzept) von der Mehrheit, als Fachwissen nur von ausgewählten Gruppen geteilt werden und die auch als konkurrenzierende Wissensmengen in Konflikt geraten können. Das kulturelle Wissen wird durch Diskurse organisiert und bildet zusammen mit der Denkstruktur einer Epoche das Wissenssystem, die systematisch geordnete Menge der Wissenselemente einer Kultur.«
Michael Titzmann
[20]Auch der Begriff des kulturellen Gedächtnisses, der von Jan und Aleida Assmann stammt, geht in eine ähnliche Richtung.8
Packungen nutzen dieses Repräsentationssystem raffiniert aus, und zwar das zugrunde liegende Denksystem wie auch die zeichenhaft ausgeformten Codes, die es anzitiert. Wir wissen, dass die »Flüssigkeit« der Informationsverarbeitung unter anderem davon abhängt, ob die Erwartungssysteme, die wir im Kopf haben, bestätigt werden. Ist dies der Fall, finden wir einen instinktiven und intuitiven Zugang zu einem Meinungsobjekt. Diese intuitiven Zugänge sind aber nichts anderes als unsere kollektiv geteilten Annahmen und Einsichten. Diese gilt es in Bezug auf Produktfelder und Markengestaltungen zu rekonstruieren.
Ein Beispiel dafür soll im Folgenden anhand der Felder »the idea of a home« und »building the perfect body« erläutert werden. Wir wissen, dass Menschen, wenn sie sich einem sehr komplexen Datenfeld gegenübersehen, Ausschau nach cues, nach Schlüsselreizen suchen, die dieser Überfülle eine Bedeutung geben.9
Wir werden zeigen, dass die cues, die die Felder Reinigungsprodukte und Körperpflegeprodukte bestimmen, nicht beliebig auftauchen, sondern dass sie Ausdruck der Denkweisen und Ideologien sind, die diese Felder steuern, dass sie also in diesem Fall damit zusammenhängen, was wir als einen Haushalt oder einen perfekten Körper ansehen.
Der zweite interessante Gesichtspunkt ist die Tatsache, dass Packungen Artefakte sind, die zentrale soziale Konzepte ausdrücken. Damit beschäftigen wir uns in den folgenden Abschnitten.
1.3Packungen inszenieren zentrale soziale Konzepte
Jede Gesellschaft schafft Objekte, also Artefakte, die sie zu funktionalen Zwecken, aber darüber hinaus auch zu kommunikativen Zwecken nutzt: Geschirr, Kleider, Waffen, rituelle Gegenstände usw. Dies trifft auf hochentwickelte Gesellschaften ebenso wie auf Stammesgesellschaften zu. Gerade für Stammesgesellschaften wurde dieser Bereich umfangreich von der Ethnologie untersucht, da diese materielle Kultur in schriftlosen Kulturen einen wichtigen Bereich darstellt, um die Mechanismen einer Kultur zu analysieren. Dabei wurde sichtbar, zu welchen hochkomplexen kommunika[21]tiven Leistungen diese Artefakte imstande sind und welche Rolle sie für den sozialen und kulturellen Zusammenhalt einer Gruppe oder Gesellschaft spielen.
Ein besonders interessanter Aspekt besteht darin, dass sie zentrale gesellschaftliche Sachverhalte über einen materiellen Gegenstand sichtbar machen: Man kann mit ihnen und durch sie soziale Ideen denken.
Ein Buch der amerikanischen Ethnologen Amiria Henare, Martin Holbraad und Sari Wastell trägt daher den Titel »Thinking through things«.10 Dieses Buch stellt eine Fülle von Beispielen über Artefakte dieser Art in unterschiedlichen Gesellschaften zusammen. Am bekanntesten ist wohl das Konzept der Gabe, das Marcel Mauss für die Gesellschaft der Trobriander beschrieb.11
Das Konzept der Gabe
Diese Gesellschaft, die auf weit voneinander entfernten Inseln im indonesischen Archipel lebte, basierte nicht auf Märkten und nicht auf Hierarchien, sondern auf einem weit verzweigten Netz von Handelsbeziehungen. Gehandelt wurde mit Muscheln, die Angehörige einer Insel zu einer anderen Insel brachten, worauf sie von diesen Einwohnern andere Muscheln erhielten, die so in einem Kreis durch alle Inseln reisten. Diese Muscheln wurden jedoch nicht bezahlt, sondern sie wurden geschenkt. Diese Geschenke waren gratis, aber nicht umsonst – der Beschenkte hatte die Verpflichtung, die Gabe nach einer angemessenen Zeit in einer angemessen Form zu erwidern.
Auf diese Weise entwickelten sich stabile soziale Beziehungen über einen langen Zeit- und Raumkontext. Es war dies eine Gesellschaft, die nach den Prinzipien von Ehre und Scham funktionierte: das Nichterwidern eines Geschenkes hätte den sozialen Tod nach sich gezogen.
Dies ist eine der schwierigen Leistungen, die jede Kultur ihren Mitgliedern abverlangen muss: Sie muss durch viele Mechanismen Sorge tragen, dass ihre zentralen Forderungen und Regelungen erfüllt werden. In diesem Fall wird das durch das Konzept der Gabe bewerkstelligt.
Es wird angenommen, dass diese hoch geschätzten Muscheln »taonga« sind, das bedeutet, sie sind wertvoll nicht als materielle Objekte, sondern weil in ihnen »hau«, der Geist der Gabe lebt, der eine Gegengabe erzwingt. Diese Beseelung des Gegenstandes erfolgt auch dadurch, dass angenommen wird, ein Teil ihres Besitzers sei in ihr ent[22]halten. Geschenkt werden also nicht nur materielle Objekte sondern auch Personen (übrigens in einem intensiven Kommunikationsprozess).
Die Bedeutung von Artefakten
Ein weiteres Beispiel aus dem oben genannten Buch beschreibt das Konzept des »xishing«, das für nomadische Stämme der Mongolei eine große Rolle spielt. Es bezeichnet Glück, das man für alle Verhältnisse anstrebt und das für personelle und materielle Beziehungen unerlässlich ist. Dieses Glück, so glaubt man, ist in Teilen von materiellen Objekten vorhanden: Diese Teile muss man bewahren, auch wenn man das ganze Teil veräußert. So behält man ein kleines Stück Fell von einer Kuh zurück, wenn sie verkauft wird. Genau in diesem Teil könnte das Glück vorhanden sein, das für die ganze Herde wichtig ist.
Ein zentrales Artefakt in diesem Umkreis des Glücks ist die Truhe, die in jedem Haushalt vorhanden ist. Sie ist mit Gegenständen, Bildern, Fotografien dekoriert, die wichtigen männlichen Angehörigen gehören oder gehört haben, und sie enthält im Inneren Andenken an Kinder, die jetzt groß sind und den Haushalt verlassen haben: die Nabelschnur, erste Haarlocken. Wenn jemand den Haushalt verlässt, so muss man einen Teil von ihm zurückbehalten, damit es der ganzen Familie gut geht.
Diese mongolischen Stämme sind Nomaden, die kein Land besitzen und die weite Wanderungen unternehmen. Für sie ergibt sich das Problem, wie sie den Zusammenhalt der Gruppen und Familien über diese langen Raum- und Zeitstrecken bewältigen. Die Truhe, die immer mitgeführt wird, stellt diesen Zusammenhalt sinnfällig aus: Durch die Teile, die in ihr zurückgelassen werden, bleibt immer ein Teil mit dem Ganzen verbunden.
Die Konstruktion dieser Truhe basiert auch auf wesentlichen Denkkategorien dieser Kultur:
Man erklärt sich die Entstehung eines menschlichen Embryos so, dass Frauen das Blut beisteuern und Männer die Knochen. Ein Mensch entsteht aus dem väterlichen Knochen und dem mütterlichen Blut.Die Knochen sind mit den Merkmalen fest, lange dauernd und stabil verbunden (Bereich der Männer), Blut mit den Merkmalen flüssig, nicht stabil.Der Bereich der Männer ist der Bereich, der sichtbar ist: Er wird auf der Truhe dargestellt, der Bereich des Weiblichen ist der unsichtbare Teil, der im Inneren der Truhe ist – sehr deutlich ist dies eine männerdominierte Gesellschaft.Die Konstruktion dieses Artefaktes ermöglicht es, subtile kulturelle Überzeugungen zu »denken«.
Ein ähnliches Beispiel sind die Schamanenkostüme, die es ihren Trägern erlauben, Ebenen zu betreten, die normalerweise Menschen verschlossen sind. Sie sind nach [23]dem Modell einer »world conquering time machine« konstruiert und machen durch ihre Konstruktion sichtbar, dass dies in dem Augenblick des Tragens möglich ist.
Es mag weit hergeholt sein: Aber in gewissem Sinn lässt sich das Gebiet der Verpackungen, die wir im Übermaß in unserer Gesellschaft produzieren, als eine Art von kognitiver Schaubühne (cognitive scaffolding) begreifen: Sie stellen gesellschaftlich hoch relevante Sachverhalte aus.
Packungen nehmen in unserer Gesellschaft einen beträchtlichen Raum ein, wir produzieren mit ihnen so viele Artefakte wie dies niemals zuvor eine Gesellschaft getan hat. Mit den Worten von Gert Selle: »Unsere Produktwelt ist ein riesiger semiotischer Raum, in dem die Dinge einen großen Lärm machen.«12 Diese Tatsache ist zu interpretieren:
Die ungeheure Vermehrung dieser Artefakte steht in Verbindung mit der Entwicklung von Industrie- und Marktgesellschaften, die davon leben, Produkte in noch nie gekannter Zahl zu produzieren, die sie voneinander unterscheiden und als jeweils hoch attraktive Einzelprodukte ausgestalten müssen.
Die riesigen Ansammlungen und Präsentationen unserer Supermärkte stellen aber auch eine unserer zentralen ideologischen Denkfiguren visuell aus: Sie inszenieren die Freiheit der Wahl, die wir als Personen dieser Gesellschaft beanspruchen und im Bereich des Konsums jeden Tag aufs Neue einlösen können, und zwar als Individuen, die nur dem persönlichen Hedonismus, unserem Vergnügen, unserem Eigenwohl verpflichtet sind, nicht dem Gemeinwohl. Dies jedenfalls dann, wenn wir das Geld für den Konsum haben. Marktgesellschaften richten sich naturgemäß nur an Personen, die das Geld haben, an Märkten teilzuhaben. Die Rolle des Konsumenten ist daher eine Masterkategorie industrialisierter Gesellschaften, die sich im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts herausbildete.13
Auf diesen Märkten geht es nicht darum, sich das zu besorgen, was wir brauchen, sondern auch das, was wir uns wünschen, auch wenn wir es in einem existenziellen Sinn nicht brauchen. Einer dieser Wünsche besteht darin, autonom zwischen vielen attraktiven Möglichkeiten wählen zu können – und genau dazu benötigen wir Packungen.
Wir gehen eben im Allgemeinen nicht mit Milchkannen einkaufen oder trinken Wasser aus dem Leitungshahn oder mischen zu Hause selbst gemachten Joghurt und Erdbeeren, sondern wir kaufen Milchpackungen, Mineralwasser in Kunststoffflaschen [24]und Fruchtjoghurt in Plastikbechern und dies aus einer Anzahl von Optionen, die sich meterlang im Raum der Supermärkte erstrecken.
Kulturkritische Überlegungen
Diese Zivilisationstatsache hat natürlich eine kulturkritische Komponente, die auch immer wieder angesprochen wird: Ist es unter Umwelt- und Verantwortungsgesichtspunkten nicht höchst verwerflich, eine solche Menge an Ressourcen zu verbrauchen und solche Mengen von Müll zu produzieren? Packungen bleiben ja im Allgemeinen übrig, wenn das Produkt, das sie enthalten, verbraucht ist, sie müssen dann entsorgt werden. Dies wird kaum jemand wirklich verneinen und doch geschieht es in großem Umfang.
Dies ist eines jener zahlreichen Beispiele für unseren kulturell blinden Fleck: Genau dieser Prozess der Verschwendung ermöglicht unsere Art zu leben. Unsere Gesellschaft basiert eben auf Märkten und auf der Kultur des Individualismus. Wir müssen produzieren, konsumieren, Gewinne erwirtschaften, wenn möglich stetig wachsen. Und wir können das nur, indem wir Begehrlichkeiten nach Produkten schaffen und Produkten eine ganz besondere Rolle zuschreiben.
Wie in Kapitel 1 beschrieben: Wir brauchen Produkte nicht nur, weil sie bestimmte nützliche Funktionen haben, sondern wir brauchen sie auch, weil wir glauben, dass dadurch unser Leben reicher und befriedigender wird, weil sie uns stolz machen, weil sie uns Lust verschaffen, Anerkennung, Trost, weil sie Lebensgefühle geben, weil sie uns Beziehungen mit anderen Menschen ermöglichen, Identität, Gruppenzugehörigkeit, weil sie für die großen Geschichten und Mythen unserer Kultur stehen, weil sie immer wieder unserer Denkkategorien bestätigen.
Bekanntlich entwickelt sich derzeit eine Gegenströmung zu dieser Idee der auf individuellem Konsum beruhenden Marktwirtschaft. Autoren, die dieses Konzept verfolgen, gehen davon aus, dass wir uns auf eine Gesellschaft zubewegen, in der Werte wie Teilen und Kooperieren außerordentlich wichtig sind, was auch die Art der von uns entwickelten Produkte verändern würde. Ausgespart wird dabei allerdings die Frage, dass die Fülle von institutionellen und kulturellen Rahmenbedingungen, die für diese neue Wirtschaft notwendig ist, noch bei Weitem nicht entwickelt ist.14 Unser noch bestehendes System, wie immer man es bewerten mag, präsentiert sich jedenfalls höchst eindrucksvoll.
Wir befinden uns in einer intensiven Debatte zum Thema der Nachhaltigkeit. Dabei müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir mit einer Klimaveränderung zu rechnen haben und unsere Art zu leben und zu wirtschaften einen erheblichen Einfluss auf [25]diesen Klimawandel hat. Packungen spielen dabei eine wesentliche Rolle: Soll man darauf verzichten? Oder soll man sie so gestalten, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten? Die erste Option verlangt eine ideologische Neuorientierung, die zweite versucht das Problem mit den Mitteln des Marktes zu lösen. Wir werden diesen Aspekt in Kapitel 5.6 beleuchten.
Wenn wir die semiotischen Raffinessen betrachten, mit denen sich unsere Warenwelt darstellt, die Mythenbildungen und Erzählungen, die Verdichtung in materielle Objekte, in Ikonen und Zeichenfelder, so wird umgekehrt deutlich, dass unsere politische und institutionelle Welt bei Weitem nicht über diesen Reichtum an zeichenhafter Vermittlung verfügt, sondern sich weitgehend auf verbale diskursive Systeme beschränkt. Es gibt eher einen Mangel an noncommodity symbols, institutionellen und politischen Symbolen.
Dies war nicht immer so: Historisch zurückliegende Epochen unserer Gesellschaft, die nicht auf Märkten basierten, brachten eindrucksvolle bildliche Repräsentationen politischer Sachverhalte hervor. Man denke an die ausgeformten rituellen Inszenierungen von politischer Macht, die Barbara Stollberg Rilinger für das ausgehende Mittelalter beschreibt, oder an das Bild des Leviathan.15 Zwar existieren diese Darstellungen politischer Machtfülle noch, aber gute Beispiele sind eher selten.
Sobald wir uns in eine ökonomische und marktbasierte Gesellschaft transformieren, verlagert sich auf jeden Fall ein Teil der Mythenbildung und der rituellen und ästhetischen Produktion von Sinn auf die Ebene des Marktes und damit in die Zeichensprache der Populärkultur.16 Zu dieser gehören auch Packungen:
Packungen sind also auch ein Teil des sozialen Klebstoffes, der unsere Gesellschaft zusammenhält, gewissermaßen eine ästhetische Signatur von gesellschaftlichem Rückhalt.17
Packungen umkleiden das nackte Produkt mit einer Hülle, die das gesamte Wertefeld des Marktes bezeichnet, Markt in einem umfassenden Sinn einer ideologischen Orientierung verstanden: Die Packung ist quasi das Markthafte an ihnen, sie transportiert den Mythos der freien und autonomen Wahl, die Bedeutung von Produkten, die Denkfiguren, die sie zitieren, aber auch die Verschwendung.
Gruppen, die gegen diese Markt- und Konsumorientierung durch ihren Lebensstil protestieren, entwickeln daher auch einen besonderen Umgang mit Packungen. Dies hat eine längere Vorgeschichte, die bis in die Anfänge der Hippiebewegung zurückreicht.
[26]Cronin, Mc Carthy und Collins beschreiben in diesem Zusammenhang eine Untersuchung, in der sie das kulinarische Verhalten einer Gruppe von Hipstern durch teilnehmende Beobachtung begleiteten, unter anderem auch den Umgang dieser Gruppe mit Packungen. Es galt in dieser Gruppe, die sich als Nonkonformisten verstanden, als Tabu, Produkte in ihren Packungen zu belassen: Sie füllten sie sofort in Behälter um, sie »decommodifizierten« sie, befreiten sie von ihren »entfremdeten Qualitäten«, restaurierten sie wieder in ihren originalen Zustand.18
Dies wird auch als sacred consumption bezeichnet: Um etwas als wertvoll oder heilig zu deklarieren, muss es wie in einem Ritual von allem Profanen gereinigt werden, aus dem Griff der »gierigen Konzerne« befreit werden, wie die Teilnehmer erklärten.19
Diese Tendenz, Packungen zu vermeiden, findet sich heute in teilweise sehr ausgeprägter Form: Es gibt Geschäfte, die nahezu alles unverpackt anbieten. Auch große Super- oder Drogeriemärkte errichten Abfüllstationen für Waschmittel, Kosmetikprodukte, Lebensmittel.
Der dritte Gesichtspunkt begreift Packungen als Teil der ästhetischen Ökonomie.
1.4Packungen als Teil der ästhetischen Ökonomie
Auf den Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz geht der Begriff der ästhetischen Ökonomie zurück. In seinem Buch »Die Erfindung der Kreativität« beschreibt er, dass Prozesse der Ästhetisierung immer stärker unsere gesellschaftliche Realität prägen: Dies zeigt sich in Managementlehren, die Kreativität von jedermann fordern, in dem Aufstieg der sogenannten Creative Industries, in der Forderung nach kreativer Selbstverwirklichung und ganz deutlich auf dem Feld der Produktion und Konsumption von Waren und der Warenwelt selbst.20
Dieser Prozess wurde von einer Reihe von Kulturwissenschaftlern beschrieben, so auch von Mike Featherstone, der von einer Aestheticization of everyday life spricht.21 Auch er führt das auf eine Forderung unserer Gesellschaft zurück, die von jedermann verlangt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, neue und bereichernde Erfahrungen zu machen, kreativ und erfinderisch zu sein. Damit werden Ideen der Avantgarde am Beginn des 20. Jahrhunderts aufgenommen und zu einem Merkmal moderner Eliten [27]gemacht. Die Figur des »Bobo«, des bohemian artist, der ein hoch ästhetisiertes Leben führt, einen Lebensstil kultiviert, der ihn weit von der dumpf konsumierenden Masse abhebt, der aber auch moralisches Bewusstsein zeigt, ist ein Beleg für diese These.22
Beachten Sie
Es geht nicht mehr nur um den funktionalen Nutzen von Waren, es geht vielmehr um die Produktion von Bedeutungen und von affektiv sinnlichen Wirkungen durch die Verwendung von semiotischen Strategien. Damit müssen Produzenten und Gestalter über ein beträchtliches kulturelles Kapital verfügen. Diese ästhetische Differenzierung wird in großem Umfang auch von Packungen getragen.
Sehr deutlich zeigt sich dies an dem Problem des Neuen, dem Andreas Reckwitz ein eigenes Kapitel widmet: Unsere gesamte Ökonomie steht unter der Forderung, permanente Neuerungen hervorzubringen: Nur das Neue verspricht Fortschritt und garantiert Aufmerksamkeit. Innovation und Fortschritt sind auch die Begriffe eines unserer zentralen Narrative.
Im Mittelalter war dies genau umgekehrt, das Neue war minderwertig, da es die irdische Unvollkommenheit verkörperte, wertvoll war allein Unveränderlichkeit und Kontinuität, da dies auf göttliche Attribute verwies.
Innovationen wurden lange ausschließlich als technisch funktionaler Fortschritt betrachtet. Dies kann, muss aber nicht der Fall sein. Innovationen können ferner im Sinne einer Revolution, der Ablösung eines Systems und Ersatz durch eine neues, erfolgen oder im Sinne einer Perfektionierung: Etwas wird schneller, besser, perfekter.
Beide Prozesse scheinen in unserer Gegenwart an Grenzen zu stoßen: Viele Dinge sind nicht mehr zu perfektionieren. Naturgemäß stimmt das nur bedingt. Gerade im Bereich technischer Produkte sind immer noch Innovationen möglich und notwendig.23 Die rasante Entwicklung von Geräten zur mobilen Kommunikation zeigt dies deutlich. Jedes Unternehmen, das diese Produkte anbietet, steht vor der Notwendigkeit, immer wieder eine neue Generation von Geräten herauszubringen, die von ihren Fans auch sehnlich erwartet werden. Besonders gut inszeniert das Apple. Jede Generation von Geräten ist von einem neuen Designschub begleitet: Jedes neue Gerät ist ein bisschen flacher, smarter, »cooler«.
Innovationen verlagern sich insgesamt in hohem Ausmaß auf die Ebene der Ästhetik: Es werden zunehmend ästhetische Differenzierungen produziert, damit aber auch Ge[28]fühle und nichtverbale Appelle. Dadurch wird der von Natur aus »gefühlskalte« Kapitalismus eine sinnlich motivierende Veranstaltung. Im Meer der erkaltenden Systeme der Moderne ist die Kunst ein heißer Archipel.
Beachten Sie
Das Kreativitätsdispositiv hat endgültig gesiegt. »Man will kreativ sein und man soll es.«24 Genau dies führen Packungen vor. Sie setzen das Ästhetische ein, um Waren mit Bedeutungen aufzuladen, attraktiv zu machen, mit Affektwerten zu versehen. Sie streben im Wesentlichen nach »poetischer Verdichtung«.25
Diese »Verdichtung« erfolgt im Fall des Marktes aber nicht regellos und nur durch Gefallen gesteuert, sondern sie stellt, wenn sie gut gemacht ist, eine wohlbegründete Wahl aus den Codes dar, die man in einem einzelnen Fall zur Verfügung hat.
Mit dieser ästhetischen Bedeutung von Packungen hat sich auch der amerikanische Marketingspezialist Richard Shear beschäftigt, der Packungen in seinem Blog bespricht: the unseen package. Er beschreibt Packungen wie folgt:
»The package is an unique object in our contemporary culture. Created as a vessel, designed as an icon, sold as a brand and consumed with both passion and derision. In short it is an unique intersection of design and life.«
Richard Shear
Für Shear sind Packungen der Teil von Marketingstrategien, der sich am wenigsten schnell ändert, weit weniger schnell als zum Beispiel die Werbung. Und Packungen spielen naturgemäß eine eminente Rolle als reale Objekte in einer Zeit, in der sich immer mehr auf die mediale Ebene verlagert: Sie sind real beobachtbar und sie sind auch Teil der personalen und häuslichen Ensembles, in denen sie verweilen, solange das Produkt benutzt wird: Sie haben also eine feste Raum-Zeitbindung. Sie gehören damit in den weiten Bereich der thingification of culture.26
Ebenso sind Packungen das, womit der Konsument unmittelbar in Berührung kommt, sie können ihren Benutzern beim Gebrauch besondere Erlebnisse vermitteln: Über die Art, wie sie sich anfühlen, öffnen lassen, ihren Inhalt in bestimmter Weise abgeben.27
[29]Unboxing – das Auspacken von Produkten
Selbst das Auspacken eines Produktes kann ein besonderes Erlebnis darstellen. Man kennt das vom Auspacken von Geschenken oder auch von edlen Gegenständen, so zum Beispiel über das Knistern von feinem Seidenpapier, in das kostbare Schals, Hemden oder Blusen gewickelt sind. In letzter Zeit ist das sogenannte unboxing ein wahrer Trend geworden. Auf YouTube schauen Tausende zu, wie Protagonisten Packungen öffnen. Unboxing wird auch in deutlicher Parallele zu erotischen Aktivitäten der Vorlust, dem Entkleiden, gesetzt und gute Packungen können tatsächlich Gefühle dieser Art liefern.
Schön gestaltete Packungen – das Beauty Premium
Den Begriff »Ästhetik« haben wir bisher abstrakt gebraucht, im Sinne einer kreativen Gestaltung von Produkten, die die Ebene des Funktionalen übersteigt. Es gibt jedoch inzwischen Untersuchungen im Bereich der Konsumentenforschung, die das Ästhetische mit dem Schönen im engeren Sinn gleichsetzen und die in empirischen Untersuchungen bestätigen, dass Produkte, die als schön gestaltet beurteilt werden, erhebliche Wettbewerbsvorteile haben, sie werden verstärkt gewählt und es wird ein wenig mehr für sie bezahlt, gewissermaßen ein survival of the beautiful. Eine entsprechende Untersuchung wird im Journal of Consumer Research vorgestellt. Die Autoren dieser Studie gehen davon aus, dass das Beauty Premium, das sich bei der Bewertung von Personen findet, auch bei Produkten vorkommt. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass Personen, die als schön beurteilt werden, bessere Chancen bei der Partnerwahl, bei Einstellungsgesprächen, selbst vor Gericht haben. Dabei wird häufig von äußerer Schönheit auf innere Werte wie soziale Geschicklichkeit, Intelligenz, Güte usw. geschlossen. Die Autoren dieser Studie, Claudia Townsend und Sanjay Sood, gehen davon aus, dass das Bedürfnis nach dem Schönen ein universelles Bedürfnis ist, es wird daher in der Literatur auch zu den sechs basalen Werten gezählt, die Menschen motivieren.28
Dieses Beauty Premium findet sich auch im Bereich von verpackten Gütern. Differenziert angelegte und gut abgesicherte experimentelle Untersuchungen, die den Einfluss von ästhetischen Faktoren bei der Entscheidung zwischen Produkten nachgingen, haben gezeigt, dass dieser Einfluss beträchtlich ist, er übersteigt den Faktor Funktionalität bei Weitem. Die Autoren dieser Studie führen dies im Übrigen darauf zurück, dass die Käufer eines als schön empfundenen Produktes dadurch ihren Selbstwert steigern. Zu diesem Phänomen haben sich auch E. Raghubir und E. Greenleaf im Journal of Marketing geäußert.29
[30]Unsere Analysen werden sich aber auch mit der Tatsache beschäftigen, dass es mehrere Definitionen vom Schönen gibt. Einzelne soziale Gruppen unterscheiden sich beträchtlich in dem, was sie als schön bewerten. Ebenso gibt es verschiedene Ästhetiken, die unterschiedliche Konzepte von Schönheit postulieren: das Erhabene und das Liebliche, das Minimalistische und das Opulente, das Tradierte und das Avantgardistische usw.
Das Bemühen, die Ästhetik einer Packung zu verbessern, ist also in jedem Fall ein Wettbewerbsvorteil – umso erstaunlicher, wie viele Packungen in unseren Supermärkten diesen Gesichtspunkt nicht ernst nehmen.
Das Konzept der Verpackung ist, abgesehen von seiner Bedeutung für die Produktkultur, auch sonst ein wichtiges Konzept, das in vielen Bereichen verwendet wird: Politiker müssen die richtige Verpackung für sich und ihre Programme wählen, Erlebnisse und Serviceleistungen werden zunehmend verpackt, Unternehmen verpacken ihre Leitbilder in architektonische Entwürfe. Zu dieser Form der Inszenierung gehören Namen, Logos, Ikonen, Farben, Formen, Größen.
Ein gelungenes Beispiel für die Verpackung einer besonderen Serviceleistung stellt die Umgestaltung der Frankfurter Börse dar.30 Aus den bürokratisch geordneten und abgezirkelten Abschnitten der alten Börse, die aber eine hektische Atmosphäre vermittelten, wurde durch die Verwendung von Formen und räumlichen Anordnungen eine zugleich ruhige und dynamische Atmosphäre erzeugt, die den Raum wie eine riesige Maschine wirken lässt, in der Massen von Kapital bewegt werden. Gleichzeitig wurde in diesem Raum eine Lichtinstallation angebracht, die die natürlichen Lichtverhältnisse während eines Tages simuliert. Der Betrachter hat also den Eindruck, dass das finanzielle Geschehen Teil eines natürlichen Prozesses ist.
Verpackungen sind allgegenwärtig
Die Verpackung findet sich zum Beispiel auch im Bereich touristischer Angebote. So stellen die Südtiroler Betriebe, die Ferien am Bauernhof anbieten, ihre Angebote unter die gemeinsame Marke Roter Hahn, verpacken sie also in ein Zeichenfeld, das das Echte, Authentische signalisiert, aber auch einen Komplex von roter mystischer Kraft kommuniziert, der sehr einprägsam ist.
Die Kommunikationsleistung von Packungen
Ohne der Frage ihrer moralischen Rechtfertigung weiter nachzugehen, wollen wir uns im Folgenden nur mit der Kommunikationsleistung von Packungen beschäftigen und zwar tatsächlich nur mit der Leistung von Packungen. Es geht also nicht um die Aus[31]formung der Produkte selbst und auch nicht um begleitende Werbung und sonstige Kommunikation, sondern nur um das, was Packungen selbst leisten.
Viele Beispiele werden klarmachen, dass diese Leistungen beträchtlich sind: Sie sind in der Lage, Differenzen herbeizuführen, die nicht in der Sache selbst begründet sind, sie fügen den nackten Produkten große Mehrwerte hinzu, machen sie über die Prozesse der Markenbildung wiedererkennbar und begehrenswert.
Sie spielen in den Funktionskreisen, die wir Produkten zuschreiben, eine wichtige Rolle: Sie verstärken unsere Art zu denken, bestimmte Vorstellungen zu schätzen, sie sind also good to think with, aber sie basieren auch auf unseren Sehnsüchten, denen Waren antworten: Unserem Wunsch, dass alles immer besser werden möge, unserer Sehnsucht, dass es etwas mehr geben muss als die triviale Realität, nämlich Verzauberung, Verwöhnung, Erhöhung, ultimative Erlebnisse, wie es im Englischen heißt: Our emotions are woven into them.
Packungen kommunizieren also nicht nur den use value der Produkte sondern auch den dream value.31 Wir wollen also folgende Fragen betrachten:
Welche Strategien verwenden Packungen, …
um Produkte über die Markenbildung attraktiv zu machen, um etwas Alltägliches in etwas Außer-Alltägliches zu verwandeln, um es zu verzaubern, magisch aufzuladen, mit wichtigen Konzeptionen des Wünschenswerten zu verbinden?um sie zum Anker zu machen, eine Geschichte zu erzählen?um Produkte voneinander zu differenzieren, die der Sache nach relativ gleich sind, um also die Illusion der freien Wahl herzustellen?um Produkten funktionalen und emotionalen Nutzen zuzuschreiben?um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?um die Flüssigkeit der Informationsverarbeitung sicherzustellen?Von welchen kulturellen Rahmungen machen Verpackungen dabei Gebrauch? Auf welches kulturelle Wissen beziehen sie sich? Welche Codes verwenden sie?
1 KARMASIN, Helene: Produkte als Botschaften. mi-Fachverlag. Landsberg am Lech: 20074.
2 Mc CRACKEN, Grant: Culture and Consumption. Indiana University Press. Bloomington: 1990.
3 KARMASIN, Helene: Produkte als Botschaften. a. a. O.
4 HOLT, Lucy: Consumption, Markets, Culture. Vol. 16. Routledge. New York: 2013. MILLER, Daniel: Material Culture and Mass Consumption. Wiley-Blackwell. Oxford: 1987. MILLER, Daniel: Consumption and its Consequences. John Wiley & Sons. Oxford: 2012. Mc CRACKEN, Grant: Culture and Consumption. a. a. O.
5 WILLIS, Paul: The Ethnographic Imagination. Polity. Cambridge: 2007.
6 POLANYI, Michael: Tacit knowing. Review of modern physics: 1962.
7 TITZMANN: Propositionale Analyse – kulturelles Wissen – Interpretation, Strutz. Passau 2006 sowie Mediensemiotik Arbeitskreis Forschungsfelder Beiträge, Universität Passau.
8 ASSMANN, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. C.H. Beck. München: 2007.
9 CHABRIS, C./SIMON D.: The Invisible Gorilla. Harmony. Crown Publishing Group. New York: 2010.
10 HENARE, A./HOLBRAAD, M./WASTELL, S.: Thinking through Things. Theorising artefacts ethnografically. Routledge. New York: 2007.
11 MAUSS, Marcel: Die Gabe. Suhrkamp. Frankfurt: 1968.
12 SELLE in PRINZ, S./MOEBIUS, St.: Das Design der Gesellschaft. Transcript. Bielefeld: 2012.
13 LURY Celia: Consumer Culture, Polity Press. Cambridge: 2011.
14 RIFKIN, Jeremy: Die dritte industrielle Revolution. Campus Verlag. Frankfurt: 2011.
15 RILINGER, Barbara: Des Kaisers alte Kleider. C.H. Beck. München: 2013.
16 POLANYI, Michael: Tacit knowing. a. a. O.
17 BOSCH in PRINZ, S./MOEBIUS, St.: Das Design der Gesellschaft. a. a. O.
18 CRONIN, J./Mc CARTHY, M./COLLINS, A.: Consumption, Markets, Culture. Vol. 17. Nr. 1. Routledge. New York: 2014.
19 BELK, R. W./WALLENDORF, M./SHERRY, J.F.: Journal of Consumer Research. The scared and the profane in consumer behaviour. Vol. 16. Nr. 1. 1989.
20 RECKWITZ, Andreas: Die Erfindung der Kreativität. Suhrkamp. Berlin: 2012.
21 FEATHERSTONE, Mike: Consumer Culture and Postmodernism. Sage Publications. California: 2007.
22 LASH, S./LURY C.: Global Culture Industry. The Mediation of things. Polity. Cambridge: 2004.
23 SCHULZE, Gerhard: Die beste aller Welten. Carl Hanser Verlag. München: 2003.
24 RECKWITZ, Andreas: Die Erfindung der Kreativität. a. a. O.
25 MEDIEN UND WANDEL, hrsg. vom Institut für interdisziplinäre Medienforschung. Passauer Schriften zur interdisziplinären Medienforschung. Band 1. Logos Verlag Berlin: 2011.
26 LASH, S./LURY C.: Global Culture Industry. a. a. O.
27 HARTMANN, O./HAUPT, S.: Touch! Der Haptik-Effekt im multisensorischen Marketing. Haufe Lexware. Freiburg: 2014.
28 TOWNSEND, C./SOOD, S.: Journal of Consumer Research. Volume 40. Supplement June 2013. S. 257.
29 RAGHUBIR, P./GREENLEAF, E.: Ratios in Proportions: What should the shape of the package be? In: Journal of Marketing. 2006. S. 70.
30 Consumption, markets, culture: Vol. 16. Nr. 4. Dezember 2013. S. 363.
31 WILLIAMSON, Judith: Consuming Passions. Marion Boyars. London: 1995.
[33]2Die Sprache der Packungen
2.1Langue und Parole – die Basiscodes
Die zugrunde liegende Sprache, die das Universum der Packungen hervorbringt, stützt sich auf eine Reihe von Elementen, die in sich geordnete Systeme sind, also Codes, aus denen durch entsprechende Wahlen eine Packung erzeugt wird. Dies ist mit einem Ansatz der Linguistik vergleichbar, in der zwischen Langue und Parole unterschieden wird. Dieses Konzept geht auf den Linguisten Ferdinand de Saussure zurück.32
Langue enthält die möglichen Bedeutungen von Einzelzeichen einer Sprache sowie ihrer Verknüpfungsregeln – aus ihnen kann ein Sprecher wählen, um eine bestimmte Äußerung zu treffen. Deutsch als Sprache enthält die Bedeutungen und Verknüpfungsregeln, die im Deutschen möglich und zulässig sind. Dies ist die Langue – daraus können Millionen von Sätzen gebildet werden. Diese realen Sätze bilden die Parole.
Ebenso basiert das Universum der konkreten Packungen auf bestimmten Bausteinen, die in geordneten Klassen vorliegen, und ihren möglichen Verknüpfungsregeln. Im Unterschied zu natürlichen Sprachen sind jedoch in diesem Bereich die Bedeutungen fließend, sie ändern sich schneller im Zeitverlauf als bei der Sprache und die Verknüpfungsregeln sind sehr locker. Dennoch lassen sich die Klassen der Möglichkeiten rekonstruieren, also die Codes, aus denen gewählt werden kann. Diese Klassen sind summarisch:
Die wichtigste Wahl: Wie viel Verpackung zeige ich, wie viel Produkt zeige ich? Das ist der Gesichtspunkt: das Nackte und das Bekleidete (vgl. Kapitel 2.3).Dann die materiellen Basiscodes:
MaterialGrößeFormFarbeSchließlich die sozialen Basiscodes:
männlich und weiblichkindlich/jung/altPositionierung in Raum und ZeitDiese Basiscodes, die in Packungen aller Produktgattungen eine Rolle spielen, sollen im Folgenden näher erläutert werden.
[34]2.2Die Kommunikationsflächen des Mediums Packung
Die einzelnen Zonen von Packungen haben verschiedene Aufgaben und sie leiten zu je verschiedenen Systemen ihrer Umwelt: Die Gesamtgestalt, also die 3D-Form, die Größe, die verbalen und visuellen Codes des Etiketts, die Farbgebung haben die Aufgabe, den Konsumenten anzuziehen, ihm die notwendigen Informationen für seine Wahl zu geben.
Die Rückseite der Verpackung
Die Rückseite oder manchmal auch die Seitenwände sind der reinen Information gewidmet: Sie dienen dazu, Informationen aufzunehmen, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind oder an denen ein Konsument, der sich näher mit dem Produkt beschäftigt, interessiert sein könnte, also zum Beispiel die Firmengeschichte oder Einzelheiten über die Gewinnung von Inhaltsstoffen oder Nachhaltigkeitskriterien. Man kann bei dieser Zone nicht sicher sein, ob sie der Konsument beachtet. In jedem Fall muss sie aktiv gelesen werden.
Jede Packung enthält an verschiedenen Punkten Informationen, die zeigen, dass sie institutionell gerahmt sind, dass also offizielle Instanzen, der Staat oder die Behörden über sie wachen: Diese benutzen immer den bürokratischen Code. Hier geht es also um Inhaltsstoffe und ihre Herkunft, die Einhaltung von EU-Vorschriften, Preise, die gescannt werden, Mengenangaben usw. Sehr oft erscheinen hier auch Siegel, Güte- oder Kontrollsiegel, die angeben, dass der Inhalt der Packung verschiedenen Kontrollen unterworfen wurde.
Der QR-Code
Schließlich enthalten Packungen einen QR-Code, der es Konsumenten erlaubt, viele Informationen aus unterschiedlichen Quellen über den Inhalt der Packung oder das Unternehmen über das Internet abzurufen: Er hält zum Beispiel sein Mobiltelefon an den Strichcode und bekommt alle Informationen auf das Handy geliefert.
2.3Das Nackte und das Bekleidete
Welche Rolle soll das Produkt an sich in der Wahrnehmung der Packung spielen: Soll es sichtbar sein? Oder soll es gänzlich unter Packungsschichten verschwinden? Das ist die zentrale Leitdifferenz, die bestimmend für die Gestaltung von Packungen ist.
Der Ausdruck »das Bekleidete« ist nicht von ungefähr so gewählt, er zeigt, dass zwischen Packungen und dem vestimentären Code, also dem Code der Kleider, enge Ver[35]bindungen bestehen. Packungen können auch als der Versuch betrachtet werden, das nackte Produkt, das gleichsam die Natur darstellt, mit einem zivilisierten Gewand zu bekleiden. Oder anders ausgedrückt: Das nackte Produkt wäre das Notwendige, aber gleichsam Anonyme, nicht mehr Unterscheidbare, gleichzeitig aber das moralisch Richtige.
Die Bekleidung hebt es aus dem Zustand der Notwendigkeit und Natur in den der Kultur: personalisiert es, unterscheidet es, lädt es mit Bedeutung auf, macht es von etwas Alltäglichem zu etwas Außer-Alltäglichem, nimmt es zum Anlass, um eine Geschichte zu erzählen – sie ist es, die die natürlichen Objekte zu Objekten des Marktes macht, zu Artefakten, sie stellt also eine zentrale Strategie von Märkten dar und ist konstitutiv für unsere Gesellschaft. Um all den Müll zu vermeiden, der dadurch entsteht, könnten wir uns natürlich entschließen, nackte Produkte zu kaufen: Milch in Kannen, Waschpulver in Säcken, kosmetische Cremes in Plastiksäckchen – eine Strategie, die derzeit durchaus verfolgt wird. Zu Ende gedacht würde das aber bedeuten, dass wir eine andere Gesellschaft hätten, die, wie sich leicht zeigen lässt, ebenfalls ihre Nachteile hätte.
Der vestimentäre Code
Packungen lassen sich als Kleidung des Produktes betrachten und sie partizipieren demnach auch an dem vestimentären Code, also an der Sprache der Kleider. Diese stellt ein hoch differenziertes System der Bedeutungsvermittlung dar. Die Sprache der Kleider wird in jeder Gesellschaft gesprochen. Alle Kleidungsstücke sind zu Klassen geordnet, aus denen ich wähle, und indem ich das tue, vermittle ich damit automatisch eine Bedeutung. Ich kann nicht »den Mantel« tragen, sondern ich muss wählen zwischen einem roten Swinger, einem Fellmantel, einem Lodenmantel, einem langen oder kurzen Daunenmantel. Indem ich den einen wähle, mache ich klar, dass ich alle anderen nicht gewählt habe.
In geschlossenen traditionellen Gesellschaften ist diese Wahlfreiheit nicht so deutlich gegeben: Hier ist vorgeschrieben, welches Kleidungsstück eine Frau oder ein Mann zu welchem Anlass trägt. Auch bei uns legt der vestimentäre Code fest, was für Männer und Frauen angemessen ist, für alte und junge Leute, für bestimmte Gelegenheiten, auch ritueller Natur: Es gibt Hochzeitskleider und Trauerkleider, Kleidung für formelle und informelle Anlässe. Dies hat, wie im Folgenden beschrieben wird, auch Konsequenzen für die Packungsgestaltung.
Kleidung wird in den Kulturwissenschaften auch oft mit bestimmten Themen verknüpft, sehr oft mit dem Thema der inneren und äußeren Werte, Täuschung und Wahrheit, Oberfläche und Tiefe. Sehr schöne Beispiele liefert hier die Literatur:
[36]Beispiele