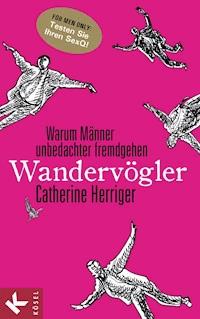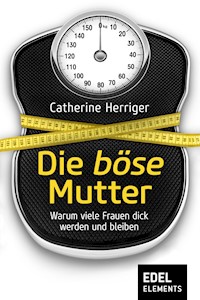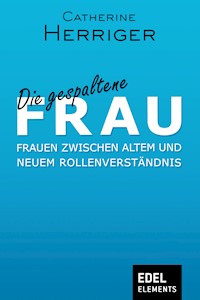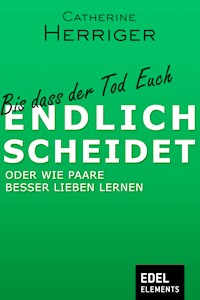
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum haben Sie sich ausgerechnet in einen ganz bestimmten Menschen verliebt und nicht in einen anderen? Warum erleben Sie Konflikte, Streit und andere schmerzliche Situationen in Ihrer Partnerschaft? Catherine Herriger, Diplom-Psychologin und erfahrene Paar- und Familientherapeutin, zeigt Ihnen die Hintergründe Ihrer Partnerwahl auf und erklärt wichtige Zusammenhänge zwischen Ihrer Kindheit und Ihrer derzeitgen Beziehung. "Do-it-yourself"-Checklisten und anschauliche Skizzen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beziehungserfahrungen selbstständig zu überprüfen und Ihre partnerschaftliche Kommunikation nachhaltig zu verbessern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Catherine Herriger
Bis dass der Tod Euch endlich scheidet
Oder wie Paare besser lieben lernen
Edel eBooks
Inhalt
Ein Vorwort
Eine Einführung
1. Eine Paar-Beziehung ... Was ist das überhaupt?
2. Einsichten in Beziehungsmuster
3. Kommunikation in der Paarbeziehung
4. Verlieben als Versuch einer seelischen Korrektur: Sechs Fallstudien
5. Zu neuen Ufern: Die Emanzipation beider Geschlechter zur Ganzheitlichkeit
Meinen Enkelkindern
ZUM (BEZIEHUNGS-)GELEIT: EIN VORWORT
»Eine Beziehung ist immer das Resultat von dem, was die Beteiligten investiert haben – nicht mehr, aber auch nicht weniger.«
Ein schöner Satz. Doch sehr schwer verständlich, da kaum einer weiß, was der Begriff Beziehung überhaupt beinhaltet. Dabei dürfte es das meist benützte und strapazierte Wort im zwischenmenschlichen Bereich sein.
Wir streben zwar nach Beziehungen, leben in Beziehungen, und sprechen, sprechen, sprechen über Beziehungen ... und alle haben wir Vorstellungen, wie für uns eine »gute« Beziehung aussehen sollte – um dann zu erleben, daß die Realität ganz anders aussieht. Beziehungswünsche und Beziehungsalltag klaffen meistens meilenweit auseinander. Der übliche bedauerliche Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Warum?
Weil nach wie vor kaum jemand richtig auf das intensive, auf Langzeit geplante Unternehmen »Beziehung« vorbereitet ist. Jeder meint doch sowieso, er könne es. Ein meist fataler Irrtum, wie alleine schon die Scheidungsziffern beweisen.
»Es wird wieder mehr geheiratet«, höre ich immer wieder. Na und? Es wird auch mehr geschieden. Mir scheint, für Beziehungen braucht man auch eine Ausbildung – besser früher als später!
Kaum ein anderes Gebiet wirft so viele Fragen auf:
Was ist das überhaupt – eine Beziehung? Wie entsteht sie? Warum fühlen sich zwei Menschen zueinander hingezogen? Warum kann eine Beziehung plötzlich aufhören? Wie kann sie verbessert und entwickelt werden? Was bringt sie überhaupt zum Ticken?
Zwar gibt es vielerlei Erklärungs- und Lösungsmodelle für alle nur erdenklichen Situationen in der Arbeitswelt – aber im privaten Bereich hapert es damit. Eigentlich ein deutlicher Hinweis darauf, wie leicht der emotional kommunikative Bereich des Menschen – also das, was tatsächlich in der Paarbeziehung geschieht – noch immer als zweitrangig betrachtet wird.
Dabei weiß jeder Unternehmensberater nur zu genau, daß unbewältigte oder schlecht verarbeitete persönliche Konflikte früher oder später jeden einholen. Eine Wahrheit, der jedoch in der Arbeitswelt trotz aller Kurs- und Seminarvarianten noch immer nicht genügend Rechenschaft getragen wird. Der kommunikationstechnisch noch so geübte Manager, der abends nach Hause zu seiner Familie kommt, sieht sich einem emotionalen Erwartungsfeld ausgesetzt, auf das ihn nichts und niemand vorbereitet hat – am allerwenigsten seine Erziehung. Kein Wunder also, daß er morgens mit Wonne wieder dorthin zurückkehrt, wo ihm niemand emotional-kommunikative Unzulänglichkeit vorwerfen kann: in sein Büro.
Ein böser Fehler – gerade in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, denn: Wer seine persönlichen und seine Beziehungs-Schwierigkeiten nicht lösen lernt, wird auch beruflich / hierarchisch irgendwann ins Straucheln geraten.
Warum?
Unsere Energie, unser Lebensmotor, wird von unserer emotionalen Seite gespeist, genau wie unsere körperliche Gesundheit. Den wichtigsten Ausdruck seiner Emotionalität erlebt jeder Mensch nach wie vor in seinen Beziehungen. Hier erhält jeder einen deutlichen Spiegel präsentiert, wie es in Wirklichkeit um ihn steht.
Jedes Verdrängen oder Mißachten von Konflikten in diesem Bereich bringt uns um die Chance, eine entscheidende Verbesserung unserer Lebenssituation und -qualität wahrzunehmen.
Wenn wir aber nicht verdrängen und nicht mißachten, müssen wir unter Umständen die Konsequenz ziehen und eine für uns unbefriedigende Beziehung beenden. Um dann – mit mehr Beziehungswissen und größerer Selbsterkenntnis – eine neue Partnerschaft einzugehen, möglichst ohne die alten Beziehungsfehler zu wiederholen. Unser Leben ist zu kurz, um unglücklich in einer Beziehung ... bis daß der Tod uns endlich! scheidet – auszuharren.
In den meisten Fällen hätte es aber gar nicht zu einer Trennung kommen müssen – wenn beide Partner in der Lage gewesen wären, rechtzeitig das Richtige für sich und ihre Beziehung zu tun. Nur fehlte es, wie so häufig, am Beziehungs-Know-how.
Da Beziehungen aber (psycho)logische Systeme ohne Zufälligkeiten sind, kann Gott sei Dank jeder lernen, besser und entwicklungsfähiger damit umzugehen. Eine gute und beglückende Beziehung ist noch immer die Grundlage für ein erfülltes und erfolgreiches Leben.
In diesem Sinne wünsche ich allen meinen Lesern eine anregende und motivierende Zeit mit meinem Buch!
Catherine Herriger
... BIS DASS DER TOD EUCH ENDLICH! SCHEIDET: EINE EINFÜHRUNG
»... nachdem er seine Frau mit Fäusten und Fußtritten zusammengeschlagen hatte, setzte er sich vor den Fernsehapparat, um endlich mal in Ruhe das Fußballspiel anzuschauen. Am Ende der Sportschau bemerkte er, daß sie noch immer auf dem Küchenboden lag. Doch jede Hilfe kam zu spät. Sie war infolge innerer Verletzungen verblutet.«
Nein – keine Schauergeschichte und kein Horrorfilm, nur ein Auszug aus einer Gerichtsakte, die das blutige Ende einer 27jährigen ehelichen Beziehung berichtet. Eine Beziehung, die einmal mit dem freudig liebe- und hoffnungsvollen Gelübde begann: »... in guten wie in schlechten Zeiten, bis daß der Tod euch scheidet.«
Was geschah in den letzten 27 Jahren mit diesen zwei Menschen? Der Mann war alles andere als ein Schlägertyp und die Frau keinesfalls ein Ausbund an Bösartigkeit. Sie hatten sich sicherlich einmal geliebt, waren finanziell abgesichert und erfreuten sich bereits an ihrem ersten Enkel. Für die Nachbarn waren sie ein mustergültiges Ehepaar mit einem harmonischen Familienleben. Eine unverständliche Geschichte? Mitnichten. Eine tieftraurige Kette von ersten Mißverständnissen und Reibereien, verschieden gelagerten Interessen, unausgesprochenen Enttäuschungen und daraus folgenden kleinen Racheakten, gegenseitigem Anschweigen und immer stärker werdenden unterdrückten Aggressionen – bis zum schlimmen, unvorhergesehenen Ende. »... bis daß der Tod euch endlich! scheidet.«
Es ist die Geschichte zweier Menschen, die gleich unzähligen anderen eine gemeinsame Beziehung eingingen, ohne eigentlich genau zu wissen, was das überhaupt heißt und beinhaltet. Beide hatten nur das Beispiel der Beziehungen ihrer Eltern, Freunde und Bekannten. Und wie schon bei ihren Eltern, Freunden und Bekannten hielt auch ihre Beziehung nicht, was sie anfänglich versprach: stetige Liebe, ungetrübte Harmonie, unverletztes Vertrauen, leidenschaftliches Begehren und erfüllte Partnerschaft.
Die Vorgeschichte für dieses entsetzliche Ende war erschütternd in seiner Einfachheit und Banalität: Dem Mann und Täter gingen seine Sportberichte über alles. Früher, als Junggeselle, war er aktiver Sportler gewesen und hatte seiner Frau zuliebe damit aufgehört. Sie sei immer äußerst eifersüchtig gewesen. Ständig hätte sie deswegen an ihm »rumgenörgelt« und ihn unter Druck gesetzt. Um des lieben Friedens willen trat er aus seinen Sportvereinen aus und verfolgte stattdessen von zu Hause aus sämtliche Sportberichte, derer er habhaft werden konnte. Meistens hätte sie aber gerade dann mit ihm sprechen wollen und ihn auch sonst am Zuschauen oder Zuhören gehindert, bis es nach vielen, vielen Jahren zu dieser unbeabsichtigten und schrecklichen Kurzschlußhandlung kam.
Totschlag im Affekt!
Der Mann erhielt eine verhältnismäßig kurze Gefängnisstrafe, erholte sich aber nicht mehr ganz von seinem schweren Nervenzusammenbruch, der ihn traf, als er seine Tat realisierte.
Wie sahen wohl diese 27 Jahre Ehe für seine Frau, das Opfer aus? Wir können nur mutmaßen. Der Mann wirkte schweigsam und in sich gekehrt, sie hingegen galt als eher fröhlich und aufgeschlossen. Beide bereits erwachsenen Kinder berichteten, daß der Vater die Mutter oft tagelang mit Schweigen für irgendwas »bestrafte«, bis sie ihn weinend anflehte, doch wieder »gut« zu sein. Es scheint, als sei die Frau jahrelang gegen eine menschliche Barriere ihres Mannes angerannt, immer in der Hoffnung, dahinter verberge sich etwas, was zu ihrem Glück beitragen könnte. Es sieht so aus, als hätte der Mann versucht, ihr mehr Gefühle zu geben – nur war sein »Reservoir« an Sensibilität und Empfindungen wesentlich kleiner als ihr eigenes. Er gab ihr ja »alles«, was er hatte: er opferte ihr »zuliebe« seine sportlichen Aktivitäten. Dann saß er mit ihr zu Hause und es zeigte sich, daß trotzdem von ihm und mit ihm nicht mehr an gefühlsmäßigem Austausch möglich war als bisher. Er blieb verschlossen und wortkarg. Da die Frau dies aber nicht ertragen konnte, fuhr sie damit fort, ihn weiterhin zu drängen und »mehr« von ihm zu fordern. Bis er eines Tages nicht mehr konnte ...
Was hätten die beiden anders, sicherlich besser, machen können? Wie hätten sie ihre gemeinsame Beziehung gestalten können? Man könnte dies jetzt resigniert als müßige Fragen bezeichnen, aber wir können daraus lernen.
Die meisten Menschen wissen genauso wenig wie dieses Ehepaar, was das Wesen einer Paarbeziehung ausmacht, was sie zum »Ticken« bringt und wie sie gefördert und entwickelt^ werden könnte. Dabei braucht jede Tätigkeit eine kürzere oder längere Ausbildung – aber ausgerechnet diese schwierigste aller Lebensformen, das enge Zusammenleben mit einem anderen Menschen, soll einfach so zu bewältigen sein?!
In den meisten Fällen beschränkt sich die Grundlage für eine Paarbeziehung auf folgende Vorsätze:
a) man möchte es genauso machen wie die eigenen Eltern, oder
b) um Himmels willen ganz anders!
Ziemlich knappe Voraussetzungen für ein derartig langfristig geplantes Unternehmen wie eine Zweierbeziehung, nicht?
Machen wir uns also daran, mehr in Erfahrung zu bringen über dieses Unternehmen. Es werden sich neue Aspekte und ungeahnte Zusammenhänge eröffnen, in Zukunft das Unternehmen Paarbeziehung besser und erfolgreicher planen und aufbauen zu können.
1.Eine Paar-Beziehung ... Was ist das überhaupt?
»Ich lebe in einer Beziehung.« Damit sage ich, daß ich mich absichtlich, wissentlich und gezielt auf einen ganz bestimmten Menschen einlasse, also beziehe. Ich nehme Be-zug auf ihn ... ich setze mich in Be-ziehung zu ihm ... ich lasse mich in Be-zug nehmen ... er be-zieht sich auf mich ... wir be-ziehen uns aufeinander.
Dieses Wort »ziehen«, in allen Formen, das überall vertreten ist, springt uns förmlich ins Auge. Also sollte es möglich sein, den Begriff Beziehung bildhaft darzustellen, damit wir ihn alle auf ein und dieselbe Art sehen und dadurch verstehen können.
Wie machen wir das?
Wir schließen die Augen und lassen das Wort Be-zieh-ung auf uns einwirken. Nun passiert etwas Großartiges in einem Teil unserer rechten Gehirnhälfte: irgend etwas beginnt zu »illustrieren«, also Inhalte in Bilder umzusetzen. Unser rechtshemisphärisches Denken hat eingesetzt und ist jetzt kreativ tätig.
Während Ihre linke Gehirnhälfte »denkt«, ist Ihre rechte Gehirnhälfte damit beschäftigt, zu »illustrieren« – oder Töne, Farben, Düfte, Szenen zu assoziieren. Leider benützen wir die Ausdrucksformen, die unserem rechtshemisphärischen Denken entspringen, viel zu wenig. Sie kennen sie aber sicherlich von Ihren Kritzeleien her, wenn Sie zum Beispiel telephonieren. Ohne es zu wollen, haben Sie dabei bildhaft ein Gefühl oder eine Gedankenkette umgesetzt.
Gerade im Beziehungs- und Kommunikationsbereich wäre die gezielte Anwendung dieser Ausdrucksform von unschätzbarem Wert, weil sie die Möglichkeit bietet, ein nur schwer verbalisierbares Gefühl trotzdem unmißverständlich zum Ausdruck zu bringen.
Stellen Sie sich vor: In einer Auseinandersetzung oder in einem Streitgespräch, wo Worte längst versagt haben oder mißverstanden wurden, greift einer zum Bleistift und fertigt eine ganz einfache Zeichnung zum Thema an: Der Konflikt wird dadurch für beide »sichtbar« gemacht – der Weg zueinander spürbar erleichtert.
Doch zurück zum Begriff Beziehung. Mir persönlich lag es nahe, vom sprachsymbolischen Gehalt des Wortes Be-zieh-ung her die gefühlsmäßige Interaktion zweier Menschen wie ein verbindendes Seil darzustellen, an dessen Ende jeweils einer steht und »zieht« (sich be-zieht). Als vereinfachte Darstellung der Beziehungspartner wählte ich Strichmännchen (Piktogramme).
Nun »sehen« Sie den Sinn und Inhalt des Wortes Beziehung deutlich vor sich. Mißverständnisse bezüglich dieses Begriffes sind jetzt ausgeräumt – dank dem Einschalten unseres rechtshemisphärischen Denkens.
Kontaktsuche und Kontaktangst
Wir alle tragen den Wunsch nach Beziehungen in uns. Wir suchen im Leben immer wieder nach Menschen, die uns Ratgeber, Freunde, Liebespartner usw. sein könnten. Somit haben wir alle auch die Möglichkeit, ein »verbindendes Seil« zu einem anderen Menschen »auszuwerfen«.
Doch es kann auch geschehen, daß ein Mensch, verängstigt und verstört durch schlechte Beziehungserfahrungen, vorläufig beschließt, alleine zu bleiben – oder noch nicht den Mut gefunden hat, seine Beziehungsmöglichkeiten auszuprobieren. So oder so, jedermann hat die Fähigkeit in sich, auf andere zuzugehen – unter Umständen muß er aber vorher sein Ich-Gefühl entwickeln, um seine Wünsche und Grenzen spüren zu können.
Wir haben jetzt Kontaktsuche und Kontaktangst bildhaft umgesetzt. Nun schauen wir, welche Beziehungsarten zwei kontaktsuchende Menschen miteinander entwickeln können.
2.EinsichteninBeziehungsmuster
DIE SYMBIOTISCHE BEZIEHUNG
Beide Partner sind derart aufeinander bezogen, daß kaum mehr Platz für den einzelnen bleibt.
Wir alle haben diesen Zustand (hoffentlich) schon erlebt: den der Verliebtheit. Die Minuten, die man nicht in der Nähe des anderen verbringen kann, werden zur Qual. Jeder möchte mit dem geliebten Partner verschmelzen, eins sein mit ihm. Ein fast paradiesischer Zustand, der fern jeglicher Lebensrealität ist und von daher allmählich in eine reifere, weil distanziertere Form des Miteinanderseins gleiten sollte. Wenn aber beide krampfhaft versuchen, diesen kindlich-symbiotischen Zustand des Ein-ander-besitzen-Wollens aufrechtzuerhalten, wird die Beziehung zum Gefängnis: Es darf ja keinerlei Selbstentfaltung stattfinden – beide hätten Angst, sie würden sich voneinander weg entwickeln und somit das Beziehungsmotto »Du ersetzt mir die Welt« gefährden. Jegliche Form von äußeren Impulsen (Freundeskreis, Reisen, Hobbys) muß eifersüchtig gemieden werden. Kein Wunder, daß das Flämmchen Liebe allmählich erstickt, um Aggressionen und Einengungsängsten Platz zu machen.
Wenn die Verliebten aber wissen und spüren, daß Beziehungen lebendige und somit dynamische Gebilde sind, die Weiterentwicklung und Reifungsprozesse per se beinhalten, dann können sie sich gelassen und vertrauensvoll ihre Freiheiten lassen, ohne dabei das Wesen und den Inhalt ihrer Beziehung in Frage zu stellen. Beide haben Spielraum und ihren eigenen, autonomen Standpunkt. Sie haben ihre Eigenständigkeit behalten. Das Kräfteverhältnis ist von vornherein ausgeglichen – eine gute und reife Partnerschaft konnte sich entwickeln: die standfeste Beziehung.
DIE EINSEITIGEN BEZIEHUNGSMUSTER
Da, wo ein Partner sich merklich stärker um den anderen bemüht, entsteht bald ein deutliches Engagementgefälle. Was anfänglich noch so bequem war – einer trifft alle Entscheidungen und Initiativen, der andere läßt sich umwerben –, wird schnell zum Grundstein gegenseitigen Ärgernisses. Der Partner, der sich stärker bezieht, beginnt zu spüren, wie einseitig die Beziehung ist, wie wenig aktiven Anteil der andere übernimmt. Daraus zieht er (natürlich) die falsche Schlußfolgerung: statt sich seinerseits etwas zurückzuhalten, um dem anderen mehr Raum zur Initiative zu lassen, bezieht er sich eher noch mehr. Er wird drängender und fordernder, der andere passiver und abweisender (Piktogramm 1).
Diese Form der einseitigen Beziehung kann sich auf bösartige Weise steigern: Der Partner, der sich mehr bezieht, beginnt um Zuwendung und Anteilnahme zu betteln. Er versucht, durch Ich-Aufgabe den anderen dazu zu bringen, ihm endlich die gewünschte Aufmerksamkeit zu schenken. Wie ein Kind bemüht er sich um Wohlverhalten, damit ihm etwas Liebe zuteil wird. Er verzichtet auf immer mehr Äußerungen seiner Persönlichkeit und seiner Ansprüche zugunsten des anderen, der wie ein Blutegel diese Selbstaufgabe zur Stärkung seines Ichs mißbraucht (Piktogramm 2).
Im allgemeinen aber läßt sich sagen, daß wir alle immer wieder Einseitigkeiten in unseren Beziehungen erleben. Es ist schlichtweg für beide Seiten unmöglich, ständig den Ansprüchen des Partners zu genügen. Es wird immer wieder mehr oder weniger schmerzhafte Augenblicke geben, wo der eine mehr will oder braucht als der andere gerade geben kann oder zu geben bereit ist. Daraus mag sich eine kurzfristige Standpunkt-Verunsicherung dem Partner gegenüber ergeben, die keinesfalls als Machtbedrohung oder gar als Machtverlust angesehen werden darf – durchaus aber als Aufforderung zu einer neuen und bewußteren Standortbestimmung (Piktogramm 3).
Falsch wäre es, wenn in einer gefühlsmäßig als einseitig empfundenen Situation der als stärker und unabhängiger empfundene Partner »bestraft« würde mit Liebesentzug – als »Rache« für nicht oder noch nicht erhaltene Streicheleinheiten. Damit könnte tatsächlich ein unnötiger und sicherlich schmerzhafter Machtkampf eröffnet werden (Piktogramm 4).
Völlig aussichtslos wird eine Beziehung dann, wenn ein Partner aus uneingestandener Verlustangst, Eifersucht, eigener Verunsicherung usw. versucht, den anderen einzuengen und zu dominieren – ihn also für sich »einzuvernehmen« (Piktogramm 5).
Schlußfolgerung
Aus lauter Sorge und Wissen, wie schwierig und empfindlich Beziehungen sein können und wie verletzlich die Beteiligten sind, wird gerne ein falscher Schluß gezogen: der Partner muß unbedingt unter allen Umständen geschont werden, genauso wie man anscheinend selbst der Schonung bedarf. »Harmonie à tout prix« heißt dann das Motto. Streit und Auseinandersetzungen müssen vermieden werden – es wird ein Zustand geschaffen, der vor allem eines anstrebt: totale Spannungslosigkeit. Ähnlich wie bei den Verliebten werden störende Außenimpulse abgewehrt. Doch während in der symbiotischen Beziehung ein tropisch-üppiges Gefühlsklima bewahrt werden will, regiert hier Plastikblumen-Sterilität. (Motto: Jetzt sind wir schon so lange zusammen und haben uns noch niiiie gestritten ...) Kein Wunder, daß Langeweile sich breit macht und sexuelles Begehren schwindet (Piktogramm 6)!
Es geht also nicht darum, den anderen besitzen zu wollen, bzw. sich dominieren zu lassen »im Namen der Liebe«, auch nicht darum, in künstlicher Harmonie und Nähe jegliche Entwicklung und Herausforderung zu vermeiden – es geht darum, seinen Standpunkt zu spüren und zu bewahren und auch dem anderen seinen Raum und seine Entscheidungsfreiheit zu lassen. Auf dieser Basis gegenseitigen Respekts bleibt die Beziehung lebendig und erfüllend, weil beide stets freiwillig-bewußt sich aufeinander be-ziehen. Dadurch wird eine Beziehung zum denkbar kraftvollsten Energiespender überhaupt (Piktogramm 7).
BEZIEHUNGS(BEI)SPIELE
Nachdem wir nun den theoretischen Aspekt miteinander angeschaut haben, wenden wir uns praktischen Beispielen zu. Durch das bewußte Einschalten Ihres rechtshemisphärischen Denkens werden Sie bemerken, daß es Ihnen zunehmend leichter fällt, auch komplizierte Beziehungsmuster zu verstehen.
Nehmen Sie einen Bleistift zur Hand und zeichnen Sie! Beginnen Sie ruhig mit Ihren eigenen vergangenen oder jetzigen Beziehungen. Sie werden plötzlich ganz klare Muster erkennen können, die Ihnen deutlich Aufschluß über die Art und Weise geben, wie Sie bislang in Ihren Beziehungen unbewußt »funktioniert« und »agiert« haben.
Sie können auch gleich weiter lesen und anhand von Beziehungsgeschichten »üben«. Vergleichen Sie dann Ihre Skizze mit dem jeweiligen Piktogramm am Schluß des Fallbeispiels.
Benützen Sie nun die folgenden Beziehungsbeispiele, um mit Hilfe Ihres rechtshemisphärischen Denkens Interaktionen bildlich zu erfassen.
Die Beziehung mit dem »bösen« Partner
Monika und Rudolf leben seit sechs Jahren mehr schlecht als recht zusammen. Immer fröhlich und lächelnd, dabei aufmerksam und zuvorkommend, wirkt Rudolf sofort anziehend auf die meisten Menschen. Monika hingegen hat etwas Abwehrendes und Spitzes an sich. Es gibt schwerlich einen größeren Kontrast als die beiden zusammen zu sehen – und zu erleben!
Rudolf ist in Gesellschaft kaum in der Lage, einen Satz fertig zu reden, ohne daß Monika korrigierend einspringt. Sie scheut sich auch nicht, ihm Vorwürfe oder eine Szene vor allen Anwesenden zu machen. Doch wie auch immer: Rudolf reagiert freundlich-beschwichtigend, versucht Monika zu beruhigen und lächelt die peinlich berührten Anwesenden entschuldigend an. Worauf Monika meist zusätzlich beleidigend wird, so daß nach überstandener Einladung alle derselben Meinung sind: der arme Rudolf!
Monika würde man längst nicht mehr einladen, wenn es nicht wegen Rudolf wäre ... man muß sie eben mit in Kauf nehmen. Häufig taucht die Frage auf, warum Rudolf all das überhaupt mitmacht? Ein Bekannter hatte ihn direkt gefragt, mit der Bemerkung, er könne sicher Besseres finden. Worauf Rudolf leise und etwas traurig geantwortet haben soll: sie braucht mich.
Schauen wir uns mal Monika an: Wenn dieser bitter-gehässige Zug um den Mund nicht wäre, sobald sie mit Rudolf spricht, könnte man sie durchaus als attraktive Frau bezeichnen. Übrigens ist sie eine sehr beliebte und gute Lehrerin und hat etliche Freunde. Eigenartig? Nein – nur ihre Beziehung mit Rudolf stimmt für sie überhaupt nicht. Sie will es noch nicht wahrhaben, wird aber immer unglücklicher und zänkischer mit ihm. Der doch, allen offensichtlich, sooo lieb ist. Warum nur fühlt sie eine immer stärkere Aggression ihm gegenüber? Sie liebt ihn doch und würde alles für ihn tun.
Die Realität ist »einfach«: Rudolf läßt sich lieben. Wohlwissend, daß er kaum wieder eine Frau mit Monikas Qualitäten finden würde, die sich schon jahrelang mit dem wenigen abfindet, das er fähig und gewillt ist, in eine Beziehung zu investieren. Rudolf wird gerne umsorgt und umworben; sein jungenhaft-charmantes Auftreten vermeidet von vornherein, daß er sich irgendwelchen menschlichen Konfrontationen stellen müßte. Ein anziehender Mann ohne viel Gefühlswärme. Deswegen hat er auch keinen engeren Freundeskreis. Rudolf ist ein Beziehungs-Bluffer.
Rudolf wählte für sich den einfacheren, weil passiveren und verantwortungsschmaleren Weg. Für ihn war immer klar: die andere Seite – wer auch immer – trägt die Beziehungsverantwortung. Ihm wäre sie eine Last.
Und so sucht sich Rudolf Frauen aus mit einem schwachen Selbstwertgefühl, einem tief sitzenden Minderwertigkeitsempfinden, die von daher unbewußt bereit sind, ihn als Beziehungsschmarotzer »durchzufüttern«. Denn natürlich ist gerade so eine Frau glücklich, ihn, den anziehenden Rudolf, erobert zu haben. Mit der Zeit aber kommt bei ihr doch ein leises Gefühl auf, daß irgendwas nicht stimmt. Aber weil ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zuwenig entwickelt ist, glaubt sie, sie trage selbst Schuld an ihren wachsenden Gefühlen von Unzufriedenheit und Gereiztheit. Dabei spürt die Frau eine ihr unbewußte Wut und Aggression wegen Rudolfs mangelndem Sich-Beziehen, das bewirkt, daß sie gefühlsmäßig ständig alleine ist und zu kurz kommt. Trotz aller oberflächlich freundlich-liebevollen Aufmerksamkeit von Rudolf, dem es an tatsächlicher Beziehungsfähigkeit fehlt. Nur merkt das keiner – aber Monika spürt es und verdoppelt fälschlicherweise ihre Bezugnahme auf Rudolf, um doch endlich eine Antwort, einen Gegenbezug auszulösen. Dadurch zieht Rudolf sich innerlich noch etwas mehr zurück – stets freundlich, aber eindeutig sich verweigernd. Er möchte wohl umworben werden, doch viel geben liegt nicht drin und solange Monika da mitmacht ...
Die Umwelt, die nur Rudolfs nettes Bemühen um Monika sieht, unterstützt ihn und verurteilt Monika. Dadurch holpert diese ungleichgewichtige Beziehung weiter, da Monika keinerlei objektives Wahrnehmen von außen erfährt und ihre negativen Gefühle sich daher selbst zuschiebt.
Bis sie hoffentlich eines Tages, mit oder ohne äußere Hilfe, zu erkennen vermag, wie ihre Beziehung in Wirklichkeit aussieht. Daß sie mit Recht immer wieder »böse« wurde und wird! Und dann ...
Die harmonische Beziehung
Jahrelang galten Markus und Birgit als »das Paar«. Immer zusammen, meistens einer Meinung, zärtlich ineinander verschlungen, sich häufig küssend ... Manch einer wurde grün vor Neid ob dieser Innigkeit. Sowohl Birgit wie Markus sprachen eigentlich nur in der Wir-Form: Wir gingen ins Theater und uns gefiel das Stück ausnehmend gut ... wir verbringen unsere Ferien immer auf Sylt, weil uns das Klima so gut tut ... wir gehen gerne mit Obermüllers essen, weil wir so gut mit denen plaudern können ... usw. usf.
Der ganze Freundeskreis war perplex, als Markus eines Tages sang- und klanglos verschwand – mit der um etliche Jahre jüngeren Nachbarstochter.
Birgit schnitt sich die Pulsadern auf, wurde aber rechtzeitig gefunden. Dann folgte eine lange Zeitspanne, in der Birgit allen erzählte, welcher Saukerl Markus sei. Eine Horrorstory jagte die andere. Um dann wieder Markus ausfindig zu machen, zu betteln und zu drohen, daß er doch wieder zu ihr zurückkehren möge.