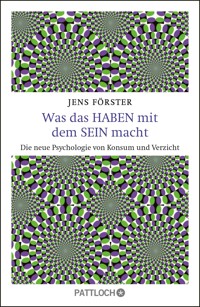Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wer die systemische Haltung des Nichtwissens und Nichtverstehens im Praxisalltag konsequent umsetzen möchte, sollte es einmal mit Black-Box-Methoden versuchen. Was sich hinter diesen auch als »analog« oder »verdeckt« bezeichneten Verfahren verbirgt, erläutert Jens Förster kenntnis- und ideenreich in diesem Leitfaden für Therapie, Beratung und Supervision anhand von zahlreichen Fallbeispielen. Das Ignorieren der Inhaltsebene (Was ist das Problem?) erlaubt ein vorurteilsfreies Arbeiten auf der Prozessebene (Wie können wir die Situation verbessern?). Klient:innen werden ermutigt, Expert:innen für ihre Anliegen zu werden und selbst neue Lösungsideen zu entwickeln. Wenn Sie unparteiisch begleiten statt nur behandeln und kokreativ Räume für Selbstorganisation gestalten möchten, sind Sie hier richtig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jens Förster
Black-Box-Methoden
Mit systemischer Haltung therapieren, coachen und beraten, ohne das Problem zu kennen
VANDENHOECK & RUPRECHT
Dem IF Weinheim gewidmet
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2024 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: chingraph/Adobe Stock
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99305-8
Inhalt
Kapitel I: Losgehen
Black-Box-Methode: Wie ich zu dem wurde, was ich jetzt bin
Zu mir und diesem Buch
Black Box-Methoden: Menschen beim Denken zuschauen
Grenzen der Kommunikation
Kommunikation ist unmöglich, Therapie ist nützlich
Landkarten sind nicht das Land
Schublade auf, Schublade zu
Chancen von Black-Box-Verfahren
Rechte statt Zuschreibungen
Das Recht, die Kontrolle über den Prozess zu haben
Das Recht, alles denken zu dürfen
Das Recht auf Widerstände
Das Recht, mich nicht verändern zu müssen
Das Recht, nicht über-redet oder manipuliert zu werden
Das Recht, nicht bewertet oder analysiert zu werden
Das Recht, mich nicht für irgendjemanden verstellen zu müssen
Das Recht, mich nicht verständlich machen zu müssen
Das Recht, mich nicht schämen zu müssen
Das Recht auf einen co-kreativen Raum
Das Recht auf Begleitung statt Analyse, Beratung oder Therapie
Haltung als Methode
Kapitel II: Entscheidungen mit Herzen und Füßen
Ein bisschen Struktur vorweg
Fallbeschreibung: Galips Schlange im Nacken
Methode: Das Tetralemma
Methodenleitfaden
Ein paar Fragen
Tetralemma als Black-Box-Methode in Gruppen
Prozessorientierte Anwendung der Methode
Entscheidungsfreiheiten
Einladende Körpersprachen
Metaphern (mit-)gestalten
Reframing: Neue Rahmen für alte Themen
Gründe für die Black-Box-Methode im Fall Galip
Theorie: Systemische Grundpfeiler
Selbstorganisation – die Autopoiese
Wir treten keine Hunde
Selbst ist das Leben
Filtern in guter Absicht
Unbewusst Ziele erreichen
Unbewusste Prozesse in der Therapie
Selbst wirken steigert die Selbstwirksamkeit
Rahmenbedingungen für Autopoiese und kreatives Denken
Konstruktivismus: Jede:r sieht es anders, und alle haben recht
Der radikale Konstruktivismus: Es könnte auch alles ganz anders sein
Operativer Konstruktivismus: Bilde Unterschiede, um dir selbst zu helfen
Der soziale Konstruktionismus: Sprache schafft Wirklichkeit
Kapitel III: Fragen vor, hinter und zwischen uns
Fallbeschreibung: Frau Kyra stellt sich auf die Fensterbank
Methode: FragenStellen
Methodenleitfaden
Einzelsetting
Gruppensetting
Prozessorientierte Anwendung der Methode
Minimalistisch aufgestellte Repräsentant:innen
Lösungsorientierung, Sprache
Gründe für die Black-Box-Methode im Fall von Agnes Kyra
Theorie: Sozialpsychologische und systemische Ansätze von (Co-)Kreativität und Prozesswechseln
Kreativität im Kontext: Nährböden für neue Ideen
Intrinsische Motivation: Von innen kommt die Energie
Positive Stimmung: Mut liebt gut Laune
Mit Sicherheit kreativ
Ausdrucksmuster: Auch der Körper kann denken
Farben: Blaues Wunder, grüne Hoffnung
Distanz: Es war einmal vor langer langer Zeit, da lebte in einem fernen Land
Priming: Das Hirn vorglühen
Fazit Rahmenbedingungen der Kreativität
Liegende Acht
Durch Reibung entsteht Energie
Theoretisch können wir das auch
Kapitel IV: Königliche Tänze auf der Lebenslinie
Fallbeschreibung: Wenn Herr König sein Leben tanzt, ist ihm das scheißegal
Methode: Zeitlinie
Methodenleitfaden: Zeitlinie oder Timeline
Prozessorientierte Anwendung der Methode
Verantwortungsübernahme: Wir sind zur Freiheit verurteilt
Den Namen tanzen – und was es sonst noch zu tanzen gibt
Der heiße Brei: Am Thema vorbeireden
Zurückhalten von Hypothesen
Gründe für Black-Box-Methode bei Herrn König
Theorie: Systemische Grundpfeiler
Embodiment: Psychologische Passung zwischen Körper und Umwelt
Körper und Geist in Interaktion
Annähern und Vermeiden: Drauf zu oder weg davon
Sprache entstand aus Räumen
Embodimentforschung – was unser Körper so alles kann
Kreativität entsteht im Körper
Embodiment in der Therapie: Drück weg, was du nicht haben willst!
Embodiment systemischer gesehen
Shared Reality: In anderer Leute Fußstapfen treten
Ressourcen ver-Körper-n
Ressourcenarbeit
Bausteine für Lösungen
Positive Psychologie: Menschen beim Aufblühen unterstützen
Up up to the sky – Aufwärtsspiralen
Bitte nicht zu fröhlich werden: Warum Menschen nicht platzen vor Glück
Selbstwert in der Black Box
Kapitel V: Mal ernstgenommen: Ich als Expertin meiner selbst
Fallbeschreibung: Mitschwingen mit Skeletten und fliegenden Fischen – Halima und Sven in der Reha
Methode: Resonanzbild
Methodenleitfaden: Resonanzbildverfahren
Prozessorientierte Anwendung der Methode
Gründe für die Black-Box-Methode in der Gruppe mit Halima und Sven
Theorie
Externalisierung: Du hast ein Problem, aber du bist nicht das Problem
Ich erzähle, was (ich denke, was) ankommt
Dekonstruktion durch Bewegung von innen nach außen
Du bist nicht dein Problem, du hast es
Möglichkeiten, etwas nach außen zu verlagern
Der Sinn des Bildhaften
Bild und Sprache
Mit Luhmann im Bilde
Digital und analog ticken
GLOMOsys: Vom Wald und von den Bäumen
Was und wie – Inhalt und Beziehung
Ich sehe was, was du nicht siehst
Resonanz
Mitschwingen – wenn es passt
Unterschiede zwischen Empathie und Perspektivenwechsel: Mitfühlen, Mitdenken
Resonanzbildmethode: Was geht denn da ab?
Wir können es auch Projektion nennen – jenseits von »richtig oder falsch«
Das »Nützliche« im »Falschen«
Mal auf uns geschaut
Kapitel VI: Gehen, um anzukommen
Randbedingungen
Aggression und Suizid
»Psychosen« und Stimmen hören
Prozessorientierung
Einstellungen und Haltung
Danksagung
Literatur
Die Würde des Menschen ist unantastbar
Kapitel I: Losgehen
Black-Box-Methode: Wie ich zu dem wurde, was ich jetzt bin
Ich habe mich gemeldet. Karin Nöcker hat gefragt, wer ein Anliegen hätte, und meine Hand hat sich wie von selbst erhoben. Sie steht auf, stellt sich in die Mitte des Raumes und macht eine einladende Geste. Karin möchte eine Black-Box-Methode1 zeigen und braucht dafür ein »echtes« Problem eines Teilnehmenden. Ich bin zu diesem Zeitpunkt Teilnehmer am »Institut für systemische Entwicklung und Ausbildung Weinheim«, kurz IFW, und Karin ist meine Dozentin. Im Seminar, das dieses Mal an der Universität Düsseldorf stattfindet, sitzen 14 andere Teilnehmer:innen2 im Stuhlkreis und sind gespannt.
Ich bin vor allem erleichtert. Ich wollte dieses Thema sowieso im Seminar mit ihr bearbeiten, aber es gibt tausend Gründe, warum ich mich davor auch gefürchtet hatte. Die Einladung, dass ich gar nichts erzählen müsste, sondern dass wir »rein körperlich und ohne viel Sprache« arbeiten würden, gibt mir eine richtig gute Energie. Ich fühle mich bei Karin in sicheren Händen. Sie weiß, was sie tut, und sie wird schon dafür sorgen, dass ich nicht zu tief falle.
Ich kann Ihnen hier das Problem verraten, das ich damals hatte: Ich war Professor der Sozialpsychologie mit einer guten Reputation und einer Institutsleitung an der Universität Amsterdam und dem Kurt-Lewin-Institut der Niederlande. Ich hatte mich, weil ich es dort ganz furchtbar fand, entschieden, mich an der Ruhr-Universität Bochum zu bewerben. Mein eigentliches Ziel war es, ein eigenes Institut mit therapeutischer Praxis in Köln zu gründen und übergangsweise an der Ruhr-Uni zu arbeiten, als Zwischenfinanzierung. Ich wollte kündigen, wenn meine Praxis gut laufen würde. Nach Jahren in der Forschung hatte ich alles erreicht, was ich erreichen wollte, und ich war es zudem leid, hinter dem Schreibtisch zu sitzen. Ich war es auch leid, als Homosexueller in einem spießigen System diskriminiert zu werden, und ich war es leid, 16 Stunden am Tag zu arbeiten und darum gleichzeitig beneidet und bedauert zu werden. Und ich hatte über viele Jahre genug Erfahrung als Therapeut, Coach und Supervisor angesammelt, um mich selbstständig zu machen.
Doch dann kam Alexander von Humboldt. Die Uni Bochum hatte mich während des Bewerbungsprozesses für eine Stiftungsprofessur vorgeschlagen. Ein Preis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, den Forscher aus dem Ausland erhalten können, wenn sie nach Deutschland zurückkehren. Ein Preis, den bisher nur ein einziger Psychologe je erhalten hatte. Eine Anerkennung, die mit 5 Millionen ausgestattet war und mir selbst ein Gehalt von 175.000 Euro pro Jahr zusichern würde. Ich hatte zugelassen, dass sie mich vorschlugen, weil ich mir sicher war, dass ich diesen Preis sowieso nie erhalten würde, und hatte mich schon nach Praxisräumen in Köln umgesehen.
Dann aber gewann ich das Ding und war in der Falle. Jede und jeder, der oder dem ich erzählte, dass ich mich bald selbstständig machen würde, hielt mich nun für verrückt. 5 Millionen! Beamtenstatus! Räume, Personal und ein gutes Gehalt! Pension! Prestige! Und ein Teil von mir sagte ebenfalls: »Das kannst du nicht einfach zum Fenster rauswerfen!« Während ein anderer Teil mir zurief: »Die Arbeit hat dich so erschöpft, dass du neun Monate zu Hause sein musstest. Universitäten sind Haifischbecken! Du bist ein richtig guter Therapeut und Supervisor! Mach endlich was Nützliches.«
Ich könnte noch stundenlang weitererzählen, doch war ich froh, dies nicht vor der Gruppe öffnen zu müssen. Was würden die anderen denn denken, wenn die mich so reden hörten? »Was für ein arroganter Angeber!«, »Hat der noch andere Probleme?«, »Ich verdiene grad mal 30.000 im Jahr – geht’s noch?« »Wie blöd ist der denn – erst will er die Stelle und dann will er sie nicht?« Ich musste das alles nicht erzählen, ich musste mich nicht erklären und nicht rechtfertigen. Ich darf aber alles denken.
Die Gruppe sieht mir freundlich zu, während Karin mich bittet, eine Karte aus einem bunten Kartenstapel zu wählen und sie auf den Boden zu legen. Ich soll mir einen »guten Platz« für mein Thema suchen, das ich mitgebracht habe. Ich nehme eine gelbe Karte und lege sie in die Mitte des Raumes. Karin lädt mich ein, mich auf das Thema zu stellen und mich einzufühlen. Ich stelle mich darauf und sofort beginnt mein Körper zu zittern. Die körperliche Reaktion ist so heftig, dass ich mich neben das Problem stelle.
Karin fragt: »Was passiert gerade?«
»Ich stehe da drauf und es ist heftig. Ich will da nicht draufstehen.« »Was bedeutet es für dich, dass du dich danebengestellt hast?«
»Ich denke, es könnte so etwas wie Verdrängen sein. Nein, das ist es nicht. Ich halte es einfach da nicht aus und kümmere mich um mich selbst. Ich muss mir nicht weh tun.«
»Du verdrängst nicht und kümmerst dich um dich. Und im wirklichen Leben: Stehst du da drauf oder daneben?«
Meine Gefühle übermannen mich. Nach einer Minute Arbeit stehe ich mitten im Raum und weine.
»Ist das auszuhalten?«, fragt Karin.
»So ist es eben«, sage ich. »So, genauso, ist es. Ich stehe da die ganze Zeit drauf und es ist furchtbar.«
»Ich sehe dich, wie du da danebenstehst, auf das Problem schaust und weinst.«
»Ja.«
Ich stelle mich wieder drauf. Die Reaktion ist weniger heftig.
»Es geht jetzt. Ich halte das ja täglich aus. Stündlich, jede Sekunde.«
»Wie machst du das? Wie hältst du das aus?«
»Weiß nicht.« Ich denke nach, lange, vielleicht drei Minuten? Fünf?
Es arbeitet in mir. Stille im Raum.
»Ich kann Dinge gut aushalten.«
»Was spürst du im Körper?«
»Magen, Nacken, die Haut juckt. Alles meine körperlichen Baustellen.«
»Liebevolle Signale deines Körpers?« Karin lächelt.
Ich lächle: »Könnte man so sagen.«
»In Bezug auf dein Thema, das ich ja nicht kenne – gibt es da einen ersten Impuls?«
»Ja, klar, ich kann mich auch danebenstellen, neben mein Thema. Ich muss mir nicht wehtun. Das ist mir gerade bewusst geworden.«
Ich sehe vor meinem inneren Auge die neun Monate, in denen ich nicht zur Uni gegangen war. In denen ich zu Hause in meiner schönen Wohnung wieder Kraft entwickeln konnte, Gedanken nachhängen durfte, Sport treiben, Malen, Singen, Filme schauen durfte – schöne Dinge schreiben konnte.
Karin reicht mir den Kartenstapel noch einmal. »Wähl doch einmal eine Karte für einen Zustand, der sich richtig gut anfühlt. Wo wäre der Platz?«
Ich nehme eine hellblaue Karte, gehe im Raum herum und bleibe vor dem Fenster stehen. Durch die Wolken bricht ein Licht. Ich lege die Karte auf den Boden, stelle mich auf die Karte, es fließt warm von den Füßen hoch. Magen, Schultern, Haut fühlen sich gut an. Es ist gut, dass Karin mich im Blick hat, es passiert gerade viel mit mir und sie fragt mich nichts. Dennoch ist es gut, dass sie mich sieht. Irgendwie sorge ich selbst dafür. Ich bin verbunden.
Erst nachdem ich mich ganz zu ihr wende fragt sie: »Wie kämest du denn von dem Hier und Jetzt da hinten auf diesen Zustand? Was bringst du mit, um das zu erreichen?«
»Viel!«, sage ich spontan. Sie bittet mich, in den Kartenstapel zu greifen.
»Greif mal rein, gefühlsmäßig. Wie viele Ressourcen stehen dir zur Verfügung, die dir helfen könnten, um von dem furchtbaren Zustand in diesen zu kommen?« Ich greife in die Vollen. Das fühlt sich gut an. Ich denke sofort an meinen Fleiß, meine Disziplin, meine Intelligenz, meine Beredsamkeit, meine Freunde, meinen Mann, meine Begeisterungsfähigkeit … wie gut, dass ich diese Ressourcen nicht laut nennen muss – wie komisch käme ich mir dann wohl vor. Hier darf ich einmal alles denken, ohne bewertet zu werden! Das fühlt sich großartig an.
»Kann das sein, dass du gerade deinen Rücken aufgerichtet hast? – Ich nehme gerade wahr, wie aufrecht du stehst« Ich nicke. Sie deutet auf die Karten. »Wo liegen diese Ressourcen? Leg sie doch mal in den Raum!«
»Na, zwischen Problem und Ziel.«
»Du nennst das jetzt Ziel. Was ist für dich der Unterschied zwischen Ziel und Zustand?«
»Ein Ziel kann ich erreichen und ich möchte es vielleicht auch …« Ich denke: Ich stehe auf meiner Selbstständigkeit. Meiner Praxis. Meiner Arbeit mit Menschen. Es ist schön, dass ich all das nicht aussprechen muss, denn ich bin ja mit der Praxis noch am Anfang und allein dieser Wunsch könnte den anderen ja überheblich vorkommen. Das Ganze macht mir auch Angst. In der Wissenschaft hatte ich mich an die internationale Spitze gespielt. Ich wusste, wie es geht, auch wenn es mir keinen Spaß machte. Aber wer würde in meine Praxis kommen? Was, wenn niemand käme? Ich würde meine Pension verlieren.
Ich streue die Ressourcenkarten mit Schwung zwischen Problem und Ziel.
»Wie wäre es, wenn du vom Problem einmal zum Ziel gehen würdest?« Ich habe große Lust dazu, stelle mich auf das Problem und gehe über meine Ressourcen hinweg zum Ziel. Ich merke wie sich mein angespannter Rücken auf dem Weg zum Ziel entspannt, wie die Schultern weicher werden, wie ich mich aufrichte und gleichzeitig entspanne. Ich darf dem eine längere Zeit nachgehen, es ist wieder minutenlang Stille im Raum.
»Jetzt ist das Leben ja nicht nur voller Ressourcen, sondern es gibt auch Herausforderungen, Hindernisse, Schwierigkeiten. Möchtest du auch dafür Karten wählen?«
Ich wähle sechs Karten und beschrifte sie mit einem Buchstaben. S wie »finanzielle Sicherheit«, F für »was sollen meine Freunde denken«? H wie »Haifischbecken«, P wie »Prestige«, Z wie Zweifel an einer Karriere als Selbstständiger« und M, ja meine Mutter fällt mir ein – sie würde das wohl nie begreifen. Ich lege die Karten auf den Weg.
Wieder gehe ich vom Problem über die Karten, dieses Mal die Problemkarten, zum schönen Zustand, dem Ziel. Das fühlt sich weniger schlimm an, als erwartet. Liegt es an den vielen Ressourcenkarten, die da liegen? Ich denke: Das Haifischbecken werde ich ja verlassen und was die dann sagen werden, muss mich nichts mehr angehen. Eine finanzielle Sicherheit habe ich, ohne viel zu arbeiten, da sich meine Bücher gut verkaufen und die daraus folgenden Vorträge richtig viel Geld einbringen. Mir kommt der Gedanke: »Du wirst nicht mittellos werden, du nicht.« Bei Prestige fallen mir zuerst die Nachteile ein, die jemand hat, der erste Liga spielt: Neid und Einsamkeit. Je erfolgreicher ich in der Universität wurde, umso einsamer und belasteter fühlte ich mich.
Es war ein Angebot aus Ohio, das den Amsterdamer Kolleg:innen nicht gepasst hatte. Wie hat er denn das gemacht? Dann bekam ich den europäischen Kurt-Lewin-Preis, der einmal in drei Jahren vergeben wird – und den meine Kolleg:innen eben nicht bekommen hatten. Nahezu jeder Artikel, den ich schrieb, wurde in internationalen Zeitschriften veröffentlicht; sie fragten sich, ob das an meinen guten internationalen Beziehungen lag, dem »Vitamin B«. Ein Maiskolben, der aus dem Feld herausragt, wird niedergemacht, heißt es in einem niederländischen Sprichwort. Und wieder ist es gut, dass ich all das nicht erzählen muss, denn ich weiß nur zu gut, wie viele Deutsche die Niederlande einfach nur wunderbar finden. Ich dagegen darf an all die Diskriminierungen zurückdenken, die ich dort erfahren habe. Ich muss jetzt nicht so komische Erklärungen liefern wie: »Wisst ihr, als Touristen seid ihr hier willkommen, aber wenn ihr da arbeitet, dann macht euch auf was gefasst.« Ich denke auch, dass ich auf keinen Fall nach Bochum will. Die Uni, die Kollegen, die Stadt – ich muss das alles nicht erklären. Aber ich darf das alles denken! Das Unangemessene, das Tabuisierte, das politisch Inkorrekte, das Schräge, das vielleicht Ungerechte.
Karin lädt mich dazu ein, den Weg ein paar Mal hin und her zu gehen. Irgendwann stehe ich auf der Zielkarte, schaue in das Licht, die Hände in den Hüften, wie ein Bauer, der auf ein frisch gesätes Feld schaut.
»Karin, reicht«, höre ich mich sagen. »Ich weiß, was ich zu tun habe.«
»Heißt dass, wir beenden die Sitzung hier?«
»Ja, gern, Karin, es ist jetzt alles klar. Es fühlt sich großartig an.
Danke!«
Karin bedankt sich bei mir und fragt nach, wie ich aus der Sitzung gehe. Ich nehme die anderen um mich herum wahr, bedanke mich bei allen und sage zu ihr: »Gut. Deine Arbeit ist so würdevoll.« Wundere mich über meine Wortwahl. Das Wort »Würde« ist mir im Zusammenhang mit Therapie noch nie eingefallen.
Karin schlägt mir vor, eine Stunde lang allein spazieren zu gehen, um dann den Tag mit der Gruppe zu beschließen. Ich gehe ein wenig durch Licht und Regen und die Zeit verfliegt in Gedanken. Die Uni Düsseldorf ist architektonisch irgendwie hässlich wie alle anderen deutschen Universitäten – doch das nehme ich nur am Rande wahr. Ich gehe schwanger mit meinen Gedanken. Ich fühle Licht. Kraft. Mut.
Dann teile ich der Gruppe mit, dass ich meine Universitätskarriere heute Abend noch beenden werde. Dies ist der Beginn meiner schönsten Lebensphase.
Zu mir und diesem Buch
Sie merken es bereits, ich nehme diese Arbeit persönlich und trotzdem denke ich, dass ich ein Sachbuch geschrieben habe. 2005, da war ich seit vier Jahren Professor in Bremen, habe ich mir zum ersten Mal die Aufgabe gestellt, Wissenschaft verständlich zu kommunizieren. Ich komme aus »einfachen Verhältnissen« und meine Mutter wusste nicht, über was ich redete, wenn ich mit meinen Brüdern über meine Arbeit schwadronierte. »Stereotype«, »Embodiment« und »Metaebene« waren in der Ludwigstraße in Lübbecke unbekannte Begriffe. Ich wollte Bücher für meine Mama und meinen Papa schreiben, damit sie wussten, was ich tue.
Mittlerweile habe ich viele Lieder, Bücher, Theaterstücke und wissenschaftliche Artikel geschrieben und habe irgendwann für mich herausgefunden, dass jeder Text ein Stück Biografie des Autors oder der Autorin ist. Niemand kann über den eigenen Schatten springen, selbst Wissenschaftler:innen nicht. Ich habe Stimmungsforscher:innen erlebt, deren Stimmung ich im Uni-Alltag bemerkenswert fand; ich habe Selbstregulationsforscher:innen morgens Wodka trinkend bei Kongressen beobachtet und Aggressionsforscher:innen, die ihr Kind beleidigten. Jedes Buch hat etwas mit den Autor:innen selbst zu tun, jedes Buch ist eine Biografie – es ist schwierig, wie Niklas Luhmann sagen würde, unser eigenes, geschlossenes System zu verlassen (wenn Sie es kompliziert wollen: Für mich ist ein Schreiben in der persönlichen Ich-Form ein Ernstnehmen der Kybernetik 2. Ordnung: Ich kann als Mensch nicht neutral sein, alles, was ich schreibe, fließt durch mein Hirn, das sich von allen anderen unterscheidet, und durch mein Herz. Daher ist alles, was ich sage, weit entfernt von Wahrheiten – alles, was ich sage, ist nichts als eine Meinung, auch wenn es wissenschaftlich klingt). Daher bleibe ich lieber in meinem System und erzähle frei heraus von mir, meinen Wahrnehmungen, meinen Erlebnissen und meinen Fällen.
Mit einem früheren Lektorat hatte ich verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, »verständlich zu schreiben«. Bis ich schlussendlich hörte: »Schreiben Sie über sich. So, als ob Sie mir ins Ohr sprechen würden. Reden Sie über Ihren Alltag, Ihre Wahrnehmung der Dinge, in Ich-Form. Ihre Krisen, Höhepunkte im Leben. Seien Sie persönlich. Das verstehen wir am besten.« Auf diese Weise habe ich acht Sachbücher geschrieben.
In meiner Rolle als Professor der Psychologie dagegen habe ich über 200 Artikel in einer Sprache geschrieben, die sehr wenige verstehen. Nicht weil Menschen dumm wären, sondern weil es einen wissenschaftlichen Jargon gibt, der gleichermaßen ein Ticket für den Elfenbeinturm ist. Einen Jargon, der Komplexität reflektiert, der Qualität anzeigen soll und der auch beeindrucken soll. Meiner Erfahrung nach exkludiert dieser Stil auch. Mit dem Älterwerden verliere ich die Lust, andere durch Schreiben zu beeindrucken. Ich gebe mir auch in diesem Buch die Erlaubnis, leichter zu schreiben. In meinem persönlichen Stil.
Das bedeutet übrigens nicht, dass es leichter ist, so zu schreiben. Als Sänger weiß ich: Es ist viel schwieriger, eine Operette zu singen als eine Opernarie. Ich versuche Leichtigkeit, ohne Komplexität zu verlieren – das wird mir nicht immer gelingen. Aber so macht mir das Schreiben Spaß. (Und wenn mir langweilig darüber werden sollte, dann schreibe ich eben wieder kompliziert.)
Sie werden auch bemerken, dass ich viele Zitate aus meiner eigenen wissenschaftlichen Karriere präsentiere. Ich war fast zwei Jahrzehnte lang Professor der Sozialpsychologie und habe unter anderem in Bremen, New York, Amsterdam und Trier gearbeitet. Als ich mit Black-Box-Methoden begann, habe ich nahezu jedes Forschungsthema, das ich bis dahin bearbeitet hatte, nutzen können. Wie oft dachte ich, wenn ich Kolleg:innen am IF Weinheim beobachtete: »Hey, das ist doch so wie in meiner Embodiment-Forschung!« oder »Wow – da geht es doch um meine Selbstregulationstheorie!«. Mein Therapeuten-Ich war mit meinem Forscher-Ich in Resonanz, es war kongruent. Manche werden denken: Muss der denn ständig sich selbst zitieren? Und ich kann nur antworten: Ich müsste nicht, aber ich will. Das, was ich war, passt einfach so gut zu dem, der ich bin. Ich bin gespannt darauf, was Sie sagen!
Zu guter Letzt: Ich habe mich entschieden, in diesem Buch zu gendern. Ich weiß aus meiner Arbeit in den Medien, dass mir dies Schelte einbringen wird, halte es aber aus verschiedenen Gründen für notwendig (s. Abschnitt »Sprache als Teambuilderin«, S. 95 f.). Schon vor über 30 Jahren zeigte sich in wissenschaftlichen Experimenten, dass Frauen eher gedanklich mit einbezogen werden, wenn das generische Maskulinum durch eine gegenderte Form ersetzt wird (Förster, 1993). Frauen werden demnach nicht automatisch »mitgedacht«, wenn von »Therapeuten« die Rede ist. Seitdem versuche ich, durch eine differenzierte Sprache Ungerechtigkeit und Diskriminierung entgegenzuwirken. Daher finde ich es auch bedenklich, wenn Politiker:innen wie Markus Söder oder Alice Weidel diesen sinnvollen Sprachgebrauch verbieten wollen.
Es gibt verschiedene Versionen, um zu markieren, dass alle Geschlechter gemeint sind. Ich habe mich für den Doppelpunkt »:« entschieden, weil er am ehesten barrierefrei ist, das heißt, bei einer automatisierten akustischen Übersetzung verständlich gesprochen wird3. Wenn ich das Gefühl hatte, dass der Lesefluss stark eingeschränkt war, habe ich, vor allem wenn ich Beispiele schildere, »gelost«. Das bedeutet, ich spreche in manchen Abschnitten von einer Klientin, in anderen von einem Klienten und manchmal von einer Therapeutin bzw. einem Therapeuten. Dadurch sollte der Anteil von männlichen und weiblichen Beispielen ausgeglichen sein.
Für bessere Ideen zur Lösung von Diskriminierung auf der sprachlichen Ebene bin ich sehr dankbar, da Gerechtigkeit ein hoher Wert für mich ist (Förster, 2020b).
Black Box-Methoden: Menschen beim Denken zuschauen
Mit Hilfe von Black-Box-Methoden kann ein Coach oder eine Therapeutin Prozesse begleiten, ohne viele Informationen über das Problem oder die Themen der Klient:innen zu haben. Manche nennen sie auch »verdeckte« Methoden, manche »formale« im Gegensatz zu »inhaltlichen« Methoden und manche »analoge« Methoden.
Wir gehen als systemisch Arbeitende ja sowieso davon aus, dass wir andere Menschen nur annähernd verstehen können (Luhmann, 1984; Nöcker u. Molter, 2012). Wenn meine Klientin von »Sehnsucht« spricht, dann habe ich eine vage Vorstellung davon, was sie meinen könnte. Aber wie sich dieser Zustand für sie anfühlt, welche Bilder und Assoziationen er bei ihr weckt oder mit welchen Erfahrungen (vermutlich Hunderte!) sie Sehnsucht verbindet, das werde ich auch nach jahrelanger therapeutischer Arbeit mit ihr nicht begreifen können.
Eine radikale Lösung wäre, auf Sprache als recht vages, unsicheres Element der Therapie zu verzichten oder, in einer weniger radikalen Weise, mich nicht allein auf Sprache zu verlassen, sondern andere Wege der Kommunikation und des Sich-Einfühlens zu finden. An die Stelle von Gesprächen, die in vielen therapeutischen Sitzungen die Hauptsache sind, treten beim Einbezug von Black-Box-Methoden angeleitete Imaginationen, Verbildlichungen, Körperübungen und Aufstellungen, um nur einiges zu nennen.
Black-Box-Methoden sind für verschiedene Beratungssettings wie Coachings, Supervisionen und psychologische Therapien nutzbar. In diesem Buch rede ich meistens von Therapie, wechsele aber auch zwischen diesen Beratungsformen, wann immer es sich anbietet. Tatsächlich sind Black-Box-Methoden fast universell einsetzbar. Ich kenne wenige Situationen in der Beratung, in denen sie fehl am Platz wären – allein wenn der Klient oder die Klientin diese Art des Vorgehens nicht möchten, wende ich sie – natürlich – nicht an. Black-Box-Methoden ermöglichen ein würdevolles, am Menschen orientiertes Vorgehen, das ihre oder seine kreativen Ressourcen und die eigene Selbstorganisation anregt. Sie begrenzen übergriffiges vorurteilsbehaftetes Therapieren sowie Beeinflussungs- und Manipulationsversuche und entsprechen einer systemischeren4 Haltung des Nichtverstehens.
Grenzen der Kommunikation
»Ja, das habe ich verstanden!« – wie oft sagen wir das im Alltag? Und wundern uns wiederum nicht, wenn wir wieder einmal jemanden nicht verstanden haben oder selbst nicht verstanden wurden.
Da habe ich einer Klientin eine Hypothese präsentiert, lehrbuchmäßig, indem ich einen Ich-Bezug hergestellt habe, im Konjunktiv geredet und sie noch extra darauf aufmerksam gemacht habe, dass dies nur ein subjektvier Eindruck ist: »Ich habe beobachtet, und das bin ja nur ich, dass Sie häufig, wenn Sie von ihrem Vater sprechen, Sätze nicht beenden. Sie selbst sprachen einmal von Verwirrung. Ich habe eine Hypothese, es ist nur eine Hypothese, aber vielleicht bringt sie Sie ja weiter. Möglicherweise ist Ihre Verwirrung ein Mittel, um ein größeres Problem nicht ansprechen zu müssen? Wer profitiert möglicherweise noch von Ihrer Verwirrung?« Und dann kommt sie in die nächste Sitzung und sagt: »Ich habe jetzt genau das gemacht, was Sie mir gesagt haben: Mein Vater bringt mich durcheinander. Ich habe ihm Ihre Einschätzung mitgeteilt und er war total sauer und hat mich aus der Wohnung geschmissen.«
Wir können immer wieder versuchen, zu kommunizieren, wir können und sollten uns Mühe geben, eine therapeutische Sprache zu entwickeln, die möglichst klar und verständlich ist – aber letztendlich hören Menschen das, was sie hören wollen oder können. Wir können Kommunikation nicht kontrollieren.
Kommunikation ist unmöglich, Therapie ist nützlich
Die Logik der Black-Box-Methoden folgt der konstruktivistischen Grundthese (von Foerster, 1981; Watzlawick, 1976), dass das, was wir als unsere Wirklichkeit erleben, nicht etwa ein passives Abbild der Realität, sondern das Ergebnis einer aktiven Erkenntnisleistung ist. Über die Übereinstimmung zwischen subjektiver Wirklichkeit und objektiver Realität kann keine gesicherte Aussage getroffen werden.
Subjektives Verstehen bedeutet auch, dass jeder Mensch eine Information anders versteht. Spricht meine Klientin Frau Schmidtke etwa von »der Erfüllung einer tiefen Sehnsucht«, übersetze ich dies vielleicht als »wehmütiges Zweifeln am Leben«, während sie damit »Ort in der Zukunft, wo ich gern leben will« meint. Oftmals reden wir aneinander vorbei, haben aber den Eindruck, einander zu verstehen. Dieses Phänomen der »Kontingenz« hat Niklas Luhmann in seiner Systemtheorie beschrieben (Luhmann, 1984; 2017). Kontingenz bedeutet für ihn, salopp gesagt, dass sich Menschen nicht gegenseitig in die Köpfe schauen können und damit letztendlich nicht wissen, welche Bedeutung sie gleichklingenden Situationen, Gedanken oder Gefühlen geben. Reden wir über Bäume, stellt sich mein Gegenüber vielleicht eine Tanne vor und ich eine Birke. Menschen sind nach Luhmann »geschlossene Systeme«. Ich kann nicht in das Gehirn meiner Klientin schauen (Luhmann, 1984).
Landkarten sind nicht das Land
Ich kann mich zudem nicht von meinem Wahrnehmungssystem lösen. Ich höre das, was ich hören will, ich höre alles so, wie mein Wahrnehmungsapparat es verstehen kann. Mein Verstehen ist aktiv, wie die moderne Sozialpsychologie zeigt, es basiert auf dem, was ich gelernt habe: Die Information, die hereinkommt, wird von mir verändert (Bartlett u. Burt, 1933; Förster, 2018). Spricht ein Klient davon, dass er sich heute Abend »etwas Gutes« tun will, denke ich vielleicht an ein leichtes gutes Essen, ein gutes Buch und frühes Zubettgehen, weil das dem entspricht, was ich tue, wenn ich mir einen schönen Abend mache. Er versteht darunter aber vielleicht eine Flasche Rotwein und Chips. »Aktives Verstehen« bedeutet für mich, dass ich beim Zuhören immer Eigenes mit in das Gehörte einfließen lasse. Habe ich meine Mutter über Jahre beobachtet, wie sie sehnsüchtig ein besseres Leben verfolgte, dann kommen diese Assoziationen hoch, wenn meine Klientin von Sehnsucht spricht. Information kommt nicht objektiv bei mir an, ich kann sie nur vor dem Hintergrund meines eigenen biografischen Gedächtnisses verstehen.
Der Sozialpsychologe Tory Higgins nennt das »chronisches Priming«, das heißt, mein biografisches Langzeitgedächtnis »bahnt« die Wahrnehmung (Higgins, 1996; Higgins u. King, 1981; Förster u. Liberman, 2007). Wir hören Gesagtes durch einen individuellen Filter. Wissenschaftler wie Daniel Kahnemann (Kahneman, Slovic u. Tversky, 1982), die sich mit der Frage »Was ist richtiges Urteilen?« beschäftigt haben, nennen solche Prozesse »Urteilsfehler«, »Biases« oder sprechen von »verzerrter Wahrnehmung«. Als systemisch Denkende und Arbeitende sind wir eingeladen, jenseits der Dimension »richtig–falsch« solche Phänomene zu beobachten, sie hinzunehmen oder nach ihrer Funktion zu suchen.
Schublade auf, Schublade zu
Die Sozialpsychologie zeigt, dass unsere Wahrnehmungsfilter wie Schubladen zu vorurteilsbasierten Bewertungen führen können, dies geschieht auch in der Therapie und Beratung (Förster u. Nußbaum, 2022). Wir haben zahlreiche Vorstellungen über andere Menschen, Rollen und Situationen im Gedächtnis abgespeichert. Kommt eine 50-jährige Managerin zu uns ins Erstgespräch und erzählt von »hoher Leistungsmotivation«, erhält dies vielleicht eine negative Konnotation, weil viele von uns die Gruppe der »Manager:innen mit 50« mit Midlife Crisis, Burnout und Stress assoziieren. Unser Gedächtnis ist in Schubladen aufgebaut und wenn in meiner Schublade »Managerin« »Geld«, »Stress« und »Midlife Crisis« stecken, dann führt die Aktivierung dieser Konzepte zu einem bestimmten Verständnis von »Leistungsmotivation«. Dieses Konzept hätte vermutlich eine andere Bedeutung, wenn eine Mutter bezogen auf ihren drogenabhängigen 16-Jährigen von mangelnder »Leistungsmotivation« berichtete (Förster, 2020a; 2020b). In diesem Fall habe ich eine ganz andere Schublade geöffnet, in der auch andere Assoziationen liegen.
Das alles kann für die Therapie förderlich sein, da die Schubladen nicht nach einem Zufallsprinzip gebaut sind, sondern meist eine gewisse Plausibilität haben (statistisch gesehen steigt die Zahl der Manager:innen mit Problemen in diesem Alter; Lubbadeh, 2020). Es kann aber auch im individuellen Fall hinderlich sein. Wenn wir beispielsweise unterstellen, dass ein Leistungsmotiv für jede Managerin um die 50 schlecht ist, verschwenden wir viel Zeit, wenn das bei der Klientin, nennen wir sie Frau Schmitdke, nicht der Fall ist. Wenn wir zu sehr auf unsere Vorannahmen und Vorurteile vertrauen, kommen wir mitunter zu Hypothesen, die für Frau Schmitdke in unserer Praxis unplausibel sind: »Ach, Frau Schmitdke, Sie haben eine hohe Leistungsmotivation? Sie stehen ja ganz schön unter Druck!« Nehmen wir an, Frau Schmidtke wollte mir mit einer Geschichte über ihre Leistungsmotivation schlichtweg andeuten, wie erfolgreich sie sein kann, wenn sie ihre Ressource Leistungsmotivation nutzt, dann hätte ich eine recht unpassende Bemerkung gemacht. Darauffolgend könnten mir wenig anschlussfähige Methoden einfallen (zum Beispiel Entspannungsübungen). Zudem könnten meine Fragen, die durch meine Konstruktion eines bestimmten Begriffs beeinflusst sind, auch als irritierend empfunden werden. Ich könnte der Klientin sogar den Eindruck vermitteln, sie würde nicht »gehört«.
Und es könnte sogar sein, dass ich eine Klientin in eine Richtung lenke, die für sie wenig hilfreich ist. In eine Richtung, in die sie gar nicht will. Im obigen Beispiel der Sehnsucht könnte ich die Klientin durch mein Reden etwa in eine melancholische Stimmung versetzen, wohingegen sie selbst gerade gern über schöne Perspektiven reden möchte. Und bei Frau Schmidtke könnte ich versucht sein, ihr ihre Ressource madig zu machen: »Tun Sie mal was für sich selbst und gehen eine halbe Stunde am Rhein spazieren.« Zugegeben, so explizit würde vermutlich kein systemischer Berater arbeiten, aber es gibt ja auch eine unbewusste Neigung, Menschen in eine bestimmte Weise zu beeinflussen. Unbewusste Stereotypsierungen, so zeigt die Forschung, geschehen hunderte Male am Tag – auch wir als Therapeut:innen und Coaches sind nicht vor ihnen gefeit (Förster, 2007; Förster u. Nußbaum, 2022). Nachfragen und Informationen sammeln sind eine Möglichkeit, dieses allgemeine Kommunikationsproblem anzugehen, wobei es sich dabei jedoch immer nur um Annäherungen handelt. Vollständiges Verständnis ist prinzipiell unmöglich.
Und dennoch funktioniert die systemische Therapie so gut, dass sie – trotz enormer Gegenwehr – im Jahre 2019 als Richtlinienverfahren anerkannt wurde. Sie wird seit Juli 2020 als ambulante Leistung für Erwachsene von gesetzlichen Krankenkassen bezahlt – trotz aller Zweifel an menschlichen Wahrnehmungen und der Anerkennung von Grenzen der Einflussmöglichkeiten auf die menschliche Psyche.
Chancen von Black-Box-Verfahren
Es gibt sicherlich viele Gründe für die Wirksamkeit der systemischen Therapie, Beratung und Supervision. Auch ich beobachte mannigfaltige Faktoren. Dies ist nicht der Ort, sie alle zu benennen. Jedoch glaube ich, dass der Einsatz von Körper, Raum und Metaphern in systemischen Beratungssettings einen großen Beitrag am Erfolg hat.
Neben diesen methodischen Besonderheiten ist es für mich die systemische Haltung (Erpenbeck, 2017). Ich verstehe sie so, dass wir in jedem Menschen ein kreatives und kluges System entdecken können, das seine Probleme selbst lösen kann. Aus dieser Einstellung heraus versuchen wir nicht, Menschen zu beeinflussen, sondern erarbeiten mit ihnen Optionen, für oder gegen die sie sich entscheiden können. Wir akzeptieren ein Nein zu Interventionen, Fragen und Methoden und ermöglichen eine Freiheit zu denken, zu fühlen und zu handeln. Menschen sind freiheitsliebende Wesen und sie dürfen bei uns experimentieren, ungewöhnliche Dinge denken, sich in neue und alte Situationen hineinfühlen. Sie sind keine Patient:innen (kommt von lateinisch »erdulden«), denen wir etwas verschreiben oder die uns zuhören und uns folgen müssen. Sie sind stattdessen Klient:innen mit allen Rechten und Anliegen und wir sind Dienstleistende, die versuchen, sie zu ihren Zielen zu führen (de Shazer, 1989/2022).
Zu dieser Haltung passen Black-Box-Methoden in besonderem Maße, sie sind tatsächlich ihre Verkörperung – wenn ich wenig vom Problem weiß, kann ich auch nicht besserwisserisch im Leben der Menschen herumpfuschen. Wenn ich nicht über das Problem spreche, kann ich es auch nicht missverstehen. Black-Box-Methoden erleichtern uns Therapeut:innen zudem, unserer Haltung treu zu bleiben und sie durchzuhalten, denn es kommt ja schon einmal vor, dass wir das Gefühl haben, es besser zu wissen, oder geneigt sind, unseren Klient:innen Tipps und Tricks mitzugeben.
Rechte statt Zuschreibungen
Wir sollten nicht vergessen, dass die systemische Haltung ein revolutionäres Verständnis von Therapie beinhaltet: Wenn ich andere nicht verstehe, kann ich sie auch nicht kontrollieren (Einführungen bei von Schlippe u. Schweitzer, 2016; 2019). Damit klingen Begriffe wie »Intervention« und »Methode« oder »Manual« schief, insofern ich damit verbinde, dass irgendetwas einen gesicherten Effekt auf eine bestimmte Klientin oder einen Klienten haben könnte, damit es ihnen besser geht. Es geht bei Therapie um das Gegenteil von Kontrolle. Es geht um Selbstermächtigung – der Klient:innen!
Ja, es geht um unsere Haltung. Ja, es geht um Methoden. Aber nicht vorrangig. In allererster Linie geht es um die Klient:innen, die von uns Hilfe erwarten. Und wenn sie uns ihre Anliegen präsentieren, ist es unsere Aufgabe, sie zu stützen, ihnen Impulse zu geben. Doch der Zweck heiligt keinesfalls die Mittel. Klient:innen haben Rechte. Diese Hilfesuchenden Menschen stehen nicht unter uns. Sie geben Zeit und Energie, sie zahlen Geld in die Krankenkasse ein oder zahlen privat. Wir sind in jedem Fall Dienstleistende. Sie haben das Recht, angemessen begleitet zu werden.
Das Recht, die Kontrolle über den Prozess zu haben
Es gilt, dass ich mit den Klient:innen herausarbeite, was bei ihnen individuell schon gewirkt hat oder wirkt. Sie selbst haben die Kontrolle über ihre Denkprozesse und ihre Entscheidungen. Klient:innen können schon alles, was sie brauchen, um aus einer misslichen Lage herauszukommen. Sie haben bisher überlebt. Sie kommen zu uns – ein Akt der Selbstbestimmung und nicht etwa der Hilflosigkeit. Wir müssen sie lediglich daran erinnern, was sie können, und können sie dabei unterstützen, Ideen zu entwickeln.
Ein Beispiel: Einer Klientin hatte in einer Therapie eine Weiterbildung zum Erwerb eines Pferdekutschführerscheins aus dem Burnout geholfen. Tatsächlich gibt es kein Manual, in dem ich hätte lesen können, dass Pferdekutschenführerscheine ein wirksames Mittel gegen sogenannte »Burnouts« wären. Ich habe, bevor sie bei mir die Idee zu ihrer »Intervention« entwickelte, gar nicht gewusst, dass es Pferdekutschenführerscheine überhaupt gibt. Ich habe ihr das also auch gar nicht vorgeschlagen, sondern sie ist selbst darauf gekommen, dass ihr das helfen könnte.
Ich hatte auch nicht verstanden, warum sie ihren Zustand »Burnout« nannte und ob das so ähnlich war wie damals mein Zustand, den Ärzte als »Erschöpfungszustand« bezeichnet hatten. Obwohl ich weder ihr Problem noch ihre individuelle Lösung richtig verstanden habe, hat sich ihre Lage in meiner Praxis, so ihre eigenen Worte, stark verbessert. Seitdem empfiehlt sie mich.
Die vier weiteren Fallbeispiele, die ich geben werde, sollen zeigen, wie es möglich ist, Klient:innen an das zu erinnern, was bei ihnen »wirkt«. Ich habe in diesen Prozessen kaum Informationen zu ihren jeweiligen Problemen gesammelt – oftmals war mir das Problem total unbekannt. Im systemtheoretischen Verständnis (das habe ich oben bereits beschrieben, S. 24) ist es sowieso nahezu unmöglich, die Probleme anderer zu verstehen. Damit können wir auch keine spezifischen Lösungen anbieten. Eine prozess- und klient:innenorientierte Therapie hingegen kann Rahmenbedingungen schaffen, in denen Klient:innen Ideen und Lösungsimpulse entwickeln. In diesem Rahmen denken und entscheiden sie selbst.
Eine Teilnehmerin meines Black-Box-Seminars drückte es so aus: »Ich sehe mich nach diesem Seminar als Umzugsdienst, der Leuten dabei hilft umzuziehen. Dazu muss ich ihnen nicht in die Kisten schauen. Tatsächlich ist das gar nicht mein Job. Es würde mich sogar vom Job abhalten.«5 Führen wir den Vergleich für unsere Praxis konsequent weiter, so wäre es sogar höchst unprofessionell, sich von Inhalten verführen zu lassen.
Das Recht, alles denken zu dürfen
Black-Box-Methoden stellen Rahmungen zur Verfügung, die – statt Interviews – eine hilfreiche »innere Kommunikation« bei Klient:innen fördern sollen. Mit der Idee: Je bewusster eigene innere kommunikative Abläufe werden, umso mannigfaltiger die Entscheidungsmöglichkeiten. Durch eine innere Kommunikation werden Impulse für neue Ideen und Veränderungsmöglichkeiten aktiviert – wird Raum geschaffen für Eigenes.
Eine Klientin sagte es so: »In dem Moment, wo ich nichts erzählen musste, kamen mir ganz neue Gedanken. Ich fand es auch gut, dass ich nicht alles erklären musste. Manchmal schweifte ich ab. Manchmal dachte ich was total Verrücktes. Manchmal hatte ich Gedanken, die man nicht sagen darf. Ich durfte hier einmal alles denken. Das hat zur Lösung geführt.«
Black-Box-Methoden können Klient:innen dabei helfen zu sehen, »was sich zeigt« im Jetzt oder »was sein könnte« in der Zukunft. Der Prozess selbst bleibt uns Therapeut:innen dabei im Verborgenen (Kiel, 2020). Dabei dürfen Klient:innen alles fühlen, denken, ausprobieren – und wir können sie zum freien Denken ermuntern. Was sie dann umsetzen, ist der nächste Schritt. Wenn sie wollen, können wir sie auch darin unterstützen.
Das Recht auf Widerstände
Mit Hilfe von Black-Box-Methoden können wir Menschen therapieren, beraten, coachen oder supervidieren, ohne viel um das vermeintliche Problem zu wissen. Die Klient:innen entscheiden, was sie veröffentlichen möchten und was nicht und wie sie es veröffentlichen möchten. So kann es passieren, dass wir manchmal lediglich den Namen, manchmal nur die Anfangsbuchstaben der zum Problem gehörigen Personen und ein paar Eckdaten wissen. Dies kann ein Vorteil sein, weil es Zuschreibungen, eine enge Fokussierung auf Lieblingshypothesen und Vorurteile in Grenzen hält. Klient:innen haben das Recht, uns nicht zu folgen, nein zu sagen, Fragen unbeantwortet zu lassen. Um es auf die Spitze zu treiben: Unsere Klient:innen haben alles Recht der Welt, zu verdrängen. Was sich nicht zeigt oder zeigen will, geht mich als Therapeut:in überhaupt nichts an und ich kitzele es auch nicht aus ihnen heraus. Wenn ich beim Einsatz von Black-Box-Methoden sowieso nichts über das Problem wissen will, dann erübrigt sich auch die Frage an die Klient:innen, was sie sagen wollen und was nicht.
Ich habe es häufig erlebt, dass Auszubildende gern »bohren« wollten. Sie meinen damit meist, dass sie genau Bescheid wüssten, was der Grund für das eigentliche Problem sei. Und dass sie es »aufdecken« sollten, das heißt in meinen Worten: ihre Hypothese bestätigt haben wollten. Ich finde das höchst anmaßend: Was soll das denn sein, dass du als Therapeut über die Klientin weißt, was die Klientin nicht über sich weiß? Was sollte dich denn zu diesem Wissen ermächtigen? Deine Erfahrung mit gerade mal zweitausend Klient:innen? Hier laufen ein paar Millionen Menschen herum, die anders ticken könnten. Deine Erfahrung mit deinem Familiensystem, was eventuell nicht repräsentativ ist? Deine Intuition, die sicherlich auch schon zu Fehlern geführt hat? Ich bitte um Entschuldigung, falls ich deinen Selbstwerttopf geleert habe.
Ich würde dich aber auch nicht bremsen wollen, wenn du mich jetzt abwertest. Also in den sogenannten Widerstand gehst6. Das ist dein Recht. Soll ich dir ernsthaft nahelegen, dich meinen Ideen anzupassen? Dasselbe Recht zum Widerstand gilt auch für unsere Klient:innen.
Das Recht, mich nicht verändern zu müssen
Wenn ein Klient zu mir kommt, gehe ich erst einmal davon aus, dass er etwas verändern will – sonst wäre er ja nicht gekommen. Wir arbeiten also daran, zu ergründen, was er verändern möchte und wie das aussehen könnte. Letztendlich ist es aber an ihm zu entscheiden, ob er sich tatsächlich verändern möchte. Es steht mir nicht zu, ihn dazu zu motivieren. Es gilt, Veränderungen als selbstverantwortliche »Eigenleistungen« zu begreifen (Willke, 2004).
Das beinhaltet auch »Störungen«. Wenn sich eine Klientin dafür entscheidet, weiterhin 16 Stunden am Tag zu arbeiten und damit vermutlich in die nächste sogenannte »depressive Phase rutscht«, dann ist das ihre Angelegenheit. Ein systemischeres Verständnis würde mir nahelegen, dass ich letztendlich nicht weiß, was die Konsequenzen eines Aufgebens der »Störung« für sie bedeuteten. Käme etwas Schlimmeres hoch? Bekäme jemand anderes in ihrem System eine »Störung«? Würde sie die Beachtung, die Aufmerksamkeit ihres Systems verlieren? Was wäre sie ohne ihre »Störung«?
Beim Ausführen von Black-Box-Methoden werden Klient:innen häufig noch nicht einmal eingeladen zu berichten, was oder ob sie etwas verändern wollen. So kann ich sie als Therapeut auch nicht in eine eventuell problematische Veränderung führen. Welche Therapeutin würde denn die Verantwortung dafür übernehmen, wenn ein bettnässendes Kind sein störendes Verhalten aufgibt – und damit seine Eltern wieder die Kapazitäten haben, über eine Scheidung nachzudenken?
Das Recht, nicht über-redet oder manipuliert zu werden
Insgesamt wird auch eine unbewusste oder bewusste Beeinflussung der Klient:innen verhindert, was dem Anspruch vieler systemischen Berater:innen entgegenkommt. Wenn man der These folgt, dass mit dem Reden über Probleme die Wahrscheinlichkeit von bewussten oder auch unbewussten Tendenzen zu beeinflussen und zu manipulieren, steigt, dann könnte man das Argument auf die Spitze treiben und sagen: Je weniger Details wir von unseren Klient:innen wissen und je weniger wir darüber reden, umso besser. Bei Black-Box-Methoden wird die Bedeutung des gesprochenen Wortes minimiert und körperinterne Prozesse treten in den Vordergrund.