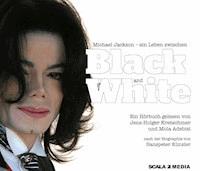Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Schwarz oder weiß: Das tragische Leben von Michael Jackson 40 Jahre lang begeisterte der King of Pop die Fans mit einer Karriere der Superlative – das legendäre Album Thriller von 1982, mit dem er den weltweiten Durchbruch als Solokünstler feierte, ist mit 67 Millionen verkauften Tonträgern bis heute das weltweit erfolgreichste Pop- Album aller Zeiten. Auf der Bühne war Jackson ein Gigant, privat reihten sich zahllose Katastrophen aneinander. Drogensucht, Finanzprobleme, Operationen, die Skandale um seine Ehe mit Lisa Marie Presley und die Leihmutterschaft von Debbie Rowe, vor allem aber die Vorwürfe wegen Kindesmissbrauch befleckten seinen Ruf. Und dennoch: Als er im Juni 2009 mit nur 51 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol starb, trauerte eine riesige Fangemeinde um ihn. 16 Jahre nach seinem Tod ist Michael Jackson noch immer unvergessen. Seine dramatische Lebensgeschichte liefert den Stoff für das gefeierte Musical MJ, das aktuell in Hamburg gezeigt wird und gerade bis Oktober 2026 verlängert wurde. Und im Oktober 2025 soll nun auch endlich das Biopic Michael in die Kinos kommen, bei dem Jacksons Neffe Jaafar in die Rolle des King of Pop schlüpft. Grund genug für eine Neuauflage von Hanspeter Künzlers packender Biografie Black Or White, die 2009 bis auf Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste gelangte und die der Autor nun auf den neusten Stand gebracht hat. In zwei Erzählsträngen schildert Künzler einerseits die sagenhaften Erfolge des Weltstars, andererseits aber auch die schier endlose Kette von Skandalen, in die Jackson verwickelt war, bis hin zu seinem tragischen frühen Tod. Black Or White, Licht oder Schatten – Michael Jacksons Karriere hatte von beidem reichlich zu bieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanspeter Künzler
Black or White
Michael Jackson – Die ganze Geschichte
Hans Peter Künzler
BLACKORWHITE
Michael Jackson – Die ganze Geschichte
www.hannibal-verlag.de
Impressum
Der Autor:
Der Schweizer Journalist Hanspeter Künzler lebt und arbeitet seit vielen Jahren in London, wo er gleich am ersten Tag Wreckless Eric live im Marquee erlebte. Zwei Wochen lang spielte er mit seinem Akkordeon in der Pub-Rock-Band The Idlers mit, dann konzentrierte er sich auf das Schreiben. Seither hat er mehr als zweitausend Interviews geführt mit Popstars von Elton John über Noel und Liam Gallagher bis hin zu Jay-Z, Tina Turner und diversen Mitgliedern der Familie Jackson. Seine Beiträge über Musik, Kunst und das Leben in Grossbritannien sind in so diversen Publikationen wie Neue Zürcher Zeitung, Musik Express, Clarino, Du, WoZ, dem deutschen Wiener und Watch International erschienen. Er ist regelmäßig im Schweizer Radio SRF zu hören und präsentierte jahrelang eine Musiksendung für den BBC German World Service. Sein besonderes Interesse gilt der Verflechtung von sozialen Umständen und künstlerischem Ausdruck. So beschäftigt Hanspeter Künzler sich seit vier Dekaden mit der Entwicklung der schwarzen Musik Amerikas. Im Herbst 2025 erscheint von ihm im Geparden Verlag, Zürich, eine Sammlung von Erzählungen, Das Wetter zwischen Jukebox und Theke.
Internet: www.hanspeterkuenzler.com
Deutsche Erstausgabe 2009
Komplett überarbeitete, aktualisierte und wesentlich erweiterte Neuauflage 2025
© 2025 by Hannibal
Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International
GmbH, Gewerbegebiet 2, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
ISBN 978-3-85445-809-8
Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-808-1
Coverdesign: bw works, Wien
Coverfoto: mptv/picturedesk.com
Grafischer Satz: Thomas Auer
Lektorat/Korrektorat: Dr. Matthias Auer
Hinweis für den Leser:
Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.
Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist verboten.
Inhalt
Vorwort
Vorspiel Die positiven Seiten
Die ersten fünf Jahre Die positiven Seiten
Die ersten fünf Jahre Die negativen Seiten
1963 bis 1968 Die positiven Seiten
1963 bis 1968 Die negativen Seiten
Motown Die positiven Seiten
Motown Die negativen Seiten
I Want You Back Die positiven Seiten
I Want You Back Die negativen Seiten
Jackson 5-Mania Die positiven Seiten
Jackson 5-Mania Die negativen Seiten
Die Befreiung Die positiven Seiten
Die Befreiung Die negativen Seiten
The Wiz und Destiny Die positiven Seiten
The Wiz und Destiny Die negativen Seiten
Off The Wall Die positiven Seiten
Off The Wall Die negativen Seiten
Thriller Die positiven Seiten
Thriller Die negativen Seiten
Bad Die positiven Seiten
Bad Die negativen Seiten
Dangerous I Die positiven Seiten
Dangerous I Die negativen Seiten
Dangerous II Die positiven Seiten
Dangerous II Die negativen Seiten
Jordy Die negativen Seiten
Dangerous-Welttournee Die positiven Seiten
Lisa Marie Presley Die positiven Seiten
HIStory Die negativen Seiten
ATV-Musikverlag Die positiven Seiten
Lisa Marie Presley Die negativen Seiten
Nachwuchs I Die positiven Seiten
Blood On The Dance Floor Die negativen Seiten
Invincible Die positiven Seiten
Cash-Krise Die negativen Seiten
Nachwuchs II Die positiven Seiten
Bashir Die negativen Seiten
Number Ones Die positiven Seiten
Der Prozess Die negativen Seiten
Die fahlen Jahre danach Die negativen Seiten
This is it! Die positiven Seiten
This is it! Die negativen Seiten
Trauerfeier und Beerdigung Die negativen Seiten
Gericht, Gerangel und „Renaissance“ Die negativen Seiten
Das Geschäft boomt und dann … Die positiven Seiten
Diskografie
Bibliografie
Dank
Das könnte Sie interessieren
Vorwort
25. Juni 2009 auf einer Bank vor der Xenix Bar in Zürich. Ein lauer Abend, man denkt sich nichts Böses. Etwa eine halbe Stunde ist verstrichen seit Mitternacht, da gesellt sich ein junger Mann zu uns, der Pete Doherty aufs Haar gleicht. Mir fällt auf, dass auf seinem weißen T-Shirt mit Kugelschreiber ein paar hingekritzelte Worte stehen. Ich beuge mich vor und lese: „Michael Jackson, der King of Pop, ist tot“. Erste Reaktion: schlechter Scherz! Der junge Mann beteuert, es sei keiner. Rundum zücken nun alle ihre Blackberrys, und – oh Schreck – die Meldung wird von den seriösen News Sites bestätigt. Wir sind auf der Stelle nüchtern. Es ist ein Schreckmoment, an den man sich bis ans eigene Ende erinnern wird …
Mit dem Tod Michael Jacksons ging eine Epoche zu Ende. Das umjubelte Wunderkind der späten 60er Jahre wandelte sich in den 80er Jahren zur Ikone. Wie kein anderer Künstler verkörperte er den hedonistischen und ehrgeizigen Zeitgeist der 80er Jahre, der durch das heimtückische Auftreten von AIDS gleichzeitig eine große Angst zu verarbeiten hatte (bezeichnenderweise war das auffälligste Symptom seiner Genusssucht die manische Anschaffung von Luxusgütern). Gerade dadurch, dass er sich völlig den Werten der 80er Jahre verschrieb, verdammte sich Michael Jackson selbst zum Scheitern. Er zerbrach am selbstauferlegten Druck, den Fans eine immer noch spektakulärere Show zu bieten und mit dem nächsten Album noch mehr Menschen anzusprechen als mit dem letzten. Am 25. Juni 2009 um 14 Uhr 26 Ortszeit Los Angeles hielt sein überstrapaziertes Herz diesem Druck nicht mehr stand. Sein Leibarzt bemühte sich vergeblich, ihn zu retten. Michael Jackson befand sich zu der Zeit mitten in den letzten Vorbereitungen für die gewaltige Comeback-Show, die er vom 14. Juli an 50 Mal in der Londoner O2 Arena aufführen wollte. Es wären abgesehen von gelegentlichen Auftritten bei Benefizkonzerten seine ersten abendfüllenden Auftritte gewesen seit der HIStory-Tour von 1996/97.
Aus dieser Warte erhält sein kurzer Auftritt am 5. März in London, bei dem ich dabei war, eine ganz andere Bedeutung. Man weiß jetzt, dass es sein letztes Auftreten vor Publikum war. Er wirkte damals fast schon sportlich, so geschmeidig hüpfte er auf die Bühne. Seine Stimme war eine Spur tiefer, als man sie vielleicht in Erinnerung hatte. Aber im Nachhinein haftete den so frohen Worten, mit denen er vorerst zehn Comeback-Konzerte ankündigte, ein unheilvoller, prophetischer Unterton an …
Seither hat sich viel verändert auf der Welt. Wie würde sich der inzwischen 67 Jahre alte Michael darin zurechtfinden? Dürfen wir spekulieren? Sicherlich hätte er mit den technologischen Entwicklungen, die seither durchs Land gezogen sind, Schritt gehalten. Seine Filme wären inzwischen so spektakulär, dass wir uns unbedingt ins Kino begeben müssten, um sie in voller Glorie genießen zu können. Beflügelt durch den überwältigenden Erfolg seiner O2-Shows hätte er endlich seine Angst vor dem Scheitern besiegt und womöglich zwei, drei junge Produzenten entdeckt, die ihm Quincy-gleich geholfen hätten, seine Muse in neue Bahnen zu lenken. Vielleicht wäre er wie Leonard Cohen in die mönchische Meditationsstille des Mount Baldy Zen Center in den San Gabriel Mountains nördlich von L.A. abgewandert. Vielleicht wäre er nach ein paar Jahren als abgeklärter Philosoph zurückgekehrt, um sein Neverland in ein Paradies für Erwachsene umzubauen. Sicher ist nur eines: In seiner Musik ist uns Michael Jackson als klanggewordener, ewig frischer Peter Pan erhalten geblieben. Vieles, was sich in den 80er, 90er und 00er Jahren entwickelt hat, wirkt heute altbacken bis ungenießbar. Jedes Sample und jedes Keyboard-Setting steht für eine verwelkte Technologie, die höchstens noch als nostalgisches Mahnmal taugt. Auch Michael Jackson hat immer den neuesten technologischen Schrei eingesetzt. Aber in seiner Einzigartigkeit stand er allein da. Niemand und nichts konnten ihn kopieren. Darum ist seine Musik genauso zeitlos wie die Friedensbotschaft, die zu vermitteln er nie müde wurde.
Vorspiel Die positiven Seiten
Die Einladung klingt reizvoll. „KING OF POP MICHAEL JACKSON TO MAKE A SPECIAL ANNOUNCEMENT IN LONDON AT THE O2“ heißt es in der E-Mail mit lauter Großbuchstaben.Wann: Donnerstag, 5. März 2009. Wo: The O2, Grand Concourse, Peninsula Square, London SE10 ODX. Die Fotografen hätten sich um 13 Uhr einzufinden, die restlichen Medien um 14 Uhr, mit dem „Announcement“ gehe es pünktlich um 16 Uhr los. Und siehe da, zu Hunderten erscheinen die Vertreter der Weltmedien. Zuerst stehen sie in der beißenden Kälte Schlange bei der Dame mit der Namensliste. Danach stehen sie Schlange vor der Dame, die ihnen einen Plastikstreifen ums Handgelenk heftet, der je nach Farbe Zugang zu den verschiedenen Lounges, „Kommunikationszentren“ und Radio- und TV-Absperrungen gewährt. Zuletzt stehen sie Schlange vor der Röntgenanlage für die Taschen, gefolgt vom persönlichen Security Check. Ein Heer von bis an die Zähne mit Clipboards und Handys bewaffneten PR-Damen sorgt dafür, dass sich in den labyrinthartigen Gängen der Halle niemand verirren kann, selbst wenn er dies im Dienste seiner professionellen Schnüffelnase gern tun möchte. Keine der PR-Damen scheint allerdings so richtig zu wissen, was als Nächstes passieren soll. Wird der King of Pop eine Ansprache halten? Wird er gar Fragen beantworten? Was wird er überhaupt noch zu erzählen haben? Die großen News waren ja schon am Morgen in der Boulevardpresse nachzulesen. Nämlich: Michael Jackson will endlich wieder Konzerte geben. Angefangen am 8. Juli sollen es zehn Auftritte werden, hier in der O2-Halle. Das ist eine verblüffende und sensationelle Nachricht. Denn abgesehen von einer Handvoll Charity-Shows um die Jahrtausendwende herum sowie einem desaströsen Mini-Auftritt im November 2006 bei den World Music Awards in London hat man den Superstar seit der HIStory-Tour von 1996/97 nie mehr live erlebt. Und hatte es nicht erst vor ein paar Monaten noch geheißen, sein Gesundheitszustand sei so fragil, dass er sich kaum noch aus dem Haus traue? Punkt 16 Uhr holen uns die PR-Damen in der Lounge ab. Genau in dem Moment, wo uns die BBC live vom Hyde Park Corner informiert, dass Jackson soeben sein Hotel verlassen habe, um einen Minibus zu besteigen, kommen wir im Foyer des O2-Zentrums an. Dort sind nebst einer Bühne, die von einer gewaltigen Videowand umrahmt ist, mehrere Gehege für die diversen Kategorien von Journalisten eingerichtet worden. An die tausend Fans haben sich ebenfalls eingefunden. Sie singen, johlen, jubeln, werfen sich fürs Souvenir-Foto in Pose und spüren offensichtlich nichts von der sibirischen Kälte. Im Auto von Knightsbridge in die Docklands – beim spätnachmittäglichen Stoßverkehr kann das gut und gern seine zwei Stunden dauern! Warum müssen Popstars immer zu spät sein? Die Fotografen sind bereits ganz schön grummelig. Seit drei Stunden stehen sie auf einer winzigen Tribüne hinter ihren Stativen. Es ist so eng, dass sie kaum die Schultern bewegen können. Und weil sie alle auf einem Haufen hocken, werden sie nachher auch noch alle den gleichen Shot haben. Michael Jackson. Wird er ein neues Album ankündigen? Vielleicht gar den Rücktritt? Wird er im Pyjama auftreten und ein taufrisches Baby genannt Blanket II. über dem Bühnenrand zappeln lassen? Wird er überhaupt erscheinen?
So oder so, die Massenversammlung von Fans, Reportern und sonstigen Schlachtenbummlern beweist eindrücklich, dass Jackson auch heute noch „News“ ist. Heute – das heißt: etwas weniger als acht Jahre seit seinem letzten Studioalbum Invincible und gute fünf Jahre seit dem bescheidenen letzten Hit mit der R.-Kelly-Komposition „One More Chance“. Andererseits sind auch bereits wieder vier Jahre verstrichen seit dem Schauprozess von Santa Maria, wo Jackson unter Anklage stand, Unzucht mit einem Kind begangen zu haben. 2 200 akkreditierte Journalisten prophezeiten damals zuversichtlich einen Schuldspruch und damit das supernovahafte Verglühen des größten Superstars aller Zeiten. Aber Jackson wurde vom Geschworenengericht in allen Punkten freigesprochen. Seither hat er ein für seine Verhältnisse diskretes Leben geführt – ein Nomadenleben. Ein paar Monate wohnte er in Bahrain, ein paar in Dubai, ein paar weitere in Irland. Er trug sich mit dem Gedanken, ein Haus in der Schweiz zu kaufen, ging dann aber doch lieber nach Las Vegas. Im Juli 2008 machte ein Foto die Runde, das ihn in Pyjama und Pantoffeln zeigte, wie er im Rollstuhl durch die Straßen der Casino-Metropole gestoßen wurde. Bei dem Anblick konnte man die brutale Schlagzeile der britischen Boulevardzeitung The Sun geradezu nachvollziehen: „Demise of the King of Pop“ stand da geschrieben. Dann und wann hörte man indessen auch Gerüchte anderer Art. Jackson plane ein neues Album, hieß es. Nebst Akon und Will.i.am bestätigte auch Ne-Yo, dass er Jackson neue Songs auf den Leib geschrieben habe. Die Frage, was aus diesen Liedern werden sollte, wusste allerdings niemand zu beantworten.
Eine Stunde und fünfundvierzig Minuten dauert das Warten. Pech für die Medienvertreter, welche sich vorher allzu oft bei den Freidrinks bedient haben: Wer die Toiletten aufsucht, wird nicht wieder eingelassen. Dann endlich Bewegung auf der Bühne. „Ready for this? You have waited long enough!“, hebt Big Brother-Moderator Dermot O’Leary an. „750 Millionen verkaufte Alben, 13 Grammys. London heißt ihn willkommen, den King of Pop, Mister Michael Jackson!“ Auf der Videowand sehen wir, wie ein Minibus vor dem O2-Center anhält. Wie der besagte King of Pop an einem Spalier von breiten Security-Protzen vorbei dem Eingang zuschreitet. Ein bisschen gebückt wirkt er. Sein Gesicht ist hinter einer schwarzen Sonnenbrille versteckt. Das putzige Näschen sieht eigentlich ganz normal aus. Das silberne Muster auf der schwarzen Uniformjacke wirkt auf den ersten Blick wie die Röntgenaufnahme eines Brustkastens. „Ozzy Osbourne!“, fährt es einem durch den Kopf: die gleichen schwarzen Haarsträhnen, der gleiche leicht gebückte und leicht wacklige Gang. Aber mit ersten Eindrücken ist es so eine Sache. Als man sich die Szene später auf YouTube noch mal anschaut, sieht man bloß einen Michael Jackson, der zügig durch die Tür schreitet, den auf ihn dort wartenden Buggy zur Seite winkt und im Korridor verschwindet. Die Fans heulen derweil auf wie ein Jumbo-Jet kurz vor dem Start und blitzen mit Fotoapparaten und Handys Richtung Videowand. Ehe Jackson tatsächlich die Bühne betritt, kredenzt die Videowand eine Sequenz von Video-Highlights aus seiner ganzen Karriere. Das Fan-Geschrei wird noch ein paar Dezibel lauter. Und dann steht er endlich da, dieser Michael Jackson – flüstert O’Leary etwas ins Ohr und wird von diesem hinter das Mikrofon mit dem roten Schild gewiesen: „King of Pop – Michael Jackson“. Man fürchtet ob des daraufhin einsetzenden Kreischens um die Glasfront der schönen Nobelhalle, wo selbst die Hamburger in Ciabatta serviert werden. Michael macht mit seiner Rechten das Victoryzeichen und sagt: „I love you so much. I love you so much.“ Die versammelte Fan-Gemeinde, zu der Teenager ebenso gehören wie deren Eltern und womöglich Großeltern, dankt es mit einem kurzen Aufschrei und versinkt in inniger, respektvoller Stille. Jackson guckt kurz auf seine Schuhe, zupft am Ärmel, lehnt sich vor: „Thank you all.“ Guckt in die Runde. Räuspert sich. Rückt das Mikrofon zurecht. Sticht mit dem Zeigefinger in die Luft und sagt: „This – is – it!“ Wendet sich vom Mikrofon ab, geht leicht in die Knie und zappelt mit den Armen wie Rafael Nadal nach dem siegreichen Ass. „Ich will nur sagen“, meint er dann und bittet mittels hochgehaltener Hand um neuerliche Ruhe, „dies werden meine letzten Show-Performances sein – in London. Das wird es sein. This is it. Wenn ich sage: This is it, dann heißt das nun wirklich: This is it. Denn …“ Ein Zwischenruf aus dem Publikum entlockt Jackson ein Schmunzeln und einen kleinen Lacher. Er wendet sich ab. Blickt grinsend zu O’Leary hinüber. Blickt ins Publikum. Dieses skandiert mittlerweile aus voller Brust „We want Michael“, obwohl es ihn nun ja eigentlich hat. Jackson drückt sich die rechte Hand flach auf die Brust, dann die Linke flach auf die Rechte. Dann spricht er weiter: „Ich werde die Songs aufführen, die meine Fans hören wollen.“ Pause. Kreischen. „This is it. Ich meine: This is really it. Das ist der endgültige Schlusspunkt. Okay? Ich werde euch also im Juli sehen. Und …“ Pause. Kreischen. Zurufe. Jackson grinst. Hebt die Hand zum Gruß. „I love you. I really do. Das müsst ihr wissen. I love you so much. Really. From the bottom of my heart.“ Diesmal die Linke flach auf die Brust. „This is it – see you in July!“ Zwei, drei Faust-in-die-Luft-Posen für die Fotografen. Ein Handküsschen fürs Publikum, und schon entschwindet der King zwischen den feuerroten Vorhängen. O’Leary wird vom raschen Ende des Auftrittes sichtlich überrascht. Er fasst das Gesagte kurz zusammen und fügt noch das Datum der ersten der zehn geplanten Shows hinzu – 8. Juli 2009. Niemand hört mehr zu. Um ihn herum hat man bereits mit dem Abbau der Bühne begonnen. Kaum zwei Minuten stand Michael Jackson vor dem Mikrofon. Zwei Minuten, die unter den Journalisten zuerst ungläubiges Gelächter („Zwei Minuten! This is it! Der hat sie ja nicht alle!“), dann rege Diskussionen auslösen. Was hat Jackson mit seinen Sprüchen nun wirklich gemeint? Sollen das tatsächlich seine letzten Konzerte überhaupt werden? Oder muss man ihn beim Wort nehmen, sind es nur die letzten in London? Wird er in zwei Jahren statt in London einfach in Exeter auftreten? Oder für die nächsten zehn Shows nach Berlin, New York oder Johannesburg bitten? Könnte er gar eine Tournee unternehmen, wenn die O2-Konzerte gelingen? Und was ist mit dem neuen Album? Einer langen Tradition folgend hat es Michael Jackson erneut geschafft, bei einem öffentlichen Auftritt mehr Fragen aufzuwerfen als zu beantworten. Schon seine Erscheinung zum Beispiel. Für einen 50-Jährigen, der vor Kurzem noch zu schwach war zum Gehen, machte er einen erstaunlich robusten und jugendlichen Eindruck. Die Stimme war auch nicht das, was man erwartet hätte. Richtiggehend kräftig war sie, vital. Nicht wiederzuerkennen zum vergleichsweise heliumleichten Flöten, mit welchem er einst die Fragen von Martin Bashir beantwortete! Bald erfinden die versammelten Medienvertreter ein Gerücht. „War er das wirklich, der Jackson?“, fragen sie hinter vorgehaltener Hand. „War das nicht ein Double?“
Danach redet man draußen mit den wahren Fans. „Unglaublich, auch wenn er nur ein paar Minuten dastand“, sagt ein junger Mann. „Wie immer, bei Michael.“ Ein anderer kann es kaum fassen: „Amazing. Amazing. Er ist echt zurück! Wir lieben ihn.“ „Wir warteten sechs Stunden“, strahlen zwei ebenfalls junge Damen. „Es war brillant. Nur schon, dass er wirklich dastand.“ „Ich bin Michael-Jackson-Fan seit meiner Geburt“, kommt es von einem nigerianischen MJ-Verehrer: „Nur schon, ihn live vor mir zu sehen, war amazing.“ Es ist erstaunlich. Zwei Minuten auf der Bühne, kommen sich die Fans da nicht veräppelt vor? Nein, ist die simple Antwort. Immerhin ein Mann, ein Jamaikaner, gibt zu, nicht der allergrößte Jackson-Fan zu sein. Trotzdem ist er happy: „Michael ist einfach ein phänomenaler Künstler. Der Künstler einer Generation. Ein Künstler, den, würde ich sagen, jedermann einmal im Leben live erleben will.“ Eintausend Pfund – den Betrag sind die meisten Befragten bereit, für ein Ticket auszugeben.
Einige Tage später folgt die Nachricht, dass Jackson der Ticket-Nachfrage entsprechend 40 weitere O2-Konzerte bestreiten wolle. Wenn alles gut geht, wird sich die Serie bis in den Februar 2010 hineinziehen. Insgesamt 50 Shows in einer Halle, die 17 000 Zuschauer fasst. Beim ersten Ansturm gingen stündlich 39 474 Tickets weg. Die Konzerte waren in Rekordfrist ausverkauft. Damit stellt Jackson seinen alten Rivalen Prince in den Schatten, der zwei Jahre zuvor mit vergleichsweise mickrigen 21 O2-Shows eine Karriere-Renaissance einleitete. Jackson habe sich einer Reihe von Fitness- und Gesundheitstests unterziehen müssen, ehe der Veranstalter das Risiko eingegangen sei, sich auf die Konzerte einzulassen. Die Versicherungssumme für den Fall einer Absage der 50 Konzerte soll sich auf 300 Millionen Pfund belaufen. Wen verwundert es da, wenn Gerüchte aufkommen?
Die ersten fünf Jahre Die positiven Seiten
Es ist immer wieder eine schockierende Einsicht, wenn man daran erinnert wird, wie wenige Generationen verstrichen sind seit der Abschaffung der Sklaverei. Der Urgroßvater von Katherine B. Scruse hatte diese Zeiten noch miterlebt und schließlich sogar den Namen der Familie angenommen, bei der er zuletzt Sklavenarbeit geleistet hatte. „Kattie“ wurde am 4. Mai 1930 im tiefsten Süden geboren, in Barbour County, Alabama. Ihr Vater, Prince Scruse (der Vorname ist also weder von Michael Jackson noch gar von Prince Rogers Nelson erfunden worden!), arbeitete bei der Eisenbahn und führte nebenbei eine kleine Baumwollfarm. Mit 18 Monaten wurde Katherine von der Kinderlähmung befallen, einer manchmal tödlichen Krankheit, gegen die es damals noch keinen Impfstoff gab. Auf der Suche nach besserer Arbeit zog die Familie 1934 in den Norden, nach Chicago. Wenig später trennten sich die Eltern, die beiden Töchter blieben bei der Mutter Martha. Als Teenager verbrachte Katherine wegen der Spätfolgen der Kinderlähmung viel Zeit im Krankenhaus, was ihre Schulbildung erheblich beeinträchtigte. Dafür ging sie in der Musik auf. Sie spielte Klarinette und Klavier, war Mitglied des Schulchors und im Chor der lokalen Baptistengemeinde. Ausgerechnet der kontroverse und tragische Country & Western-Pionier Hank Williams war das Idol der gottesfürchtigen jungen Frau (später galt ihre Vorliebe dem rebellischen Willie Nelson). Mit 17 Jahren lernte sie auf einer Party den ein Jahr älteren und bereits verheirateten Joseph Walter Jackson kennen. Dieser – geboren am 26. Juli 1929 – war der Sohn eines autoritären Highschool-Lehrers mit zutiefst anti-sozialen Neigungen. So war es ihm und seinen vier Geschwistern strengstens verboten, sich außerhalb des Hauses mit Freunden zu tummeln. Als er ein Teenager war, trennten sich die Eltern. Er wohnte zuerst beim Vater in Oakland, zog dann zur Mutter nach Chicago. Der Schule kehrte er frühzeitig den Rücken und verbrachte dafür umso mehr Zeit im Amateur-Boxring. Seine erste Ehe ging nach einem Jahr in die Brüche. Am 5. November 1949 fand die Hochzeit von Joseph Jackson und Katherine Scruse statt.
Das frisch vermählte Paar ließ sich in Gary, Indiana, nieder, einer Satellitenstadt von Chicago am Lake Michigan, die in den frühen Jahren des Jahrhunderts von der United States Steel Corporation aufgebaut und nach dem damaligen Firmenpräsidenten Elbert H. Gary benannt worden war. Anfang der fünfziger Jahre hatte Gary rund 130 000 Einwohner (bei der letzten Volkszählung im Jahr 2020 waren es noch knapp 70 000). Die Großzahl war in der Stahlindustrie tätig, welche einerseits die Baufirmen von Chicago, andererseits die Automobilhersteller von Detroit belieferte. Seit beide Industrien in den 60er Jahren langsam aber sicher in die Krise schlitterten, haben Arbeitslosigkeit und Gewalttätigkeit um sich gegriffen. (Heute sind 79,11 % der Bevölkerung afro-karibischer Abstammung, nachdem die Zahl noch vor wenigen Jahren bei 85 % lag). Nachdem die Mordrate (Fälle von Mord und Totschlag pro 100 000 Einwohner) in den 2000er Jahren zwischenzeitlich um 13 Mal höher lag als der amerikanische Durchschnitt, hat sich die Situation in letzter Zeit leicht beruhigt. Die Jacksons erlebten Gary noch in seinen besseren Tagen. Die schwarze Bevölkerung der Stadt entwickelte früh ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und eine starke politische Tradition. 1967 wurde Richard G. Hatcher zum Bürgermeister gewählt – er gehörte zu den ersten schwarzen Bürgermeistern im amerikanischen Norden. Hatcher hatte sich an der Seite von Martin Luther King als führende Persönlichkeit in der amerikanischen Civil-Rights-Bewegung hervorgetan. 1972 fand unter der Regie von ihm, dem Politiker Charles Diggs und dem militanten Dichter Imamu Amiri Baraka alias LeRoy Jones in Gary die National Black Political Convention statt, eine wegweisende überparteiliche Versammlung von mehreren tausend schwarzen Politikern und Civil-Rights-Kämpfern. 1984 leitete Hatcher die Präsidentschaftskandidatur von Reverend Jesse Jackson, einem Mann, der auch im Leben von Michael Jackson noch eine Rolle spielen sollte.
Die Entfernung zur Musikmetropole Chicago betrug nur 50 Kilometer. So florierte auch in Gary eine rege Musikszene. Auf der Suche nach Arbeit waren über die vergangenen Dekaden hinweg allerhand Blues-Musiker aus dem Mississippi-Delta in den Norden gewandert und hatten ihren Sound der hektischen, urbanen Umgebung angepasst. Die traditionelle Mundharmonika wurde in Chicago nun über das Mikrofon gespielt, die akustische Gitarre durch einen Verstärker gejagt oder gar durch eine elektrische Gitarre ersetzt. Bass, Drums, Klavier und manchmal Saxofon halfen ebenfalls mit, den druckvollen neuen Chicago Blues zu prägen. In der Stadt war auch das wegweisende Plattenlabel Chess Records beheimatet. Gegründet im Jahre 1950 von den Gebrüdern Phil und Leonard Chess, erschien hier von Muddy Waters über Howlin’ Wolf bis Willie Dixon (dem „Vater des Chicago Blues“) und Little Walter alles, was im Blues Rang und Namen hatte und später die Rolling Stones und die Beatles so nachhaltig beeinflussen sollte. Bei Chess waren auch Chuck Berry aus St. Louis sowie Lokalmatador Bo Diddley untergebracht, deren Namen, wenn es im Musikgeschäft fair zuginge und wenn ihre Hautfarbe eine Spur bleicher gewesen wäre, heute als Pioniere des Rock’n’Roll im selben Atemzug genannt würden mit Elvis und Bill Haley. Diverse Blues-Künstler lebten in den fünfziger Jahren in Gary, darunter Jimmy Reed und Albert King. Berühmter waren indessen The Spaniels, die erste Doo-Wop-Truppe, bei der sich der Leader – in ihrem Fall hieß er Pookie Hudson – an sein eigenes Mikrofon stellte, derweil sich seine Kollegen zu viert um das zweite scharten. Doo-Wop war eine vorab von schwarzen Stimmen gepflegte Mischform aus Gospel, Rhythm & Blues, Swing und Pop, deren kapitaler Einfluss auf die Entwicklung von Rock’n’Roll, Funk und Soul heute ebenfalls oft unterschätzt wird. Sie war in den vierziger Jahren aus den Industriestädten des Nordostens und des Mittleren Westens herausgewachsen, schaffte aber erst in den fünfziger Jahren so richtig den Sprung in die Hitparade. Die Spannbreite des Stils reichte von der schmalztriefenden Schnulze, die eher ein älteres Publikum entzückte, bis zum swingenden Rockabilly für die Strizzis an der Straßenecke. Vom Rock’n’Roll unterschied sich Doo-Wop vor allem durch die subtil arrangierten, gospelartigen Gesangsharmonien, die hier im Vordergrund standen. Auch gehörte es zum Doo-Wop, dass die Gruppen supercoole Anzüge trugen und kleine Tänzchen inszenierten, bei denen alle Mitglieder im Gleichtakt die gleichen Bewegungen ausführten. Diese bereiteten nicht nur Vergnügen, sie waren auch eine billige und dabei eindrückliche Art, wie man zeigen konnte, dass man etwas zustande brachte, auch wenn man keinen Cent in der Tasche hatte.
The Spaniels hatten sich in der Roosevelt High School an der 25th Avenue in Gary formiert und gaben dort 1952 auch ihr Live-Debüt – buchstäblich um die Ecke von der Adresse 2300 Jackson Street, wo sinniger-, aber zufälligerweise die junge Jackson-Familie wohnte. Anfang 1953 unterschrieb die Gruppe einen Vertrag beim soeben gegründeten, ebenfalls in Gary ansäßigen Plattenlabel Vee-Jay. Es ist dies keine Nebensache: Vee-Jay war das erste größere, unabhängige Plattenlabel in den USA, das ganz im Besitz von Schwarzen war, nämlich dem Ehepaar Vivian Carter und James C. Bracken, das in Gary einen Plattenladen führte. Mit „Baby It’s You“ landeten die Spaniels auf Anhieb in den Top 10 der Rhythm & Blues-Charts. Im Frühjahr 1954 gelang mit „Goodnite Sweetheart, Goodnite“ auch noch der Sprung in die Pop-Top-30. In der Folge gehörten zum Repertoire von Vee-Jay nebst Doo-Wop auch Blues (Jimmy Reed, John Lee Hooker, Gene Allison etc.), Soul (Jerry Butler) und die Beatles (Capitol Records, die amerikanische Abteilung von EMI, hatte sich geweigert, mit den frühen Singles der Schreihälse aus Liverpool ihren respektablen Ruf zu ruinieren!). Michael Jackson nannte früh den Doo-Wop-Sänger Frankie Lymon als großes Vorbild, und zwar im positiven wie im abschreckenden Sinn. Lymon war erst 13 Jahre alt, als er mit seiner Gruppe The Teenagers und der Nummer „Why Do Fools Fall In Love“ in der Hitparade landete. Er zeigte also, dass eine junge Stimme nicht unbedingt Lieder mit Kinderthemen anstimmen musste, um Erfolg zu haben. Andererseits konnte Lymon mit dem Erfolg nicht umgehen. Er war erst 25 Jahre alt, aber bereits zum dritten Mal verheiratet, als er im Februar 1968 in Harlem, New York, an einer Überdosis Heroin verstarb.
Joe und Katherine Jackson verfolgten die popmusikalischen Entwicklungen so gut es eben ging mit ihren bescheidenen Mitteln. Das Paar hatte alle Hände voll zu tun damit, die rasant anwachsende Familie über die Runden zu bringen. Am 29. Mai 1950 kam die erste Tochter zur Welt – Maureen alias Rebbie. Es folgten Sigmund Esco (genannt Jackie, 4. Mai 1951), Tariano Adaryl (Tito, 15. Oktober 1953), Jermaine LaJuane (11. Dezember 1954), LaToya Yvonne (29. Mai 1956), Marlon David (12. März 1957; ein Zwillingsbruder verstarb am Tag nach der Geburt), Michael (29. August 1958), Steven Randall (29. Oktober 1961) und schließlich noch Nesthäkchen Janet Damita (16. Mai 1966). Joe verdiente sein Brot als Kranführer in den Stahlwerken und nahm zusätzlich Gelegenheitsjobs in den Kartoffelfeldern und als Schweißer an. Wenn das Geld besonders knapp wurde, arbeitete Katherine im Kaufhaus Sears. Die Musik war eine Passion, mit der Joe und Katherine auch gewisse Hoffnungen verbanden. Katherine träumte davon, Sängerin zu werden. Joe formierte mit seinem Bruder Luther die Rhythm & Blues-Band The Falcons, um mit Auftritten in lokalen Bars ein paar zusätzliche Cents in die Haushaltskasse zu bringen – und danach, wer weiß?
Zu ihrem Programm gehörten die druckvolleren Rhythm & Blues-Hits von Chuck Berry und Little Richard (was angesichts von Joes kapitaler Homophobie nicht einer gewissen Ironie entbehrt). Aber die Band war offenbar nicht imstande, das Interesse von Plattenlabels zu wecken oder sich einen überregionalen Ruf zu erspielen. Wann genau Jackson die Falcons aufgab, ist unklar. Seine Söhne Jackie, Tito und Jermaine können sich alle noch daran erinnern, wie die Band in der Stube des Bungalows an der Jackson Street geübt habe. Michael hat früher erklärt, er könne sich daran nicht entsinnen, beschreibt diese Proben dann aber in seinen Memoiren (Moonwalk, 1988), als ob er dabei gewesen wäre. So oder so ist das, was danach passierte, Stoff der Legende. Wenn der Vater nicht im Hause war, sangen die kleinen Jacksons mit ihrer Mutter gern Volkslieder und Country & Western-Hits. Es gehöre zu seinen frühesten Erinnerungen, wie ihm Katherine das Leadbelly-Lied „Cotton Fields“ sowie „You Are My Sunshine“ vorgesungen habe, schreibt Michael. Man habe die Wahl gehabt, einer Gesangsgruppe beizutreten oder einer Streetgang, hat Jackie Jackson berichtet. Die Jacksons wählten notgedrungen die erste Variante, denn so wie ihr Vater nicht hatte mit den Nachbarskindern spielen dürfen, gönnte er das Vergnügen wiederum auch seinem eigenem Nachwuchs nicht. Am Anfang bestand die „Gruppe“ aus Jackie, Tito und Jermaine. Tito riskierte jedes Mal Kopf und Kragen, wenn er Joes Gitarre aus dem Schrank holte. Diese nur schon zu berühren war den Kindern streng untersagt. Als Katherine es merkte, behielt sie das Geheimnis für sich. Sie habe gespürt, dass die Boys Talent hätten. Eines Tages riss eine Saite, niemand wusste, wie man sie ersetzte, und so war die Missetat nicht mehr zu vertuschen. Wie befürchtet setzte es gehörig Prügel. Tito verzog sich heulend in sein Zimmer. Nach einer Weile sei Joe hereingekommen und habe ihm die Gitarre hingestreckt: „Dann zeig mal, was du kannst.“ Als auch noch Jackie und Jermaine hereinkamen und zu singen anfingen, änderte sich Joes Stimmung. Er erkannte, dass ihm bis dahin eine wichtige Seite seiner Familie verborgen geblieben war. Am nächsten Tag brachte er eine brandneue Gitarre nach Hause. Sie war feuerrot und sollte Tito gehören. Auch wollte der Vater die Proben seiner Sprösslinge künftig selbst überwachen.
Unterdessen hatte auch der kleine Michael gewisse Talente an den Tag gelegt. Katherine berichtet, wie er mit eineinhalb Jahren mit der Milchflasche in der Hand zum Groove der laufenden Waschmaschine getanzt habe. Schon mit drei Jahren soll er herzzerreißend schön gesungen haben. Mit fünf Jahren erlaubte ihm der Vater, bei der Familiengruppe mitzusingen und – wie der nun ebenfalls in den Kreis aufgenommene Marlon – Bongos zu spielen. Im Herbst 1963 trat Michael in die Kindergartenabteilung der Garnett Elementary School ein. Bald darauf organisierten die Lehrer eine Show, bei der jeder Schüler sein besonderes Kabinettstück aufführen sollte. Michael gab die Rodgers-und-Hammerstein-Komposition „Climb Ev’ry Mountain“ aus dem Musical The Sound Of Music zum Besten. „Der Applaus war gewaltig“, schreibt er, „überall sah ich lächelnde Gesichter, viele Leute standen sogar auf, und die Lehrer weinten. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte sie alle glücklich gemacht! Es war ein großartiges Gefühl.“ Ein wenig verwirrt sei er ebenfalls gewesen: „Ich hatte nicht das Gefühl, ich hätte etwas Besonderes geleistet. Ich hatte ja nur gesungen, wie ich das daheim jeden Abend tat. Auf der Bühne erfasst man nicht, wie man klingt oder wie der Auftritt rüberkommt. Man macht bloß den Mund auf und singt.“ Wenig später setzte der 12-jährige Jackie durch, dass Michael statt Jermaine Leadsänger bei den Jackson Brothers war.
Die ersten fünf Jahre Die negativen Seiten
Es ist eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit der Popgeschichte, dass es sich bei zwei Gruppen, welche auf quasi archetypische Weise die Hoffnungen und Möglichkeiten des American Dream verkörpern, um Familienformationen handelte, die von brutalen Vätern regelrecht zum Erfolg geprügelt wurden. Denn so, wie Joseph Jackson in Gary, Indiana, anfangs der 60er Jahre mit dem Gürtel auf seine Söhne eindrosch, wenn diese den rechten Ton nicht erwischten, kannte Murry Wilson in Hawthorne, Kalifornien, in den Fünfzigern keine Gnade, wenn seine Söhne, die späteren Beach Boys, nicht spurten. Beide Väter meinten, nur das Beste zu wollen für ihre Söhne, und konnten später auf eine stolze Hitparadenbilanz verweisen, wenn jemand ihre Verdienste anzweifelte.
Beide Väter fügten aber den begabtesten Talenten in ihrer Familie bleibenden Schaden zu. Im Falle von Brian Wilson waren es nicht nur psychische Schäden, sondern auch physische: Mit sechs Jahren wurde er von Murry dermaßen verprügelt, dass er auf seinem rechten Ohr praktisch taub war und so nie die Stereoeffekte seiner Produktionen genießen konnte. Vater Jackson fügte keinem seiner Söhne einen bleibenden körperlichen Schaden zu, aber das war eher Glücksache. Marlon Jackson erinnert sich an eine besonders traumatische Episode, als Joseph den dreijährigen Michael am Fußgelenk in der Luft zappeln ließ, um mit der freien Hand endlos auf ihn einzuschlagen. Als der Vater Michael endlich gehen ließ, habe dieser geschrieen „I hate you!“ – worauf er gleich noch mal drangekommen sei, noch härter und noch länger. Ein anderes Mal sperrte Joseph den aufmüpfigen Michael stundenlang in einen Schrank. Am häufigsten sei Marlon drangekommen, erklärte ein von der Erinnerung immer noch über den Rand der Selbstbeherrschung hinaus getriebener Michael in Living With Michael Jackson, dem notorischen Dokumentarfilm von Martin Bashir: „Mir ging es nicht so schlecht“, sagte Michael dort, „denn ich wurde von Joseph als Exempel hingestellt.“ Ihm sei es leichtergefallen als den anderen, die Töne zu erwischen und die Tanzschritte auszuführen. „Aber Marlon, der Arme, der kam am häufigsten dran. Er gab sich ja solche Mühe, wahnsinnige Mühe. Und immer wieder sagte Joseph: ‚Mach’s wie Michael!‘ Und wenn er es nicht schaffte, kam der Gürtel. Es war hart. So hart!“
Genau wie Murry Wilson warf auch Joseph Jackson seine Söhne im Zorn einfach an die Wand. Und ebenfalls wie Wilson gefiel er sich darin, den Kindern einen Schreck einzujagen: Während Wilson beim Essen unerwartet sein Glasauge aus der Höhle entfernte, um eine grausige Fratze zu ziehen, zog sich Joseph eine Monstermaske über den Kopf, kletterte mitten in der Nacht ins Zimmer der Kinder und brüllte ihnen so laut es ging ins Ohr: „Eine Lektion, das Fenster nicht offen zu lassen“ nannte er das. Seit den frühen achtziger Jahren kommt Michael Jackson bei jedem seiner raren Interviews früher oder später auf die Brutalität des Vaters zu sprechen. Im Jahr 2002 stellte der für seine tiefgründigen Dokumentarfilme hochrespektierte britische Journalist Louis Theroux auch Joseph Jackson (der ihm für das kurze Gespräch 5 000 Dollar abgeknöpft hatte) einige Fragen zu dem Thema. „Was denken Sie, wenn Michael sagt, er habe dermaßen Angst gehabt vor Ihnen, dass er sich manchmal erbrechen musste, wenn er Sie kommen hörte?“, fragte Theroux. „Soll er doch – auf dem ganzen Weg zur Bank!“, kam die Antwort. „Michael sagt, Sie hätten ihn mit Ruten und Gürteln geschlagen …“, fuhr Theroux fort. Jackson brauste auf: „Geschlagen habe ich ihn nie mit Rute und Gürtel! Gepeitscht habe ich ihn damit! Schlagen tut man jemanden mit einem Stock, nicht aber mit Rute und Gürtel!“ (Zu sehen im Dokumentarfilm Louis, Martin & Michael). Joseph Jackson und Murry Wilson teilen noch eine weitere Eigenschaft: Beide waren sie einst Musiker gewesen, deren Hoffnungen auf Karriere und Ruhm sich zerschlagen hatten (Jackson hatte dazu schon als Boxer eine ähnliche Enttäuschung einstecken müssen). Wie ein Mantra zitierte Joseph Jackson in den frühen Jahren der Jacksons das Motto: „Entweder bist du im Leben ein Gewinner, oder du bist ein Verlierer.“ Während es zum Beispiel in Großbritannien möglich ist, vor sich selbst einen Mangel an Erfolg durch den Hinweis zu kaschieren, dass man gegen die Schranken der rigiden Klassengesellschaft angelaufen sei, suggeriert der vielzitierte „amerikanische Traum“ die Möglichkeit, dass es absolut jeder Mensch in Amerika zum Millionär bringen kann, wenn er nur genug arbeite (oder bete oder eben schlau sei). Es dürfte für den erfolglosen, aber ehrgeizigen Joseph Jackson nicht einfach gewesen sein, mit der brachialen Eindeutigkeit seiner eigenen Maxime – „Verlierer oder Gewinner“ – zu leben. Indem er seine Kinder zum Erfolg drosch, nahm er wohl seine letzte Chance wahr, sich selbst vom Verlierer zum Gewinner zu wandeln.
Übrigens vermochte Murry Wilson seine Ambitionen schließlich doch noch zu erfüllen – wenigstens ein bisschen. Indem er den Erfolg seiner Boys als Druckmittel einsetzte, überzeugte er deren Plattenfirma Capitol von der Notwendigkeit, auch von ihm ein Album zu veröffentlichen. The Many Moods Of Murry Wilson ist ein unfreiwilliges Glanzlicht der Sparte „Cheesy Listening“ und enthält „The Plumber’s Tune“, gesungen vom Klempner, der zufällig in Wilsons Haus an der Arbeit war. „Das Album zeigt, dass das Talent in der Familie Wilson nicht nur bei den Boys liegt“, sagte Murry …
The Jacksons und die Beach Boys entstanden beide auf der Kippe zwischen den konservativen fünfziger Jahren und dem Aufbruchklima der Sixties. Es ist, als würde sich mit der ans Pathologische grenzenden Disziplinierungswut von Joseph Jackson und Murry Wilson (die ein Echo findet in der Arbeitsweise von konventionelleren Bandleadern derselben Generation wie Ike Turner und James Brown) eine todgeweihte Weltordnung ein letztes, desperates Mal aufbäumen.
Joseph Jackson unternahm mit seinen Söhnen zwar dann und wann einen Ausflug an die Seen zum Fischen, oder er versuchte, ihnen das Boxen beizubringen. Aber er bestand auf eine Kälte und Distanz, die auch nur den Hauch von Herzlichkeit praktisch unmöglich machte (die Töchter im Haus sollen von seinem Radar schon gar nicht mehr erfasst worden sein). So habe es das Wort „Daddy“ im Haus der Jacksons nicht gegeben, sagte Michael im Interview mit Martin Bashir: „Für dich bin ich Joe“, habe es geheißen. „Darum will ich es mit meinen eigenen Kindern anders machen. Meine Kinder sollen einen ‚Daddy‘ haben.“ Er habe seinen Vater nie richtig zu verstehen gelernt, schreibt Michael in den Memoiren: „Es gehört zu den wenigen Dingen, die ich sehr bedaure in meinem Leben. Nämlich, dass es mir nie gelungen ist, eine engere Beziehung aufzubauen mit ihm. Über die Jahre hinweg hüllte er sich in eine undurchdringliche Schale. Von dem Moment an, wo wir aufhörten, über das Familiengeschäft zu reden, fand er es schwierig, einen Bezug zu uns herzustellen. Wenn wir alle beisammen waren, hat er einfach den Raum verlassen.“
Nie wird Michael Jackson dagegen müde, die Vorzüge seiner Mutter Katherine zu preisen. „Es ist eine alte Story“, heißt es in Moonwalk: „Jedes Kind glaubt, seine Mutter sei die beste Mutter auf der ganzen Welt. Wir Jacksons haben dieses Gefühl nie verloren. Wenn ich an die Güte, Wärme und Aufmerksamkeit von Katherine denke, kann ich mir nicht vorstellen, was es heißt, ohne die Liebe einer Mutter aufwachsen zu müssen.“ Katherine scheint die Gewalttätigkeit ihres Ehemannes mit erstaunlichem Gleichmut hingenommen zu haben – zumal Joseph sie selbst mehr oder weniger in Frieden ließ nach einer frühen Episode, wo sie angedroht hatte, ihn zu verlassen. Auch scheint der Mann eine Art Jekyll/Hyde-Figur gewesen zu sein, die insbesondere im Umgang mit Frauen, die ihm gefielen – und dazu gehörte durch dick und dünn auch Katherine –, mächtig den Charme aufdrehen konnte.
Katherine verfügte über starke religiöse Überzeugungen und wollte schon deswegen keine Trennung oder gar eine Veränderung in den viktorianischen Machtverhältnissen in ihrem Haushalt. So ist es bezeichnend, dass sie sich 1963 während einer Zeremonie in der Roosevelt High School zur Zeugin Jehovas taufen ließ. Die Sekte versteht sich als Gottes Organisation auf Erden und glaubt, der Mann sei durch göttliche Anordnung zum Oberhaupt der Familie bestimmt und als solches für alle Entscheidungen zuständig. Zuvor hatte Katherine den Baptisten, dann der lutheranischen Kirche angehört – aus beiden war sie ausgetreten, weil sie herausgefunden hatte, dass ihre Pfarrer außereheliche Affären hatten. Rebbie, LaToya und vor allem Michael waren die einzigen Sprösslinge, die in der Folge gern mit der Mutter am Sonntag die Gottesdienste in der lokalen „Kingdom Hall“ besuchten – Joe und den anderen waren die Predigten zu langweilig. Die Zeugen Jehovas sind überzeugt, alle Aspekte ihres Glaubens aus Bibelzitaten herleiten zu können. Außerehelicher Geschlechtsverkehr ist ebenso strikt verboten wie Masturbation, Homosexualität, Alkohol, Tabak und andere Drogen. Verboten ist auch Götzenverehrung – es bedeutet, dass Jehovas Zeugen keine Flagge grüßen. Im 19. Jahrhundert vermochte die Sekte einigen Einfluss auf gewisse Formulierungen im Rahmen der amerikanischen Gesetzgebung auszuüben, nicht zuletzt im Zusammenhang von Militärdienst und Gewissensfragen; Zeugen Jehovas sind seither von der Militärpflicht befreit. Konsequente Zeugen Jehovas verweigern jegliche Form von Bluttransfusionen. In den Augen der Zeugen Jehovas wird die Welt derzeit von Satan regiert, der schon Adam und Eva mit seiner Schlauheit auf Abwege geführt hat. Bald aber werde die Erde durch einen von Gott geführten Weltkrieg und der alles entscheidenden Schlacht von Armageddon von ihrem Joch befreit. Exakt 144 000 Auserwählte – ausschließlich Zeugen Jehovas – würden danach im Himmel an der Seite Gottes Gutes tun. Eine zweite Klasse von Gläubigen werde auf Erden paradiesische Zustände ohne Krankheiten, Gebrechen und anderes Elend erleben. Die Vorstellung eines solchen spirituellen Schlaraffenlandes hat etwas Märchenhaftes an sich. Das Bild ist nicht so weit entfernt von der Geschichte Peter Pans, des Knaben, der sich weigert, erwachsen zu werden, und in seinem Neverland auf ewige Zeiten kindlichen Abenteuern nachhängt. Sie wird dem fünfjährigen Michael Jackson mächtig Eindruck gemacht haben, so, wie sich jedes Kind in dem Alter von „großen“ Storys packen lässt.
Im Gegensatz zu seinen älteren Geschwistern, die doch schon auf einige Erfahrung im Umgang mit anderen Kindern und Lebenshaltungen zurückblicken konnten, war seine Welt zu dem Zeitpunkt fast ausschließlich auf die vier Wände des Bungalows an der 2300 Jackson Street beschränkt gewesen. Es erfordert keines großen Gedankensprunges, um sich vorstellen zu können, wie intensiv Klein-Michael, für den die Mutter alles bedeutete, dem Weltbild der Zeugen Jehovas Glauben schenken wollte. Wie verquer Michaels Verhältnis zu seiner Umwelt zu diesem Zeitpunkt war, zeigt eine Anekdote aus seinen Memoiren. Am Ende des Schuljahres, so erzählt er, hätten die Lehrerinnen geweint, wenn sie von ihm Abschied nehmen mussten. Die Zuneigung dieser Lehrerinnen war ihm derart wichtig, dass er ihnen als Geschenke Schmuckstücke brachte, die er aus der Schatulle Katherines stibitzt hatte: „Dass ich diesen Drang verspürte, ihnen etwas zurückzugeben für all das, was ich von ihnen erhalten hatte, zeigt, wie sehr ich sie und die Schule liebte.“
1963 bis 1968 Die positiven Seiten
Drei Stunden täglich dauerten die Proben der Jackson Brothers unter der Ägide von Joseph. Zum Spielen im herkömmlichen, kindlichen Sinn blieb wenig Zeit. Wenn Joseph auf dem Heimweg von der Arbeit um die Ecke kurvte, ließen seine Söhne alles stehen und liegen. Wenn sie nicht bereitstanden, sobald Joseph mit der Probe loslegen wollte, drohte „Trouble“. Michael, so sind sich alle Beteiligten einig, habe am meisten Enthusiasmus an den Tag gelegt. Dazu verfügte er über eine frappierende Fähigkeit, Gesten, Tanzschritte und gesangliche Tricks im Nu nachahmen zu können. „Wenn es mir gelang, Jermaine nachzumachen, erntete ich ermunterndes Gelächter, wenn ich zu singen anfing, dann hörte man mir zu“, schreibt er. Das Repertoire der Gruppe bestand aus Rhythm & Blues- sowie Soul-Hits, die sich zumeist um die üblichen, weltlich-fleischlichen Themen drehten. Der Knirps verstand die wenigsten Texte, aber sein Imitationstalent erlaubte es ihm zu lernen, wie er diese selbst mit seiner Babystimme einigermaßen glaubwürdig interpretieren konnte. Oder wenigstens so, dass sie trotz der unfreiwilligen Komik der Situation, dass ein Kind Lieder mit der Thematik von Erwachsenen sang, nicht einfach nur ulkig wirkten. Die Nachbarjugend zeigte wenig Respekt vor den Ambitionen der Jacksons: Manchmal, wenn sie zu üben anfingen, flogen Steine auf den Bungalow.
Joseph Jackson investierte jeden Cent in die Zukunft seiner Söhne (und damit die Verwirklichung seiner eigenen Träume). Katherine wehrte sich dagegen. Derweil sie sich die größte Mühe gab, aus Zutaten wie „Chitterlings“ (geschmorte Innereien vom Schwein, ein traditionelles Gericht aus der „Soul Food“-Cuisine, der afro-amerikanischen Kochkultur), Kohl und dergleichen ungeliebtem Billigstgemüse einigermaßen schmackhafte Mahlzeiten auf den Tisch zu zaubern, kam Joseph laufend mit neuen Instrumenten und Mikrofonen heim. Er kümmerte sich nicht um ihre Einwände: „Ich war das Haupt der Familie. Ich hatte das letzte Wort. Ich habe Katherines Meinung in der Sache schlicht übergangen.“ Sein Weitblick – nicht zu reden von seiner Investition – trug Früchte. Zum Beispiel hatte er Mikrofone vor seinen Söhnen platziert, lange, bevor sie diese wirklich gebraucht hätten. Als sie nun anfingen, sich an Talentwettbewerben zu beteiligen, zeigte sich, dass er ihnen damit zu einem unbezahlbaren Vorteil verholfen hatte. Die wenigsten Konkurrenten waren an den Umgang mit dem Mikrofon gewöhnt. Die Jacksons hingegen wussten nicht nur, wie man dieses am besten in der Hand hielt, sondern sie konnten es auch noch showgerecht durch die Luft schwingen. Vater Jackson verfügte zudem über ein für seine Generation ungewöhnlich offenes Ohr. Wenn Smokey Robinson und seine Miracles „Tracks Of My Tears“ sangen, lauschte er mit genauso viel Aufmerksamkeit wie seine Söhne. „Obwohl er mit seiner Band den Chicago-Sound von Muddy Waters und Howlin’ Wolf pflegte“, erinnert sich Michael, „erkannte er, dass die beschwingteren, gradlinigeren Sounds, die uns Kids gefielen, durchaus ihren Reiz besaßen. Wir hatten Glück, denn es gab Leute in seinem Alter, die nicht so hip waren. Wir kannten einige Musiker, die der Überzeugung waren, der Sixties-Sound sei unter der Würde von Männern in ihrem Alter. Dazu gehörte unser Vater nicht.“ Am Wochenende unternahm Joseph regelmäßig musikalische Entdeckungsreisen in die Clubs von Gary und Chicago. Am Sonntag konnte er es kaum erwarten, dass Michael vom Gottesdienst heimkam, um ihm von seinen neuesten Entdeckungen vorzuschwärmen. „Von der Kirche direkt ins Showbusiness, das war mein Sonntag“, hat Michael lakonisch festgestellt.
Im Frühjahr 1965 traten die Jackson Brothers erstmals in der Öffentlichkeit auf. Während einer Modenschau für Kinder kredenzten sie drei Lieder, darunter „The Jerk“, ein brandneuer Hit von Don Julian & The Larks. Der Organisatorin der Modenschau passte keiner der beiden von Joseph vorgeschlagenen Namen, weder The Jackson Family noch The Jackson Brothers. Sie meinte, diese würden einen falschen Eindruck verbreiten, nämlich den, dass man es mit einer altmodischen Barbershop-Truppe wie den Mills Brothers zu tun habe (eine tatsächlich aus vier Brüdern bestehende Gesangsgruppe, die von den Roaring Twenties an bis in die achtziger Jahre hinein höchst erfolgreich swingende Gesänge im Stil des Golden Gate Quartett servierte). Ihrem Rat folgend hießen die Jacksons fortan The Jackson 5. Wenig später gewannen sie mit einer Version des Tempations-Hit „My Girl“, wo Jermaine und Michael sich beim Singen der Verse ablösten, den stadtweiten Talentwettbewerb an der Roosevelt High School. Noch mal zwei Monate vergingen, ehe man mit dem Robert-Parker-Song „Barefootin’“ auch beim jährlichen Talentfestival im Gilroy Open Air Stadium von Gary triumphierte. Den Sieg sicherte nicht zuletzt die furiose und natürlich barfüßige Tanzeinlage von Michael während des Gitarren-Solos. Von da an fuhren die Jacksons in ihrem VW-Bus zu so vielen Talentwettbewerben, wie es nur ging. So konnten sie an einem Wochenende gut ein paar hundert Kilometer zurücklegen. Die Shows erforderten totale Konzentration, besonders dann, wenn man in einer fremden Stadt auftrat, wo lokale Bands auf die lautstarke Unterstützung der mitgebrachten Fans zählen konnten. Um eine Siegeschance zu haben, musste man um so viele Klassen besser sein als sie, dass selbst deren Fans nicht abstreiten konnten, dass der Sieg den Eindringlingen von auswärts gehörte. Darum war Joseph Jackson peinlichst darauf bedacht, dass jedes Detail stimmte. Er steckte die Söhne in einheitliche Anzüge, wo von der Schuhspitze bis zum zehntelmillimetergenauen Haarschnitt alles bei den Meistern des Faches abgeschaut wurde. Wenn sich einer der Brüder nur einen Moment lang nicht voll konzentrierte, konnte der Fehler den Auftritt ruinieren, und Joseph, der für die verschwendete Chance das Geld aus dem Fenster geworfen hatte, zur gewalttätigen Weißglut treiben. Zum Glück kam das selten vor, denn die Boys legten sich mit einer Intensität ins Zeug, dass sie nach zwei Songs genau so ausgebrannt gewesen seien wie in späteren Jahren nach einer 90 Minuten dauernden Show. Die Talentshows waren die Lehre der Jackson 5. Joseph habe zwar ein schrecklicher Mensch sein können, sagt Michael, aber er sei auch ein brillanter Manager und Lehrer gewesen. Inzwischen arbeitete dieser nur noch einzelne Tage im Stahlwerk. Die meiste Zeit verbrachte er als Manager der Jackson 5 am Telefon. In dieser Zeit seien die Jacksons als Familie am glücklichsten, sei der Zusammenhalt am stärksten gewesen: „Als es nur uns und unser Talent gab.“ Nahe beisammen, das war auch wörtlich zu verstehen. Katherine und Joseph belegten im Bungalow das Schlafzimmer. Die Boys teilten sich das Kinderzimmer und schliefen in einem dreistöckigen Kajütenbett: Tito und Jermaine zuoberst, Michael und Marlon in der Mitte und Jackie zuunterst. Die drei Mädchen hatten ein Sofabett im Wohnzimmer für sich, Randy bekam dann noch die Couch.
Im Gegensatz zu vielen anderen Soul- und Funk-Gruppen führte der Pfad der Jacksons nicht über die Kirche zum Erfolg. Ganz im Gegenteil. Nach den Talentshows war die nächste Stufe auf dem Jackson’schen Karrieretreppchen ein Engagement bei Mr Lucky’s, einem Nachtclub in Gary. Der Legende nach war die Gruppe dort bald so populär, dass sie jeden Abend fünf Sets spielte, sechs Mal in der Woche. Die Gage betrug 8 Dollar pro Nacht, dazu kamen die Münzen und Banknoten, welche die Gäste, einer alten Nachtklub-Tradition folgend, auf die Bühne warfen. Manchmal waren Michaels Taschen so voll, dass er vor lauter Gewicht fast die Hosen verloren hätte. Bonbons und andere Süßigkeiten standen zuoberst auf seiner Einkaufsliste. Falls es Joseph gelang, für die arbeitsfreie Nacht eine weitere Verpflichtung zu ergattern, wurde diese selbstverständlich ebenfalls wahrgenommen. Unterdessen hatten die Jackson 5 mit dem Schlagzeuger Johnny Porter Jackson (einem Nachbarjungen, der mit Michael & Co. nicht verwandt war) und dem Keyboarder Ronnie Rancifer zwei permanente neue Mitglieder gewonnen, welche ihren Sound merklich druckvoller und vielseitiger machten.
Im Herbst 1966 war Joseph überzeugt, dass seine Truppe reif sei für die ersten Plattenaufnahmen. Er schickte ein Demotape gleich an die allererste Adresse für schwarzen Pop – Motown Records in Detroit, das selbsternannte „Hitsville USA“. Drei Monate später kamen die Aufnahmen zurück. Motown-Gründer Berry Gordy zeigte kein Interesse. Der Rückschlag war nicht allzu schwer verdaulich, konnten sich die Jacksons doch über Arbeit nicht beklagen. Unterdessen fanden sie in mehreren namhaften Nachtclubs in Chicago Anstellung. Außerdem operierten sie im sogenannten „Chitlin’ Circuit“. „Chitlin’“ ist die Kurzform von Chitterlings. Zum „Chitlin’ Circuit“ gehörte eine Reihe von Clubs und Theatern im Osten und im Süden der USA (darunter das berühmte Apollo Theatre in Harlem, New York, The Victory Grill in Austin, Texas, und The Regal Theatre in Chicago), wo schwarze Künstler und auch ein schwarzes Publikum willkommen waren, was noch in den frühen Sixties besonders in den Südstaaten keineswegs eine Selbstverständlichkeit war. Solche Lokale konnten eine Kapazität bis zu 2 000 Zuschauern aufweisen. Die Chitlin’-Circuit-Shows hatten den großen Vorteil, dass an einem Abend jeweils eine ganze Reihe von Künstlern auftrat, darunter manchmal auch ein großer Name. Dreimal hintereinander gewannen die Jackson 5 den wöchentlichen Talentwettbewerb im Regal Theatre von Chicago. Die Belohnung für eine solche Leistung bestand darin, im Vorprogramm eines namhaften Stars gegen entsprechende Bezahlung aufzutreten. Die Jackson 5 zogen das große Los mit den seit Kurzem bei Motown unter Vertrag stehenden Gladys Knight & the Pips, die an dem Abend einen neuen Song ausprobierten, „I Heard It Through The Grapevine“ (im Herbst 1967 erreichte der Titel Platz zwei in den Billboard-Pop-Charts). Nun reiste Joseph Jackson nach New York, um James Brown und Sam & Dave anzuhalten, seine Schützlinge in ihrem Vorprogramm auftreten zu lassen. Beide lehnten die Ehre ab, aber Dave Prater (der Dave von Sam) sorgte dafür, dass die Jackson 5 im Mekka des Soul, dem New Yorker Apollo Theatre, auftreten durften, und zwar beim prestigereichsten Talentwettbewerb überhaupt, dem Superdogs Contest. Das Publikum in Harlem war notorisch für seine kurze Lunte. Wenn ein „Act“ nicht zündete, wurde er ohne falsches Mitleid sehr bald ausgebuht und von der Bühne gejagt. Die Jackson 5 hatten keine solchen Probleme. Am 13. August trugen sie auch hier die Siegertrophäe davon.
In den folgenden Monaten kletterten die Jackson 5 in der Hierarchie der Support Acts rasch höher. Die Stars, in deren Vorprogramm sie auftraten durften, leuchteten von Tag zu Tag heller. Derweil die restlichen Jacksons nach ihren Auftritten das aufregende Leben hinter der Bühne genossen, verbrachte Michael jede freie Minute damit, diese Stars bei der Arbeit zu beobachten. Wenn ihm ein Tanzschritt oder eine Pose Eindruck machte, ließ er nicht nach, bis er diese selbst perfekt einstudiert hatte. Zu den Vorbildern, die er auf diese Weise aus nächster Nähe miterlebte, gehörten die Temptations, The O’Jays und Sam & Dave. Das Gesangs-Quintett The Temptations kam aus Detroit und war 1961 von Eddie Kendricks und Paul Williams formiert worden. Es war bei Motown Records unter Vertrag und jahrelang die erfolgreichste schwarze Gesangsgruppe überhaupt. Mit Wurzeln im Doo-Wop modifizierten die „Temps“ ihren Stil immer wieder, um mit der Zeit zu gehen. Der Erfolg gründete einerseits in den Liedern, die der junge Smokey Robinson im Büro von Motown für sie schrieb, andererseits im Kontrast zwischen dem fragilen Tenor von Eddie Kendricks und dem virilen Bariton von David Ruffin. Die Gesangsgruppe The O’Jays stammte aus Canton, Ohio, kam ebenfalls von Gospel und Doo-Wop her und war bekannt für ihre herzensbrecherischen Bühnenauftritte. Ihr Erfolg beschränkte sich auf die R&B-Charts (damals das musikalische Ghetto für jegliche schwarze Musik), ehe sie viel später, 1972, mit „Back Stabbers“ zum Pop-Erfolg fanden. Sam David Moore kam aus Miami, David Prater aus Ocilla, Georgia. Beide lernten ihr Gesangs-Metier in der Kirche und waren beim trendsettenden Label Stax Records in Memphis unter Vertrag, wo Isaac Hayes zum Stab der Songschreiber gehörte. Zusammen mit David Porter schrieb ihnen dieser das (lebens-)stildefinierende „Soul Man“ auf den Leib, mit dem sie 1967 die Top 3 der R&B- und der Pop-Charts erreichten. Am meisten habe er von Jackie Wilson gelernt, sagt Michael Jackson. Wilson – wie Joe Jackson ein Ex-Boxer – fiel durch seinen dramatischen und emotionsschwangeren Gesangs- und Show-Stil auf. Sein Gesangsstil war vom Rhythm & Blues geprägt und von Little Richard, aber auch von Frank Sinatra und Sammy Davis Junior. Er trug schichtweise Make-up auf und perfektionierte die Kunst, sich mitten im Song auf ein Knie sinken zu lassen, um durch diese Geste der „Aufrichtigkeit“ seinen Worten erst recht Nachdruck zu verleihen. Derweil seine Platten zwischen abgeschmackt und sublim pendelten, konnte er live den plumpsten Gimmick-Song zum Erlebnis erheben. James Brown persönlich brachte Michael Jackson eines Abends in der Garderobe bei, wie man ein Mikrofon loslassen und wieder auffangen konnte, ehe es auf den Boden krachte. James Brown hat diverse Spitznamen: „The Hardest Working Man in Show-Business“, „The Minister of the New New Super Heavy Funk“ – und natürlich „The Godfather of Soul“. Geboren 1928 in Barnwell, South Carolina, war er älter als viele andere Soul-Stars der Sixties. Dank der Bemühungen des Bandleaders Bobby Byrd (der Brown über Dekaden hinweg zur Seite stehen sollte) wurde er in den mittleren vierziger Jahren aus der Reformschule entlassen, wo er wegen Diebstahls gelandet war. Er trat den Gospel Starlighters bei, die sich zur R&B-Combo The Flames wandelten und dann und wann die vorderen Positionen in den R&B-Charts erreichten. Erst 1960 war die Band aber richtig etabliert, 1962 kam der große Meilenstein, das Album Live At The Apollo, das Brown selbst finanzieren musste, weil niemand daran glaubte, dass sich ein Livealbum verkaufen lassen würde. Jetzt warf Brown die letzten Fesseln ab, die ihn mit der konventionellen schwarzen Popmusik verband. Seine Rhythmen wurden vertrackter, sein Gesang noch emotionsgeladener, die mit militärischer Präzision einstudierten Bläsersätze verbreiteten nichtsdestotrotz ein Gefühl von cooler, jazziger Anarchie. Im Juni 1965 veröffentlichte er die bahnbrechende Single „Papa’s Got A Brand New Bag“ (auf der B-Seite fand sich schlicht die Fortsetzung der A-Seite!), die gemeinhin als die Geburtsstunde von Funk gilt.
Die Tatsache, dass Michael den wahren Sinn der Texte, die er sang, nicht verstand – und dies auch wahrnahm – beeinflusste seine Karriere nachhaltig. Weil er sich bei seiner Lied-Interpretation nicht an die ihm rätselhaften Worte halten konnte, klammerte er sich umso stärker an die Ausdrucksmöglichkeiten von Tanz und Bühnenpräsentation. Deswegen war für ihn das Vorbild von James Brown besonders wichtig. Dessen klingenscharfe Tanzeinlagen waren kaum weniger atemberaubend und flexibel als sein Gesang. „Bis dahin hatte es sehr wohl Sänger gegeben, die auch tanzen konnten, und Tänzer, die auch sangen“, schreibt Michael. „Aber wenn man nicht Fred Astair oder Gene Kelly war, konnte man das eine besser als das andere, besonders bei einem Live-Auftritt. Mit James Brown änderte sich das. Wenn er über die Bühne schlitterte, kam ihm kein Spotlight nach. Die ganze Bühne musste mit Scheinwerferlicht getränkt werden, damit man nichts verpasste. So gut wollte auch ich sein.“ Damit machte der kleine Jackson aus der Not – er verstand die Worte nicht, die er sang – ein Credo. Was zählte, war nicht der eigentliche Inhalt der Worte, die es zu singen galt, sondern die Wirkung dieser Worte sozusagen als klangliches Tanzelement im Rahmen der Gesamtshow. Künstler wie Bruce Springsteen und U2, so heißt es in Moonwalk