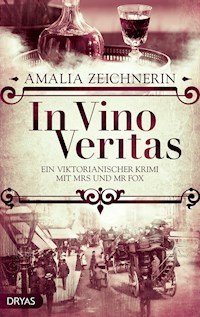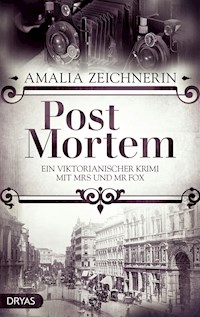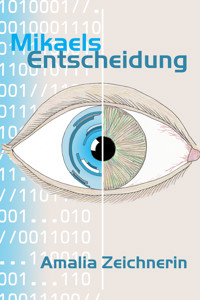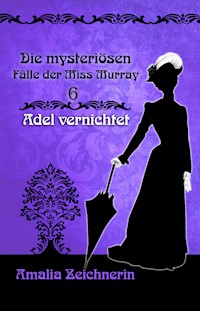5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Schutzengel Turiel versagt bei einem Auftrag und wird zu allem Unglück auch noch von Dämonen gefangen genommen. Der Vampir Richard hat sich mit seinem Schöpfer überworfen, der ihm aus Rache eine Vampirjägerin und ihren Kollegen auf den Hals hetzt. Unabhängig voneinander können Turiel und Richard fliehen. Als sie sich an einer Autoraststätte begegnen, beschließen sie gemeinsam weiterzufahren. Unterwegs treffen sie auf weitere Übernatürliche. Währenddessen entwickelt Turiel romantische Gefühle für den Vampir, aber als Engel ist es ihm verboten, sich zu verlieben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Table of Contents
Titelei
Inhaltswarnungen
Playlist zum Roman
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Danksagung
Impressum
Blutige Flügel
Urban Fantasy Roman
von
Amalia Zeichnerin
Zu den Inhaltswarnungen
Inhaltswarnungen überspringen
Inhaltswarnungen
Blut, Vampirbisse, Verstümmelung, eine vergangene toxische Beziehung, Gewalt, Autounfall, Tod, sexuelle Inhalte, aber keine expliziten Sexszenen, Bodyhorror (wenig). Alles Folgende wird erwähnt, nicht gezeigt: Todesfälle in der Coronapandemie, Genitalien, Folter, Krieg, Pandemien, Naturkatastrophen, Nazis kurz vor dem 2. Weltkrieg
Playlist zum Roman
Carl Orff – Oh Fortuna (aus »Carmina Burana«)U2 – Stay (Faraway, So Close)Queen – Friends will be Friends
Olivia Rodrigo – Vampire
Taylor Swift – Death by A Thousand Cuts
Tito & Tarantula – Cry in the Night
Blutengel – Children of the Night
Deine Lakaien – Love Me to the End
Depeche Mode – Ghosts Again
Sarah McLachlan – Angel
Lewis Capaldi – Heavenly State of Mind
Placebo – Loud Like Love
Imagine Dragons – Demons
Florence + the Machine – Cosmic Love
MUNA – I Know a Place
Poets of the Fall – Maybe Tomorrow is a Better Day
The Goo Goo Dolls – Iris
Beyoncé – Halo
Belinda Carlisle – Heaven is a Place on Earth
Auf Spotify:
https://bit.ly/playlist_urbanfantasy_roman
Kapitel 1 – Turiel
Irgendwo auf dem Land in DeutschlandSamstag, 2. September
»Du solltest nicht betrunken fahren!«, rief Turiel mit Nachdruck dem verschwitzten jungen Mann mit dem zerzausten lockigen Haar zu, der gerade in sein eigenes Auto gestiegen war. Eine feuchtfröhliche Scheunenparty auf dem Land neigte sich dem Ende zu und in einigen Stunden würde die Sonne wieder aufgehen. Turiel hatte neben dem Partygast auf dem Beifahrersitz Platz genommen, aber dieser konnte ihn nicht sehen. Allerdings drehte er sich seitwärts und schaute einen Moment lang durch Turiel hindurch.
»Oh Mann«, nuschelte der Mann mit verwaschener Stimme. Dann kicherte er. »Ich hab wohl ein' im Tee, hör schon Stimmen, die gar nich' da sind.«
»Ich bin aber da«, beharrte Turiel, so laut er nur konnte. »Ich bin dein Schutzengel!« Es war nicht einfach, zu einem Schützling durchzudringen. Die Menschen konnten nicht automatisch jedes Wort hören, dass ihre Schutzengel zu ihnen sagten. Dazu mussten die Engel schon schreien.
Sein Schützling lachte nur und startete den Wagen.
Oh bei allen himmlischen Mächten, das lief überhaupt nicht gut! Turiel musste ihn sofort dazu bringen, den Wagen abzustellen und sich ein Taxi zu rufen! Das war allerdings alles andere als einfach hier draußen auf dem Land. Aber sein Schützling könnte irgendwo anrufen? Sich von einem Freund oder Verwandten abholen lassen?
Hinter ihnen erscholl ein Hupen. Turiel fuhr hastig herum. Fünf einzelne Scheinwerfer. Das mussten Motorräder sein. Wo kamen die auf einmal her? Waren diese Leute auch auf der Scheunenparty gewesen?
Der betrunkene Fahrer raste nun in kurvigen Schlangenlinien weiter. Das Auto schlingerte gefährlich auf der dunklen Straße.
»Ich sage es noch einmal, halte an!«, rief Turiel mit wachsender Verzweiflung.
»Höhö! Du bist nur eine Stimme in meinem Kopf, das kommt garantiert vom Saufen. Warum sollte ich auf dich hören?«
Genug war genug! Turiel platzte der metaphorische Kragen. Er materialisierte sich mitsamt seiner Flügel, obwohl das eigentlich strengstens verboten war. Letztere drückte er so nah es ging an den Körper, da im Auto nur wenig Platz war.
Der Betrunkene schrak mit einem schrillen Schrei zusammen und verriss das Steuer. Innerhalb von Sekunden kam der Wagen von der Fahrbahn ab. Nach einigem Holpern prallte er mit einem lauten, berstenden Knall seitlich gegen einen Baum am Straßenrand. Der Aufprall war so stark, dass sich der Wagen überschlug. Die Welt drehte sich in übelkeiterregender Weise und Turiel schrie auf. Kopfüber hing er in seinem Sitz, blickte benommen um sich. Sollten Autos nicht eigentlich Airbags haben, diese weichen Kissen, die bei einem Unfall zum Einsatz kamen? Warum hatte dieser Wagen keine?
Der Mann neben ihm war völlig still, hatte die Augen geschlossen. Blut rann von seiner Schläfe herab, lief dem Verletzten über den Mund bis auf den Hals. Turiel wurde von einem Zittern erfasst, seine Flügel raschelten. Zögernd, mit bebenden Fingern, legte er eine Hand auf den Hals des Mannes. Kein Puls, nicht mal ein schwacher. Er hielt seine Hand über dessen Nase, um herauszufinden, ob sein Gegenüber noch atmete. Nicht der kleinste Atemzug. »Nein, nein, bitte nicht … öffne deine Augen … komm schon …« Turiel wusste nicht weiter, als das Grauen über ihm zusammenschlug. Eine kalte Gewissheit ergriff ihn: Sein Schützling war tot. Turiel verkrampfte seine Hände ineinander, während er versuchte zu begreifen, was gerade passiert war. Die Verletzung an der Schläfe war gewiss nicht schuld an dessen Tod. Vielleicht hatte er sich durch eine besonders heftige Halsbewegung bei dem Aufprall das Genick gebrochen? Turiel war zwar mit der menschlichen Anatomie einigermaßen vertraut, aber er war kein Mediziner. Aber eines war ihm klar, er würde den Mann nicht reanimieren können. Jede Hilfe kam zu spät!
Mit Tränen in den Augen öffnete Turiel die Tür auf seiner Seite und krabbelte aus dem Fahrzeug. Das Zittern wurde schlimmer, er umarmte sich selbst, wiegte sich vor und zurück, während das Entsetzen wie ein eisiger Sturm durch sein Inneres rauschte. Es war allein seine Schuld, er hatte den Mann erschreckt. Ohne das hätte sein Schützling es vielleicht sogar heil nach Hause geschafft, trotz seiner Trunkenheit.
Am liebsten hätte Turiel laut geflucht, aber das durfte er nicht. Auch nicht lautlos. Er hätte sich auch nicht materialisieren dürfen! Allmählich sickerte es in sein Bewusstsein: Bei diesem Schutzengelauftrag hatte er auf schändliche Weise versagt. Weitere Tränen liefen ihm über die Wangen, seine Schultern bebten von den Schluchzern, die ihn nun schüttelten. Er hatte diesen jungen Mann nicht näher gekannt, aber dessen Tod … entsetzlich! Dumpfe Verzweiflung wirbelte durch seinen Geist und er wischte sich über die Augen.
Allerdings bekam er keine Gelegenheit, noch weiter darüber nachzudenken, denn mittlerweile umkreisten fünf Motorräder den verunglückten Wagen. Eine Art grölendes Johlen dröhnte durch die Nacht. Wie unangemessen, angesichts des tragischen Unfalls. Er straffte sich und das Zittern ließ etwas nach. Denen würde er was erzählen!
Das Verbot, sich zu materialisieren, war ihm in dieser Situation herzlich egal, aber er verkleinerte seine Flügel so sehr, dass sie von vorn nicht sichtbar sein würden. Die Scheinwerfer der Motorräder blendeten ihn. »Rufen Sie bitte einen Krankenwagen! Leider hat der Fahrer den Unfall nicht überlebt.«
Erst nachdem er diese Worte ausgesprochen hatte, nahm er den Geruch wahr. Etwas Bitteres … und Schwefel. Auch das noch, das waren keine Menschen, sondern Ausgeburten der Hölle! Die Verzweiflung in seinem Inneren wuchs ein weiteres Mal, ballte sich wie ein eisiges Knäuel in seiner Magengegend. Turiel erstarrte, unfähig, einen weiteren Gedanken zu fassen.
»Hehe, das könnte dir wohl so passen, Engel«, rief einer von ihnen mit tiefer Stimme. Sie mussten ihn ebenfalls am Geruch erkannt haben! Bevor er bis drei zählen konnte, hatten sie ihn umkreist. So konnten sie auch seine Flügel sehen, obwohl diese nun kleiner waren.
»Fesselt ihn!«, befahl der Dämon mit der tiefen Stimme. In der Dunkelheit war nicht viel von ihm zu erkennen, aber im Licht der Scheinwerfer war sein langes, welliges Haar zu sehen, ebenso der lange, mit Schuppen besetzte Schwanz, der unruhig über den Boden strich.
Drei der Dämonen, die grässlich nach Schwefel stanken, verschnürten ihn rasch wie ein Paket, mit einem festen schwarzen Seil. Das alles ging so schnell, dass er nicht die innere Ruhe fand, sich wieder zu entmaterialisieren. Beim Himmel, er musste auf eine günstigere Gelegenheit warten! Anfangs wehrte Turiel sich noch, trat sie und zerrte an seinen Fesseln. Aber gegen fünf dieser Wesen hatte er beim besten Willen keine Chance. Eines von ihnen hatte schuppige Haut, wie ein Reptil.
Kalte Angst fraß sich in sein Inneres, füllte ihn aus, zerbrach etwas in ihm. Aber auch das dämonische Seil verhinderte die Verwandlung. Es brannte ihm auf der Haut wie Feuer. Das hatten diese Abscheulichkeiten garantiert aus der Hölle mitgebracht! Turiel begann erneut zu zittern. Was hatten diese Ungeheuer mit ihm vor?
Kapitel 2 – Richard
An einem anderen Ort in Deutschland, auf dem Land
»Komm mit mir nach Frankreich.« Ludwigs Worte klangen nicht wie eine Bitte, eher wie ein Befehl. Richard wand sich unwillig aus der Umarmung seines Schöpfers.
Ludwigs silbergraues Haar schmiegte sich in leichten Wellen an seinen Kopf und wie immer trug er einen eleganten dreiteiligen Anzug, als wolle er zu einer Einladung zum Abendessen oder ins Theater aufbrechen. Eine schwarz-silbern gemusterte Fliege zierte den Kragen seines hellgrauen Hemdes.
»Nein, das werde ich nicht«, erwiderte Richard mit fester Stimme und trat einen Schritt zurück. »Bloody hell, ich bin nicht den ganzen weiten Weg von England hierhergekommen, um ständig umzuziehen. Du hast doch erst vor wenigen Monaten diesen Resthof gekauft und umbauen lassen. Und jetzt willst du das alles aufgeben und nach Frankreich umsiedeln?! Bist du von allen guten Geistern verlassen?«
In Richards Innerem brodelten Ärger und Enttäuschung. Verdammt, so war es schon immer mit Ludwig gewesen! Er langweilte sich schnell. Suchte immer wieder neue Herausforderungen. Hatte merkwürdige Einfälle, die er unbedingt umsetzen wollte. Wahrscheinlich war er im Grunde seines Herzens zutiefst unzufrieden mit seiner vampirischen Existenz? Anders konnte sich Richard die Rastlosigkeit seines Schöpfers nicht erklären. Aber das hätte dieser niemals zugegeben.
»Aber ich dachte, du magst die französische Kultur?«, erwiderte Ludwig schmollend.
»Ja, sicher«, räumte Richard ein. »Ich mag auch italienische Opern und japanische Haikus, manches aus der amerikanischen Popkultur und und und … aber verflixt noch mal, das alles heißt nicht, dass ich dorthin ziehen möchte. Ich müsste ja ständig umziehen, um all das vor Ort zu sehen. Ach, verdammt, Ludwig, warum bist du immer so rastlos? Wir wollten uns doch hier etwas Kleines aufbauen.«
»Ist das wieder so ein englisches Ding von dir, dieser Hang zum Nestbau? Home Sweet Home und so?«
Richard ging nicht darauf ein. Stattdessen sagte er: »Du hast mir versprochen, dass wir länger hierbleiben. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Es gibt doch überhaupt keinen Anlass, das alles aufzugeben. Oder hab ich irgendetwas verpasst?«
»Ich habe aber keine Lust, in der deutschen Provinz zu versauern!«, herrschte Ludwig ihn an. »Ich will noch etwas von der Welt sehen.«
Richard lachte freudlos auf. »Ha! Als ob du das nicht schon längst hättest, in all den Jahrzehnten. Und wir haben das Wohnmobil. Wir können jederzeit auf Reisen gehen, wenn dir … wenn uns danach ist.«
»Aber das reicht mir nicht mehr«, entgegnete Ludwig mit gerunzelter Stirn. Als Mensch war er mit zweiundfünfzig durch eine Vampira dem Tod von der Schippe gesprungen. Sie hatte ihm das Leben gerettet, als er in einen Kutschenunfall geraten war. Zumindest hatte er das erzählt. Richard hatte keine Ahnung, ob es die Wahrheit war. Aber es erklärte Ludwigs Drang, viel erleben zu wollen, weil er wusste, wie schnell alles enden konnte. Selbst seine vampirische Existenz.
Mit einem Mal veränderte sich die Miene seines Schöpfers, ein schmeichelndes Lächeln umspielte seine Lippen. »Stell dir doch mal vor, wie romantisch das wäre – wir zwei in Paris. Wir könnten uns den Eiffelturm ansehen und an der Seine entlangspazieren. Uns unter die Nachtschwärmer mischen. Das Moulin Rouge besuchen. Die Exponate im Louvre bewundern.«
»Du hoffnungsloser Romantiker!« Richard bedachte seinen Schöpfer gern mit solchen freundschaftlichen Beleidigungen, was diesen am Anfang irritiert hatte. »Aber mal ehrlich, das alles könnten wir auch auf einer Reise machen. Du kannst mich nicht nach Belieben herumschieben wie eine Schachfigur! Ich bin doch nicht dein Spielzeug! Das hättest du wohl gern, oder?«
Das Lächeln verschwand aus Ludwigs Gesicht.
Richard war noch nicht fertig. Noch lange nicht. »Hast du dir vielleicht mal darüber Gedanken gemacht, was ich möchte?«
Ludwig trat näher an ihn heran, griff nach seiner Hand und hauchte einen Kuss darauf. Richard kannte das schon, sein Schöpfer wollte sich nur bei ihm einschmeicheln, um später doch seinen eigenen Kopf durchzusetzen. »Erzähl es mir«, sagte er mit einem Tonfall, der wohl verführerisch klingen sollte. Oder zumindest interessiert. Aber die Masche zog nicht mehr bei Richard. Schon lange nicht mehr.
Er fuhr sich über die Stirn. Er wusste nicht weiter, also sagte er das Erstbeste, das ihm einfiel. »Lass uns doch einfach einige Jahre hier auf dem Resthof bleiben. Wir könnten es uns so richtig schön gemütlich machen. Und wenn uns das irgendwann langweilig wird, schauen wir weiter? Wir könnten auch hier in Deutschland ein bisschen herumreisen, oder vielleicht einen Abstecher in die Schweiz machen, oder die Niederlande. Oder Österreich?«
Ludwigs Mund bekam einen harten Zug. »Nein, das will ich nicht. Komm mit mir nach Frankreich«, wiederholte er. »Wenn wir erst einmal in Paris sind, wirst du schon sehen, wie sehr es dir dort gefällt. Dein Französisch ist doch auch recht gut.«
Richard ballte eine Hand zur Faust. Seine Ratlosigkeit verwandelte sich allmählich in Wut und das war bei weitem nicht das erste Mal, seit er wieder mit Ludwig zusammenlebte. Und wie immer hatte sich nichts geändert. Ludwig riss sich eine Zeit lang zusammen, es war richtig schön, aber dann gingen die Streitereien los … Mit einem Mal durchfuhr Richard eine Erkenntnis, die er bisher nicht hatte wahrhaben wollen. Was ihm nun klar vor Augen stand, hatte er schon lange geahnt, aber immer wieder verdrängt. Weil er Ludwig noch immer liebte. Oder sich das zumindest einbildete. Schluss damit, es war Zeit, endlich mal Tacheles zu reden. »Immer geht es dir nur um dich! Es ist dir völlig gleichgültig, was ich empfinde oder was ich möchte. Und dann überredest du mich oder versprichst mir, dass alles anders wird. Lügen. Nichts als Lügen!« Vielleicht würde er das später bereuen, aber er redete sich immer mehr in Rage. »Das ist doch keine Basis für eine Beziehung! Ja, du bist älter als ich. Aber das ist kein Grund, mich so zu behandeln. Du bist nicht mein Vater. Ich bin kein Kind, dem du alles vorschreiben kannst!«
»Ich bin dein Schöpfer«, grollte Ludwig, dessen Gesicht sich rötete. »Das wiegt schwerer als das Band zwischen einem Vater und seinem Sohn.«
»Das behauptest du doch nur, weil es dir so in den Kram passt«, schleuderte Richard ihm entgegen. Endlich erkannte er das ganze Ausmaß ihrer verkorksten Beziehung. All die Streitereien. Wie Ludwig immer wieder versuchte, ihn zu manipulieren. Seine Lügen und Schmeicheleien. Und so würde es ewig weitergehen. Wenn Richard nicht einen Schlussstrich zog. Und dieses Mal für immer. Wenn er ganz ehrlich zu sich selbst war, hatte er sich schon vor Wochen, vielleicht sogar Monaten innerlich aus dieser Beziehung verabschiedet. Er hatte es nur noch nicht wahrhaben wollen.
Richard verschränkte die Arme vor der Brust und wappnete sich für die nächsten Worte. Mit einem Mal überkam ihn eine große Ruhe. »Ich habe genug von dir«, sagte er leise, aber immer noch deutlich hörbar. »Ich mag dir nicht das Wasser reichen können, aber ich kann so nicht weitermachen. Es ist aus.«
Ludwig schenkte ihm ein höhnisches Lächeln. »Das hast du schon einmal gesagt, damals. Und du bist doch zu mir zurückgekommen.«
Richard ließ sich davon nicht beeindrucken. Nicht mehr. »Ich verlasse dich.«
Ludwig lachte herablassend. »Das schaffst du nicht!«
Richard zuckte mit den Schultern. »Es wäre nicht das erste Mal.«
Ludwigs Miene versteinerte. »Du wirst mich nicht verlassen.« Es klang nicht wie eine Feststellung, auch nicht wie eine Vermutung. Eher wie ein weiterer Befehl.
Richard schleuderte ihm die nächsten Worte wie Wurfdolche entgegen. »Okay, ich rede jetzt mal Klartext. Wie deine Landsleute das auch immer so gern machen. Du manipulierst und betrügst mich. So war es schon immer zwischen uns. Du hast mir versprochen, dass es anders werden würde, dass du dich bessern willst. Nichts davon ist passiert. Und ich glaube, du hast mich nie geliebt. Nicht wirklich. Du wolltest nur jemanden haben, über den du Macht hattest. Und vielleicht einen Gefährten, um nicht so allein zu sein. Aber ich bin deine Spielchen leid! Warum sollte ich auch nur eine Nacht länger bei dir bleiben?«
Ludwigs hellblaue Augen verwandelten sich in Eis. »Überlege dir gut, was du tust«, sagte er mit schneidender Stimme. »Weil ich dich dieses Mal jagen lassen werde, wenn du mich verlässt. Ich kenne Leute, die Leute kennen, die … den Rest kannst du dir sicherlich denken.«
Richard presste die Lippen aufeinander und trat einen Schritt zurück. »Du willst mir doch nur Angst machen.«
Ludwig trat einen Schritt auf ihn zu und drängte Richard an die Wand. Im nächsten Moment packte er ihn am Kragen seines Hemdes, zog ihn näher an sich heran, während er die nächsten Worte ausspie: »Oh nein, es ist mir bitterernst! Wir zwei Kinder der Nacht gehören zusammen, auf ewig.«
Richard versuchte, sein Gesicht wegzudrehen, aber Ludwig war nicht fertig und hielt ihn noch immer herrisch am Kragen fest. »Ich werde jetzt in die Stadt fahren, ich brauche frisches Blut. Und ich will, dass du hierbleibst und einmal in Ruhe über deine Verfehlungen nachdenkst.«
Richard war mit einem Mal nach Lachen zumute. Dass ausgerechnet Ludwig ihm mit Verfehlungen kam! Sein nächster Gedanke war, ein weiteres Mal zu widersprechen. Aber dann kam ihm eine viel bessere Idee. Er senkte den Blick, gab sich reuevoll. »Vielleicht hast du recht.«
Ludwig ließ Richards Kragen los. Väterlich tätschelte er dessen Schulter, seine Miene entspannte sich. »Na, siehst du, das war doch gar nicht so schwer. Wir können später noch einmal miteinander reden, wenn ich wieder da bin. Im Kühlschrank ist noch eine Blutkonserve, falls du Durst bekommst.«
Richard bedankte sich, noch immer in diesem falschen, reuevollen Ton, und Ludwig verließ den Raum.
Wenig später hörte er den Mercedes seines Schöpfers knirschend über den Kies in der Auffahrt fahren. Viel Zeit blieb ihm nicht, nun war Eile angesagt. Einen Moment lang stand er wie erstarrt, weil die Gefühle ihn übermannten. Ein Knäuel aus Wut, Enttäuschung und Ärger. Und das, was er einst für Liebe gehalten hatte. Was immer da gewesen war, verabschiedete sich lautlos durch die Hintertür seines Geistes und es fühlte sich endgültig an. Er war besser dran ohne Ludwig, ganz bestimmt …
Richard straffte sich. Er konnte nun nicht über all das nachdenken und seinen Gefühlen nachspüren, das musste warten. Sein erster Gang führte ihn zum Schlüsselbord neben der Eingangstür. »Bingo!«, rief er. Der kleine Schlüsselbund für das Wohnmobil hing am Bord. Ludwig war sich seiner Sache offenbar sehr sicher. Der Kerl war einfach zu sehr von sich und seiner Macht über Richard eingenommen. Weder respektierte er ihn, noch nahm er ihn ernst. Anderenfalls hätte sein Schöpfer diese Schlüssel garantiert mitgenommen.
»Fuck you, Ludwig«, murmelte Richard. Das Wohnmobil war teuer gewesen, obwohl es gebraucht war. Aber Ludwig hatte im Laufe seiner langen untoten Existenz viel Geld angehäuft, womit er immer mal wieder geprahlt hatte. Durch das Geld hatte er auch diesen Resthof kaufen und umbauen können. Sie wohnten hier weitab vom Schuss, ungestört von neugierigen menschlichen Nachbarn.
Wie alle übernatürlichen Wesen hielten Vampire ihre Existenz geheim. Ganz war das nicht gelungen. Es gab immer noch – oder genau genommen schon wieder – Menschen, die sich der Vampirjagd verschrieben hatten. Selbst heute, in diesen aufgeklärten Zeiten, in denen die meisten Leute alles Übernatürliche als abergläubischen Humbug, Folklore oder Märchen abtaten. Richard wischte diese unangenehmen Gedanken ebenso beiseite wie die Drohung Ludwigs. Wenn du mich verlässt, werde ich dich jagen lassen.
So schnell es ging, packte er alles Wichtige zusammen. Seine Hände zitterten, aber er ließ sich davon nicht aufhalten. »Nur ruhig Blut bewahren«, sprach er sich selbst Mut zu und musste im nächsten Moment über den verirrten Wortwitz schmunzeln. Um sich abzulenken, summte er die Melodie des Songs »Heaven is a Place on Earth« von Belinda Carlisle. Den hatte er schon damals in den 1980ern gemocht.
Richard griff nach seinem gefälschten Personalausweis und sammelte alles an Bargeld zusammen, das er im Haus finden konnte. Zum Glück hatte er vor rund vier Wochen die Kombination für den Safe herausbekommen. Rasch öffnete er ihn, fächerte die Banknoten auseinander und überschlug die Summe. Wie gut, es würde für eine Weile reichen. Ludwig hatte ein Bankkonto, Richard nicht. Das war mehr als ungünstig, aber irgendwie würde er schon klarkommen.
Den Laptop und einen Koffer voll Kleidung. Mäntel, Jacken und Schuhe. Und den feinen Anzug, auf den wollte er auf keinen Fall verzichten. Er packte auch eine Krawatte dazu. Die Blutkonserve aus dem Kühlschrank ebenfalls. Diese stammte von einem Schwarzmarkt, der über das Internet abgewickelt wurde. Zumindest hatte Ludwig ihm das erzählt, sich aber geweigert, Richard entsprechende Zugangsdaten zu geben. Wie sehr das zu diesem gnadenlosen Kontrollfreak passte!
Richard holte seinen Führerschein, der ebenfalls eine Fälschung war. Die Fahrzeugpapiere für das Wohnmobil befanden sich in einer der Schubladen der kleinen Kommode im Flur. Die Kiste mit den von Ludwig kürzlich erworbenen Zaubern mochte sich ebenfalls als nützlich erweisen. Und noch ein paar weitere Dinge.
Entgegen dem Klischee, das man in so vielen Vampirromanen las, schliefen weder er noch sein Schöpfer in Särgen. Die waren einfach nur abscheulich unbequem und sorgten für Rückenschmerzen. Wer wollte sich das antun? Was dagegen der Wahrheit entsprach: Alle Vampire benötigten ein paar Krümel Heimaterde unter ihren Betten. Deshalb griff er nach dem Beutel mit der Erde aus England, den er in seinem Kleiderschrank aufbewahrte.
Das Wohnmobil verfügte über einen Alkoven mit einer Schlafstätte und die Fenster dort waren abgedichtet, sodass kein Sonnenlicht hindurchdrang. Er würde einfach etwas von der Erde ringsum verstreuen, dann konnte er dort übertagen.
Aber wo sollte er hinfahren? Heim nach England? Nein, viel zu offensichtlich. Falls Ludwig ihn verfolgen würde, war die Strecke nach England sicherlich die erste, die er in Betracht zog. Vermutlich war es besser, erst einmal kreuz und quer durch Deutschland zu reisen? Um seinen Schöpfer von einer möglichen Fährte abzubringen? Etwas anderes fiel ihm nicht ein. Zu sehr tobte das Chaos seiner Emotionen wieder durch ihn hindurch, das er in den Minuten zuvor verdrängt hatte. Er hatte eine verdammte Wut auf diesen Mistkerl. Warum war er nicht schon längst abgehauen? Aber Richard kannte den Grund dafür nur allzu gut. Er hatte sich ihre Beziehung schöngeredet, wieder und wieder. In seiner Magengegend bildete sich ein schmerzhafter Knoten und seine Hände zitterten schon wieder. Er ballte sie ein paar Sekunden lang zu Fäusten, das half ein bisschen. Auf der Fahrt würde er über alles nachdenken können.
Nachdem Richard seine wenigen Habseligkeiten verstaut hatte, setzte er sich hinters Steuer und startete das Gefährt. Innerhalb weniger Minuten hatte er die Landstraße erreicht, die zur Autobahn führen würde. Er schaltete das Radio ein. Taylor Swifts Stimme erklang, sie sang »Death by a thousand cuts«. Ein Tod durch tausend Schnitte? Eine historische Foltermethode, wenn er es richtig in Erinnerung hatte. Ihm fiel der traurige Text des Songs auf, der von einer schmerzhaften Trennung erzählte. Das ließ ihn unweigerlich wieder an die desolate Beziehung mit Ludwig denken. Das war vorbei, endgültig. Richard brauchte einen Plan. Noch einen, um genau zu sein, aber den würde er unterwegs schmieden müssen. Etwas anderes blieb ihm kaum übrig.
Kapitel 3 – Turiel
Die Dämonen hatten Turiel in ein offenbar verlassenes Gebäude geschleift, eine alte Scheune, in der noch einige verrostete landwirtschaftliche Geräte herumlagen. Dort hatten die höllischen Kreaturen ihm weitere dieser Höllenfesseln angelegt, an den Händen und Füßen.
»Tja, das hast du nun davon, Engel!« Voller Verachtung spuckte der Dämon aus.
Der Schmerz fraß sich tief in Turiels Rücken hinein, brennend wie Feuer. Turiel biss sich auf die Lippe und schmeckte Blut, metallisch und süß zugleich. Er wollte vor den Dämonen nicht weinen. Aber der Schmerz überwältigte ihn schon bald und Tränen liefen ihm über die Wangen. Turiel versuchte verzweifelt sich aus dem Griff der Höllenkreaturen winden, aber drei von denen hielten ihn mit eiserner Härte fest. Die anderen zwei schnitten ihm die Flügel am Ansatz ab, mit scharfen Klingen. Die gefiederten Teile gehörten nicht nur zu seinem Körper, sie waren auch wie eine Verlängerung seines ganzen Wesens. Und er konnte nichts dagegen tun, dass sie ihm genommen wurden! Die Tränen kribbelten ihm auf dem Gesicht, während sich der Schmerz noch tiefer in ihn hineinpresste und ihm die Luft zum Atmen raubte.
Die hellgraue Jacke und den pastellblauen Pullover hatten die höllischen Wesen ihm ausgezogen und achtlos in eine Ecke geworfen. Und nun säbelten sie an seinen Flügeln herum wie schlecht ausgebildete Schlachter. Wegen der abscheulichen Fesseln aus der Hölle, die entsetzlich brannten, gelang es ihm nicht, sich zu entmaterialisieren.
Turiel presste die Lippen aufeinander, schmeckte wieder das Blut. Er wollte diesen Ungeheuern nicht die Genugtuung geben, ihn vor Schmerz schreien zu hören. Aber was hatten die mit ihm vor? Ohne Flügel konnte er überleben. Die Frage war nur, würden sie es bei den Flügeln belassen, oder so lange auf ihn einprügeln, bis sein materialisierter Körper den Geist aufgab? Kalte Angst durchfuhr ihn. Vor noch mehr Schmerzen, von der tödlichen Art. Er würde zwar nicht vollends ausgelöscht werden, so viel Macht hatten diese Kreaturen nicht. Aber sie konnten diesen Körper töten und das wäre eine Katastrophe! Nicht nur die damit verbundenen Schmerzen ängstigten ihn. Ein materialisierter, aber zu Tode gefolterter Körper wäre noch mehr, für das er sich im Himmel verantworten musste …
»Seid ihr endlich fertig?«, knurrte ihr Anführer. Das Wesen hatte eine gespaltene Zunge und spitz zulaufende Ohren, in der mehrere schwarze Ohrringe steckten.
»Gleich, gleich!«, erwiderte einer der anderen.
Turiel biss die Zähne zusammen, aber das half nichts. Wäre er doch ein Mensch gewesen! Dann hätte er vielleicht die Gnade einer Ohnmacht erlebt. Aber er blieb bei vollem Bewusstsein. Noch nie in seiner Existenz hatte er solche Schmerzen empfunden, die mittlerweile brennend durch seinen ganzen Körper zogen. Sie trieben ihm weitere Tränen in die Augen und schüttelten sein ganzes Inneres durch. Was war ein Engel schon ohne Flügel? Warum war er nicht vorsichtiger gewesen?!
In diesem Moment erscholl dröhnend ein Chorgesang, der von Instrumenten und Paukenschlägen flankiert wurde. O Fortuna! Velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vita detestabilis … Die »Carmina Burana« von Carl Orff. Angesichts der drückenden, brennenden Schmerzen brauchte Turiel einen Moment, um zu begreifen, dass es ein Smartphone war, das diese Musik erklingen ließ.
Einer der Dämonen, der mit dem schuppenbesetzten Schwanz, nahm das Gespräch an. »Was? Ja, die Flügel hat das Geflügel gleich nicht mehr.«
Turiel wurde speiübel, als der Dämon mit der gespalteten Zunge ihm lachend seine abgetrennten Flügel hinhielt und damit herumwedelte, als ob es riesige Fächer seien. »Das wars dann, keine Ausflüge mehr.«
»Was … was habt ihr mit mir vor?« Die Tränen brannten ihm auf dem Gesicht. Aber das war nichts im Vergleich zu dem Feuer, das durch seinen Rücken tobte.
»Das merkst du schon noch früh genug«, sagte der Geschuppte und steckte das Telefon wieder weg. Er wandte sich an die anderen Dämonen. »Meine hässlichen Abscheulichkeiten, wir kümmern uns nachher weiter um das Geflügel. Das kann erst mal hierbleiben, wir haben es ja gefesselt. Wir sollen uns mit Jhensyt treffen, so schnell wie möglich. Also, worauf wartet ihr noch? Auf gehts!«
»Aber … wenn es sich entmaterialisiert?«
Der angesprochene Dämon steckte sein Handy ein und machte eine wegwerfende Geste. »Pah, das wird es nicht schaffen. Nicht mit unseren Fesseln.«
Keiner der anderen protestierte. Offenbar war dieser Jhensyt sehr wichtig für sie. Turiel hatte von dieser Kreatur bisher noch nicht gehört. Achtlos ließen sie die blutigen Flügel fallen.
Einer der Dämonen grinste maliziös. »Bis nachher, du federloses Federvieh.« Sie alle verließen die Scheune. Schließlich erklang das Motorengeräusch ihrer Bikes.
Ein paar Minuten lang hatte er nur noch Kraft zu weinen, als ihm seine gesamte Situation klar wurde. Die abgehackten Flügel und der reißende Schmerz. Die Verzweiflung, dass sein Schützling durch seine Schuld gestorben war. Die Frage, was die Dämonen mit ihm anstellen würden, wenn sie zurückkehrten. Dieser letzte Gedanke riss ihn schließlich aus seiner Erstarrung und dem Weinen.
Die Dämonen waren nicht hier. Bestimmt war das seine einzige Chance und er musste sie nutzen! Gott allein mochte wissen, wie lange die scheußlichen Wesen unterwegs sein würden. Leider hatte der Dämon recht: Turiel konnte sich nicht mehr entmaterialisieren. Nicht nur wegen der brennenden Schmerzen, die die Fesseln und seine Wunden verursachten.
Im Himmel gab es zahlreiche Beobachtungssysteme, die auch die Engel bis zu einem gewissen Grad überwachten – zumindest im unkörperlichen Zustand. Aber auch dieser Zustand musste makellos sein. Wenn er sich ohne Flügel entmaterialisierte, erschien sein Abbild garantiert irgendwo in den himmlischen Überwachungssystemen und würde Fragen aufwerfen. Ein Engel ohne Flügel war undenkbar, eine Abscheulichkeit, fast wie ein gefallener. Oder ein Dämon.
Und wenn sie erst einmal auf ihn aufmerksam geworden waren, würde er sich umgehend für den Verlust seiner Flügel und den Tod seines Schützlings verantworten müssen. Das konnte schwere Strafen nach sich ziehen. Er hatte entsprechende Geschichten gehört. Aber er war sich nicht sicher, welche Strafe genau ihn erwartete. Und Gott allein wusste, ob die himmlischen Mächte bereits im Bilde waren – darüber, dass sein Schützling den Unfall nicht überlebt hatte. Er musste fliehen! Nicht nur vor den Dämonen, sondern auch vor seinen eigenen Leuten.
Verzweiflung spülte über ihn hinweg wie eine hohe Woge, die alles mit sich riss. Ein frostiges Zittern erfasste seinen Leib. »Tief durchatmen«, sprach er sich selbst Mut zu, aber das half nur wenig. Wie um alles in der Welt sollte er sich von den Fesseln befreien?
Harry Houdini fiel ihm plötzlich ein, der Entfesselungs- und Zauberkünstler aus dem frühen 20. Jahrhundert. Er hatte einmal eine Vorstellung von diesem in New York gesehen, als er einen Schützling begleitet hatte, eine junge Dame. Turiel versuchte sich an die Einzelheiten zu erinnern. Aber das brachte leider nichts. Was Houdini damals gezeigt hatte, bezog sich nicht auf Fesseln, sondern auf Zaubertricks. Nein, was Turiel brauchte, war ein scharfer Gegenstand, mit dem er seine Handfesseln durchtrennen konnte. Er blickte sich um. Es war dunkel in der Scheune, aber ein wenig Mondlicht drang herein und als Engel hatte er auch in dieser materialisierten Form eine sehr gute Sicht. An der gegenüberliegenden Wand entdeckte er die Umrisse einer Säge.
Schweiß und Blut liefen an ihm herunter, während er, gefesselt wie er war, über den kalten Steinboden kroch. Nun brannte nicht nur sein Rücken, sondern auch seine Knie, die er sich bald wundscheuerte. Wie erniedrigend das war, hier wie eine Schlange über den Boden zu kriechen. Aber was blieb ihm anderes übrig?
Endlich erreichte er die Wand, an der die Säge hing. Weitere Werkzeuge waren dort ebenfalls aufgehängt, darunter auch eine Mistgabel und ein Hammer. Vorsichtig streckte er seine gefesselten Hände aus, die schweißnass waren. Die Säge war von Rost bedeckt und möglicherweise schon recht stumpf, aber er entdeckte keine anderen Werkzeuge, die hilfreicher gewesen wären. Turiel musste seine Arme verbiegen, um einen guten Winkel zu finden, mit dem er das Sägeblatt an das Seil bringen konnte, das um seine Hände geschlungen war.
Stöhnend begann er zu säbeln. Zuerst wirkte es so, als ob das überhaupt nichts brächte, aber nach und nach lösten sich die ersten Fasern des Seiles. Das spornte ihn an, weiterzumachen. Nur nicht aufgeben! Dann würde auch endlich das fürchterliche Brennen aufhören.
Er konnte nicht einschätzen, wie lange es dauerte … eine halbe Ewigkeit. Aber endlich war das letzte Stück Seil durchtrennt. Hastig entfernte er es von seinen Händen und kümmerte sich danach um die Fesseln an den Füßen.
Diese waren sehr fest und es dauerte kostbare Minuten, bis er die Knoten öffnen konnte. Danach stand er auf und schwankte einen Moment lang. Ihm wurde schwindlig und er musste sich an der Wand abstützen. Der Geruch seines Blutes lag schwer in der Luft. Turiel warf einen letzten Blick auf seine Flügel. Ob er sie mitnehmen sollte? Ob man sie wieder annähen konnte? Schaudernd trat er darauf zu. Aber nein, sie waren so sehr zerstört und zerrissen, dass jede Hilfe zu spät kam. Nähen kam sicherlich auch nicht in Frage. Selbst wenn es möglich gewesen wäre, er konnte nicht einfach in ein Krankenhaus spazieren und dort darum bitten.
Turiel raufte sich das lange Haar, rieb sich über das Kinn. Es war klar, was das bedeutete. Im Himmel hätte er ein paar neue Flügel beantragen können. Aber zuerst hätte er sich verantworten müssen, wegen des Autounfalls. Nein, das konnte er auf keinen Fall tun, er wagte es nicht. Turiel gab einen ächzenden Laut von sich, der all das zusammenfasste, was ihn beschäftigte: Seine Wunden und dass er nun völlig auf sich allein gestellt war. Zum ersten Mal in seiner langen Existenz als Engel.
Während die Schmerzen weiter in seinem Rücken und seinen aufgescheuerten Knien brannten, fragte er sich: Wohin sollte er fliehen? Und womit? Er konnte nicht mehr fliegen, aber zu Fuß würde er nicht weit kommen. Sein materieller Körper hatte gewisse Grenzen und allmählich wurde ihm kalt. Er griff nach dem zerknitterten Pullover und der Jacke, zog beides an. Die Berührung des Stoffs auf seinem Rücken tat scheußlich weh, aber es ging nicht anders. Turiel gab ein schmerzvolles Stöhnen von sich und schaute sich in der Scheune um. Ganz am anderen Ende lehnte ein klappriges, rostiges Fahrrad an der Wand, an dem auch eine kleine Luftpumpe befestigt war. Er wusste, wie man diese bediente, hatte es schon mal bei einem Menschen gesehen. Turiel versuchte sein Glück und tatsächlich gelang es ihm, die schlaffen Reifen des Fahrrads aufzupumpen.
Vielleicht konnte er sich damit zu einer Straße durchschlagen? Nur weg von hier, so schnell es ging! Ein letzter bedauernder Blick auf die zerfetzten Überreste seiner Flügel. Turiel war nach Schreien und Heulen zumute, aber er beherrschte sich. Er durfte jetzt nicht die Fassung verlieren! Turiel schwang sich auf das Rad und verließ die Scheune.
Sein Gefährt war wie befürchtet ziemlich klapprig. Er hatte natürlich schon öfter Menschen auf Fahrrädern gesehen, hatte ihre Bewegungen beobachtet, aber es war noch mal eine ganz andere Sache, es selbst zu versuchen. Auf den ersten paar Metern verlor er fast das Gleichgewicht, aber dann gelang es ihm doch zu fahren, wenn auch schwankend. Beim Himmel, nun sah er sicherlich selbst wie ein Betrunkener aus, der nur schlecht und recht hier torkelnd entlangfuhr.
Der Weg bis zur Landstraße war nicht weit und nach kurzer Zeit entdeckte er ein Schild, das auf die nahegelegene Autobahn hinwies. Turiel fuhr am Straßenrand entlang und verlor ein weiteres Mal fast das Gleichgewicht. Mit mehr Glück als Geschick erreichte er schließlich die Ausfahrt zur Autobahn. Auf der mehrspurigen Straße war kaum etwas los, nur hin und wieder erhellten die Scheinwerfer einzelner Fahrzeuge die düstere Nacht. Turiel hielt sich so weit es ging auf dem Seitenstreifen. Die Schmerzen im Rücken und den Knien meldeten sich auf dem Fahrrad mit doppelter Härte zurück und er stöhnte auf. Bei allen himmlischen Mächten, lange würde er das nicht durchhalten …
Turiel passierte ein weiteres Schild, das eine Raststätte anzeigte. Wenige Meter weiter fuhr er über etwas Holpriges. Sekunden später erklang ein leises Pfeifen und das Vorderrad des Fahrrads gab den Geist auf. »Oh nein, tu mir das nicht an!« Moment mal, redete er da tatsächlich mit einem Fahrrad? Das war doch lächerlich! Er hielt an, betastete den Reifen des Vorderrads. Ein dünner Riss zog sich hindurch. Er musste über irgendetwas gefahren sein, das diesen Schaden ausgelöst hatte.
Nachdenklich schaute er sich um. Sollte er sich als Anhalter versuchen? Würde ihn überhaupt irgendjemand mitnehmen? Vielleicht gab es an der Raststätte einen Kiosk, der Fahrradflicken verkaufte? Aber wohl kaum zu dieser nachtschlafenden Zeit, oder? Egal, dann musste er halt abwarten. Oder hatten sie tagsüber und auch nachts geöffnet? Er war sich nicht sicher. Vielleicht konnte er auf der Raststätte jemanden finden, der ihn ein Stück weit mitnahm. Turiel stöhnte ein weiteres Mal auf, schob dann aber das Fahrrad neben sich her. Rund eine halbe Stunde später erreichte er die Raststätte. Dort gab es eine beleuchtete Tankstelle. Zu seiner Überraschung war sie leer, bis auf ein einzelnes Wohnmobil, dessen Fahrer gerade tankte.
Turiel hob grüßend eine Hand und bereute die Geste sofort, da sie einen schmerzhaften Blitz in seine verletzte Schulter schleuderte. Er schob sein Fahrrad an den Kiosk heran, der zur Tankstelle gehörte, und stellte es neben dem Eingang ab. Danach ging er direkt zur Kasse. Der Mitarbeiter musterte ihn durch dicke Brillengläser und sagte: »N’Abend.«
»Hallo. Haben Sie Flicken, für Fahrradreifen?«
»Wir sind eine Autoraststätte, keine Fahrradwerkstatt«, sagte der Mann mit gelangweilter Miene.
»Oh, ach so. Wie schade.«
»Wollen Sie sonst noch etwas kaufen?«
In diesem Moment wurde Turiel bewusst, dass er keinen Cent in der Tasche hatte. Selbst wenn sie hier Fahrradflicken gehabt hätten, wäre er nicht weitergekommen. »Nein, danke. Auf Wiedersehen.«
Der Mann nickte ihm zu, mit einem lässigen »Tschüß«.
Der Kunde, der gerade sein Wohnmobil betankt hatte, kam herein. Er trug einen schwarzen Mantel, darunter einen Rollkragenpullover in derselben Farbe. Seine dunkelgraue Jeans wirkte schon etwas verwaschen. Selbst für eine weiße Person war er auffallend blass und seine Gesichtszüge waren scharf geschnitten, umrahmt von kurzem, dunkelbraunem Haar. Turiel war nicht gut darin, das Alter von Menschen einzuschätzen, aber dieser war etwa Mitte oder Ende dreißig. Der Mann musterte Turiel mit seinen braunen Augen, die einen leicht goldfarbenen Schimmer hatten – oder lag das an der Beleuchtung hier?
Ein seltsames Kribbeln erfasste Turiels Inneres, das er nicht einordnen konnte. Ein ungewohntes, aber nicht unangenehmes Gefühl … aber da war noch etwas anderes seltsam an diesem Fremden. Er brachte einen Geruch herein, der Turiel draußen nicht aufgefallen war. Erdig und herb. Ein wenig wie Patchouli und Vetiver. Aber das war kein Parfüm.
Die Erkenntnis traf Turiel wie ein Stromschlag. Diese Person war kein Mensch, sondern ein übernatürliches Wesen. Kein Engel, dafür war sein Geruch zu … jenseitig? Wie konnte das angehen? Dämonen rochen ebenfalls anders, mehr nach Fäulnis oder Schwefel. Turiel wurde bewusst, dass er den Mann schon viel zu lange anstarrte. Ob dieser auch erkannte, dass er einem übernatürlichen Wesen gegenüberstand? Der Mann wandte sich abrupt ab und ging zur Kasse, bezahlte dort.
»Noch einen Wunsch?«, fragte der Verkäufer ihn.
»Nein, danke. Wiedersehen.« Der Fremde hatte eine angenehm tiefe Stimme, die gleichzeitig fast samtig klang. Er sprach mit einem Akzent, den Turiel nicht einordnen konnte. Der Übernatürliche wandte sich zum Gehen.
Turiel überlegte nicht länger. Er setzte alles auf eine Karte und ging hinter dem Mann her, der zielstrebig auf das Wohnmobil zusteuerte.
»Entschuldigen Sie«, begann er laut.
Der Übernatürliche, was immer er war, drehte sich um und fragte ungehalten: »Was wollen Sie von mir? Und warum haben Sie mich eben so angestarrt?«
Turiel holte ihn ein, blieb in einem geringen Abstand vor ihm stehen. »Entschuldigen Sie, das war sehr unhöflich von mir. Ich war nur überrascht. Lassen Sie mich ganz offen sein. Ich glaube, Sie und ich haben etwas gemeinsam.«
Einen Moment lang schwieg sein Gegenüber. »Das ist jetzt eigentlich viel zu privat …« Er zögerte. »Aber wenn wir schon mal dabei sind – dachte ich es mir doch. Sie sind kein Mensch, nicht wahr?«
Turiel öffnete überrascht den Mund. Schloss ihn wieder. Dann setzte er erneut an. »Hören Sie, ich weiß nicht, was Sie sind, und es geht mich auch nichts an. Aber ich befinde mich in einer Notsituation und mein Fahrrad ist kaputt. Können Sie mich ein Stück mitnehmen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar.«
»Ich habe keinen Platz für Ihr Fahrrad«, sagte sein Gegenüber mit angespannter Miene.
Turiel zögerte. Mit dem Fahrrad würde er sowieso nicht weit kommen … »Das macht nichts, dann lasse ich es hier.«
Ein Auto fuhr heran und parkte in Hörweite, an einer der Zapfsäulen.
Der Fremde wies auf das Wohnmobil. »Lass uns drinnen weiterreden.«
Turiel entging nicht, dass der Mann ihn auf einmal duzte. Aber das störte ihn nicht weiter. Er überlegte nicht lange, sondern stellte das Fahrrad ab und folgte ihm. Der Mann betätigte einen Knopf an seinem Schlüsselbund und die Verriegelung der Türen öffnete sich mit einem Klicklaut. Turiel setzte sich auf der Beifahrerseite in das Gefährt.
»So, das geht mir zwar gegen den Strich, weil wir uns nicht kennen, aber ich fange jetzt keinen Smalltalk über das Wetter an oder so«, begann der Fremde, nachdem sie beide die Türen geschlossen hatten und damit außer Hörweite waren. »Damit eines klar ist – ich will jetzt erst mal wissen, warum du so nach Blut und Angst riechst. Und was du bist. Wenn du mir das nicht verrätst, kannst du gleich wieder aussteigen.«
Turiel überlegte. Er hatte ein übernatürliches Wesen vor sich. Der würde ihm vermutlich glauben, was er war? Aber ob er sich in Gefahr begab, wenn er es ihm verriet?
»Keine Sorge, ich tue dir schon nichts«, sagte der Fremde, als hätte er Turiels Gedanken gelesen.
Turiel räusperte sich. »Beherrschen Sie die Kunst des Gedankenlesens?«
»Nein. Und du kannst mich duzen, Nichtmensch. Also noch mal, ich tue dir nichts, was immer du auch bist«, versprach der Mann, von dem noch immer dieser herbe erdige Geruch ausging.
Ob er dieser Aussage trauen konnte? Turiel biss sich auf die Unterlippe.
»Ich warte«, sagte der Fremde, als Turiel nicht antwortete.
Turiel legte seine rechte Hand auf den Türgriff, um im Notfall schnell das Fahrzeug verlassen zu können. Das Herz seines materialisierten Körpers klopfte mit einem Mal schneller. Der Fremde konnte seine Angst spüren und das wiederum machte Turiel noch nervöser. »Ich bin ein Engel«, brachte er schließlich hervor. »Aber ich wurde von Dämonen entführt und die haben mir meine …« Er musste sich zusammenreißen, bevor er es aussprechen konnte. »Die haben mir meine Flügel abgeschnitten. Deshalb das Blut.«
Die Augen des Mannes weiteten sich, doch nur kurz. »Verfolgen sie dich?«
»Ich bin mir nicht sicher.« Turiel erzählte so knapp wie möglich, wie er ihnen entkommen war. »Aber vielleicht werden sie die Verfolgung aufnehmen, wenn sie wiederkommen. Je schneller ich von hier fliehen kann, desto besser.«
»Ich verstehe.« Der Fremde musterte ihn einen Moment lang schweigend, aus schmalen Augen, die Stirn gefurcht. Zäh tropften die Sekunden dahin und die Anspannung hing schwer in der Luft zwischen ihnen. »Kannst du ein Wohnmobil fahren?«, wollte er als Nächstes wissen.
»Wenn es ähnlich ist wie bei einem Auto, dann ja«, erklärte Turiel. »Ich habe mir im Laufe der Jahrzehnte das Autofahren abgeschaut. Den Menschen ist dieses Transportmittel sehr wichtig, nicht wahr? Und gerade hier in Deutschland ist es unheimlich beliebt. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe mir das alles genauer angeschaut.«
Turiel hatte auch selbst schon einmal einen verletzten Schützling ins Krankenhaus gefahren, der bewusstlos gewesen war – auch wenn ihm das eigentlich strenggenommen nicht erlaubt gewesen war. Aber er hatte die himmlischen Regeln und Vorschriften ein bisschen frei ausgelegt, wie schon des Öfteren in vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber das erzählte er lieber nicht. Er sprach auch nicht davon, dass er sich schon häufiger materialisiert hatte, um Auto zu fahren – mit den Fahrzeugen von Menschen, die er beschützen sollte. Kleine heimliche Spritztouren. Er mochte diese Fortbewegungsart. Sie war so ganz anders als fliegen oder gehen, aber irgendwie entspannend.
Der Fremde leckte sich mit einer auffallend roten Zunge kurz über die Lippen. Der Anblick löste etwas in Turiel aus, für das er keine Erklärung fand. Eine unerwartete Wärme flutete sein Inneres. Aber er verstand sich selbst nicht. Diese Zunge, diese leicht geschwungenen Lippen … sie sahen verführerisch aus. Ja, das war es. Wie eine verbotene Frucht. Ein anderer Vergleich als der mit dem Garten Eden fiel ihm nicht ein. Aber warum hatte dieses Wesen solch eine Wirkung auf ihn? Das durfte nicht sein. Es war verboten. Engel durften sich weder mit anderen Engeln einlassen, noch mit Menschen. Aber diese Person neben ihm war weder das eine noch das andere …
»Und wo musst du hin?«, unterbrach der Mann seine durcheinanderwirbelnden Gedanken.
Turiel zuckte zusammen, fing sich aber augenblicklich wieder. »Das ist mir ehrlich gesagt, ziemlich egal. Nur erst mal weg von hier.«
Der Übernatürliche schaute ihn prüfend an. Turiel hielt diesem Blick aus goldbraunen Augen stand. Eine Minute voll des angespannten Schweigens verstrich. Turiel hatte das Gefühl, als ob er auf Herz und Nieren geprüft würde. So hieß doch dieses deutsche Sprichwort, oder nicht? Und zugleich fiel ihm auf, wie schön er diese Augen fand, die ihn so bohrend musterten. Sie waren von dichten schwarzen Wimpern umrahmt und dieser wunderbare goldene Schein über der Iris ... beim Himmel, was wurde das denn nun? Er durfte nicht für ein anderes Wesen schwärmen.
»Wir kennen uns nicht, aber du wirkst auf mich nicht wie eine Bedrohung«, sagte sein Gegenüber schließlich. »Das trifft sich gut. Ich mache dir einen Vorschlag. Lass mich etwas von deinem Blut trinken, von deinen Wunden.« Er öffnete seinen Mund leicht und entblößte dabei spitze Fangzähne.
Turiel erschrak. Das war … das musste ein Vampir sein! Er zerrte an dem Türgriff herum, schaffte es aber nicht, das Fahrzeug zu öffnen, weil seine Hand auf einmal zitterte. Vergessen war der verführerische Anblick des Mannes.
»Ganz ruhig, ich will dich doch nicht töten. Du hilfst mir und ich helfe dir. Mehr nicht.«
»Aber du willst mein Blut trinken!«, protestierte Turiel. »Und ich soll dir vertrauen, dass du rechtzeitig aufhörst?«
Der Vampir winkte ab. »Schau mal, es ist doch so: Ich bin genau wie du auf der Flucht. Bald geht die Sonne auf und dann sitze ich im Innern fest, aber du kannst dieses Mobil fahren. Ich müsste sonst auf irgendeinem Rasthof übertagen und das ist mir zu gefährlich. Wie es aussieht, brauchen wir einander.«
»Das soll ich dir glauben?« Turiel wurde von den Anflügen einer Panik erfasst, seine Stimme bekam einen schrillen Klang.