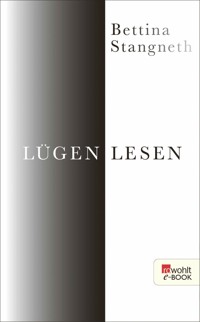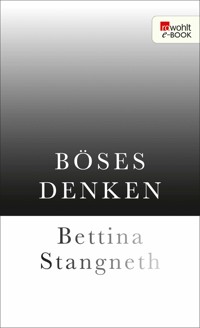
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Böses Denken - Eine provocative Untersuchung über die Ethik des Denkens von der renommierten Philosophin Bettina Stangneth Die Gedanken sind frei, und jeder, der selber zu denken lernt, wird so frei werden wie sie. Das glauben wir jedenfalls. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass es einen Zusammenhang zwischen Denken und Moral gibt, fordern Philosophen seit dem 18. Jahrhundert dazu auf, alles zu bedenken, eigene Überzeugungen zu entwickeln und konsequent danach zu handeln. Wer denkt, so hoffen wir, der mordet nicht. Wer aufrichtig seinen Überzeugungen folgt, macht die Welt besser. Aber dann kam das 20. Jahrhundert und mit ihm der organisierte Massenmord, die Tat der denkenden Mörder. Und es kamen die Selbstmordattentäter, die alles andere als gedankenlos sind und dennoch töten. In Böses Denken stellt Bettina Stangneth, die mit ihrem Buch Eichmann vor Jerusalem international die Debatte über das Böse neu entfacht hat, eine unbequeme Frage: Haben wir wirklich das Recht zu jedem Gedanken, oder braucht auch das Denken eine Ethik? Dieser elegant geschriebene Essay erklärt und erweitert klassische Konzepte des Bösen, denn wer das Böse bekämpfen will, muss es zunächst einmal erkennen. Es kommt schon lange nicht mehr nur als dummer Barbar, sadistischer Schläger oder gedankenloser Bürokrat daher, sondern mit verführerisch schlüssigen Argumenten. So sehr wir es uns auch gewünscht haben: Für uns Menschen ist nichts jenseits von Gut und Böse. Noch nicht einmal das Denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bettina Stangneth
BÖSES DENKEN
Über dieses Buch
Die Philosophin Bettina Stangneth, die mit ihrem Buch über den Holocaust-Organisator Adolf Eichmann («Eichmann vor Jerusalem») international die Debatte über das Böse neu entfacht hat, stellt eine unbequeme Frage: Haben wir wirklich das Recht zu jedem Gedanken, oder braucht auch das Denken eine Ethik?
Die Gedanken sind frei, und jeder, der selber zu denken lernt, wird so frei werden wie sie. Das glauben wir jedenfalls. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass es einen Zusammenhang zwischen Denken und Moral gibt, fordern Philosophen seit dem 18. Jahrhundert dazu auf, alles zu bedenken, eigene Überzeugungen zu entwickeln und konsequent danach zu handeln. Wer denkt, so hoffen wir, der mordet nicht. Wer aufrichtig seinen Überzeugungen folgt, macht die Welt besser. Aber dann kam das 20. Jahrhundert und mit ihm der organisierte Massenmord, die Tat der denkenden Mörder. Und es kamen die Selbstmordattentäter, die alles andere als gedankenlos sind und dennoch töten.
Dieser elegant geschriebene Essay erklärt und erweitert klassische Konzepte des Bösen, denn wer das Böse bekämpfen will, muss es zunächst einmal erkennen. Es kommt schon lange nicht mehr nur als dummer Barbar, sadistischer Schläger oder gedankenloser Bürokrat daher, sondern mit verführerisch schlüssigen Argumenten. So sehr wir es uns auch gewünscht haben: Für uns Menschen ist nichts jenseits von Gut und Böse. Noch nicht einmal das Denken.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Willi Winkler
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-05261-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Einleitung
Ja! Aber …
Die Suche nach dem Glück
Das Finden der Vernunft
Im Labyrinth der Leitkulturen
Die Neigung zur Inkonsequenz
Skeptischer Optimismus
Wenn ich das gewusst hätte …
Das unerwartete Böse
Ein neuer Typ des Verbrechers?
Oberflächliche Geschäftigkeit
Konsequenter Anstand
Die Hoffnung auf das Denken
Das wird man doch wohl noch denken dürfen!
Jenseits der Gedankenlosigkeit
Denkungsarten
Die sich verspielende Vernunft
Unbedingte Ernsthaftigkeit
Es ist so bequem, mündig zu sein
Vom bösen zum bösartigen Denken
Sie verstehen doch?
Empathie als Waffe
Willige Weltverschwörer
Zerstörung der Urteilskraft
Von der Moral
Dank
Empfehlungen zum Weiterlesen
Zitat auf dem Buchdeckel
Für Willi – die Unruhe, die mich eint.
Unsere Verbrecher sind nicht mehr jene entwaffneten Kinder, die zur Entschuldigung die Liebe anriefen. Sie sind im Gegenteil erwachsen und haben ein unwiderlegbares Alibi, die Philosophie nämlich, die zu allem dienen kann, sogar dazu, die Mörder in Richter zu verwandeln.
Albert Camus, französischer Philosoph, Der Mensch in der Revolte/Das Absurde und der Mord (1951)
Nichts ist so einfach wie Moral. Kein Licht, das dem Menschen aufgegangen ist, strahlte je heller, und keine Orientierung hat sich seither als eindeutiger erwiesen. Allen Geschichten, der eigenen kleinen und der großen der Menschheit, zum Trotz – jeder weiß, was damit gemeint ist, und es ist uns umso bewusster, je lieber wir dagegen anreden.
Achte das Leben aller Menschen und versuche wenigstens, die Welt nicht schlechter zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast.
Oder formuliert als Verbot:
Wenn deine Art und Weise zu handeln eine Welt schafft, in der du nicht selber an der Stelle eines jeden anderen leben wollen würdest, dann handle anders.
Was wäre sonst auch moralisch wesentlich! Es kann deshalb niemanden ernsthaft wundern, dass weder Religionen noch Wissenschaften unser Wissen um das, was Moral ist, grundlegend erweitern konnten – es sei denn um allerlei Ausreden, sich vor dem eigenen Anspruch zu drücken und wahlweise Rituale oder ein Werte-Ping-Pong an dessen Stelle zu setzen. Was hätte das Nachdenken über Gott und das Jenseits und die Erforschung der Welt auch an unserem Wissen ändern können, dass es besser zugeht, wenn Menschen einander menschlich begegnen? Viel erstaunlicher als unser unverrücktes Interesse an gut und böse ist deshalb auch etwas ganz anderes, nämlich der hartnäckige Versuch darzulegen, dass es Moral gar nicht gibt und schon jeder Gedanke daran eine Illusion ist, von der man in der Praxis lieber die Finger lässt.
Der Mensch kann wie kein anderes uns bekanntes Lebewesen sein Wissen zur Gestaltung der Welt verwenden, und üblicherweise tun wir das mit atemberaubender Geschwindigkeit und großem Erfolg. Kein Rückschlag kann uns aufhalten, wenn wir uns erst einmal entschieden haben, den Fuß auf den Mond zu setzen. Von der Entdeckung des Feuers bis zum LED-Bildschirm, von der Steinschleuder zur Kampfdrohne – die Erfolgsgeschichten unseres Verstehens sind ebenso zahlreich wie jede für sich beeindruckend. Warum also haben wir die moralische Erkenntnis nicht genauso begeistert genutzt? Mehr noch: Warum sind wir so bemüht, sogar kleine Erfolge sofort wieder zunichte zu machen, sobald sich die Gelegenheit bietet? Jeder, der sich eines Morgens entschließen würde, statt mit dem Intercity Express von Hamburg nach Berlin zur Arbeit zu fahren, lieber einmal auf allen vieren gen Osten zu krabbeln oder dem Chef den dringend erbetenen Vertragsentwurf per Brieftäubchen statt als E-Mail zuzustellen, darf sich des Kopfschüttelns seiner Mitmenschen sicher sein. Aber wenn wieder einmal jemand daherkommt und wortreich begründet, warum die Vorstellung der einen Menschheit nichts als eine Chimäre, eine Illusion, ein Hirngespinst, ist und dass jedes Sprechen von Vernunft, von Freiheit und Menschenrecht allenfalls weltfremde Naivität sein kann – wenn nicht sogar ein gefährlicher Betrug –, dann hören wir immer noch zu. Wenn jemand doch noch einmal sagen dürfen möchte, dass jede andere Kultur unser Leben bedroht, sofern wir nicht als Touristen Eintritt bezahlt haben, um sie am anderen Ende der Welt zu besichtigen, dann nehmen wir seine Sorgen so ernst, als hätten wir all das nie zuvor gehört, geschweige denn längst selber gedacht. Und wenn jemand behauptet, es gebe ernstzunehmende Gründe für das Ermorden von Menschen, die hauptberuflich Bilder zeichnen oder nichts anderes gemeinsam haben, als einen Freitagabend ausgerechnet in dem Café zu verbringen, das der Mörder in unguter Erinnerung hat, dann widersprechen wir immer noch nicht entschieden, sondern stellen lieber gleich mit der Würde der Opfer auch noch unsere Überzeugungen in Frage, weil es ja sein könnte, dass etwas dran ist an dieser Kritik durch Maschinengewehrläufe und Bombengürtel. Geht’s noch? – möchte man fragen. Wenn man denn genug Zeit dazu hätte, bevor gleich der Nächste daherdoziert, dass die Dinge nun einmal so lange differenzierter zu betrachten sind, bis jeder auf seine Weise recht hat, und genau das auch noch als Erkenntnisfortschritt verkauft, samt der Empfehlung, auf alte unnütze Etiketten wie «gut» und «böse», «richtig» und «falsch» lieber ganz zu verzichten, weil sie zum Verständnis von allem und jedem ohnehin nichts beitragen könnten.
Dort, wo jeder, der nicht versteht, als dumm oder doch unverständig gilt, sind Begriffe der Ratlosigkeit nicht vorgesehen. Vielleicht erklärt schon das allein, warum wir es ungern genau nehmen, wenn Philosophen über das Böse nachdenken und damit die Fähigkeit des Menschen meinen, etwas zu tun, was sie selber für falsch halten. Sollten diejenigen, die doch vorgeben, die Weisheit zu lieben, nicht ohnehin lieber unter sich bleiben, um das heilige Hochplateau des Denkens rein zu halten und über nichts als das Wahre, das Gute und das Schöne zu sprechen, auf dass da etwas glänze, und damit die Unaufgeklärten beständig hinan zu ziehen und die Dummen ebenso zu trösten wie die Teilzeitverzweifelten? Im Urlaub erwartet man ja auch weiße gepflegte Strände, etwas Aufbauendes eben, eine Art Parallelwelt, wo immer die Sonne scheint und noch die Bettler pittoresk zu sein haben, wo niemand hungert oder front und wo es allenfalls den wohligen Sinn des Lebens oder doch seelentröstende Beratung regnet. Einmal im Jahr wenigstens muss doch alles gut sein, damit wir alle so weiterwurschteln können wie zuvor.
Philosophie darf als Meditation daherkommen. Ruhig und ausgewogen, in wohlgewählten Worten und leisen Tönen, abgeklärt und jederzeit vor allem bis zur Selbstzerknirschung vorsichtig – ein bescheiden vorgetragener Sing-Sang, willkommen nur, solange es nicht weh tut oder gar etwas kostet. Nur nichts Unbequemes, bitte. Erlaubt ist allenfalls ein wenig Aufklärungs-Pathos mit etwas anrührender Utopie light oder der erhobene Zeigefinger, weil der Lausbub schon immer lebensklüger und vor allem lustiger ausgeschaut hat, wenn sich ein selbsternannter Oberlehrer damit blamiert, ihn zur Vernunft zu rufen. So hat man wahlweise erleichtert zu lächeln oder nachsichtig den Kopf zu schütteln über die gepflegte Weltfremdheit, die man nur von Zeit zu Zeit gern sieht, bevor es zurück in den Alltag geht. Zurück zum Ernst des Lebens also, von dem diese Verkopften doch noch nie etwas verstanden haben, weil die wahre Welt so viel anders ist als alles, was man von ihnen darüber hören will.
Dabei galt es einmal als vornehmste Aufgabe des Philosophen, nicht etwa Antworten zu liefern, sondern Fragen zu stellen, also hartnäckig auf das hinzuweisen, was wir keineswegs so gut verstehen, wie wir es gern vorgeben und manchmal selber glauben. Wer sich und anderen ständig den Spiegel vorhält, hat aber selten ein attraktives Image. Darum erzählte schon der griechische Philosoph Aristoteles den zahlenden Besuchern seiner Akademie lieber, dass die Philosophie mit dem Staunen beginnt. Die Vorstellung von großen wissbegierigen Kinderaugen ist natürlich viel sympathischer als der durchdringende Blick des Skeptikers. Außerdem wusste Aristoteles auch sehr genau, dass man einen seiner Vorgänger für eben seine Zweifelei zum Tode verurteilt hatte, jenen Sokrates nämlich, der mit der selbsterteilten Lizenz zum Nörgeln seinen Mitmenschen ständig ungebeten in Cafés auflauerte, um ihnen die Marktunfähigkeit ihrer Theorien vorzuführen. Philosophie, die zur Wirklichkeit hinführt, ist etwas anderes als schöngeistiges Dekor oder folgenloses Phantasieren, und das zu allererst für den, der sie betreibt. Tatsächlich bedroht das kritische Fragen unvermeidlich auch diejenigen, die ihre Macht und ihre Position in einer Gesellschaft vor allem der Hoffnung der Menschen verdanken, dass wenigstens ein paar immer genau wissen, was zu tun ist, und dass es wenigstens einen gibt, der alles im Griff hat.
Insbesondere wer über das Böse spricht, bekennt offen das Gegenteil. Es geht um das, was nicht geschehen sollte, und es geht um diejenigen, die es dennoch tun. Es geht um uns, die wir es nicht fassen können, und um diejenigen, die es erfassen und doch nicht verhindern. Es geht vor allem um etwas, das wir verstanden zu haben glauben und das wir gerade dadurch ständig unterschätzen. Es geht nicht zuletzt um unseren eitlen Stolz darauf, jederzeit zuhören und nachvollziehen zu können, und die damit verbundene Blindheit für die Gefahr, dass andere sich längst auf unseren Wunsch verlassen, alles zu verstehen, also auch sie. Kurz: Wer über das Böse spricht, der warnt – nicht nur vor den unterschätzten Tätern, sondern auch vor der verführerischen Kraft schöner Theorien und einfacher Lösungen.
Was auch sonst! Denn wer wollte heute noch mit einer Erklärung des Bösen Trost verbinden? Dass am Ende alles für irgendetwas gut sei, so wie noch der allerletzte Teufel für die Heilsgeschichte notwendig war und daher die Engel nur mit der Zustimmung ihres Gottes fielen; dass der Fleißige und Begabte sich schließlich doch durchsetzt, weil das Gute die einzig wahre Kraft ist; dass der Schatten nun einmal immer zum Licht gehört – wem soll man das weismachen? Vor allem, wer würde dieses kühle Plätzchen überhaupt noch wollen, seit die «Schatten» Namen wie Adolf Hitler und Josef Stalin tragen? Der charmante Mephistopheles, mit dem es sich so verboten-amüsant parliert, umgarnt schon lang nicht mehr die Weltenlenker, sondern schlägt sich allenfalls noch als Heiratsschwindler in die Büsche. Und auch wenn es sie tatsächlich gibt, die heimlich aufgekritzelten Bekenntnisse eines Martin Heidegger, dass noch Hitler und Massenmord unabdingbar gewesen wären für das Seynsgeschick (Fragen Sie nicht!) oder beseelte Kleriker, die bei Tee sich selber rührend erklären, dass es ohne die Verfolgung von Juden ja keine Gelegenheit gegeben hätte für die vielen Zeichen der Menschlichkeit ihrer unzähligen Helfer (Fragen Sie bitte auch nicht!) – wär’s nicht so herzlos leidensblind, man hätte womöglich noch einen bedauernden Blick für so viel spätreligiöse Heilssehnsucht. Aber ernst, nein, ernst nimmt das doch niemand mehr. Wir wissen, dass wir über etwas sprechen müssen, das nicht vorgesehen war und das nie wiedergutgemacht werden kann, weil Menschen es niemals hätten hervorbringen dürfen. Wir ahnen, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat, etwas, nach dem sich die schöngeistige Tagesordnung ebenso verbietet wie die geschäftige. Und weil uns die großen Vorspiele im Himmel längst suspekt sind, ist auch weit und breit kein Gott mehr zu finden, dem wir unsere Schandtaten als Heilsplan in die Sandalen schieben könnten. Was wir uns zurechnen müssen, passt einfach nicht mehr zur schönen Idee eines Lehrpfads der Irrungen und Wirrungen mit himmlischem Segen.
Wer heute vom Bösen spricht, der spricht allein vom Menschen.
Früher einmal, als man die Welt und uns noch von Gotteshand wohlgebildet denken konnte, da lag es nahe, das Böse einfach für die Erbschaft des Tiers in uns zu halten, für einen Rückfall in die Primitivität also, eine Regression in Zustände, die wir Anständigen und Gesunden längst überwunden haben. Gewalt, sagt eine alte Mär, könne schließlich nur reizvoll finden, wer es in den angstfreien Raum des Kompromisses, in die Bürgerlichkeit also, nicht geschafft hat oder ihr ruhiges Leben in schöner Ordnung aus unverständlichen Gründen einfach nicht zu schätzen weiß. Wer die Kultur wahrhaft fördert und pflegt, schmeichelte man sich, kennt keine Gewalt mehr und braucht weder Widerstand noch Unbehagen, weil nur der Überforderte noch rebelliert. Was gäbe man drum, wenn das so einfach wäre! Der große englische Philosoph Thomas Hobbes konnte seine Leser noch erschüttern, als er erklärte: «Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.» Das war 1642. Noch nicht einmal vierhundert Jahre später würden wir es schon als erfreulichen Fortschritt betrachten, wenn Menschen sich wieder so berechenbar wie Tiere benähmen und wir nicht sogar noch in der wohlgeordneten Freiheit sofort ein Mittel erkennen würden, um uns diejenigen unterzuordnen, die wir nicht wirklich mit an die schön gedeckte Tafel, sondern allenfalls das Silber putzen lassen wollen. Wir kennen längst subtilste Formen der Gewalt aus Kultiviertheit, die kein Barbar sich je hat träumen lassen. Die Hoffnung, das Elend der Unmoral durch verfeinerte Sitten und allerlei bürgerliche Tugendkataloge zu überwinden, scheiterte nicht erst an der deutschen Vorführung perfekter Mordordnung in akkurat sitzender Uniform und mit Himmlerschem Anstand.
Der Blick in den Spiegel der Geschichte samt den Versuchen, sie zu erklären, zeigt vor allem eines: Uns gehen die Ausflüchte aus. Es ist keiner mehr da, dem wir es anhängen könnten. Die meisten Begriffe, die wir erdacht haben, greifen nur noch ins Leere, jedenfalls sobald wir versuchen, sie nicht nur zu sagen, sondern auch zu denken. Wie soll man die Mahnung verstehen, «das Böse» nicht zu «dämonisieren», wo wir doch längst in einer Welt leben, in der keiner mehr Dämonen kennt außer den je eigenen? Wer glaubt wirklich, dass allein der Hinweis auf die Urzeit reicht, um die Irrwege zur erklären, die wir ganz bewusst mit unserem Denken eingeschlagen haben? Wer mag noch auf mehr Empathie hoffen, wo die schlimmsten Foltermethoden vor allem große Einfühlsamkeit voraussetzen und die Fähigkeit, sich an die Stelle des anderen zu denken? Wie behauptet man, dass das System den Menschen moralisch korrumpiert, wenn Menschen doch inzwischen nur allzu gut verstanden haben, wie man Systeme genau so konstruiert, dass sie diesen Zweck erfüllen? Wer hat noch das Selbstbewusstsein, Terrorbanden ein schlichtes Gemüt und Rückständigkeit zu unterstellen, die jedes Kommunikationsmittel und die europäischen Wertvorstellungen sogar gut genug verstanden haben, um sie effektiver gegen uns zu verwenden, als wir sie zu erklären in der Lage sind? Und vor allem: Wie verteidigt man bei alledem die Forderung der Aufklärung, dass jeder Mensch sich seines eigenen Verstandes ohne die Leitung eines anderen bedienen solle, wenn wir inzwischen keineswegs mehr so sicher sind, wohin Selberdenken führen kann?
Es gab immer nur wenige, die sich den Luxus der unerschütterlichen Gelassenheit leisten konnten. Uns anderen bleibt nur, noch einmal nach dem Bösen zu fragen, also die Ratlosigkeit und den Schrecken in das Denken zu heben, damit es nicht im Raum je eigener diffuser Ängste bleibt, die sich bei jedem möglichen Anlass unvermittelt Bahn brechen, die sich aber auch wecken lassen, so dass wir vor ebenso unbeherrschbaren wie unnützen Schreckensbildern wie dem «absolut Bösen», «Horrortaten», «Barbarei» und «unmenschlicher Grausamkeit» in Schockstarre fallen und gleich darauf eine Menge unsinniger Entscheidungen fällen. Jede Zeit fordert ihre Begriffe, also den kritischen Blick auf die Ideen und Vorstellungen, die in einer anderen Zeit entstanden sind und ihren Anteil daran haben, dass unsere Zeit so ist, wie sie ist. Begriffe und ihr Medium, das Denken, sind keine harmlose Freizeitbeschäftigung, sondern wirken in dem Moment auf die Welt, in dem sich Menschen mit ihrer Hilfe orientieren und nach ihren Vorstellungen handeln. Darum ist es unsere Aufgabe, immer wieder unsere Werkzeuge des Begreifens zu überprüfen und zu schärfen, und das nicht nur, um besser zu erkennen, wie wir wurden, was wir sind, sondern weil nur so ein gemeinsames Sprechen möglich ist, insbesondere über das, was uns verunsichert. Nicht als Geschichtsschreibung, auch nicht als Mentalitätsgeschichte, sondern als Versuch, die Unklarheit unserer Erfahrungen in uns und miteinander nicht noch durch unscharfe Begriffe zusätzlich zu verwirren. Begriffe sind wie Schlüssel zu Türen, und wer sich die eigene Erfahrung und die Probleme seiner Zeit aufschließen will, muss nicht nur immer wieder neu fragen, welcher Schlüssel in welches Schloss passt, sondern auch die Räume benennen, die uns noch ganz verschlossen sind. Die Methode, das herauszufinden, ist in der Wissenschaft seit jeher dieselbe: Man fängt mit dem Vertrauten an und schaut, wie weit man damit kommt.
Wie also anders, als mit den beiden stärksten und ebenso heftig umstrittenen Begriffen des Bösen zu beginnen, die die Philosophie zu bieten hat. Es wird nicht gehen ohne das philosophische Gespräch mit Immanuel Kant und Hannah Arendt über das radikal Böse und die Banalität des Bösen. Denn so sehr man auch die Versuchung verstehen kann, einfach alles wegzuwischen und ohne den Ballast alter Gedanken ganz und gar neu anzufangen: Die Vorstellung, dass Philosophie jederzeit von vorn zu beginnen habe, ist nicht nur ebenso eitel wie der Wunsch, der Erfinder des Rades zu sein. Es ist vor allem fahrlässig. Denn wenn wir nicht auf die Hilfe zurückgreifen, die wir überhaupt noch finden können, geben wir mit den längst beschrittenen Denkwegen auch die Begriffe der Verwässerung preis. Mehr noch, wir können nicht mehr verhindern, dass sie genutzt werden, um genau die Verwirrung noch zu steigern, die zu klären wir verpflichtet sind, und dort mit großen Namen und schillernden Worten zu blenden, wo nur einfach mehr Licht sein sollte. Die Tradition des klaren Denkens im Respekt vor Leistungen zu pflegen, die anderen bereits gelungen sind, gehört zu den stärksten Waffen der Philosophie. Wer mag es einen Zufall nennen, dass den Vorschlag zur Abschaffung der Denktradition niemand ernster genommen und vor allem konsequenter zu realisieren versucht hat als die Nationalsozialisten, die den Philosophen so grundlegend misstrauten wie ansonsten nur noch den Journalisten und darum nicht aufhören wollten, den «artfremden Geist» und die «Lügenpresse» samt ihren Vertretern zu vernichten.
Wenn mich meine Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Denken und Handeln etwas gelehrt hat, dann das eine, dass man bestimmte Denkwege nicht allein gehen sollte, weil die Geschichten vom großen Neuanfang immer nur im eigenen Kopf gut klingen. Nun habe ich allerdings auch das Glück, noch zu jener Generation von Philosophie-Studenten zu gehören, der die Möglichkeit offen stand, zu lernen, dass Philosophiegeschichte vor allem eines sein kann: ein Café Central voll von unvergleichlich klugen Gesprächspartnern, die immer Zeit haben. Denn auch wenn es einem durch das Examen hilft, die Klassiker bestmöglich zu imitieren, zu verteidigen oder auch zu kritisieren – der wahre Gewinn für den, der sich zu ihnen an den Tisch setzt, besteht in ihrer Erfahrung mit dem Rüstzeug des Denkens und den Denkbreschen, die sie schon geschlagen haben. Der Kundige wird meine Gesprächspartner und insbesondere die Korrekturen, die ich ihnen verdanke, selbstverständlich jederzeit erkennen. Alle anderen werden diesen Hintergrund nicht brauchen, um mich zu begleiten. Wer anschließend kundig werden möchte oder gern eine Empfehlung für die Tischwahl hätte, um auch den nächsten Tee nicht allein zu trinken, findet am Ende des Bandes die Adressen meiner wegweisenden Denker. Wer Philosophie studiert und seine Prüfungen bestehen möchte, sei ausdrücklich gewarnt: Die vorgestellten Gedanken taugen nicht als Abkürzung zur Interpretation der Klassiker. Die Verantwortung für den hier zu findenden Denkweg tragen nämlich selbstverständlich weder Immanuel Kant noch Hannah Arendt, sondern trage ich allein, und das auch dann, wenn sie in Wort und Gedanken unübersehbar bei mir sind. So bescheiden es auch auf den ersten Blick aussehen mag, sich hinter Begriffen und Argumenten anderer unkenntlich zu machen, so anmaßend und feige ist es, große Namen wie Marionetten auf die Bühne zu führen, um sie heimlich nur nach der Melodie unserer Fragen tanzen zu lassen. Wer das lebendige Denken will, darf nicht mit der Leugnung eigener Zuständigkeit anfangen. Es bleibt jedem unbenommen, andere Wege zu gehen, eigene Wege, und dort nach Grenzen zu fragen, wo mich nur die Tragfähigkeit interessiert. Insbesondere weil ich weiß, wie viel ich dem intensiven Gespräch mit den großen Philosophen verdanke, das ich in den letzten dreißig Jahren führen durfte, ist mir nur zu bewusst, wann nichts mehr bleibt als das Wagnis, selber ohne Geländer zu denken, also auch ohne sie.
Das Privileg der toten Denker besteht darin, dass kein Interesse einer Zeit der Kraft ihres Denkens je etwas anhaben könnte. Die Pflicht der Lebenden ist es, immer nur so lange bei ihnen sitzen zu bleiben, bis die eigene Kraft wieder zum Weitergehen reicht.
Beginnen wir also an der Seite von Immanuel Kant, denn von ihm stammt eine Antwort auf unsere Frage nach dem Bösen, die so einfach klingt, dass die Folgen gar nicht anders als kompliziert sein können:
Warum verfehlen wir unseren eigenen moralischen Anspruch?
Weil der Mensch es nun einmal kann.
Ja! Aber …
oder: Das radikal Böse (Immanuel Kant, 1792)
Die Seele ist des Menschen edelster Teil, weil es derjenige ist, den wir am wenigsten kennen.
Paul-Henri Thiry d’Holbach, deutsch-französischer Philosoph, Taschentheologie (1768)
Auf den ersten Blick scheint die Frage so trivial, wie man es dem großen Philosophen gar nicht zutrauen mag, und doch fand Immanuel Kant es alles andere als selbstverständlich, dass wir Menschen es überhaupt können: das Böse tun. Kants Antwort hat schon seinen Lesern im 18. Jahrhundert nicht gefallen: Der Mensch, so urteilte Kant, ist von Natur aus böse. Er ist als Mensch böse. Wir sind von der Wurzel – die lateinisch «radix» heißt – böse. Der Mensch ist also radikal böse.
«Radikal böse» ist eine Wortschöpfung von Kant. Er war sich sicher, auf etwas bisher Unbeachtetes gestoßen zu sein, für das der vorhandene Wortschatz also nicht reichte. Wir stutzen heute nicht mehr, wenn jemand etwas radikal nennt. Zu Kants Zeiten war das anders. Er konnte sich darauf verlassen, dass jeder über das Wort stolperte und entsprechend sehr langsam und gründlich weiterlas. Tatsächlich meinte Kant etwas ganz anderes als das, was in den letzten zweihundert Jahren aus dem Wort wurde, seit es zum Allgemeingut gehört. Radikal meint weder, dass das Böse, von dem Kant spricht, extrem oder absolut wäre; auch nicht rücksichtslos, übersteigert, eine Ausnahmeerscheinung noch gar aggressiv. Kants Begriff taugt gar nicht, um damit einzelne Menschen oder ein besonderes Verhalten zu beschreiben. Er meint ganz wörtlich das, was den Menschen als Menschen ausmacht, also was zu unserer Grundausstattung gehört. Deshalb ist es völlig ungereimt, sich zu fragen, ob Adolf Hitler radikal böse war oder nicht. Und es ist unsinnig, ein Verbrechen radikal böse zu nennen. Es ist auch niemand in diesem Sinne radikaler als ein anderer, und man kann sich nicht radikalisieren. Radikal bezeichnet das, was den Menschen überhaupt charakterisiert. Es ist eine anthropologische Bestimmung: Die Menschen sind eine böse Spezies. Und das sind wir immer und ganz unabhängig davon, was ein einzelner Mensch tut oder lässt.
Dieses alles andere als schmeichelhafte Urteil passte schon vor über zweihundert Jahren ganz und gar nicht zu den Hoffnungen von Kants Zeitgenossen. Johann Wolfgang von Goethe war so entsetzt, dass ihm beim Lesen übel wurde, und auch wenn Kants Ärger mit der Zensur dem Buchverkauf guttat, weil nichts so anziehend ist wie verbotene Bücher, sind die zahllosen Besprechungen doch alles andere als begeistert. Was hatte sich der Mann nur dabei gedacht? Das 18. Jahrhundert hatte eben erst die Kindheit entdeckt, also in der Beobachtung von Heranwachsenden herausgefunden, dass die Entwicklung jedes Individuums durch äußere und damit auch immer zufällige Einflüsse einen sehr unterschiedlichen Verlauf nehmen kann. Die Erziehung bekam damit eine völlig neue Bedeutung. Außerdem erkannte man, wie sehr Herkunft und die soziale Umgebung einen Menschen prägen können, dass also der Mensch keineswegs immer seines Glückes Schmied ist, sondern in den meisten Fällen einfach Glück gehabt hat, wenn er nicht unangenehm auffällt. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau hatte 1762 öffentlich darüber nachgedacht, ob nicht die Erziehung überhaupt der Schlüssel zur Lösung aller moralischen Probleme sei. Émile, sein großes Buch über Erziehung, beginnt mit dem sympathischen Satz: «Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut; alles entartet unter den Händen des Menschen.»
Um zu verstehen, warum Kants Gedanke eines radikal Bösen eine solche Ungeheuerlichkeit und tatsächlich der Buchskandal der 1790er-Jahre war, reicht es schon, sich zu vergegenwärtigen, wie groß die Hoffnungen sind, die wir bis heute mit der Wirkmöglichkeit der Pädagogik verbinden. Das Glaubensbekenntnis der Erzieher klingt in der modernen Form zwar vertrauter, sagt aber doch immer noch dasselbe wie Rousseau: Der Mensch wird nicht böse geboren. Der Mensch wird nur böse gemacht. Wir können, so lautet die Botschaft, die Welt in einen besseren Ort verwandeln, einfach dadurch, dass wir darauf aufpassen, dass Kinder sich ungestört entwickeln. Es kommt demnach nur darauf an, Menschen von Anfang an so aufwachsen zu lassen, dass sie bei ihrer Natur bleiben und nicht die Zivilisationskrankheiten ihrer Umwelt entwickeln. Die Überzeugung, dass der Mensch «von Natur», also als solcher gut ist, nährt die Hoffnung, dass das Böse in den Griff zu bekommen ist, weil es allein das Ergebnis einer Fehlentwicklung ist, die sich vermeiden lässt. Es gilt, die falschen Einflüsse zu erkennen und schon die Kleinsten mit dem Rüstzeug auszustatten, damit sie sich auch als Erwachsene frei von fremder Beeinflussung verhalten. Ein frei denkender, ein mündiger Mensch, der tut nichts Böses, zumindest will er es nicht. Das war nicht nur im 18. Jahrhundert, also auch vor dem Versuch herauszufinden, wie allgemeine Schulpflicht eine Gesellschaft verändert, die Grundlage für genau den Optimismus, der das Jahrhundert Rousseaus und Kants geprägt hatte. Und dann kommt zum Ende dieses Jahrhunderts der größte Philosoph aller Zeiten, der Inbegriff der Befreiung von Vorurteilen, Religion und Glaubenswahn, der vehemente Verteidiger menschlicher Freiheit, ausgerechnet der Mann, der mit seinen drei Kritiken, also den berühmten Büchern über die Erkenntnisvermögen der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft alles zerhauen hat, was bisher dazu diente, uns zu fesseln, und ausgerechnet dieser so verehrte Mann behauptet genau das Gegenteil. Er veröffentlicht einen Text Über das radicale Böse in der menschlichen Natur. Und er hat auch noch recht.
Vielleicht erklärt der Widerwille gegen diese uncharmante Charakteristik der menschlichen Gattung allein die Tatsache, dass so gut wie niemand noch Lust hatte, sich über die Überschrift hinaus näher mit dem zu beschäftigen, wofür genau Kant denn nun diesen seltsamen Begriff «radikal Böse» erfunden hatte. Die einen diskreditierten den berühmten Philosophen einfach damit, dass sie unterstellten, er sei ein Opfer seines Alters geworden. Nur noch senile selige Sehnsucht und debile Altersfrömmelei sei das, ein ekelhaftes Anbiedern an die christliche Lehre von der Erbsünde. Die Kindergeschichte von Adam, Eva, der falschen Schlange und dem Apfel vom rechten Baum, sonst nichts. Reaktionäre Sonntagsschule. Denn schrieb Kant nicht auch, dass der Mensch ein krummes Holz sei, aus dem nichts Gerades gemacht werden könne? (In seiner Zeit wussten die Menschen noch, dass er diese Formulierung keineswegs erfunden, sondern die Bibel zitiert hatte.) Die anderen taten das, was wir auch heute noch gern tun: Sie eigneten sich das Wort schon 1792 als Schlagwort an, das jeder so verwendet, wie es ihm nützlich erscheint, weil es sich angeblich von allein versteht, und das am Ende tatsächlich jemanden erschlägt, nämlich seinen Autor und die Theorie, für die es stehen sollte. Das geschieht auffällig häufig mit Versuchen, das Böse zu denken. Hannah Arendt wird es gleich zweimal genauso ergehen: Sie spricht selber von einem «radikalen Bösen», das mit Kant nichts zu tun hat, und begründet die «Banalität des Bösen», von der seither ebenfalls jeder spricht, auch wenn es nicht immer um Hannah Arendt geht. Es scheint wirklich, dass wir es nicht so genau wissen wollen, sobald jemand vom Bösen spricht und damit nicht filmreife Bösewichte oder sonstige Fremde meint, sondern einfach uns.
Also wie kam Immanuel Kant zu dem, was er das «Verdammungsurteil» über den Menschen genannt hat? Warum teilte er nicht die so sympathische Hoffnung seiner Zeitgenossen auf den unschuldigen Anfang in jedem Kind?
Tatsächlich ist die Frage, warum Menschen überhaupt die Forderung missachten, sich anständig zu verhalten, deshalb so schwierig zu beantworten, weil niemand anderes als die Menschen überhaupt erst nach Moral gefragt haben. Im 21. Jahrhundert gehen wir jedenfalls davon aus, dass Verhaltensregeln weder vom Himmel fallen noch an Bäumen wachsen. Ja, selbst derjenige, der sich von diesen schönen Bildern nicht lösen will, müsste immer noch erklären, warum Menschen dieses Obst dann interessant genug fanden, um es auch zu pflücken, also warum wir in einem Gesetz etwas Besonderes zu sehen in der Lage sind. Der Mensch hat doch eine Vorstellung von Gesetzlichkeit. Wir haben einen Begriff von Verbindlichkeit und fragen deshalb nach einem Verhaltensmaßstab, der genau diese Verbindlichkeit mit sich bringt. Mit anderen Worten: Wir suchen nach einem Halt in der Welt.
Die Suche nach dem Glück
Wären wir so glücklich gebaut, daß wir uns alles, was wir gelernt haben, stets ohne Reflexion vollständig einverleiben könnten, so daß wir es bei jeder Handlung angemessen berücksichtigen könnten, dann könnten wir uns die Mühen der Reflexion ganz gut schenken.
Charles S. Peirce, amerikanischer Philosoph, Entwurf und Zufall (1884)
Was haben Menschen da nicht schon alles ausprobiert: komplizierte Glaubenssysteme und die Hoffnung auf die Offenbarung zur rechten Zeit, die Hoffnung auf die Natur in uns, die Instinkte, und die Selbsterhöhung zu Göttern, die Erfindung von Barbaren und edlen Wilden, die wir nur nachahmen müssten – nichts, das nicht irgendwo irgendwer erfolglos versucht hätte. Die Epoche der Aufklärung war von der Idee besessen, die Welt zu verbessern, und die Philosophie war das auserkorene Werkzeug, um endlich den Trick zu entdecken, der uns zu dem führen sollte, was dem Menschen so lange vorenthalten worden war: das Glück. Jetzt, wo man die Gängelung durch Religion und die Jenseitsflucht mit Hilfe des Glaubens endlich losgeworden war, sollte nichts den Optimismus bändigen oder ihm gar widersprechen. Auch nicht der Blick auf das Leid der Menschen außerhalb der Studierstuben und Salons, das selbstverständlich immer noch da war. Ein Krieg folgte dem anderen, fand sogar vom Orient bis zur neuentdeckten Welt immer neue Schlachtfelder, auf denen immer mehr zwangsrekrutierte Bauern starben, und daheim sorgten Hungersnöte für den Rest, den die Pest nicht dahingerafft hatte. Die beste aller möglichen Welten, in der sich die Philosophen schon in Sichtweite zum vollkommenen Glück wähnten, war selbstverständlich das blanke Elend, so wie die Welt es nun einmal ist, in der man verzweifelt, darbt und stirbt. Vielleicht war es tatsächlich sein Alter, das den achtundsechzigjährigen Kant nicht so unbeschwert träumen ließ, vielleicht auch die Tatsache, dass sich das Jahrhundert dem Ende näherte und das Umschlagen der Französischen Revolution, die er 1789 so sehr begrüßt hatte, schon 1792 erste Schatten des kommenden Großen Terrors vorausschickte. Kant jedenfalls war nicht zum Feiern zumute.
Natürlich war sich Kant des unweigerlichen Scheiterns auf der Suche nach einem Halt in der Welt auch deshalb so bewusst, weil er selber nicht wenig dazu beigetragen hatte, Geltungsansprüche des Glaubens und Wissens grundsätzlich zu erschüttern. Der Philosoph Moses Mendelssohn nannte ihn nicht zu unrecht den «Alleszermalmer», und er tat es in einer Mischung aus Bewunderung und Schrecken: So gern es der ebenfalls berühmte Mendelssohn auch sah, dass Immanuel Kant allem Glauben und damit vor allem dem Einfluss der Religion der Mehrheitsgesellschaft auf Wissenschaft und Philosophie die Geltung absprach, so bang wurde Mendelssohn doch dabei, dass sein Freund tatsächlich kaum einen Stein auf dem anderen ließ. Zwar konnte man keinen besseren Unterstützer im Kampf gegen die Diskriminierung von Minderheiten finden, aber auch wenn Mendelssohn darin gerade als Jude einen Fortschritt sah, war der Preis, der dafür zu entrichten war, erschütternd: Menschen, das wird Kant nie aufhören zu wiederholen, wissen sehr viel weniger, als sie glauben. Vor allem aber wissen wir sehr viel weniger, als wir gern wissen würden. Unser Erkenntnisvermögen, also unsere gesamte Grundausstattung mit all den Werkzeugen zum Erkennen der Welt und uns selbst, reicht einfach nicht sehr weit. Wir wissen rein gar nichts über die Seele oder ein mögliches Leben nach dem Tod. Nicht einmal über einen schlichten Apfel wissen wir alles, sondern nur das, was unsere Sinne und unsere Fähigkeit zu begreifen uns von diesem Ding greifbar machen. Er ist süß oder sauer, er ist rund, rot, gelb oder grün, er wächst am Baum, er kostet vielleicht einen Euro, man kann einen Kuchen damit backen und eine Scheibe damit einwerfen – aber was ist der Apfel an sich? Also der Apfel ganz unabhängig von unserer Fähigkeit, ihn zu betrachten und ihm einen Namen zu geben? Wir scheitern schon bei den einfachsten Fragen und erst recht bei den komplizierten. So sehr wir es auch wollten, wir könnten Gott nicht erkennen, selbst wenn er mit uns am Frühstückstisch säße, weil weder unsere Sinne noch unser Verstand für das Absolute reichen und weil wir Dinge immer nur in Raum und Zeit wahrnehmen können. Aber gibt es überhaupt die große Ordnung der Welt, einen Ordner, einen Baumeister und Wächter? Wir wissen es nicht.
Was für den neugierigen Menschen eine permanente Kränkung ist, dass er sich nämlich nie sicher sein kann, wie die Welt aussähe, wenn wir sie nicht mit unseren Sinnen und unserem Intellekt begreifen würden, ganz egal wie lange wir auch beobachten, forschen und denken werden, das wird zu einem wahren Albtraum für den, der handeln muss. So gern wir es auch würden, Menschen können nicht sicher berechnen, was auch nur eine einzelne Handlung auslösen wird. Wir gehen ständig auf schwankendem Grund und fahren immer nur auf Sicht.