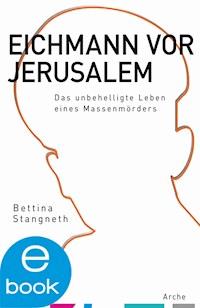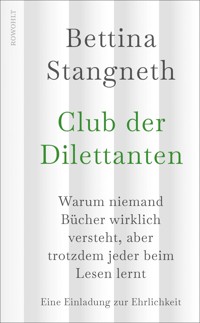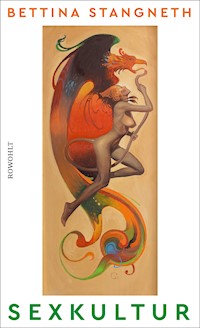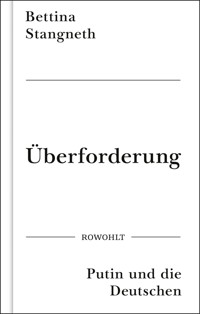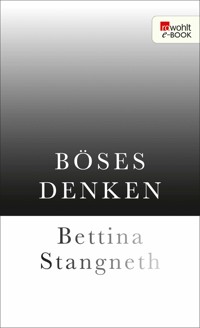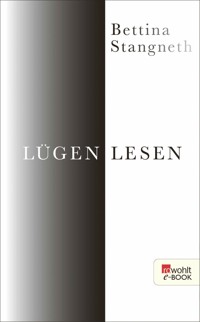
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Rückseite der Lüge. Alle Menschen lügen, behaupten die Menschen. Aber auch diejenigen, die das Lob der Lüge singen, wollen nicht bei einer erwischt und noch weniger wollen sie belogen werden. Sogar wenn man im Lügen das Leben selbst oder doch eine notwendige Kulturtechnik sehen will – wir gewöhnen uns einfach nicht an sie. Wenn Menschen sich nicht an etwas gewöhnen können, das sie doch selber gelegentlich tun, dann nennt man das ein moralisches Problem. Wer über Moral spricht, meint damit gern die anderen. Darum ist es auch kein Zufall, dass uns der Lügner von Anbeginn fasziniert. Die Hochstapler, Schwindler und Populisten, sie scheinen uns wie Zauberer zu manipulieren und planmäßig in die Irre zu führen. Die Lüge ist nur eines ihrer Werkzeuge. Als wäre sie nur dann eine Waffe, wenn sie in die falschen Hände gerät. Aber ist das wirklich alles? Und dürfen wir die philosophische Frage nach der Lüge tatsächlich auf Moral und Politik beschränken? Die Philosophin Bettina Stangneth, die ihre Leser schon mit dem Buch Böses Denken auf überraschende Wege zu großen philosophischen Fragen eingeladen hat, stellt in ihrem neuen Essay weitere, ganz einfache Fragen: Was lässt sich aus einer Lüge über unser Denken lernen? Steckt Wissen in der Unwahrheit? Und wie kommt man an dieses Wissen heran?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bettina Stangneth
LÜGEN LESEN
Über dieses Buch
«Die Rückseite der Lüge»
Alle Menschen lügen, behaupten die Menschen. Aber auch diejenigen, die das Lob der Lüge singen, wollen nicht bei einer erwischt und noch weniger wollen sie belogen werden. Sogar wenn man im Lügen das Leben selbst oder doch eine notwendige Kulturtechnik sehen will – wir gewöhnen uns einfach nicht an sie. Wenn Menschen sich nicht an etwas gewöhnen können, das sie doch selber gelegentlich tun, dann nennt man das ein moralisches Problem. Wer über Moral spricht, meint damit gern die anderen. Darum ist es auch kein Zufall, dass uns der Lügner von Anbeginn fasziniert. Die Hochstapler, Schwindler und Populisten, sie scheinen uns wie Zauberer zu manipulieren und planmäßig in die Irre zu führen. Die Lüge ist nur eines ihrer Werkzeuge. Als wäre sie nur dann eine Waffe, wenn sie in die falschen Hände gerät. Aber ist das wirklich alles? Und dürfen wir die philosophische Frage nach der Lüge tatsächlich auf Moral und Politik beschränken? Die Philosophin Bettina Stangneth, die ihre Leser schon mit dem Buch «Böses Denken» auf überraschende Wege zu großen philosophischen Fragen eingeladen hat, stellt in ihrem neuen Essay weitere, ganz einfache Fragen: Was lässt sich aus einer Lüge über unser Denken lernen? Steckt Wissen in der Unwahrheit? Und wie kommt man an dieses Wissen heran?
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Willi Winkler
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-05271-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Einleitung
Lüge ist Macht
Das Lügen
Der Lügner
Die Lüge
Der Gläubige
Die Lüge ist ein Dialog
Lüge als Wissen
Lügen heißt, keine Zeichen setzen
Wem wir glauben
Was wir glauben
Wodurch wir glauben
Warum wir glauben wollen
Jenseits der Macht
Wahrheit als Luxus
Welt als Lüge
Im Blick des anderen
Der Wille zum Du
Vom dialogischen Denken
Von der Aufrichtigkeit
Dank
Empfehlungen zum Weiterlesen
Zitat auf dem Buchdeckel
Weil Überstehn nicht alles ist – für Willi.
Ja wahrlich, wie es eine Macht der Rede geben soll, die nahezu Wunder zu tun vermag, so gibt es auch eine Macht des Zuhörers, die Wunder zu tun vermag, falls er so will.
Søren Kierkegaard, dänischer Theologe und Philosoph, Traurede (1845)
Kein Mensch will die Wahrheit. Als einziges Wesen, das überhaupt nach ihr fragt, wollen wir allenfalls einen Teil davon sagen und hören, wir möchten doch keineswegs alles. Es scheint beinahe, als könne der Mensch nicht «Ich» sagen ohne das große Bedürfnis, möglichst umgehend alles davon wieder zu verstecken und zu verstellen, und wenn die Nebelschwaden des Geheimnisses nicht reichen, um zu verhüllen, was wir denken und fühlen, dann darf es gern die Irreführung sein. Der Mensch lügt, seit er weiß, wie man Zeichen setzt. Wir lügen, wenn wir sprechen und schreiben, zeichnen und darstellen, sogar noch wenn wir schweigen. Ob mit kleinen Gesten, einem Blick, mit ablenkender Geschwätzigkeit oder der ganzen Person, wir sind Meister darin, zu verfälschen und zu täuschen, ja, wir brauchen nicht einmal eine konkrete Absicht, um einander blauen Dunst vorzumachen. Wir belügen sogar noch diejenigen, von denen wir längst wissen, dass wir von ihnen nichts zu fürchten haben und sie uns gern so sehen, wie wir sind. Lügen – das ist das Alltäglichste der Menschenwelt. Und dennoch überrascht uns nichts so sehr wie eine Lüge.
Sooft wir es auch schon erlebt haben, sind wir doch nie auf den Augenblick vorbereitet, in dem wir erkennen, belogen worden zu sein. Die Bedeutung dieser Erkenntnis geht weit über den Moment hinaus. Wahrheit, mit der wir nicht rechnen, ist das Licht, in dem unsere Illusionen und Hoffnungen zu Staub zerfallen. In der Wahrheit endet die Freiheit. Mit der Wahrheit kommt Wissen, also Gewalt, etwas, das nicht einfach wieder verschwindet, nur weil wir uns Augen, Ohren und Mund zuhalten. Wie verführerisch ist da der Gedanke, dass es sie gar nicht gibt, dass also jeder Mensch seine eigene Wahrheit haben könnte, ganz nach dem eigenen Wunschbild, unantastbar für alle anderen und sogar für die Welt. Nicht sehen zu müssen, was ist; nicht hören zu müssen, was andere wirklich denken: Wer hätte sich das noch nie gewünscht? Und dennoch verurteilen wir die Lüge.
Kein Mensch möchte als Lügner gelten. Der Verdacht, nicht vertrauenswürdig zu sein, stellt mehr in Frage als eine Geste oder einen Satz. So wie auch das Unbehagen, nicht zu wissen, was wirklich vorgeht, weil andere es vor uns verbergen, uns schließlich an den eigenen Sinnen und der Erfahrung zweifeln lässt. Wer nicht mehr weiß, ob man ihm glaubt, ist genauso verloren wie der, der nicht mehr weiß, was man noch glauben kann. Jeder, der ihr einmal unvermittelt begegnet ist, der weiß: Die Lüge hat eine unvergleichlich zerstörerische Kraft. Und dennoch lügen wir.
Zur Wahrheit über die Lüge gehört vor allem dies: Wir lügen, und können uns doch einfach nicht an die Lüge gewöhnen.
Dabei kennen wir längst genug Argumente für einen entspannteren Umgang mit der kultivierten Unwahrheit. Zwar hat es nie an Mahnungen gefehlt, dass die Lüge nur in den Abgrund führen kann, weil sie unbedingt böse, ja, gar des Teufels ist, der nicht zufällig der Vater der Lügen genannt wird. Aber in allen Kulturen weiß man ebenso von listigen Kriegern und schlauen Bauern zu erzählen, denen es gelingt, sogar dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, weil sie noch besser als der Teufel wissen, wie man es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Dumm wäre doch, wer den Lügner nicht mit der Lüge bekämpft. Herrscht unter Feinden nicht, wie Georg Simmel es in seiner Soziologie so einleuchtend beschreibt, auch ein «geistiges Faustrecht, ebenso brutal, aber gelegentlich ebenso am Platze wie das physische»? Hat wirklich auch der noch das Recht auf meine Wahrheit, der mir damit nur schaden will? Lügen taugt eindeutig als Waffe, als eine Überlebenstechnik, wie viele andere unabdingbar für den Daseinskampf. Was überhaupt wäre die Gesellschaft ohne die Möglichkeit zu lügen? Es spricht alles dafür, dass keine Gemeinschaft auch nur zwei Tage Bestand hätte, wenn wir uns alle ständig sagten, was wir denken, weil wir unbedingte Wahrhaftigkeit gar nicht aushalten. Macht das die Lüge am Ende nicht sogar zur Tugend? Zum Ausdruck gelebter Humanität? Wer das Lob der Lüge singt, verteidigt nicht nur das Recht auf Waffengleichheit im Kriegszustand, sondern ist überzeugt davon, dass unsere Fähigkeit zu lügen Gemeinschaft stiften, zumindest aber erhalten kann. Und ist sie nicht auch die Bedingung für Kunst und Kultur, weil beides gar nicht denkbar wäre ohne die spezifisch menschliche Distanz zum Faktischen? Ja, gäbe es überhaupt Freunde ohne sie? Und dennoch kann eine Freundschaft nie so unrettbar zerbrechen wie an einer einzigen Lüge. Sie kann uns tiefer verletzen als jede Tätlichkeit.
Dass die Welt verlogen sei, das ist eine Klage so alt wie die Menschheit. Schon wer sich früheste Höhlenzeichnungen anschaut, auf denen das Jagdgeschick verewigt ist, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Hörner und Krallen der erlegten Tiere so lang nun wirklich nicht gewesen sein werden. Die Diagnose lautet zu allen Zeiten genau gleich: Es war nie so schlimm wie genau hier und jetzt. Wenn uns das Nachdenken über die Lüge dennoch immer wieder ganz neu und dringlich vorkommt, dann offenbar deshalb, weil wir uns an diese Kapitel des Menschlichen nur sehr ungern erinnern. Davor, dass man sich mit Aufklärung weit weniger beliebt macht als mit einer halbwegs gut erzählten Geschichte, warnte nicht erst Platon. Der griechische Philosoph war fest davon überzeugt, dass die Menschen so sehr an ihrem Leben in der Höhle der Irrlichter hängen, dass sie im Zweifel sogar den umbringen würden, der ihnen das Licht bringt. Dabei ist es kaum zufällig der Schlachtruf der Philosophie, immer wieder aufgeregt das unmittelbar bevorstehende Zeitalter des Post-Faktischen zu beschwören und die Menschen weg von den Geschichten, zurück zu den Dingen zu rufen. Aber warum nageln wir uns wohl seit über zweitausend Jahren das Gnothi seauthon, das Erkenne Dich selbst, an die Wand? Etwa weil wir diese ständige Mahnung nicht alle nötig hätten? Schwur und Eid, feierliche Rituale wie das Versprechen, die Fußnoten ebenso wie die peinliche Befragung mitsamt dem unerschöpflichen Arsenal an Foltertechniken zeugen davon, wie allgegenwärtig das Misstrauen in den Willen zur Aufrichtigkeit ist. Und immer wieder ist da auch die Angst, es könnte irgendwann zu spät sein und die Wahrheit uns unrettbar abhandenkommen. «Heute ist die Wahrheit so verfinstert und die Lüge so festgefügt», notiert Blaise Pascal im 17. Jahrhundert und klingt doch unheimlich vertraut, «daß, wenn man die Wahrheit nur etwas weniger liebt, man sie nicht mehr zu finden weiß.» Im Jahr 1943, also dreihundert Jahre später – Joseph Goebbels keift mit Adolf Hitler um die Wette von den «Lügen des internationalen Finanzjudentums» und der «Lügenpresse» –, beginnt der aus Deutschland glücklich geflüchtete Alexandre Koyré in Paris seine Reflexionen über die Lüge mit derselben Anklage: «Nie hat man soviel gelogen wie in unseren Tagen. Niemals wurde in einer Weise gelogen, die ebenso schamlos, systematisch wie stetig ist.» Muss es uns da nicht vor allem wundern, dass sich heute noch irgendjemand daran stört, wenn genauso gelogen wird wie eh und je? Menschen lügen. Wasser ist nass. Na und?
Obwohl jeder von uns schon gelogen und vermutlich sogar einmal einen aufgeflogenen Lügner entschuldigt hat, ist uns nie ganz wohl dabei, und das nicht nur, weil jeder schnell begreift, dass das Lügen zwar mit dem Spielen verwandt sein mag, aber an diesem seltsamen Spiel doch offenbar nie alle den gleichen Spaß haben. So oft und so erfolgreich wir auch lügen, so viele Gründe uns auch dafür einfallen, so unausweichlich es uns auch scheint, es bleibt der Verdacht, dass es beim Lügen um sehr viel mehr geht als um eine Frage der guten Sitten oder, wie man früher gesagt hätte, um eine Sünde unter anderen. Es bleibt das tiefe Unbehagen, dass die Lüge eben doch kein Werkzeug wie andere sein könnte, dass wir vielmehr schon in der kleinsten Lüge etwas berühren, das man nicht anrühren sollte und das gefährlich über den konkreten Anlass und die jeweilige Absicht hinaus wirkt. Wir befürchten, dass die Lüge bei all ihrer Nützlichkeit immer schon etwas ganz anderes ist als ein beliebiges Mittel zu allerlei Zwecken. Warum es nicht ganz einfach sagen: Unsere eigene Fähigkeit zur Lüge ist uns unheimlich.
Wann immer ein Phänomen derart widerstreitende Gefühle auslöst, erschwert uns diese Zerrissenheit das Nachdenken. Allen Lippenbekenntnissen zum Trotz haben wir uns keineswegs entschieden, ob wir weiterhin mit der Lüge leben wollen oder nicht. Aber das ist nicht der einzige Grund dafür, dass wir uns ständig im Denken verheddern, sobald wir versuchen, die Lüge zu fassen. Das Nachdenken über die Lüge ist vor allem deshalb die wohl schwierigste aller Denkaufgaben, weil sich hier schon das Suchen nach dem Wissen gegen den Gegenstand selbst richtet: Wir wollen nicht weniger als Klarheit über ein Täuschendes, also nicht nur das Licht in der Dunkelheit, sondern auch aus ihr. Gleichzeitig zielt aber das Lügen auf nichts anderes als das Denken, also genau auf das Werkzeug, mit dem wir sie doch erhellen wollen. Es ist beinah, als wollten wir im Spiegel betrachten, wie es aussieht, wenn wir uns die Augen zuhalten, und uns dabei noch nicht einmal sicher sind, ob wir nicht vor einem Zerrspiegel stehen. Weil die Dunkelheit, die wir zu begreifen versuchen, indem wir das Licht anschalten, immer auch unsere eigene ist, fürchten wir schon ganz vordergründig die Erkenntnis wenigstens ebenso sehr, wie wir sie suchen. Wer nicht gerade das Opfer eines Lügners wurde und vor allem auf Sühne für den Schmerz sinnt, den er noch spürt, der weicht lieber aus. Statt neugierig auf das zu sein, was es zu lernen gibt, klingen wir, sobald wir über die Lüge sprechen, selbst wie ein ertappter Lügner, wie einer also, der retten will, was in der peinlichen Lage noch zu retten ist. Natürlich hätten wir gern ein Handbuch, das uns lehrt, einen Lügner zu erkennen, bevor wir ihm glauben. Aber andererseits hätten wir als Lügner eben auch gern ein solches Buch, damit wir wissen, was gerade als Lüge gilt und darum droht, auch schnell als solche erkannt zu werden. Wer wirklich hofft, man könne ein Computerprogramm erdenken, das Lügen nach einem Muster erkennt, schreibt mit jedem Algorithmus gegen die Lügen auch immer schon eine Anleitung, wie man künftig lügen kann, ohne dabei erwischt zu werden. Könnte es nicht sein, dass wir die Lüge in den letzten zweitausend Jahren nur aus einem Grund immer noch präziser definiert haben, nämlich um uns im Lügen nur umso geschickter an genau dieser Definition vorbei zu mogeln? Die erstaunliche Fertigkeit, es plötzlich ganz genau zu nehmen, wenn man aufgeflogen ist, kennen wir alle.
Zur Lüge gehört die Absicht. – Aber ich wollte doch gar nichts!
Die Lüge ist eine Mitteilung. – Aber ich habe doch nur so vor mich hingeredet!
Die Lüge ist eine Aussage. – Aber ich habe doch gar nichts gesagt, und meinen Blick, meine Geste, das hast du alles missverstanden!
Die Lüge ist eine Irreführung. – Aber es war doch gar nicht ernst gemeint!
Der Lügner spricht wider besseres Wissen. – Aber so genau habe ich es ja gar nicht gewusst!
Der Lügner sagt nicht die Wahrheit. – Aber für mich war das die Wahrheit, und ach, die Wahrheit, gibt es sie überhaupt?
Zur Lüge gehört die Betrugsabsicht. – Ich habe es doch nur gut gemeint!
Die Lüge ist eine Falschinformation. – Das ist alles ein Missverständnis. Es war nur meine Meinung!
Der Lügner ist ein Täter. – Ich bin hier das Opfer, nämlich das einer böswilligen Unterstellung!
Du sollst nicht lügen. – Aber es lügen doch alle?
…
Ist überhaupt eine Definition der Lüge vorstellbar, die nicht immer nur die Anleitung dafür wäre, wie man es künftig raffinierter anstellt? Und schon klingt es nur noch bedrohlich, dass wir uns nach über einhundert Jahren intensiven Nachdenkens über die Sprache einbilden, auch über die Lüge genauer zu sprechen, als alle vor uns es je konnten.
Mit Vorliebe weisen wir nämlich darauf hin, dass die berühmten Alten Griechen noch gar keinen eigenen Begriff für die Lüge hatten, sondern ein und dasselbe Wort, pseudos, für allerlei von Irrtum und Unwahrheit über Täuschung bis Lüge verwendeten, also immer ein zusätzliches Adjektiv benötigten, um nicht alles miteinander zu verwechseln. Dass dieser angebliche Begriffsmangel problemlos für die Weltdichtung vom listigen Odysseus und sogar einen ganzen Dialog Platons über die Lüge gereicht hat, stört uns in unserer Überheblichkeit wenig. Eigentlich, ja eigentlich ginge es in alldem um etwas ganz anderes, und vermutlich, so meinte jedenfalls der berühmte Platon-Übersetzer des 19. Jahrhunderts, Friedrich Schleiermacher, sei dieser Dialog über die Lüge auch gar nicht echt. Der Mensch ist am erfinderischsten dann, wenn ihm ein Text zu nahe rückt. Vor allem aber lässt sich mit der Vorliebe für Wortzählerei geschickt verbergen, dass wir inzwischen zwar etliche Wörter haben mögen, daraus aber nicht notwendig folgt, dass man sie auch als klare Begriffe, also zum Erkennen, verwendet. Mehr noch: Obwohl wir uns einbilden, einen präziseren Begriff von der Lüge zu haben, nutzen wir sogar den offensichtlich nur zögerlich. Im Rechtfertigungsmodus gefangen, scheuen wir davor zurück, einen Lügner auch Lügner zu nennen, und machen so ungeahnte Fortschritte im Verwischen von Wahrem und Falschem, als ginge es vornehmlich darum, sich nicht auszukennen. Dabei verharmlosen wir, wo wir nur können: Flunkern, Schwindeln, Spinnen, Phantasieren, es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen … alles klingt besser als das Bekenntnis, das uns so schwerfällt wie kaum ein anderes: «Ja, ich habe gelogen.»
Denn auch das ist eine Wahrheit über die Lüge: Wo alle immer lügen, da lügt am Ende keiner. Es sprächen einfach alle nur eine andere Sprache.
Zum Lügen gehört notwendig ein Ich, das nach eigenen Regeln spricht und dabei vor allem darauf aus sein muss, nicht als unverzichtbarer Teil der Lüge erkannt zu werden. Wie also nachdenken über ausgerechnet das, was aus dem Willen entsteht, nicht bedacht zu werden? Wie lässt sich auch nur ungefährdet betrachten, was sogar betrachtet werden will, damit man es falsch versteht? Wenn etwas unsere ureigenen Interessen, ja, auch Geheimnisse berührt, dann flüchten sich noch unsere Gedanken in alle Richtungen, am liebsten in das unendliche Feld der Beispiele und gleich darauf in die Moral. Wann darf man lügen, wann darf man es nicht? Gibt es die Notlüge, die weiße Lüge oder nur die schwarze? Kann man die Lüge von der Wahrheit überhaupt trennen, oder sind die Grenzen erfreulich fließend? Setzt sich die Wahrheit letztlich durch, weil sie die Wirklichkeit auf ihrer Seite hat? Ist die Welt am Ende gerecht, straft sich ein Lügner durch sein Tun auch selber, oder bleibt der Ehrliche immer der Dumme? Unzählige Bücher wurden darüber geschrieben, vermutlich kam nie eine Zeitung ohne wenigstens eine Geschichte vom Lügner aus. Denn jeder hat dazu gern, vor allem aber schnell etwas zu sagen. Wir sprudeln nur so über von lustigen Geschichten, schwelgen in Wortwitz und Ironie und genießen das Spiel mit der ungefährlichen Unwahrheit. Am liebsten allerdings ist von dem Einen die Rede, dem Zauberer und Zampano, der uns so kunstvoll betrog. Warum er log, das interessiert uns brennend; wie er dazu kam, wie er wurde, was er ist, was ihn drängt, und ein wenig sympathisch kommt er auch meist daher – so wie Felix Krull, der charmante Heiratsschwindler, von dem die Frauen träumen, oder der Hochstapler, den man um seine Erfolge doch beneidet. Noch die langweiligste Stehparty ist aufs Schönste mit einer beiläufigen Bemerkung über Lügen in Wirtschaft und Politik zu retten. So anhaltend laut, so engagiert ist die Debatte, dass keinem aufzufallen scheint, was wir mit dem eilfertigen Gerede tatsächlich tun: Wir denken uns ständig vom Gegenstand weg. Wir unterstellen nämlich, alle längst ganz genau zu wissen, wovon überhaupt die Rede ist, obwohl wir genau das offensichtlich lieber nicht so genau wissen wollen.
Niemand fragt, was die Lüge ist.
Wäre die Lüge wirklich nichts anderes als ein Satz und enthielte dieser Satz schlicht die Negation der Wahrheit, dann wäre alles ganz einfach. Auch mit umgekehrten Vorzeichen lässt sich verlässlich rechnen. Aber wenn es um die menschliche Fähigkeit zu lügen geht, kann man nicht einfach das eine in das andere umrechnen, die Lüge also nicht in Wahrheit auflösen. Wer es dennoch versucht, verliert nicht nur die Orientierung, sondern auch die Wehrhaftigkeit gegen den, der genau weiß, was Lügen heißt. Unser Versäumen, nach der Lüge als Lüge zu fragen, ist der Grund für unsere Hilflosigkeit, auf das Phänomen der Lüge zu reagieren, sobald sie in ihrer wesentlichen Form erscheint, nämlich in permanenter Verwandlung. Lüge kann nur als Metamorphose Lüge sein, als etwas also, das wir nicht als das erkennen, was es ist, weil wir auf etwas anderes gefasst und darum unvorbereitet sind. Genau deshalb missglückt uns schon der Versuch, schlicht zu beschreiben, was vorgeht, wenn ein Mensch vor aller Welt offenkundig und in voller Absicht Unwahres sagt und Millionen von Menschen genau darum in ihm den Einzigen erkennen, den Letzten, der vertrauenswürdig ist. Wenn wir derart mit und an den Wörtern scheitern, dann ist das ein untrüglicher Hinweis darauf, dass uns Begriffe fehlen, dass wir also zumindest unklar sprechen und deshalb nicht begreifen, wie uns geschieht. Die Lüge ist nicht nur eine Angelegenheit der Ethik, sondern zuallererst ein erkenntnistheoretisches Problem. Nur wenn es uns gelingt, dieses Problem wenigstens zu erkennen, und erst dann, wenn wir verstanden haben, dass das Lügen, der Lügner und die Lüge wesentlich verschiedene Dinge sind, kann unsere Diskussion darüber mehr sein als Ablenkung oder Scheitern. Nur mit geklärten Begriffen dürfen wir hoffen, uns überhaupt noch in einer Welt orientieren zu können, in der sich mehr Menschen als je zuvor am öffentlichen Gespräch und an der Wahl von Abgeordneten und damit von Regierungen beteiligen. Denn selbst wenn es uns tatsächlich unmöglich sein sollte, die Frage nach der Wahrheit zu klären: Es muss uns gelingen zu verstehen, was die Lüge ist, denn das bedeutet auch zu begreifen, was es wirklich heißt, dass alle Macht vom Volke ausgeht.
«Lügen lesen» ist, mancher wird es sich gedacht haben, die logische Fortsetzung von «Böses Denken», also der nächste Schritt nach der Beschäftigung mit einem Selbstgespräch, das bewusste Anti-Aufklärung ist und darum böse genannt werden muss. Das bedeutet aber nicht, dass Sie jetzt nur weiterlesen könnten, wenn Sie vom anderen wenigstens gehört haben. Wie bei allen langen Wanderungen ist es auch hier Ihre Entscheidung, in welcher Reihenfolge Sie die Etappen meines Denkweges gehen möchten. Das Abenteuer, mit diesem Buch anzufangen, hat sogar eine ganze eigene Berechtigung, denn der wesentliche Gedanke von «Lügen lesen» ist viel älter, war also tatsächlich zuerst da. Genauer gesagt, stammt die Idee dazu aus dem letzten Jahrhundert, nämlich den neunziger Jahren. Diese Idee allein war der Grund, mich mit dem nationalsozialistischen Denken und Männern wie Adolf Eichmann zu beschäftigen. Ich war mir sicher, eine Entdeckung gemacht zu haben, und wollte am Extremfall testen, ob es wirklich eine Entdeckung war, also ob meine Art, die Lüge zu denken, tatsächlich dazu verhilft, klarer zu sehen. Denn das ist doch die Aufgabe der Philosophie: zu erkennen, wenn unsere Orientierung versagt, also auch zu bemerken, dass wir noch einmal, dass wir präziser denken müssen, und dann den Nachweis zu erbringen, dass die eigenen Gedanken tatsächlich klar genug sind, um auch anderen zu überzeugenden Ergebnissen zu verhelfen. Es wird also höchste Zeit, die Methode nachzuliefern, die mich vor allem davor bewahrt hat, in der Konfrontation mit bösem Denken den Weg nicht mehr zu finden, nur weil jemand ihn so kunstvoll verstellt.
Wir Älteren werden uns an die Zeit vor zwanzig Jahren erinnern: Mobiltelefone waren ein Luxus, den sich die Erwachsenen leisteten, um damit zu telefonieren, wenn die Funkabdeckung es denn zuließ. Das Internet war weit entfernt von dem, was wir heute darunter verstehen. Wer chattete, konnte sich zwischen Frage und Antwort bequem einen Tee kochen, obwohl es nur um Textzeilen ging und nicht etwa um Bilder. Soziale Netzwerke wurden auf Familien- und Ehemaligentreffen gepflegt, und wer sich allzu sehr über einen Zeitungsartikel ärgerte, tippte einen Leserbrief und warf ihn in den nächstgelegenen Briefkasten, denn die E-Mail verdrängte das Papier nur langsam. Wie schon bei der Erfindung der öffentlichen Rede, der Druckerpresse, der Fotografie, des Radios, des Films und des Fernsehens traten die Mahner auf den Plan, die mit den neuen Medien wieder einmal den Untergang des Abendlandes vorhersagten, so wie es unzweifelhaft auch den nächsten Erfindungen ergehen wird, die unsere Möglichkeit erweitern, voneinander gelesen, gehört und gesehen zu werden. Aber obwohl wir längst vernetzt waren, musste ich immer noch zum Flughafen fahren, wenn ich die New York Times lesen wollte, denn nur dort gab es mit Glück und sehr viel Geld die vom Vortag. Dass ein amerikanischer Präsident der Welt mit Hilfe lauter hochpräziser Wahrheiten vorlog, was eine sexuelle Beziehung ist und was nicht, konnte man in Ausschnitten zur festgesetzten Sendezeit im Fernsehen verfolgen. Die Folgen der Praxis, die heute sehr vereinfacht, aber dafür süffig «Fake News» genannt wird, waren vor allem in Deutschland gar nicht zu übersehen, denn die «Wiedervereinigung» gestaltete sich nicht zuletzt darum so mühsam, weil sich zwei deutsche Staaten vierzig Jahre lang gründlich auseinander desinformiert hatten. Man kann sich nun einmal nicht über so lange Zeit bei jeder Gelegenheit gegenseitig mit alternativen Fakten bewerfen, ohne dass aus dem strategischen Umgang mit der Wahrheit auch zwei Wirklichkeiten werden. Und doch war das Wissen um die Möglichkeiten der Falschnachrichten alles andere als neu. Die Erfahrung, dass nicht nur der Sieger Geschichte schreibt, sondern einem auch rechtzeitig erzählte Geschichten zum Sieg verhelfen können, gehört seit je zur Kampftaktik in Krieg und Frieden; ganz zu schweigen davon, dass die Deutschen im letzten Jahrhundert gleich zweimal bewiesen haben, wie man zwei Weltkriege anfangen und hinterher doch aller Welt versichern kann, es nicht gewesen zu sein. Wie manipulierbar insbesondere das Wissen über historische Fakten ist, hat nicht nur die Beobachter der Propaganda-Schlacht des Ersten Weltkriegs beschäftigt, sondern insbesondere die Emigranten ab 1933. Wem es gelang, Deutschland in den dreißiger Jahren rechtzeitig zu verlassen, konnte die Auswirkungen der systematischen Lügerei und den Hang zu dem, was Hannah Arendt «die Etablierung einer fiktiven Welt» (fictitious world) nannte, gleich zweimal nicht fassen: vor 1945 und nach 1945. Welche Entschuldigung haben wir eigentlich dafür, dass die meisten Texte zur Lüge in Deutschland kaum diskutiert werden und auch nicht in Buchläden zu haben sind, geschweige denn, dass davon überhaupt einmal eine brauchbare Übersetzung herauskommt? Sogar ein international so vielbeachtetes Buch wie The Post-Truth Era von Ralph Keyes, dessen Titel inzwischen als tauglicher Slogan für unser Zeitalter gilt und das sich außerdem rückblickend wie das Handbuch zum öffentlichen Lügen liest, kann man nur im Original lesen. Der Name Donald Trump steht das erste Mal auf Seite 14. Genau daneben, auf Seite 15, dieselbe Höhe, findet der geneigte Leser eine lange Liste post-faktischer Schönfärbereien für selbstbewusste Lügen: «parallele Wahrheit», «virtuelle Wahrheit», «alternative Realität», «strategisch ungenaue Darstellung» … Das Buch erschien 2004. Natürlich muss man es nicht mögen. Aber kennen sollte man es doch, bevor einem allzu schnell der Seufzer «Hach, wer hätte sich das denn auch vorstellen können!» entfährt.
Wer sich über Jahrzehnte mit dem Thema Lüge beschäftigt, staunt nicht nur über die Geschwindigkeit, mit der wir vergessen, sondern bekommt vor allem viel Gelegenheit, die eigenen Begriffe an der Wirklichkeit zu erproben – auch an einem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der mit dem Angebot «Believe me!» zielsicher die Mehrheit seines Volkes gewann. Aber wer sich ein wenig mit Philosophen auskennt, der weiß natürlich, dass wir nie darauf aus sind, Reportagen oder gar Biographisches zu schreiben. Dieses Buch ist also, lassen Sie es mich zur Sicherheit deutlich sagen, kein Buch über amerikanische Präsidenten, auch keines über wiederholte Ehrenworte, über niemals herbeigedopte Tourensiege oder in mühevoller Kleinarbeit erschuftete Doktortitel. Wenn es eine Enthüllung gibt, die man sich erhoffen kann, dann ist es eine über die Bedingungen und Möglichkeiten des gemeinsamen Denkens, also auch über den Dialog, der dieses Buch sein kann, wenn Sie so wollen.
Was Begriffe vermögen, merkt nur, wer sie selber anwendet, so wie man ein Kleid anprobieren muss, um zu sehen, welche Bewegungen es mitmacht. Es spricht also nichts dagegen, die hier vorgestellten Begriffe an beliebigen Beispielen zu erproben, also mit ihnen zu denken, um herauszufinden, was sich dadurch an der eigenen Wahrnehmung ändert. Mit anderen Worten: Nur Sie können erfahren, ob es Ihnen gelingt, sich damit besser zu orientieren als vorher. Sie müssen dabei auch nicht besorgt sein, denn man kann auch Begriffe anprobieren, ohne sie gleich zu kaufen. Unser Erkenntnisvermögen setzt uns als Erwachsene in die Lage, Begriffe auf Probe zu verwenden, und tatsächlich tun wir das auch immer schon. Begriffe bewusst anzuwenden, das ist aber vor allem der Kern eines Studiums der Philosophie. Man denkt sich nicht etwa in einen anderen hinein, so wie sich ein Maulwurf in die Erde wühlt. Man aktualisiert Begriff für Begriff, Gedanke für Gedanke, indem man jeden bewusst nach-denkt, also als Koordinaten für die Anschauung, das Wahrnehmen verwendet und dabei lernt, diesen Vorgang genau zu beobachten. Weil jeder Mensch das tatsächlich erst lernen und üben muss, haben Autoren, die über die Lüge schreiben, seit je eine absonderliche Freude daran, ihre Leser mit der Möglichkeit zu erschrecken, dass schließlich auch Autoren lügen können. Wenn der folgende Denkweg zu etwas führen sollte, dann zumindest zur Antwort auf die Frage, warum Lügner so oft ihre Macht überschätzen.
Aber eines nach dem anderen.
Lüge ist Macht
Ich wundere mich, daß der Mensch allezeit gerade eine Sache an dem Orte, wo er ihren Verlust bemerkt, zu finden hofft.
Jean Paul, deutscher Schriftsteller, Das Kampaner Tal (1797)
Dass unser Nachdenken über die Lüge von Anfang an befangen ist, hat mit dem Umstand zu tun, unter dem wir zum ersten Mal davon sprechen hören. Lügen ist das, was wir nicht tun sollen. Obwohl es sich vermutlich um die komplexeste Leistung handelt, zu der wir als Denkende fähig sind, hören wir keine Anerkennung dafür. Eltern geraten nicht in die übliche Verzückung, mit der die Fortschritte der Kleinen sonst begrüßt werden, und sie kommen auch nicht auf die Idee, im Kindervergleich mit der stolzen Meldung zu punkten: «Also unser