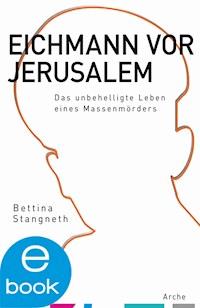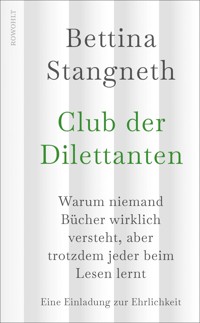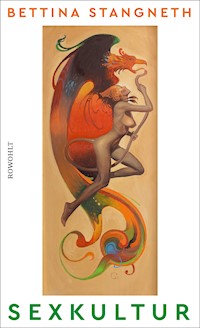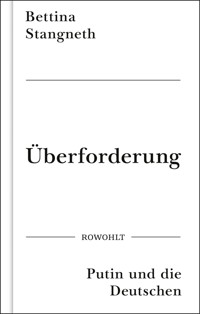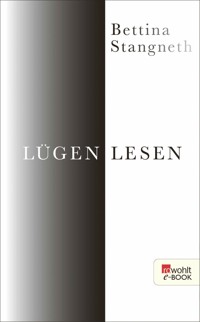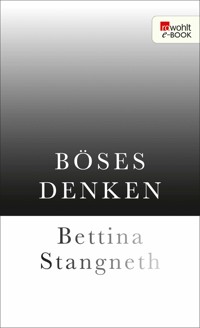9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob Lehrer oder Demagogen, Revolutionäre oder Terroristen, Kulturkämpfer oder ganz normale Selfie-Versender – sie alle eint die Hoffnung auf die Kraft der Bilder. Niemand muss nachdenken, wenn er es nicht will. Nur weil jeder Vernunft hat, steht es uns doch frei, ihr nicht zu folgen. Wer wirken will, setzt darum lieber auf die Sinne. Wer etwas ändern will, muss Zeichen setzen. Das Vertrauen in die Bildgewalt ist das Vertrauen auf die Unschuld des Sehens. Ein Bild soll leisten, was Gedanken nicht schaffen: die unmittelbare Erkenntnis. Bilderwelten können zusammenfügen, was kein Denken stiften kann: die Identität einer Gemeinschaft, das Wir. Denn hatte jemals eine Idee dieselbe Wirkung auf die Menschen wie Ideale? Konnte Vernunft je etwas ausrichten gegen Tradition und Kultur? Die Philosophin Bettina Stangneth, die hiermit den letzten Band ihrer Trilogie über das dialogische Denken vorlegt, fordert erneut dazu auf, liebgewordene Vorstellungen zu überprüfen. «Hässliches Sehen» ist ein Essay zur Frage, was eigentlich Sehen heißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bettina Stangneth
Hässliches Sehen
Über dieses Buch
«Bilder sagen nichts.»
Ob Lehrer oder Demagogen, Revolutionäre oder Terroristen, Kulturkämpfer oder ganz normale Selfie-Versender – sie alle eint die Hoffnung auf die Kraft der Bilder. Niemand muss nachdenken, wenn er es nicht will. Nur weil jeder Vernunft hat, steht es uns doch frei, ihr nicht zu folgen. Wer wirken will, setzt darum lieber auf die Sinne. Wer etwas ändern will, muss Zeichen setzen.
Das Vertrauen in die Bildgewalt ist das Vertrauen auf die Unschuld des Sehens. Ein Bild soll leisten, was Gedanken nicht schaffen: die unmittelbare Erkenntnis. Bilderwelten können zusammenfügen, was kein Denken stiften kann: die Identität einer Gemeinschaft, das Wir. Denn hatte jemals eine Idee dieselbe Wirkung auf die Menschen wie Ideale? Konnte Vernunft je etwas ausrichten gegen Tradition und Kultur?
Die Philosophin Bettina Stangneth, die hiermit den letzten Band ihrer Trilogie über das dialogische Denken vorlegt, fordert erneut dazu auf, liebgewordene Vorstellungen zu überprüfen. «Hässliches Sehen» ist ein Essay zur Frage, was eigentlich Sehen heißt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00113-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Einleitung
Das menschliche Maß
Im Angesicht Gottes
Unter sozialer Kontrolle
Vor dem unzerstörbaren Spiegel
Du sollst dir kein Bildnis machen
Das Ideal der Identität
Werte, Tugenden, Traditionen
Belehrende Geschichte
Helden und andere Opfer
Heldenkonstruktion
Die positive Karikatur
Wir suchen, also sind wir
Vom Schönen
Nachwort zur Trilogie
Dank
Die letzten sehr persönlichen Empfehlungen zum Weiterlesen
Zitat der Buchrückseite
Für Willi.
Warum fertig werden?
Wir träumten von nichts als Aufklärung und glaubten, durch das Licht der Vernunft die Gegend so aufgehellt zu finden, daß die Schwärmerei sich gewiß nicht mehr zeigen werde. Allein wie wir sehen, steiget schon von der andern Seite des Horizonts die Nacht mit allen ihren Gespenstern wieder empor. Das Fürchterlichste dabei ist, daß das Uebel so thätig, so wirksam ist. Die Schwärmerei thut, und die Vernunft begnügt sich zu sprechen.
Moses Mendelssohn, deutscher Philosoph und jüdischer Reformator, Brief (1. September 1784)
Sollte die Welt nicht schön sein? Kein Erlebnis, keine Erfahrung, keine Geschichte konnte den Menschen abgewöhnen, sicher zu wissen, was mit dieser Frage gemeint ist. Es braucht keine lange Überlegung. Uns will einfach nicht gefallen, was geschieht. Oder vielmehr: Uns gefällt nicht, was wir tun. Es ist doch kein Zufall, dass sich die Schönheit der Welt noch am leichtesten in der Einöde besingen lässt, also dort, wo kein Mensch und nichts Menschliches mehr zu ahnen ist. Aber noch der Gipfelkletterer, der für seinen Aufstieg Tage investiert, seufzt sein «Ach, die Welt ist doch schön!» mit Trotz und vor allem selten leise. Ob Selfie, Panoramafoto, ein Buch oder gleich die Talkshowtournee: Offensichtlich können wir der Welt nicht abhandenkommen, ohne in die Gemeinschaft zurückzustreben, um vom Schönen zu berichten, das wir jenseits von ihr fanden. Als wollten wir nicht nur uns, sondern allen beweisen, dass es zumindest eine schöne alte Welt gibt, irgendwo da draußen, ganz weit weg von uns. Warum nur können wir nicht so sein wie sie?
Die Absicht hinter dieser Frage ist Menschen so vertraut, dass einem das Erstaunliche daran nur allzu leicht entgeht. Wenn wir einander auffordern, uns an der Schönheit der Natur ein Exempel zu nehmen, dann wollen wir tatsächlich genau das nicht. Im Gegenteil. Wir finden die Menschheit doch gerade dann besonders hässlich, wenn sie so bleibt, wie sie ist. Uns beschleicht sogar das Gefühl, dass es besser wäre, die Welt von uns zu heilen, damit die Natur ewig schön sein kann, ungestört von einer Spezies, die einfach nicht dazulernen will. Was uns an der Natur gefallen kann, ist genau das, was uns an der menschlichen Geschichte das größte Unbehagen bereitet. Die Natur verändert sich nicht, sondern wandelt sich unerbittlich in Zyklen. Der Lauf der Sonne mit den schönen Auf- und Untergängen ist so berechenbar wie die Jahreszeiten. Tierherden, deren Bewegung uns faszinieren kann, kämpfen wieder und wieder um Territorium und Ressourcen, und keinem Vulkan, der so herrlich erhaben Feuer speit, würde es einfallen, die Lava zurückzuhalten, nur weil ein argloses Kind an seinem Hang spielt.
Die Vorstellung einer unerbittlichen Wiederkehr des ewig Gleichen erfreut im Leben und in der Geschichte nur, wenn wir diejenigen sind, die damit die Welt erschrecken, oder zu denen gehören, die ihr eigenes Tun gern als Naturgewalt tarnen möchten. Morden im Einklang mit dem Kreislauf von Werden und Vergehen wäre schließlich nur Töten, so wie auch der Fuchs die Gans holt, weil seine Natur es ihm vorschreibt – nicht der Rede, erst recht nicht der Erinnerung, also auch keiner Rechtfertigung wert. Aber noch den ärgsten Schlächter kann der Gedanke provozieren, dass alles menschliche Wollen vergeblich ist und zu gar nichts führt. Auch wenn wir wissen, wie man den Fatalismus bei Bedarf heranzitiert, wenn er als Pose nützt, sind Menschen weder begabt für das Anything goes noch für ein Laisser-faire, und noch das abgeklärteste Achselzucken über das ach so menschliche Treiben hinterlässt vor allem den Eindruck, dass sich hier nur ein Besserwisser präpariert, der hinterher schon immer alles vorher gewusst haben will.
Es mag durchaus sein, dass die Entwicklung der Zivilisation wesentlich eine Geschichte der Gewalt ist. Vielleicht war es tatsächlich das Kriegerische, das die Menschen dazu brachte, sich in Zusammenarbeit zu üben, weil niemand ohne ein Mindestmaß an Verlässlichkeit und Vertrauen gemeinsam in den Kampf ziehen und vor allem siegen kann. Man kann sich auch fragen, ob unsere Anlage zur Geselligkeit allein je gereicht hätte, um uns an Regeln und Gesetze zu gewöhnen, oder ob es dazu nicht unvermeidlich den Trieb zum Überleben brauchte. Hätten wir je unseren Erfindungsgeist so schnell geübt, wenn Werkzeugbau nicht immer auch Waffenkonstruktion gewesen wäre? Ja, es ist sogar denkbar, dass diejenigen Evolutionstheoretiker recht haben, die noch Altruismus als notwendige Folge der kriegerischen Anfänge erklären, weil schließlich nur derjenige für seine Gruppe in den Krieg ziehen kann, der bereit ist, sein eigenes Leben für das der anderen zu opfern. Unbestreitbar ist allerdings, dass Menschen dieses Bild der Gemeinschaft als Trutzburg und Kampfallianz schon lang nicht mehr gefällt. Wir, die talentiertesten Zweckrationalisten unter allen Lebewesen, wollen am Ende doch mehr sein als Werkzeugbauer und Überlebenskämpfer. Vor allem wollen wir unbedingt einen anderen Vater aller Dinge als den Krieg. Sosehr man die Einrichtung unserer Natur auch bewundern und fasziniert erforschen kann, begegnen wir dennoch jeder Theorie mit Skepsis, die Zivilisation und Kultur allein auf Naturgesetze zurückführt und Entwicklung grundsätzlich als Evolution beschreibt. Uns ist das Überleben nicht genug, und sei es auch noch so geschickt. Anders gesagt: Uns interessiert nicht nur, was nützlich ist. Der Anspruch, den wir an uns stellen, ist ein anderer als die Frage nach dem biologischen Erfolg, was nicht weniger heißt, als dass wir tatsächlich von Maßstäben wissen.
Wer von Gesetz, Maß und Ordnung weiß, kann sich auch Gesetz, Maß und Ordnung geben – nach dem Vorbild der Natur, aber zu einem eigenen, einem menschlichen Zweck.
Wenn Menschen dazu entschlossen sind, dass etwas nicht mehr sein soll, überwinden sie es, auch wenn es Jahrtausende Bestand hatte. Wir agieren nicht nur aus Trieben oder Tradition, sondern auch aus Prinzip. Sobald wir es wollen, können wir Sexualität reglementieren und kein Fleisch mehr essen. Wir konnten für den Frieden aufrüsten und für den Frieden abrüsten, die Prügelstrafe einführen und Energiespargesetze aufstellen, Kriege ächten und uns auch dazu entschließen, noch dem aufgeschlossen zu begegnen, was wir nicht kennen. Der Einzelne hat ebenso wie die Gemeinschaft die Freiheit zur Neuausrichtung gegen die Gewohnheiten der Vorfahren, womit noch nichts darüber gesagt ist, wie wir das Ergebnis dieser Verabschiedung von Tradiertem im Einzelnen beurteilen. Die für ihre unerschütterliche Nüchternheit gelobten Hamburger rissen Anfang des 18. Jahrhunderts den Mariendom ab und buddelten sogar die Fundamente aus, weil sie das vormalige Gotteshaus nicht mehr heilig, sondern nur noch entbehrlich fanden und vor allem den Platz samt Baustoff anderweitig für das Gemeinwohl verwenden wollten. Reste des einst mächtigen gotischen Prachtbaus finden sich heute unter einem Park, der zuvor ein Parkplatz war, im Namen eines Hamburger Jahrmarkts und im Röhrenbau der Kanalisation. Die Berliner hingegen bauen ein Stadtschloss wieder auf, obwohl die Deutschen seit hundert Jahren keinen Kaiser mehr haben und mehrheitlich auch keinen vermissen. Aber wenn uns Derartiges möglich ist, warum nicht auch die Ausrichtung unseres Lebens an der Vernunft?
Nun kann ja, wer die menschliche Gesellschaft über einen größeren Zeitraum betrachtet, durchaus Fortschritte auf dem Weg zu einem vernünftigen Gemeinwesen ausmachen. Der immer alarmistisch dröhnenden Tagesaktualität zum Trotz gab es in der Geschichte der Menschheit nie so viele Staaten mit freiheitlicher Verfassung und öffentlichen Schulen wie heute. Keine Generation vor der unseren hat sich Gedanken über nachhaltiges Leben gemacht und internationale Gerichtshöfe etabliert. Nie war Wissen so nah wie das nächste Smartphone, und zu keinem Zeitpunkt unserer Geschichte konnten so viele Menschen lesen und schreiben und auch den größten Unsinn sagen. Es spricht einiges dafür, dass Sigmund Freud zurecht auf eine gewisse Eigendynamik der menschlichen Denkfähigkeit vertraute: «Die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat», heißt es 1927 in seiner Schrift Die Zukunft einer Illusion. «Am Ende, nach unzähligen oft wiederholten Abweisungen, findet sie es doch. Dies ist einer der wenigen Punkte, in denen man für die Zukunft der Menschheit optimistisch sein darf, aber er bedeutet an sich nicht wenig. An ihn kann man noch andere Hoffnungen anknüpfen.»
Wenn es nur nicht so langsam ginge. Und wenn da vor allem nicht die unvermuteten Rückschläge wären.
Der Mensch kann noch so viel über das Vernünftige wissen und noch so genau erkennen, was das Richtige wäre, sobald es aber ans Handeln geht, zwingt ihn rein gar nichts, sich an sein eigenes Wissen zu halten. Wir sind so radikal frei, dass uns noch nicht einmal unsere tiefsten Überzeugungen binden. Vernünftig sein und moralisch handeln wollen heißt noch lange nicht, es auch zu tun. Auch werden Kinder geboren und damit immer wieder Menschen, die gar nichts von Aufklärung wissen. Und dann sind da noch diejenigen, die zwar aufgeklärt sind, aber ihre Mündigkeit allein als Willkür, ohne Verpflichtung auf die Vernunft, wollen und lieber den totalen Krieg predigen. Es gibt das böse Denken. Die Anti-Aufklärung rüstet auf und kann sich des Beifalls derer sicher sein, die von unvernünftigen Einrichtungen profitieren. Natürlich warnen die Krisengewinnler seit je am lautesten vor dem großen Crash. Je düsterer die Dystopie, je blutiger die Vorboten des Weltuntergangs, je talentierter die Ablasshändler, desto zahlungswilliger sind die Ängstlichen. Nach dem schlichten Diebstahl hat sich wohl kein Unternehmen als so einträglich erwiesen wie das Geschäft mit der Apokalypse und der dazugehörige Handel mit Versicherungen, Alarmanlagen, Notrationen und Utensilien zur Selbstverteidigung. Kein Wunder also, dass die Verteidiger der Vernunft schon lange nach einer Möglichkeit suchen, ihrerseits gegenzurüsten und dem Intellekt schneller Gehör zu verschaffen, bevor die Aufgeregtheit der anderen so dekorativ wird, dass auch die eigene Zuversicht wankt.
Aufklärer waren von Anfang an für den Gedanken empfänglich, dass es vielleicht doch mehrere Wege zur vernünftigen Gestaltung der Welt geben könnte als das mühsame Warten auf die Selbstrationalisierung der Menschen zu mündigen Individuen. Als Wesen, die aus der Geschichte lernen können, wissen wir nämlich längst, dass jedes Warten Opfer kostet, die auch die Wartenden zu verantworten haben. Die Suche nach Abkürzungen, also Mitteln, der Vernunft nicht nur rational Eingang in das menschliche Verhalten zu verschaffen, hat natürlich auch damit zu tun, dass es auf Dauer ziemlich langweilig ist, vernünftig zu sein, einem also auch beim besten Willen die Motivation abhandenkommen kann. Es macht keinen Spaß, es ist nicht verwegen und so wenig originell, dass man sich nicht einmal mit seinem Andersdenken oder seinem regionalen Exotismus profilieren kann. Mit Ausnahme der wenigen Momente in der menschlichen Geschichte, in denen der Common Sense die Unvernunft feiert und darum die letzten Vernünftigen wie Helden aussehen lässt, ist es auch nicht gefährlich. Vernünftig zu handeln provoziert nur selten, fühlt sich aber vor allem nicht nach dem großen Abenteuer an, über das sich Bücher schreiben lassen. Es reicht nicht einmal, um damit im Alter auf Familienfeiern Eindruck zu schinden. Auch wenn Handeln aus Vernunft der Inbegriff von Selbstbestimmung ist, hat es doch so gar nichts mit Selbstverwirklichung gemein, weil es wesentlich mit Selbstüberwindung zu tun hat. Erfahrungsgemäß empfinden es nur die wenigsten als lustvoll, Diener der Vernunft zu sein, auch wenn es ihre eigene ist. Warum nicht die Menschen verführen und besonders hartnäckige Fälle auch übertölpeln, also quasi heimlich noch diejenigen umprogrammieren, die sich gegen eine Orientierung an der Vernunft wehren? Zwar ist die Manipulation eigentlich zu verurteilen, weil es offensichtlich unmoralisch ist, die Unmündigkeit anderer auszunutzen. Aber wenn es die Verbesserung der Menschenwelt doch leichter macht und dazu verhelfen könnte, dass uns das Erscheinungsbild der Menschheit nicht mehr so peinlich ist? Oder dass wenigstens Bürger, die das Glück haben, in einem Staat mit vorbildlich vernünftiger Verfassung zu leben, auch etwas Vernünftiges wählen? Was bei Kindern erlaubt ist, die wir auch an das richtige Verhalten gewöhnen, lange bevor sie es verstehen können, sollte doch, so der sozialpädagogische Ansatz, auch unter Erwachsenen vertretbar sein, wenn wir uns über die Vernünftigkeit des Ziels einig sind. Dass Menschen sich nicht aus eigenem Willen, sondern sozusagen aus Versehen aufklären, wäre ein geringer Preis, und das nicht nur, weil am Ende das freie, das mündige Individuum steht, denn auch das ist nur der Anfang.
Es geht ja nicht nur darum, den einen oder anderen für die Kultivierung seiner eigenen Erkenntnisvermögen zu begeistern, damit es zumindest für einen kleinen Club der Anständigen reicht, die sich im herrschaftsfreien Diskurs und vor allem im Herabsehen auf alle anderen üben. Es geht nicht um eine gönnerhafte Popularisierung der Philosophie. Es geht um die Frage, wie sich ein Wir schaffen und erhalten lässt, das dauerhaft zusammenhält, weil es das bessere Bindemittel hat. Denn das Streben nach Selbsterhaltung und Erfolg, die Notwendigkeit der Versorgung und Sicherheit für Leib und Besitz, ja sogar gute allgemeine Lebens- und Erwerbsbedingungen konnten Rückfälle nachweislich nicht verhindern. Zweckbündnisse sind schließlich nur Gelegenheitsverbindungen, und wer sie eingeht, ist allein darum für Versprechen einer besseren Gelegenheit immer empfänglich. Wer nach einem Wir fragt, das wirklich eines ist, sucht nicht weniger als die Menschheitsidentität, die etwas ganz anderes ist als ein sich von Fall zu Fall zusammenraufender Haufen aus diversen Gruppen von Menschen, die gerade mal wieder schmerzhaft erfahren, dass sich manche Probleme auf einem begrenzten Planeten doch nicht aussitzen oder allein und mit ein wenig Folklore lösen lassen.
Entgegen einer beliebten Unterstellung ist Aufklärung nicht nur ein Glückseligkeitsversprechen von ewigem Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle. Wobei einem schon in dem Fall wenig einfiele, was dagegen spräche, es sei denn, man gehört zu den Zeitgenossen, denen die Diesseitigkeit dieses Konzepts zu nüchtern ist, weil die Träume vom jenseitigen Paradies die unerfreuliche Tatsache erträglicher machen, dass jeder sterben wird, oder weil faire Lebensverhältnisse einen um die Lust an der Übervorteilung anderer bringen. Es geht um viel mehr. Der Ruf nach allgemeiner Mündigkeit und Vernunftorientierung ist nicht zuletzt der Vorschlag, ein unerhörtes Experiment zu wagen: sich mit der ausdrücklichen Absicht zusammenzutun, einmal herauszufinden, was Menschen erreichen können, wenn sie sich ganz auf das verlassen, was jedem unabhängig vom Glück seiner Geburt gegeben ist. Schließlich weiß bis heute niemand, was wirklich menschenmöglich ist, wenn wir Angeborenes und traditionell Überkommenes, also die vielerlei Kulturen in ihrer ganzen Zufälligkeit, tatsächlich konsequent dem einzigen Maßstab unterwerfen, den weder Geschichte noch Kultur verändern können, sodass er bei allen Menschen vorausgesetzt werden kann: der Vernunft. Wir haben noch keine Gemeinschaft auf dem Versprechen aufgebaut, einander einfach nur darin zu unterstützen, Wissen zu sammeln, jederzeit das zu tun, was man als das Richtige erkannt hat, und alles andere dem Einzelnen und seinem Privatleben zu überlassen. Bisher hat sich die Menschheit trotz viel Verstand doch mit mehr Glück als Willen durchgemogelt. Ja, man kann es wie der Skeptiker Immanuel Kant tatsächlich für eine wundersame Einrichtung der Natur halten, dass die Menschheit überhaupt etwas zustande bringt, was wenigstens von Zeit zu Zeit vernünftig aussieht. Denn bisher, so seufzte der große Philosoph 1795 in seiner Schrift Zum ewigen Frieden, kommen Menschen offensichtlich nur «nach vielen Verwüstungen, Umkippungen und selbst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, was ihnen die Vernunft auch ohne so viel traurige Erfahrung hätte sagen können».
Wer jetzt einwerfen möchte, dass doch schon allein die Vorstellung, es könnte sich je etwas ändern, hoffnungslos naiv sei, sollte vorsichtig sein, und das nicht nur, weil der Ausgang dieses Experiments noch aussteht. Erfolgreicher waren die Theoretiker der Resignation jedenfalls selbst nicht: Was auch immer Menschen bisher angestellt und sooft wir auch versucht haben, uns von der Nutzlosigkeit oder sogar irreführenden Wirkung der Vernunft zu überzeugen – wir hören die Stimme des Intellekts immer noch. Auch wer die Vernunft am liebsten als kranke Vorstellung verbieten und das Gerede von Moral und Wahrheit abschaffen möchte, kann das nur, weil er weiß, wovon die Rede ist. Jeder, der es weiß und dennoch behauptet, ohne Vernunft auch nur ein einziges Argument vorbringen zu können, der lügt oder ist bestenfalls sich selbst gegenüber nicht aufrichtig. Menschen fragen immer noch nach Moral, und wer den Verzicht auf moralisches Fragen fordert, beweist allein damit, dass er sehr wohl von der Möglichkeit weiß, Denken und Handeln einer Norm zu unterwerfen, denn sonst könnte er uns auch sein eigenes Denken gar nicht anempfehlen. Eine kategorische Forderung zum Verzicht auf kategorische Forderungen ist offensichtlich Unfug. Vernunft schafft sich nicht ab. Und allem menschengemachten Grauen zum Trotz haben wir immer noch das sichere Gefühl, dass die Welt nicht so schön ist, wie sie es sein könnte, wenn wir unsere eigene Vernunft ernster nehmen würden.
Genau diese eigentümliche Verknüpfung vom Guten und Wahren mit dem Schönen weckt seit je eine Hoffnung. Wenn dem Menschen das vernünftige Handeln und die Aufrichtigkeit im Urteil über die eigenen Möglichkeiten so schwerfallen, könnten wir dann nicht stattdessen auf das zurückgreifen, was uns offensichtlich viel leichter fällt, nämlich auf unsere Empfänglichkeit für das Schöne? Ließe sich also der Mensch vielleicht mehr auf seine Vernunft ein, wenn sie nicht als strenge Mahnung stetig schrillte, sondern in einer anziehenden Gestalt daherkäme, mit der wir gern Schritt halten wollen, weil das Bildnis, das wir uns von ihr machen, uns endlich für sie einnimmt? Könnten wir dann aus Interesse am Wohlgefallen sogar lernen, unsere Vernunft zu lieben? Dann wäre es geradezu selbstverständlich, das Richtige und Gute zu tun, weil uns das Falsche und Böse ganz ohne jede Überlegung so hässlich vorkäme, dass wir davor sofort angeekelt zurückschreckten wie vor einem verwesenden Kadaver.