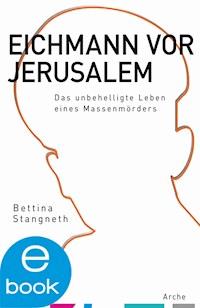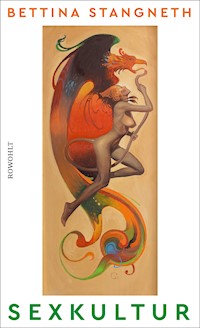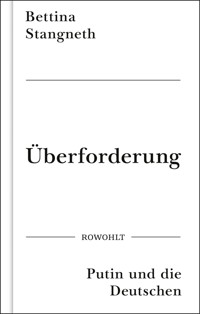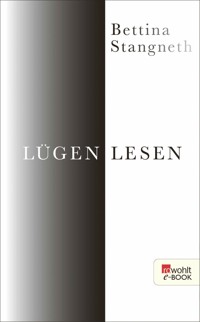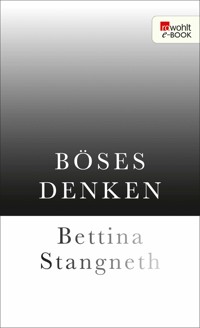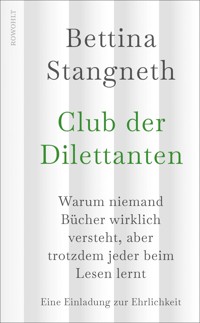
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Stangneth ist eine glänzende Schreiberin ... und eine elegante Denkerin.» DLF Wenn die PISA-Studie wieder einmal mit dem Ergebnis Schlagzeilen macht, dass Kinder immer weniger lesen können, ist das Geschrei groß. Man könnte beinahe vergessen, was die Gemüter heutzutage doch offenbar viel mehr erschreckt: Leser, die nicht das Richtige lesen oder doch an Bücher geraten, die sie falsch verstehen könnten. In einer Zeit, in der Autoren unberechenbare Leser fast so sehr fürchten wie Redaktionen und Verlage jedes verfängliche Wort und sogar über Beipackzettel für Klassiker nachdenken, die man nicht einfach umschreiben kann, muss die ketzerische Frage gestellt werden: Wie konnte man je darauf kommen, dass ausgerechnet Lesenkönnen zum Ideal des mündigen Bürgers gehört, wenn Bücher so gefährlich sind, dass sie sogar zum Risiko für die Demokratie werden können? Warum genau hat unsere Kultur so großen Wert darauf legt, dass Kinder überhaupt lesen lernen? Genau das fragt die Philosophin Bettina Stangneth und gibt eine überraschende Antwort: Wir sind nicht ehrlich zueinander, wenn wir vom Lesen sprechen. Statt vor falschen Büchern zu warnen, sollten wir davon erzählen, was Lesen wirklich ist und wie man jedes Buch mit Gewinn lesen kann. Nämlich nicht eingeschüchtert. Sondern vor allem habgierig – wie die Philosophen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bettina Stangneth
Club der Dilettanten
Warum niemand Bücher wirklich versteht, aber trotzdem jeder beim Lesen lernt
Eine Einladung zur Ehrlichkeit
Über dieses Buch
«Stangneth ist eine glänzende Schreiberin … und eine elegante Denkerin.» DLF
Wenn die PISA-Studie wieder einmal mit dem Ergebnis Schlagzeilen macht, dass Kinder immer weniger lesen können, ist das Geschrei groß. Man könnte beinahe vergessen, was die Gemüter heutzutage doch offenbar viel mehr erschreckt: Leser, die nicht das Richtige lesen oder doch an Bücher geraten, die sie falsch verstehen könnten.
In einer Zeit, in der Autoren unberechenbare Leser fast so sehr fürchten wie Redaktionen und Verlage jedes verfängliche Wort und sogar über Beipackzettel für Klassiker nachdenken, die man nicht einfach umschreiben kann, muss die ketzerische Frage gestellt werden: Wie konnte man je darauf kommen, dass ausgerechnet Lesenkönnen zum Ideal des mündigen Bürgers gehört, wenn Bücher so gefährlich sind, dass sie sogar zum Risiko für die Demokratie werden können? Warum genau hat unsere Kultur so großen Wert darauf gelegt, dass Kinder überhaupt lesen lernen?
Genau das fragt die Philosophin Bettina Stangneth und gibt eine überraschende Antwort: Wir sind nicht ehrlich zueinander, wenn wir vom Lesen sprechen. Statt vor falschen Büchern zu warnen, sollten wir davon erzählen, was Lesen wirklich ist und wie man jedes Buch mit Gewinn lesen kann. Nämlich nicht eingeschüchtert. Sondern vor allem habgierig – wie die Philosophen.
Vita
Bettina Stangneth, geboren 1966, ist unabhängige Philosophin. Sie studierte in Hamburg Philosophie und promovierte über Immanuel Kant und das radikal Böse. Für ihr Buch «Eichmann vor Jerusalem» erhielt sie 2011 den NDR Kultur Sachbuchpreis; die «New York Times» zählte es zu den besten Büchern des Jahres. Bei Rowohlt erschienen zuletzt ihre hochgelobten Essays «Böses Denken» (2016), «Lügen lesen» (2017) und «Hässliches Sehen» (2018) sowie die Bände «Sexkultur» (2020) und «Überforderung» (2023). Stangneth erhielt 2022 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Willi Winkler
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-02119-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Was aber geschieht, wenn der Leser irgend etwas ans Licht bringt, das der Autor nicht sagen konnte und niemals hätte sagen wollen und das dennoch der Text mit absoluter Klarheit auszusagen scheint?
Umberto Eco, Lector in fabula (1979/1987)
Ihr Besuchsprogramm
einige Zeilen, in welchen die Leser den dezent nahegelegten Verdacht hinterfragen könnten, ob die Gastgeberin etwa auch sie zu den Dilettanten zählt, aber in jedem Fall ganz allein dafür verantwortlich bleiben, wenn sie das kränkend fänden.
samt einem vorsorglich gereichten Mittelchen gegen Klaustrophobie oder Vertigo, je nachdem, ob man auf Straßenhöhe hineintritt und die Lawine herabfallender Bücher fürchtet oder den Lift nimmt und auf dem Rang sonst angeschwindelt die Augen schließt. Hilft eventuell auch gegen die Angst vorm Scheitern angesichts des unvermeidlich Aussichtslosen.
auch wenn es ebenso gut ein Irrgarten oder ein Spiegelkabinett sein könnte. In jedem Fall aber der Ort für jedes hoffnungslose Unterfangen, also untauglich für diejenigen, die sich in Zelten nur unbehaust fühlen und immer auf der Suche nach einem Palasthotel sind. Vor den draußen herumlungernden Straßenhändlern mit allzu günstigen Luxusuhren wird ausdrücklich gewarnt.
je nach Neigung in der Rolle des Anklägers auf der Suche nach dem Verbrecher oder als eifriger Verteidiger eines fälschlicherweise Verdächtigten, aber keinesfalls auf der Bank des Nebenklägers als verführte Unschuld oder gar Betrugsopfer. KIs erlaubt. Scharfrichter unerwünscht.
nur mit Sicherheitspersonal, eindeutig erkennbar an unzähligen Blessuren und der Gabe, mit gefährlichen Tieren zu sprechen, wenn auch nicht mit allen. Das Verbleiben in Sichtweite der Mitarbeiter wird dringend empfohlen. Jedenfalls auf den ersten Metern, bis man sich an das Tragen der Schutzkleidung gewöhnt hat.
Erste Achtsamkeitsübungen für Raum, Zeit und den besonderen Wert von Messgeräten vor Bildschirmen und in anderen künstlich beleuchteten Räumen. Aufenthaltsdauer: höchstens 30 Minuten.
Führung durch die Clubräume, je nach Lage mit Aussicht in die Gärten oder den wild belassenen Hinterhof. Zugangsberechtigung für Erwachsene jederzeit auch ohne eingetragene Mitgliedschaft. Für mögliche Folgekosten der auf unabsehbare Zeit kaum ausbleibenden Razzien können wir leider keine Verantwortung übernehmen.
«Über die Kunst, mit Büchern zu leben, ohne die Welt zu verlieren.»
Gerade weil es dem Gast jederzeit freisteht, den Besuchstag ohne Begründung abzubrechen, wird freundlich empfohlen, Zeitpunkt und konkreten Anlass zum eigenen Gebrauch schriftlich festzuhalten. Taschen werden beim Verlassen des Hauses nicht kontrolliert.
Wegzehrung für den Heimweg liegt im Anschluss zum Mitnehmen bereit.
Zum Empfang
Es war einmal die größte Hoffnung: Wenn die Menschen nur erst alle lesen könnten! Wenn nur erst alle Zugang hätten zum Wissen, zum Denken, zum Schwärmen aller wirklichen und möglichen Zeiten! Was könnte eine solche Welt der Bücher und Leser je anderes sein als das Paradies auf Erden? Oder doch immerhin die Garantie für eine unaufhaltsam besser werdende Welt? Und auch wenn sie einander trotz wachsender Bibliotheken die gleichen Wölfe blieben wie am Anbeginn der Menschenzeit; obwohl sie die Welt nicht zuletzt mithilfe ihrer Bücher immer effektvoller zu verheeren lernten als jeder Heuschreckenschwarm; so träumen sie bis heute davon, doch etwas Besseres zu sein als die Tiere. Zumindest irgendwann. Die Menschen – sie wären so gern die Hoffnung der Welt, also hießen sie einander lesen. Aber dann kamen immer mehr Leser und mehr Schreiber als jemals zuvor. Es kam das 21. Jahrhundert.
Was ist da schiefgelaufen?
Sind wir vielleicht einfach nur zu ungeduldig?
Lesen ist eine unverzichtbare Kulturtechnik, wenn etwas aus uns werden soll. Das sagt man uns schon vor der Schulzeit. Erst wer Lesen und Schreiben kann, hat eine echte Chance zum besseren Leben, zu Karriere und Teilhabe an Wohlstand und Gesellschaft. Nur wer es nicht nur kann, sondern dann auch wirklich weiterliest, kann helfen, die Welt voranzubringen. Jahrhundertelange Erziehung hat diese Überzeugung fest in den Köpfen verankert. Erst als lesender Mensch ist man tatsächlich ganz Mensch, denn nur so kann man sein Potenzial voll ausschöpfen. Dass es einmal Zeiten gab, in denen Schriftliches vor allem misstrauisch beobachtet wurde und man sich darum sorgte, wie schnell sich die Schriftlichkeit verbreitete und die Mündlichkeit mehr und mehr verdrängte? Den Heutigen kommt es nur noch befremdlich vor, sich ausgerechnet Sokrates, den weisen Philosophen im alten Griechenland, als überzeugten Skeptiker des Niederschreibens vorzustellen. Dass es aber tatsächlich genau so war, das wissen wir aus Büchern. Da haben wir es doch schon ganz weit gebracht?
Vielleicht können ja einfach immer noch nicht genug Menschen lesen? Oder wir sind sogar schon in einer Zeit des Niedergangs, des schleichenden Verlusts der allgemeinen Lesewilligkeit?
Aller Angst vor den neuen Medien zum Trotz können heute so viele Menschen lesen wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Tatsächlich bekam die Schrift mit der Verbreitung digitaler Geräte einen noch viel größeren Stellenwert. Es ist noch reizvoller, Lesen und Schreiben zu können. Schon kleine Kinder sind mit dem Nutzen der Buchstaben viel früher konfrontiert als die Generationen vor ihnen. Eltern, die vor dem Schlafengehen aus Büchern vorlesen, machen zwar neugierig auf dieses seltsame Ding «Buch». Aber die allgegenwärtigen Erwachsenen, die überall so ausdauernd auf ihren kleinen blinkenden und piepsenden Geräten herumtippen, lassen die Kleinen ganz schnell lernen, wie man genauso darauf herumtippt. Schließlich würde man auch ohne Hilfe an die begehrten Filmchen und lustigen Spiele herankommen, die einem die Erwachsenen zeigen, wenn Kinder den Alltag stören. Inzwischen wurden die Geräte kindgerechter. Der einst ganz neue Reiz der Buchstaben könnte also auch nur ein Übergangsphänomen gewesen sein. Was wird geschehen, wenn die Sprachein- und -ausgaben immer besser funktionieren? Wenn man erst mit allen Haushaltsgeräten einfach sprechen kann, wann immer man etwas von ihnen will, und nichts mehr tippen muss? Wie attraktiv fänden die Kleinen dann noch Buchstaben, die man außerdem erst viel mühsamer lernen muss, wenn Nuscheln und Brabbeln reicht? Man schaut nicht nur in unserem Land mit Sorge auf die Ergebnisse jedes neuen Lesetests in unseren Schulen, besonders im internationalen Vergleich. Schön wär’s, wenn die Computer den Kindern nicht das Lesen abnehmen, sondern es ihnen auch dann noch beibringen würden, wenn den Erwachsenen Zeit und Geduld ausgeht. Andere Länder und Kulturen in der Welt sind uns in Deutschland immerhin beneidenswert weit voraus. Die gefürchteten Tests bringen es schonungslos an den Tag. Es besteht also Aussicht, dass wir nur wieder etwas hinterher sind, wenn es um Digitalisierung geht. Oder wird dann unsere neue größte Hoffnung einfach: Wenn die Menschen nur erst alle zuhören und verständlich sprechen könnten und wenn dann noch das letzte Ding in unserer Welt eine verlässliche Spracherkennungstechnik hätte? Vielleicht wäre es eine gute Idee, rechtzeitig ins Ohrenschutz-Business zu investieren. Oder auf jeden Fall in mehr Erzieher und Lehrer. Vor allem aber sollten wir damit aufhören, immer nur auf das Internet zu zeigen, wenn wir Gründe für etwas suchen, das schiefgeht. Das ist doch offensichtlich zu wenig.
Bei aller Hoffnung auf die Leser blieben die Bemühungen, allen Menschen das Lesen beizubringen, nie ohne Kritiker und ihre Warnungen. Wenn insbesondere Büchern eine Zauberkraft innewohnt, die Welt zu verändern, ist diese Kraft doch vermutlich nicht immer ungefährlich? Natürlich hat es große Vorteile für den Staat und manchmal auch nur für den Fürsten, wenn die Offiziere sich durch schriftliche Befehle sicher führen lassen, wenn die Menschen im Land die geltenden Gesetze nachlesen können und möglichst jeder den eigenen Steuerpflichten nachkommen kann. Aber musste man dann nicht auch überwachen, was Menschen sonst noch mit ihrer Lesefähigkeit anstellen? Es ist doch schon merkwürdig: Warum sehen gerade juristische Veröffentlichungen und Abgabenformulare oft so aus, als hätten ihre Verfasser dabei an alles Mögliche gedacht, aber nicht an eine Lesbarkeit für alle? Ob es um die eifersüchtige Bewahrung des Herrschaftswissens geht, man die allgemeine Transparenz irgendwann doch fürchtet oder sich vor allem um die Schutzbefohlenen sorgt: Ob vor dem gemeinen Volk zu verbergende Bücher und Dokumente, die für die Einsicht gesperrt blieben – Leseschikanen wurden in der Geschichte immer wieder durchgesetzt. Wenn Mitleser unerwünscht sind, drohen je nach regionalen Gepflogenheiten drastische Mittel, jemanden am Lesen zu hindern. Wie stark muss der Glaube an die transformierende Kraft des allgemeinen Lesens aber erst bei denen sein, die nicht nur bestimmten Gruppen den Zugang zu Bibliotheken versperren, sondern ihnen gleich von vornherein jede Möglichkeit beschneiden wollen, überhaupt Lesen zu lernen? Wer erst einmal das Lesen lernt, so glaubten doch offenbar auch die Sklavenhalter im 19. Jahrhundert, ist auf Dauer nur noch schwer zu halten. Lesen setzt Kräfte frei, die man nicht unterschätzen darf. Auch ein Nationalsozialist wie Heinrich Himmler hielt es für wünschenswert, dass zur Sicherung seines erträumten Rassenparadieses die Polen das Lesen und Schreiben künftig nicht mehr beherrschen würden. Wer sich heute fragt, ob der erhoffte Fortschritt der Menschheit vielleicht deshalb ausgeblieben sein könnte, weil inzwischen zu viele Menschen alles lesen können, also darüber nachdenkt, ob es nicht doch besser wäre, den Zugang zu Medien wieder einzuschränken, weil er an überflüssige oder sogar an gefährliche Bücher glaubt, die besser gleich wegsollten, glaubt zweifellos an die Macht der Bücher, hat aber nicht nur sympathische Vorgänger. Bei allem pädagogischen Eifer ist es nützlich, das nicht zu vergessen.
Immer wenn eine Idee über viele Jahre so bestechend einfach klingt, ist selbstverständlich noch etwas ganz anderes zu befürchten: Sie war anfänglich ganz anders gedacht. Natürlich hat man nicht zu allen Zeiten auch wirklich alle Menschen gemeint, wenn man sich vorstellte, was aus der Welt werden könnte, wenn denn erst alle Menschen lesen könnten. Bei all dem Gerede vom Menschen als der Krone der Schöpfung – so viel Vertrauen hatten wir dann doch nie in unsere eigene Spezies, nur weil der eine oder andere sich selber durchaus für auserwählt hielt. Frauenzimmer? Bauernvolk? Dienerschaft? Der Schuhmacher und die Arbeiter? Jede Zeit und Kultur und nicht zuletzt die Kulturschaffenden kennen Gruppen, die nur in seltenen Ausnahmefällen mitgemeint sind, wenn sie an die echten, die richtigen, die Wunschleser denken. Man muss ja doch erst einmal den Nutzen berechnen, um die anderenfalls hohen zusätzlichen Bildungskosten zu rechtfertigen. Außerdem: Was hat das Denken für eine Macht, wenn jemand ohnehin keine Stimme hat und nicht einmal wählen kann? Musste man sich wirklich um jeden kümmern, wenn die Geschicke der Welt doch in den Händen der Mächtigen viel besser aufgehoben sind? Je näher man den Machthabern steht, desto leichter fällt es, eine Art Kernmenschheit für die ganze zu halten. Abgesehen davon waren die Nichtdazuzählenden meist auch Nichtzahler, sind also nicht mal die Zielgruppe für das Angebot von Bücherschreibern.
Klassendenken ist in jeder Erscheinung elitär. Gerade das verstärkt aber kurioserweise den Optimismus, auf Wandel zu hoffen, und das besonders, wenn es um den Fortschritt der Menschheit geht. Natürlich ist die Veränderung der Wenigen schneller und einfacher zu erreichen, wenn es sich dabei um eine weitgehend homogene Gruppe handelt. Der Rest wird ihrer Lenkung schon wie immer folgen. Wer wirklich glaubt, dass es nur auf ihn selbst und die Seinen ankommt, sieht also tatsächlich auch weniger Probleme. Wenn ich und nur ich in meiner Vorstellung die Menschheit bin, bräuchte ich beim Aufschreiben meiner Gedanken zur Veränderung der Menschheit doch auch nicht mehr an Leser zu denken. (Wobei ich selber dummerweise auch mein Leser bin, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, aber zu diesem eigentümlichen Phänomen kommen wir später.) Als Martin Luther die Bibel fürs Volk übersetzte, meinte er natürlich zunächst die Fürsten und die Prediger, dann vielleicht noch den vorlesenden Hausvater und erst zuletzt die hörende Gemeinde. Als Immanuel Kant sich politische Reformen erträumte, hoffte er auf das «ethische Gemeinwesen» und meinte damit zunächst einmal die Korrespondenzpartner der publizierenden Intelligenz. Noch wenn Wissenschaftler eine «Revolution» ausrufen wollen, geschieht das traditionell zunächst in Fachzeitschriften und auf Kongressen ihres Fachgebiets. Und natürlich verspricht das eine deutlich schnellere und einfachere Verbreitung als die Aufgabe, wirklich alle Menschen überzeugen zu müssen, die dann erst einmal verstanden haben müssten, wovon überhaupt die Rede ist. Beim besten aufklärerischen Willen sind es dann doch die Wenigen, die die Welt wirklich schneller und weiter voranbringen. Es fragt sich dann nur, ob der Rest der Menschheit das am Ende auch für einen Fortschritt hält.
Genau darum sind wir ja heute so erschrocken, wenn der Verlust der allgemeinen Lesekompetenz droht. Schon wenn in den Nachrichten vom angeblich abnehmenden Interesse an Büchern die Rede ist, beunruhigt das nicht selten auch diejenigen, die allenfalls kurz vor dem Einschlafen noch drei Seiten schaffen und schon seit Jahren das gleiche Buch auf dem Nachttisch liegen haben. Hinter der reflexhaften Sorge steckt mehr als die jahrhundertelang gepflegte Neigung, das Buch für den Inbegriff eines Kulturguts zu halten. Es ist auch nicht nur ein gedankenlos vorgeführter Ritus, wenn Menschen endlose Bücherwände immer wieder ungeheuer beeindruckend finden. Es geht nicht nur um eine demonstrative Pose, wie ein Gebildeter zu erscheinen. Da ist vor allem die Erfahrung jedes Einzelnen, wie sprunghaft die Anforderungen an uns inzwischen gestiegen sind. Wenn man sich die Demokratie wirklich als Gemeinschaft der Mündigen denkt, die sich jeder für sich ihrer Verantwortung bewusst sind: Was könnte das denn anderes bedeuten, als dafür den allzeit neugierigen, den jederzeit bestens informierten Bürger vorauszusetzen, der stets zumindest auf der halben Höhe der Probleme seiner Zeit ist und dazu noch jederzeit der verlässliche Repräsentant seiner eigenen kulturellen Identität? Zumal weil mit diesen «Problemen» auch so supereinfache Dinge wie der verantwortungsvolle Umgang mit der Klimaveränderung und die Organisation des Alltagslebens unter Pandemie-Bedingungen gemeint ist. Schon bei alltäglichsten Pflichten wie dem Griff ins Supermarktregal scheinen regelmäßige Recherchen ratsam, um nicht versehentlich zum Opfer einer gewinngetrieben-experimentierfreudigen Lebensmittelindustrie zu werden. Wie genau findet man denn nun schnellstmöglich pädagogische Konzepte für die multikulturelle Ansammlung von jungen Menschen mit dem Durcheinander der ganzen Erwachsenen-Welt auf einem kleinen Bildschirm in der Hosentasche? Wir müssen die jungen Menschen doch besser auf die Welt vorbereiten, damit sie nicht so an der Menschheit verzweifeln wie wir? Schließlich sollten wenigstens sie den Mut in der Irritation finden, ohne den sich mit absoluter Sicherheit gar nichts je ändern wird. Wo findet man all die Antworten, die man heute als Erwachsener schon für die Antworten bräuchte? Gäste, die das erste Mal auf einen Tee vorbeikommen und sich unvermutet in einer Privatbibliothek finden, seufzen gewöhnlich: «Ach, ich müsste auch unbedingt mehr lesen!»
Dass immer jemand schuld sein muss, wenn sich unsere Hoffnungen nicht reibungslos erfüllen, obwohl sie sich doch realistisch anfühlen, gehört zur Natur dieses menschlichsten aller Denkerlebnisse. Wer nicht nur Hoffnung verkündet, sondern sogar noch die passende Handlungsanweisung mitliefert, spricht nicht nur von eigenen Erwartungen oder träumt einfach nur laut. Es ist ein verbindliches Versprechen. Man muss einfach nur den Empfehlungen folgen, dann wird sich die Wirkung schon zeigen, sogar wenn die Hoffnung auf nicht weniger zielt als die Veränderung des Menschen und damit die Transformation der Menschheit zu etwas Besserem als dem Augenschein. Eine Hoffnung zusammen mit dem Patentrezept zu verbreiten, das ist ein Sparvertrag mit Zinsversprechen. Wenn der Erfolg ewig auf sich warten lässt, ist Schlimmeres zu befürchten als nur enttäuschte Rückfragen. So droht die größte Gefahr noch jeder Hoffnung: der Zweifel. Ohne Vertrauen in ein ganzes Handlungskonzept, also auch auf alles, was darin investiert wurde, fehlt irgendwann die Finanzierung. Was wir für wahr halten, bildet den Boden, auf dem wir bauen, und die Brücken, auf die wir uns für viele Wege verlassen. Wer das Vertrauen verliert, erlebt wortwörtlich, wie viel in unserer Welt längst nur auf Vertrauen gestützt worden ist. In den Verdacht zu geraten, ein Scharlatan gewesen zu sein, der allzu viel versprochen hat, ist aber auch entsprechend unangenehm. Das verführt immer dazu, Möglichkeiten zu finden, um noch ein bisschen länger alle anderen dafür zu schelten, dass sie halt einfach den Anweisungen nicht folgen. Es mag ja so sein, dass heute viel mehr Menschen lesen gelernt haben, aber sie lesen eben einfach noch nicht richtig. Sie haben einfach noch nicht verstanden, was man liest oder wie man das tun muss, sind zu schnell oder zu langsam, suchen nur das billige Vergnügen dabei oder gehen zu wenig in die Tiefe des Textes, der Sätze, der Wörter. Kurz gesagt: Sie bilden sich nur ein, dass sie schon wirklich lesen können. So kann es halt auch nichts werden, oder? Das klingt schon darum nicht vollends abwegig, weil Lesen für die meisten erwachsenen Menschen traditionell eine sehr intime Beschäftigung ist, bei der einem niemand über die Schulter schaut – ganz im Unterschied zum Lesenlernen, das im vollen Licht der Klassenzimmeröffentlichkeit vor sich geht, wo man Rede und Antwort zu stehen hat, was man warum mit einem Text und schließlich mit ganzen Büchern anstellt. Wer weiß also schon, ob die erwachsene Leserschaft überhaupt anderes tut, als über die Seiten hinwegzuträumen? Dilettanten allerorten.
Übrigens schön, dass Sie da sind!
Wäre das alles hier ein Beitrag zur Literaturgeschichte, würde ich Ihnen jetzt von Goethe und Schiller erzählen. Natürlich auch, weil sogar noch der ärgste Bildungszweifler davon ausgeht, dass die meisten Menschen hierzulande gelernt haben, wenigstens so zu tun, als wüsste man, wer die beiden sind. Also es begab sich im Jahr 1799, dass die mittelalten Männer einen herrlichen Freundes-Abend damit verbrachten, hemmungslos über den Niedergang der Lesekultur und wohl auch die Verkaufszahlen zu schimpfen. Die Bücher auf dem Buchmarkt werden immer mehr und nicht besser, die Leser dafür immer dümmer. Statt anständige Zeitungen mit fortschrittlichen Literatur-Experimenten von blitzgescheiten Autoren wollen sie nur Lesefraß, und das möglichst schnell und in Serie. Die Möchtegern-Kollegen sind allesamt Schnellschreiber und es droht der Welt die absolute Verblödung. Ausgerechnet der eigene Schwager reitet die Welle mit seinen Ritterromanen. Hier der unersättliche Bedarf der Binge-Reader – und herrje! erst der ganzen jungen Frauen, die neuerdings auch lesen wollen! Auf jedem Sofa liegen sie mit Liebesromanen! –, da der Reiz des leichtverdienten Geldes, dazu die auf Nachschub drängenden Verleger. Eine einzige Abwärtsspirale. Die beiden Freunde hecheln beim guten Wein alle Autoren und gleich noch Theaterleute und sonstige Künstler durch, die man schon bei flüchtigen Begegnungen nicht erträgt, wenn man anderes vom Schreiben erwartet. Und wenn der geldgebende Fürst einen wieder mal zwingt, noch seine peinlichste Geliebte auf die Bühne zu lassen, nur weil sie sich ernsthaft für eine große Schauspielerin hält, die dann doch nur wieder die eigenen Stücke verhunzt, muss man doch jetzt mal sagen dürfen, dass offenbar längst allen der Sinn für Qualität und Expertise abhandengekommen ist. Zu allem Überfluss greift der Irrsinn auch noch in der Wissenschaft um sich. Als wäre die Zeit der Laienprediger nicht schon schlimm genug gewesen.
Es ist nicht überliefert, aber es spricht alles dafür, dass es dann Goethe war, der etwas anderes versuchen wollte, als zu schimpfen: Könnte man das wachsende allgemeine Interesse nicht nutzen? War all diese Begeisterung und die Freude am Lesen und Denken und Herumforschen wirklich nur schädlich? Oder könnte es nicht vielleicht von Nutzen sein, wenn auch die Menschen sich nur zu gern mit etwas beschäftigen, was sie nur halb können und auch nie lernen werden? Der Plan ist sofort skizziert und eine Arbeit von zwei so berühmten und bewunderten Genies über den Nutzen und Schaden der Dilettanten für alle Künste und Wissenschaften passt auch ganz hervorragend zum eigenen neuen Zeitschriftenprojekt. Eine auflagensteigernde Aufmerksamkeit wäre ihnen zweifellos sicher gewesen, denn Schimpfen verkauft sich noch immer am besten. Dass die Streitschrift am Ende dennoch über Tabellen nicht hinauskam, lag offenbar daran, dass die beiden sich nicht einig waren. Schiller mochte sich einfach nicht damit anfreunden, dass dieser Hang zum enthusiastischen Gestümper auch nur zu irgendetwas zu gebrauchen sein könnte. Sein Freund hingegen gab nach einigem Nachdenken zu, dass er sich bei allem Spaß doch nicht nur wohl bei dem Unternehmen fühlte. Schließlich, schrieb er Schiller am 29. Mai 1799, würde die Arbeit über Dilettantismus sie beide unvermeidlich in eine schwierige Position bringen, «denn es ist nicht möglich die Unarten desselben deutlich einzusehen ohne ungeduldig und unfreundlich zu werden». Nicht einmal Schillers Aufmunterung, es hätte sie beide doch bisher noch nie gereut, sich mit dem Publikum anzulegen, konnte Goethe offenbar umstimmen. Bei allem Spaß an ihren vorherigen Scharmützeln: Diesmal wollte er nicht mit allen Waffen gegen die Leser in den Krieg.
Goethe hielt sich und Schiller zwar für geniale Götterkinder, aber er wusste doch ebenso gut, wie viel Freude es ihm jedes Mal machte, neue Dinge auszuprobieren, obwohl er davon eindeutig zu wenig Ahnung hatte. «Es ist eine so angenehme Erfahrung», bekannte er zehn Jahre später, aber da war Schiller bereits tot. Goethe dilettierte gelegentlich weiter und vermisste seinen anspruchsvollen Waffenbruder bis zum Ende seines Lebens schmerzlich.
Man wäre gern dabei gewesen bei ihren Gesprächen. Aber mich hätten sie entweder gar nicht erst hineingelassen oder doch spätestens dann wieder herausgeworfen, wenn ich ihnen gesagt hätte, dass es doch nicht den geringsten Grund gibt, unfreundlich zu werden, wenn man über Dilettanten schreibt. Es sei denn, man wäre gern ungeduldig und unfreundlich zu sich selbst. Denn niemand versteht Bücher wirklich. Auch diese beiden Götterkinder nicht. Und vermutlich läge ich schon auf der Straße, wenn ich ihnen erzählt hätte, dass ich davon überzeugt sei, die Menschen würden immer weiter Unheil anrichten, solange man das Buch, ja, auch seine eigenen Bücher, derart unterschätzt. Als wenn Menschen alles verstehen müssten, nur weil es Menschenwerk ist! Falsche Bescheidenheit ist es dennoch nicht, wenn jemand von sich behauptet, nie ein Buch wirklich verstanden zu haben. Auch nicht nach einem Leben, in dem jemand sicher mehr Bücher gelesen hat, als die meisten der eigenen Leser verdaulich fänden, und dennoch im nächsten Leben, wenn er die Wahl hätte, wieder so viele Bücher lesen würde. Echte Bücher natürlich, nicht nur digitale Datensätze.
Was wird das jetzt?, könnten Sie sich fragen. Vielleicht doch nur die geschickt verpackte Klage eines Büchermenschen, der hoffnungslos in altes Papier verliebt ist, Computer generell nicht mag oder die Zeichen der Zeit nicht wahrhaben will? Dass Bücher der Vergangenheit angehören, ist eine Erzählung, die man sogar in meinem Alter schon lange gehört hat, bevor man selber unter die Autoren geraten ist. Geglaubt habe ich es tatsächlich nie. Es wird auch niemand freiwillig auf gedruckte Texte verzichten, wenn man erst einmal verstanden hat, wie groß die Unterschiede sind und wie man sie für sich nutzen kann. Eine Zeit lang dachten zwar auch sehr kluge Menschen, dass der Mensch mit E-Books genauso gut klarkäme, wenn man nur erst an sie gewöhnt sei. Aber Schweden hat letztes Jahr nicht zufällig in seinem Schulsystem das Experiment des papierlosen Klassenzimmers fürs Erste wieder beendet. Nur weil ältere Leser tatsächlich schnell auch Vorzüge in digitalen Texten entdecken, ist es gar nicht mehr ausgeschlossen, dass man den Jungen nicht etwas Wesentliches vorenthält, wenn sie nicht auch mit Büchern anfangen dürfen. Was natürlich jetzt keine Ausrede dafür bieten soll, sich nicht mit der Frage nach Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen! Aber wenn Sie selber nicht so tief in der Buchwelt stecken, verrate ich Ihnen auch gern gleich, warum kein Autor wirklich etwas gegen E-Books haben kann: Die werten Käufer können es nicht weiterverkaufen und nicht mal verschenken, ohne noch einmal dafür zu zahlen. Der Text lässt sich noch im Nachhinein korrigieren und sogar aus der Ferne einfach wieder löschen. Vor allem aber bekommen Autoren für diese herrlich flüchtigen Datensätze auch noch deutlich mehr Geld. Also sollten Sie jetzt diesen Text auf einem digitalen Endgerät lesen, nehmen Sie bitte bei allem stillen Bedauern für Ihr Geschick meinen tief empfundenen Dank!
Wenn Sie dieses Buch in seiner klassischen Form vor sich haben und niemandem davon erzählen, wird auch niemand jemals herausfinden, was Sie damit treiben. Keiner wird es protokollieren, Ihr Tun benoten, auch keine Blättergeschwindigkeit oder Augenbewegung aus- oder bewerten und nicht einmal Kenntnis davon nehmen, ob Sie es bis zum Ende geschafft haben oder nicht. Ihr Buch wird verlässlich bleiben, was es ist, während sich die Welt verändert und im Idealfall auch Sie. Ja, sogar dann, wenn der nächste machtvernarrte Spinner daherkommen wird – denn das werden sie bis ans Ende aller Zeiten tun –, um Bücher wieder aus dem Verkehr zu ziehen, kann er es nicht mit einem Klick aus allen Bibliotheken gleichzeitig löschen. Er wird wie von alters her erst alle Exemplare einzeln einsammeln und verbrennen müssen. Das allein ist doch gar nicht wenig, oder?