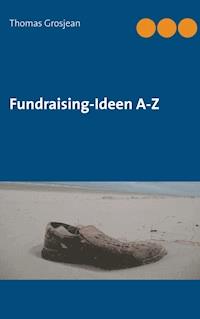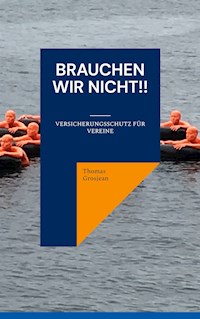
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gibt einen leicht verständlichen Überblick über die Versicherungsmöglichkeiten für Vereine. Neben dem Thema Haftung des Vereins und der Organe werden alle relevanten Felder des Versicherungsschutzes beleuchtet. Anhand von Checklisten kann der eigene Versicherungsbedarf strukturiert analysiert und organisiert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Was ist hier interessant?
Lohnt sich das Lesen überhaupt?
Wir passen doch auf! Haftpflichtversicherung?
„Wie war das nochmal mit der Haftung?“
„Die Haftung ist doch für Ehrenamtler beschränkt!“
„Ist doch alles versichert!“
Vereinshaftpflichtversicherung
Veranstalterhaftpflichtversicherung
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
D&O-Versicherung
„Ich habe doch eine Privathaftpflichtversicherung!“
Alles im Topzustand! Gebäudeversicherung?
„Was kann denn so eine Gebäudeversicherung?“
„Alles Eigenleistung! Kostet doch nur Material!“
„Erkläre doch noch einmal Unterversicherung!“
Die kleine Schatzkiste / Deckungserweiterungen
Hier ist nichts Wertvolles! Inhaltsversicherung?
Schutz vor Einbruchdiebstahl –Was muss ich wissen?
„Gibt es hier auch Deckungserweiterungen?“
Es geht immer weiter! Ertragsschadendeckung?
„Was gibt es denn konkret an Entschädigung?“
Heißes Eisen Betriebsschließung!
Wird eh immer billiger! Elektronikversicherung?
„Was kann eine Elektronikversicherung denn genau?“
Unverwüstlich! Maschinenversicherung?
„Gibt es auch Ertragsausfall bei Maschinen?“
Hat man natürlich! Erneuerbare Energien?
„Ist doch kein Problem! Installieren + Kassieren!“
„Was steckt in so einer PV-Anlagen-Versicherung?“
Wir streiten nicht! Rechtsschutzversicherung?
„Viel zu kompliziert! Wir brauchen mal Beispiele!“
„Police kam gestern. Wir haben den ersten Schaden!“
„Was ist im Schadenfall zu tun?“
„Wir haben einen Geschäftsführer!“
„Doch nicht alles versichert?“
„Wieso noch Spezial-Straf-Rechtsschutz versichern?“
Haftpflicht reicht aus! Kfz-Versicherung?
„Kein Vereinsfahrzeug? Fahre ich mit meinem Auto!“
„Es war nicht nur Blech! Unfall mit Personenschaden!“
Der kurze Weg! Transportversicherung?
„Zahlt denn nicht die Kfz-Versicherung?“
Alle ehrlich! Vertrauensschadenversicherung?
„Unsere Leute kennen wir!“
„Externe Schaenstifter? Erzähl mal!“
Regelt doch die IT! Cyberrisk-Versicherung?
„Wir sind nur kleiner Fisch; bei uns lohnt es nicht!“
„Welche Schäden können denn überhaupt passieren?“
„Was hilft denn eine Versicherung?“
„Unsere Mitarbeiter nutzen auch private Geräte!“
Jeder zahlt! Forderungsausfallversicherung?
„Macht eine Versicherung gegen Ausfälle Sinn?“
Unbekannt! Bürgschaften vom Versicherer?
Wir auch? Versicherung als Reiseveranstalter?
„Sind wir denn ein Reiseveranstalter?“
„Welche Alternativen gibt es?“
Bei uns sind doch alle gleich! AGG?
„Worum geht es denn überhaupt im AGG?“
„Das soll uns erst einmal einer beweisen!“
Ist doch geregelt! Unfallversicherung?
„Wem nutzt die gesetzliche Unfallversicherung?“
„Müssen wir uns darum als Verein kümmern?“
„Zum Glück haben wir nur Ehrenamtliche!“
„Warum eine betriebliche Unfallversicherung?“
„Was beinhaltet eine private Unfallversicherung?“
Hat sowieso jeder! Krankenversicherung?
„Da gibt es doch diese Zusatzversicherungen!“
„Das interessiert auch unsere Ehrenamtlichen!“
Macht jeder selbst! Betriebliche Altersvorsorge?
„Welche Pflichten haben wir denn hier wieder?“
„Das ist doch wieder total kompliziert!“
„Wer bezahlt denn diese Vorsorge?“
„Nutzt das überhaupt etwas?“
Und jetzt? Die Umsetzung im Verein!
„Das sehen wir Mitglieder aber ganz anders!“
„Wer kann uns denn unterstützen?“
Checklisten zur eigenen Analyse
Checkliste 1 Bestandsaufnahme
Checkliste 2 Gesamtübersicht
Checkliste 3 Haftungsrisiken
Checkliste 4 Mitarbeiter
Checkliste 5 Entscheidungsfindung
Checkliste 6 Versicherungsangebote einholen
Checkliste 7 Fundraising
Quellennachweis
Lohnt sich das Lesen überhaupt?
Sollten Sie dem Buchtitel uneingeschränkt zustimmen und jeglichen Versicherungsschutz für ihren Verein verneinen, dürfen sie das Buch zur Seite legen und sich über einen Fehlkauf ärgern. Beschleicht sie das Gefühl, dass die Absicherung des Vereines durch Versicherungen einen Sinn machen könnte, dann lesen sie bitte weiter.
Dieses Buch gibt eine leicht verständliche und strukturierte Übersicht über die möglichen und sinnvollen Versicherungen für den Verein. Die Aufzählung wird nicht komplett sein, da sich der Versicherungsmarkt ständig bewegt und weiter entwickelt.
Angesprochen sind alle Vereine, die Zwecke des §52 AO Abgabenordnung verfolgen. Auf die Wiedergabe des Gesetzestextes wird verzichtet. Ein Blick in die eigene Satzung verschafft Gewissheit.
Auch für andere Vereinsformen, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs und UGs sowie Genossenschaften können die Ausführungen zu den verschiedenen Versicherungen hilfreich für den eigenen Versicherungsschutz sein.
Nutzen sie dieses Buch als Quelle zur eigenen Entscheidungsfindung. Nach dem Erkenntnisgewinn folgt der Entscheidungsprozess, der innerhalb des Vereines stattfindet. Hier stehen sich naturgemäß Kosten und Nutzen gegenüber.
Neben den fachlichen Ausführungen zu den speziellen Versicherungen sind am Schluss des Buches einige praktische Checklisten angefügt. Sie dienen der kurzen Skizzierung der Themen sowie als Gedächtnisstütze bei den eigenen strategischen Überlegungen.
Trotz sorgfältiger Recherchen und Darstellung nach bestem Wissen stellt dieses Buch nur eine Hilfestellung dar. Daraus leitet sich keinerlei Haftung für den Autor oder den Verlag ab. Getroffene oder unterlassene Versicherungsabschlüsse unterliegen ausschließlich der Verantwortlichkeit des Vereines bzw. seiner Organe.
Die Entscheidung liegt bei Ihnen!
Wir passen doch auf! Haftpflichtversicherung?
„Wie war das noch mal mit der Haftung?“
Der Einwand der Sorgfalt und Vorsicht ist immer wieder ein vermeintlich starkes Argument, um die Prämie für die ach so teure Vereinshaftpflichtversicherung usw. einzusparen. Aber der Teufel steckt im Detail! Haftung und Haftpflichtversicherung sind komplizierte Sachverhalte, bei denen nicht immer der gesunde Menschenverstand ausreicht. Der Verein und die Organe haften für Schadensersatzansprüche, die berechtigterweise vorgebracht werden.
Über welche Haftungsszenarien sprechen wir überhaupt und wer kann Ansprüche stellen? Haftung und somit ein Schadensersatzanspruch entsteht durch ein Tun oder Unterlassen eines Organes oder Vereinsmitgliedes gegenüber Dritten. Hierbei kann es sich um Außenstehende als auch Vereinsmitglieder handeln, die einen Schaden erlitten haben und Schadensersatz fordern können. Die Gründe für Schadensersatzansprüche sind vielfältig und lassen sich oftmals erst in einer gerichtlichen Auseinandersetzung abschließend klären, wenn die Anerkennung einer Haftung abgelehnt oder bestritten wird.
Dr. Rafael Hörmann, Rechtsanwalt der Campbell Hörmann Partnerschaftsgesellschaft, München hat die Haftung sehr übersichtlich dargestellt:
1. Haftung der Vereinsorgane gegenüber Dritten (Haftung im Außenverhältnis)
a. Deliktische Haftung
Hier geht es um die schuldhaften Handlungen und Unterlassungen, die zu einem Schadensersatz führen können. Geregelt sind diese Bestimmungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) § 823 Abs. 1+2 sowie § 826. Darunter fallen unter anderem Körperverletzung, Diebstahl, Betrug, Untreue, vorsätzliche und sittenwidrige Schädigung.
b. Rechtsgeschäfte Haftung
Das Eingehen von Rechtsgeschäften hat immer Konsequenzen für die beteiligten Parteien. Überschreitet zum Beispiel ein Vorstandsmitglied oder besonderer Vertreter des Vereins seine Kompetenzen, löst dies Schadensersatzansprüche bei Vertragsstörungen aus.
c. Spendenhaftung
Fehlerhafte Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen) und / oder falsch verwendete Spendenmittel lösen eine Haftung nach § 10b Abs. 4 Einkommenssteuergesetz (EStG) aus. Die Haftungshöhe sind 30% der Spendenbeträge.
d. Steuerrechtliche Haftung
Die Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, Abgabe von Erklärungen, Erteilung von Auskünften und die Pflicht zur Steuerzahlung obliegt dem Vereinsvorstand.
e. Sozialversicherungsrechtliche Haftung
Beiträge für Arbeitnehmer sind rechtzeitig und korrekt abzuführen. Hierfür hat der Vorstand Sorge zu tragen.
f. Insolvenzhaftung
Eine zu späte oder gar unterlassene Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Vereins stellt ein erhebliches Haftungsrisiko für den Vorstand dar.
2. Haftung der Vereinsorgane gegenüber dem Verein (Haftung im Innenverhältnis)
Beginnen wir mit der Betrachtung von Haftung im Außensowie Innenverhältnis. Die Brisanz liegt darin, dass der Verein und die handelnden Personen des Organs sowie besondere Vertreter in eine gesamtschuldnerische Haftung geraten. Der Geschädigte kann sich also aussuchen, gegenüber wem er den Schadensersatz geltend machen möchte. Die betroffenen Personen haften unmittelbar und mit ihrem gesamten Privatvermögen. Als Vorstand oder Organmitglied kann sie also schnell eine Forderung persönlich treffen!
„Die Haftung ist doch für Ehrenamtler beschränkt!“
Das Ehrenamtsstärkungsgesetz hat in 2013 und danach klärende Regelungen zur Haftung von ehrenamtlichen Organen gefunden. Im § 31a+b BGB ist geregelt, dass es besondere Regelungen für Organe und Vereinsmitglieder gibt. Wichtig ist, dass die Ausübung des Ehrenamtes unentgeltlich erfolgt bzw. maximal die Ehrenamtspauschale von derzeit € 720 Anwendung findet.
Der Verein haftet für Schäden, die durch ein Organ oder Vereinsmitglied verursacht werden. Ausgeschlossen hiervon sind Vorsatzhandlungen oder grobe Fahrlässigkeiten. Wird ein Organmitglied oder Vereinsmitglied persönlich vom Geschädigten in seinem Privatvermögen in Anspruch genommen, entsteht ein Anspruch auf die Befreiung von dieser Verbindlichkeit (Zahlpflicht) durch den Verein. Spannend bleibt in diesem Zusammenhang immer die Frage der genauen Abgrenzung hinsichtlich Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und damit das Risiko der Haftung für den Verursacher mit dem Privatvermögen. Diese Problematik taucht auch auf, wenn die Befreiung von einer Verbindlichkeit durch den Verein vom Organ- oder Vereinsmitglied gefordert wird, aber kein ausreichendes Vereinsvermögen zur Befriedigung der Schadensersatzansprüche vorhanden ist. Auch dann verbleibt die Schadensersatzpflicht beim Schadenverursacher, der dann sein Privatvermögen heranziehen muss.
Die Rechtsanwältin Dr. Evelyne Menges gliedert das Thema Vorsatz und Fahrlässigkeit in dem Buch „Gemeinnützige Einrichtungen“ sehr schön auf. In Anlehnung daran eine Kurzübersicht zum besseren Verständnis:
Vorsätzliche Handlung
Die Person weiß genau, dass eine Verletzung von Vorschriften, erteiltem Auftrag oder anderen Bestimmungen bewusst stattfindet und dies auch so will.
Fahrlässige Handlung
Hierbei wird die übliche Sorgfalt nicht beachtet und angewendet. Hierbei sind zwei Arten der Fahrlässigkeit zu unterscheiden:
Bewusste Fahrlässigkeit
Der mögliche Eintritt eines Schadens wird eingerechnet, jedoch auf den Nichteintritt des Schadens vertraut.
Unbewusste Fahrlässigkeit