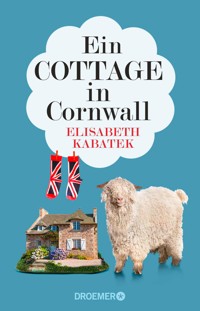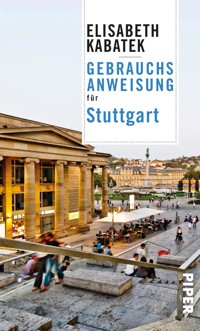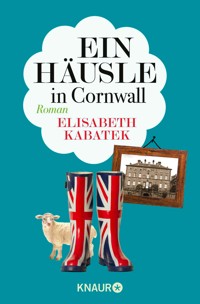Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Stuttgarterin Line und der Hamburger Leon sind ein glückliches Paar. Aber dann bricht um Line herum das Chaos aus: Ihre beste Freundin verliebt sich in den falschen Mann, Tante Dorle will nicht mehr heiraten und Lines biedere Schwester spielt mit dem Gedanken, ihre Familie zu verlassen. Und warum ist Leon plötzlich so begeistert von Einfamilienhäusern in Stuttgarter Vororten, wo es Line doch in hippe Lofts und Szene-Galerien zieht? Wieso muss sie schwimmen, joggen und Kajak fahren, obwohl sie viel lieber gemütlich Nostalgie-TV guckt? Dann taucht Tarik, der "sexiest man Stuttgarts", auf und sucht eine Muse. Leons Sandkastenfreundin Yvette bläst wieder zur Attacke und ein Abend auf dem Cannstatter Volksfest sorgt für große Liebesverwirrungen. Line wird vom Strudel der Ereignisse mitgerissen und das Beziehungskarussell dreht sich wieder ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Kabatek
Brezeltango
Roman
Elisabeth Kabatek ist in der Nähe von Stuttgartaufgewachsen. Sie studierte Anglistik, Hispanistikund Politikwissenschaft in Heidelberg, Salamancaund Granada und ist Übersetzerin für die spanischeSprache. Seit 1997 lebt sie in Stuttgart. »Brezeltango«war ihr zweiter Roman. Ihr erster Roman, »Laugenwecklezum Frühstück«, erschien 2008 und wurde aufAnhieb ein Bestseller. Eine Fortsetzung von »Brezeltango«ist unter dem Titel »Spätzleblues« erschienen.Mehr unter www.e-kabatek.de, dort auch Brezeltango-Übersetzungen aus dem Schwäbischen.
Für Laura
© 2010/2012 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Covergestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen,unter Verwendung einer Fotografievon Niels Schubert, Stuttgart.Lektorat: Bettina Kimpel, Tübingen.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1502-4E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1503-1Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-87407-984-6
Besuchen Sie uns im Internet undentdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
I love you, you’re perfect, now change
1. Kapitel
Der Mann, der zu mir passt, hat einen kleinen Bauch,eine Brille und womöglich eine Glatze auch,am Abend trinkt er Bier und schnarcht danach,liegt man neben ihm, so bleibt man lange wach.
»Mama, ich hab Hunger!«
»Gleich, Schatz. Ich muss zuerst deine Schwester wickeln.«
»Ich hab aber jetzt Hunger!«
»Dann sag’s deinem Vater.«
Ich atmete tief durch, wischte mir die fettigen Hände an meiner Schürze ab, nahm das Baby hoch und ging ins Wohnzimmer. Leon lag auf der Couch, eine halb leere Bierflasche in der Hand, und las den Kicker. Die beiden auf dem Teppich liegenden leeren Flaschen sahen aus, als würde hier demnächst Flaschendrehen gespielt. Es waren nur noch nicht genug Leute da.
»Leon!«
»Hmm.« Leon positionierte die Bierflasche, ohne hinzusehen, auf dem Gipfel des Bauchbergs unter seinem T-Shirt und konzentrierte sich weiter auf den Kicker. Das T-Shirt war so fleckig, dass man die Aufschrift »Bosch – Technik fürs Leben« kaum noch entziffern konnte.
»Leon, ich muss die Kleine wickeln und die Wäsche aufhängen. Machst du Leander was zu essen, er hat Hunger.«
»Hmja.« Leon rülpste dezent.
»Leon!«
»Hmja?«
»Leon, hörst du mir überhaupt zu?«
»Klar. Ich will nur eben den Artikel über den HSV zu Ende lesen. Dauert nur eine Sekunde.«
Leander hatte leider nicht die nordisch-entspannte Natur seines Vaters geerbt und ging jetzt auf Stufe zwei, markerschütterndes Gebrüll. »ICH – HAB – HUNGER!«
Leon drehte irritiert den Kopf in Richtung Küche. Die Bierflasche wackelte eine Millisekunde und kippte dann seitlich vom Bauchberg weg auf den Boden. Eine halbe Flasche Dinkelacker plätscherte über den zerschlissenen Teppich. Leon fuhr vom Sofa hoch und zermalmte ein paar hässliche Flüche zwischen Ober- und Unterkiefer, während Leander auf Stufe drei ging: markerschütterndes Gebrüll plus Aufreißen und Zudonnern von Küchenschranktüren.
Ich wartete nicht auf Stufe vier. Ich verschob das Wickeln und floh mit dem Baby auf dem Arm aus der Wohnung im fünften Stock hinunter in den Keller.
Vierter Stock. Frau Müller-Thurgau, im rosa Jogginganzug, mit einer brennenden Zigarette in der Hand: »Sie, Frau Praetorius! Wasch ’n des scho wiedr fir an Krach! A ganz Mietshaus tirannisiere!«
Ich rannte weiter. Dritter Stock, Herr Tellerle drohte mit der Faust. »Koi Ricksichd auf ons alde Leit!«
Zweiter Stock. Menschen, die ich noch nie gesehen hatte, zeigten mit dem Finger auf mich, zeterten und tobten, zerrten an mir und dem Baby, brüllten und schrien durcheinander: »Overschämd! Zu onsrer Zeit hätts des net gäba! Kennad Sie Ihre Kender net erzieha? Ond Kehrwoch aständig macha?«
Endlich, der Keller, die Waschküche! Ich drängte die wütende Meute hinaus, donnerte die Tür zu, schloss mit dem rostigen Schlüssel ab und drehte mich um. Aus der Waschmaschine quoll Wäsche, eine unendliche Menge an Stramplern, Höschen und Hemden, Leons Hemden, die ich alle sorgfältig würde bügeln müssen, damit er ordentlich zu Bosch ins Gschäft gehen konnte, Wäsche, immer mehr Wäsche, es nahm kein Ende, das Baby brüllte jetzt wie am Spieß, der Wäschestrom floss unaufhaltsam auf uns zu, bloß raus hier! Aber vor der Kellertür stand der Mob und versuchte die Tür einzuschlagen, das Holz splitterte, ein Besenstiel brach durch das Loch, Herr Tellerle lachte irre, ich schrie, wich zurück und stürzte, der riesige Kleiderberg deckte mich und das Baby zu, ich schrie verzweifelt, aber niemand kam mir zu Hilfe, die Wäsche hüllte mich ein in die unendliche, feuchte Dunkelheit einer Waschküche im Stuttgarter Westen, aus der es kein Entrinnen gab ...
»Line, wach auf!«
Ich fuhr schwer atmend hoch. Beruhigend legte sich eine Hand auf meinen Rücken und fuhr sanft auf und ab.
»Schsch ... Ganz ruhig, Line, du hast nur schlecht geträumt!«
Ich ließ mich erleichtert wieder in die Kissen fallen. Leon drückte mir einen Kuss auf die Stirn und flüsterte: »Du hast im Schlaf gestöhnt und geschrien. Du hast nicht zufällig von deinem feurigen Hamburger Liebhaber geträumt?«
Ich konnte Leons Grinsen im fahlen Licht des Sommermorgens deutlich vor mir sehen. Ich kannte niemanden, der so wie er jederzeit grinsen konnte, ohne vorher seine Gesichtsmuskeln aufzuwärmen, sogar gleich nach dem Aufwachen.
»Stimmt, ich habe von dir geträumt.«
Vielleicht nicht unbedingt das, was Leon sich so ausmalte. Aber sagte nicht jeder Ratgeber, dass man in einer Beziehung ein paar Geheimnisse für sich behalten sollte?
»Ach, wirklich?«, flüsterte Leon und rückte näher an mich heran.
Ich schob meine Hand auf seinen Bauch und seufzte erleichtert. Der Bauch war wie immer. Nicht der Mount Everest aus dem grässlichen Traum, sondern Leons kleiner, sympathischer Bauch an einem ansonsten vom Joggen durchtrainierten Körper. Leon nahm meine Hand und schob sie langsam tiefer, ganz allmählich entspannte ich mich und nur noch Leon und ich passten in das große Bett, der Albtraum hatte keinen Platz mehr ...
Später lauschte ich Leons Schnarchen, nachtischlöffelchenmäßig an seinen Rücken gekuschelt. Leon schnarchte nicht richtig laut, es war mehr so ein Schnürpf-pffff, wie das leise Grunzen eines neugeborenen Ferkels. Sehr gemütlich. Ich würde versuchen, nicht mehr einzuschlafen. Draußen war es jetzt taghell, und bald würde der Wecker klingeln, weil Leon zu Bosch nach Schwieberdingen musste. Es war grauenhaft, aus dem Schlaf gerissen zu werden, wenn man gerade erst wieder eingeschlummert war. Ich fühlte mich dann den ganzen Tag wie ein Zombie. Stattdessen würde ich lieber wach bleiben und den Traum analysieren. Danach würde ich mich auf Zehenspitzen aus dem Schlafzimmer schleichen, duschen, beim Bäcker Laugenweckle holen, und wenn Leon aufstand, würde es nach frischem Kaffee duften und er würde sich selbst beglückwünschen, dass er so eine großartige, fürsorgliche Freundin hatte.
Als ich wieder aufwachte, lag ich allein in dem großen Bett. Kein Wunder. Der Wecker zeigte zehn Uhr. Auf dem Fußboden – da Leon keine Bücher las, benötigte er auch keinen Nachttisch – stand eine knallgelbe Thermoskanne, daneben eine Tasse, Milch, Zucker und ein Tellerchen mit Schokoladenkeksen. Verschlafen angelte ich nach dem Zettel, der unter der Tasse lag: »Guten Morgen, meine Süße. Du hast so fest geschlafen, dass ich dich nicht wecken wollte (kein Wunder – grins). Wir sehen uns heute Abend im Kino. Freu mich auf dich! Kuss, Leon.« Darunter hatte er ein wackliges Herz gemalt.
Okay. So viel zum Thema fürsorgliche Freundin. Ich goss mir Kaffee ein, kuschelte mich mit einem Schokokeks in der einen und der Kaffeetasse in der anderen Hand wieder in die Kissen und beschloss, erst aufzustehen, wenn ich den schrecklichen Traum vollständig durchdacht und ad acta gelegt hatte. Lila hatte mir mal aus einem Buch über Traumforschung vorgelesen. Darin stand, dass man alle Träume, die man nicht bewusst bearbeitete, immer wieder träumte, bis man endlich kapierte, was sie einem sagen wollten. Ha! Das würde mir nicht passieren. Reflektiert, wie ich war, würde ich dem grauenhaften Traum sofort den Garaus machen.
Leon und ich waren gerade mal ein paar Wochen zusammen. Alles lief wunderbar. Wir waren schrecklich verliebt, konnten die Hände nicht voneinander lassen und es war einfach fabelhaft, nach einer langen Single-Phase endlich wieder einen Freund zu haben. Leon hatte beispielsweise, ohne dass ich ihn lange bitten musste, den Klokasten in Lilas Wohnung repariert!
Lila war meine beste Freundin. Vor ein paar Monaten war ich zu ihr gezogen, in ihr schnuckeliges Häuschen in der Pfeiffer’schen Siedlung im Stuttgarter Osten. Das war kurz nachdem ich mich mit Leon zerstritten hatte. Mit ihm wohnte ich vorher Wand an Wand in der Reinsburgstraße in Stuttgart-West. Im Nachhinein war der Umzug natürlich reichlich dämlich, jetzt, da Leon und ich ein Paar waren. Ich hatte aber auch keine große Wahl gehabt. Die Vermieterin, der das ganze Mietshaus gehörte, hatte mir wegen Eigenbedarfs gekündigt. Seither stand die Wohnung leer und wurde angeblich für die Nichte der Vermieterin renoviert, die an der Hochschule der Medien in Vaihingen studieren wollte. Die Nichte war aber bisher von niemandem im Haus gesichtet worden. Wie Leon im Treppenhaus von Frau Müller-Thurgau erfahren hatte, ohne dass er fragen musste, gab es nicht den leisesten Hinweis auf Renovierungsarbeiten, keine Farbeimer, keine Handwerker und keine Bohrgeräusche. Ich hatte ja von Anfang an den Verdacht gehabt, dass die Vermieterin mich loswerden wollte, weil ich arbeitslos war. Sie hatte Angst, ich könnte eines Tages meine Miete nicht mehr bezahlen.
Andererseits wohnte ich schrecklich gerne bei Lila und ihrer Katze Suffragette, auch wenn ich die beiden in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt hatte, weil ich die Abende meist bei Leon verbrachte. Lila beklagte sich mit keinem Wort. Dafür war sie viel zu großmütig und gönnte mir das Verliebtsein. Ich rechnete es ihr deshalb besonders hoch an, weil Lila selbst Single war. In der Regel sahen die Männer in ihr nur die Frau, bei der man sich so wunderbar in den Falten ihrer weiten Gewänder verkriechen konnte, wenn die Welt gemein zu einem war und sich die langbeinige neue Kollegin mit den aufreizend roten Lippen und dem Stroh im Kopf kein bisschen für einen interessierte, obwohl sie doch ganz offensichtlich ungebunden war. Lila wusste immer Rat, geizte nicht damit und blickte taktvoll über Stroh im Kopf hinweg. Ihre besondere Stärke waren Sonntagskrisentelefonate, in denen sie anderen Menschen über ebendiese Krisen hinweghalf. Ich wünschte ihr so sehr, dass endlich mal ein Mann die Vorzüge entdeckte, die sich hinter ihrem rundlichen Äußeren verbargen.
Hoppla, nun war ich ganz davon abgekommen, dass ich den bescheuerten Traum analysieren wollte. Ich schob mir einen Schokokeks in den Mund, schloss die Augen und konzentrierte mich, kam aber zu keinem Ergebnis, was die Message des Traums betraf. Leons tiefe Zuneigung hatte mein Leben verändert. Sogar das Katastrophen-Gen hatte sich einlullen lassen. Hurra! Ich würde ab jetzt ein ausgeglichener Mensch völlig ohne Chaos sein. Ich war ja schon viel ruhiger geworden. Die Natur war besiegt! Als ich Lila eifrig und stolz berichtete, dass wahre Liebe ganz eindeutig stärker war als genetische Anlagen, legte sie nur zweifelnd den Kopf schief und sagte nichts. Wahrscheinlich brauchte sie einfach ein bisschen Zeit, um sich umzustellen.
Leon hatte ich mein kleines Problemchen bisher noch nicht gebeichtet. Es gab schließlich überhaupt keinen Grund, einen soeben erworbenen Freund gleich wieder mit Hiobsbotschaften in die Flucht zu schlagen. Das Katastrophen-Gen war keine Krankheit, nur ein klitzekleiner genetischer Defekt, der manchmal ein bisschen Durcheinander produzierte oder aus heiterem Himmel Haushaltsgeräte lahmlegte. Deshalb war es sehr praktisch, einen handwerklich begabten Ingenieur zum Freund zu haben, der alles wieder reparieren konnte, sollte das Katastrophen-Gen überraschend aus seinem Dornröschenschlaf erwachen.
Warum bloß waren in dem doofen Traum Kinder aufgetaucht? Ich war vor kurzem zweiunddreißig geworden, an Nachwuchs dachte ich nicht im Entferntesten. Ich hatte auch weitaus dringlichere Probleme zu lösen. Im Februar hatte ich meinen Job als Texterin bei einer Werbeagentur in der Rotebühlstraße im Stuttgarter Westen verloren. Ich bekam zwar Arbeitslosengeld, und Leon, der als Ingenieur gut verdiente, lud mich oft großzügig ein, aber es war mir unangenehm, ihm auf der Tasche zu liegen, und die Arbeitslosigkeit machte mich rastlos und unzufrieden. In letzter Zeit hatte ich es zudem mit Bewerbungen ziemlich schleifen lassen. Höchste Zeit, sich am Riemen zu reißen! Gleich heute würde ich damit anfangen. Mit Schwung sprang ich aus dem Bett und schüttelte Leons Bettdecke auf. Leider vergaß ich dabei, dass ich Kekse mit Schokoladenüberzug gegessen hatte. Die braunen Flecken sahen ein bisschen unappetitlich aus. Aber stand nicht in vielen Kontaktanzeigen im Stadtmagazin LIFT, dass sich die Männer nach Frauen sehnten, die ihnen die Pullis klauten und das Bett vollkrümelten? Schokoflecken waren sicher genauso betörend.
Zwanzig Minuten später verließ ich frisch geduscht Leons Wohnung. Das Treppenhaus war zum Glück leer. Es hatte eine Weile gedauert, bis sich die Nachbarn daran gewöhnt hatten, dass ich nicht mehr im Haus wohnte, sondern als Besucherin kam. In schwäbischen Mietshäusern brauchten Veränderungen ihre Zeit. Vielleicht hatte es die Bewohner auch irritiert, dass nach meinem Auszug Leons Sandkastenfreundin und Arbeitskollegin Yvette eine Weile dynamisch durch den Flur gestöckelt war.
Ich öffnete die Tür zum Hinterhof, wo ich mein Rad abgestellt hatte. Es dauerte ein paar Sekunden, bis mein Gehirn die Szene einordnen konnte, die sich gerade im Hof abspielte. Mitten auf dem Asphalt stand die aufgeklappte grüne Papiertonne. In der Tonne stand Herr Tellerle aus dem dritten Stock und trampelte auf dem Tonneninhalt herum. Zumindest ließ sich das erahnen, weil man seine Beine nicht sehen konnte. Neben der Tonne stand ein nicht besonders zuverlässig aussehender Klappstuhl, den Herr Tellerle offensichtlich als Steighilfe benutzt hatte. Ziemlich gefährlich, schließlich war er nicht mehr der Jüngste. Vielleicht war Herr Tellerle in seinem früheren Leben Wengerter gewesen und stampfte deshalb das Papier wie Weintrauben in einem Bottich? Allerdings kam er ursprünglich von der Alb. Soweit ich wusste, war es dort für Wein zu rau.
»Guten Morgen, Herr Tellerle, alles in Ordnung?«, fragte ich zögernd. Möglicherweise war das ein Rückfall in die Kindheit und er benötigte therapeutische Hilfe?
»Also om drei viertel elfe isch dr Morga scho faschd vorbei. Ond en Ordnong isch gar nix, Frau Praetorius«, keuchte Herr Tellerle. »Manche Leit kabiered oifach net, dass mr Babier zammafalda muss, damid’s en Tonne bassd. Ond a Päckle muss mr hald ausnandrmacha, en Gotts Nama, noo gohd au mee nei en die Tonn. Ha, des isch doch net zviel verlangd, oder?« Herr Tellerle stampfte wütend weiter.
Der Anblick allein genügte, um mich wieder müde zu machen.
»Soll ich vielleicht noch einen Moment warten, bis Sie fertig gestampft haben, und Ihnen aus der Tonne heraushelfen?«, fragte ich unsicher. Herr Tellerle und ich hatten, um es vorsichtig auszudrücken, ein eher distanziertes Verhältnis und ich konnte nicht einschätzen, ob er meine Hilfe annehmen würde. Andererseits wollte ich nicht, dass er sich beim Herausklettern aus der Tonne den Fuß brach, weil der Klappstuhl das tat, was sein eigentlicher Job war: zusammenklappen.
Herr Tellerle schüttelte den Kopf und stampfte weiter. »I mach weidr, au wenn mir scho d’ Fieß1 wehdeen. ’s isch no net gnug Blatz en dr Tonn.«
Ich zuckte die Schultern und wandte mich zum Gehen. Die Müllmänner würden beim Leeren der Tonne ihre helle Freude an dem festgestampften Papier haben. Es kostete mich große Anstrengung, mich nicht mehr nach dem wild stampfenden Herrn Tellerle umzudrehen, besonders, als er mir hinterherbrüllte: »Sie kennad doch net oifach Ihr Rädle schdanda lassa, wenn Sie nemme hier wohnad!«
Es war viel zu heiß zum Radfahren. Schon jetzt staute sich die schwüle Luft im Kessel. Im Hochsommer erinnerte mich Stuttgart immer an den Dampfkochtopf, der mir beinahe mal um die Ohren geflogen war, weil ich vergessen hatte, vor dem Öffnen den Dampf abzulassen. Genauso entlud sich die aufgeheizte Luft regelmäßig in krachenden Gewittern. In den Stadtteilen ohne Frischluftschneisen, zu denen der Westen und der Osten gehörten, kühlte die Luft nachts kaum ab. War heute nicht der erste September? Hoffentlich bekamen wir bald trockeneres Herbstwetter.
Ich nahm die S-Bahn zur Stadtmitte, stieg in den Vierer um und am Ostendplatz wieder aus. Eigentlich war die Gegend um den Ostendplatz nicht besonders schön, auch wenn das Ambiente seit der Verlegung der U-Bahn-Haltestelle etwas ansprechender geworden war. Aber sobald ich in die Landhausstraße Richtung Teckplatz einbog, hatte ich das Gefühl, in die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts zurückversetzt zu werden. Statt Asphalt gab es hier Pflastersteine, kaum Verkehr und freundliche Backsteinhäuser, die mich mit ihren Giebeln, Erkern und Verzierungen jedes Mal persönlich willkommen zu heißen schienen. Den Teckplatz hatte man vor einigen Jahren nach dem Mäzen, der die Siedlung in Zeiten großer Wohnungsnot für arme Familien gebaut hatte, in Eduard-Pfeiffer-Platz umbenannt, aber selbst der »Friseur am Teckplatz« hatte seinen Namen behalten.
Lila, die sehr sozial eingestellt war, war stolz darauf, in der ehemaligen Arbeitersiedlung zu wohnen. Ihr Häuschen mit seinem kleinen Türmchen und den efeuumrankten Fenstern in der Neuffenstraße war das putzigste von allen. Irgendwann würde es sowieso ein Ende haben mit der Idylle, weil ich dann mit Leon zusammenziehen würde. Nicht dass wir schon darüber gesprochen hätten, dafür war es wohl noch etwas früh, aber ich stellte mir eine große Altbauwohnung mit Balkon nach hinten raus im Stuttgarter Westen vor, ohne Kehrwochentyrannei natürlich, und deutlich ruhiger als die Reinsburgstraße, wo Leon jetzt wohnte. Vielleicht fanden wir ja etwas in der Nähe vom Bismarckplatz? Unrenoviert, vermutlich, aber das war ja für Leon kein Problem. Dorle würde uns aus ihrem Bauerngärtchen Löwenmäulchen-Ableger schenken, Leon würde den Balkon bepflanzen und an lauen Sommerabenden würden wir draußen sitzen und mit Lila Chianti aus Korbflaschen trinken. Herrlich! Vielleicht schon nächsten Sommer?
Aus dem Briefkasten quoll mir neben der von Lila abonnierten Zeitschrift Die Sozialpädagogin ein bunter Haufen Werbeprospekte entgegen, obwohl auf dem Briefkastendeckel ein Robin-Wood-Aufkleber mit dem Text »Bitte keine Werbung« prangte. Praktischerweise war ein Flyer des neuen Pizza-Express am Ostendplatz dabei, der zur Einführung mit Sonderpreisen warb. Das Mittagessen war gerettet. Seit ich bei Lila wohnte, wurde ich von ihr biologisch wertvoll mit Linsen-Haferflocken-Bratlingen, Soja-Zartletten und Steckrübentopf bekocht. Okay, es schmeckte nicht schlecht, aber mein Fast-food-Pegel litt darunter. Leider teilte nicht einmal Leon meine Begeisterung für Fertigpizza und Leberkäswecken, obwohl er doch ein Mann war und sich wie die meisten Männer den größten Teil seines bisherigen Lebens kochtechnisch auf seine Mutter verlassen hatte.
Ich ließ in der Küche, die mit ihrem zusammengewürfelten Mobiliar, dem bunten Geschirr und den Flickenteppichen mehr als retro war, die Post neben den Wäschekorb auf den wackligen Küchentisch fallen. Zwischen der Werbung tauchte plötzlich ein Schreiben mit einem bunten Logo auf. Die Werbeagentur Daniel Düsentrieb mit Sitz in Bad Cannstatt schickte mir einen Brief! Nicht etwa einen großen Umschlag, dessen Format schon verriet, dass die Unterlagen zurückgeschickt wurden, oder eine Mail mit einer lapidaren Absage auf eine Online-Bewerbung, sondern einen echten Brief! Ich riss den Umschlag auf und klaubte mit zitternden Fingern eine Postkarte heraus. Auf dem Bild war ein Zauberer zu sehen, der in der einen Hand einen Zylinder und in der anderen Hand einen Zauberstab hielt, mit dem er Funken aus dem Hut sprühen ließ. Die Textseite war sehr übersichtlich. Sie bestand nur aus einem Datum und einer Uhrzeit in der nächsten Woche, einer Postadresse, einem Weblink und dem Satz: »Zaubern Sie für uns was aus dem Hut!« Yippie! Ich hatte einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in Bad Cannstatt! Komische Gegend für eine Werbeagentur. Viel lieber würde ich wie früher im Westen arbeiten.
Anscheinend musste ich mir etwas Lustiges für das Vorstellungsgespräch ausdenken, um mein ungeheures kreatives Potenzial unter Beweis zu stellen. Warum war man in der Werbung immer gezwungen, so originell zu sein? Und die Bewerbungshose, mein einziges schickes Teil, musste dringend in die Reinigung. Beim letzten Vorstellungsgespräch waren Kaffeeflecken draufgekommen. Zum Glück hatte ich noch ein paar Tage Zeit. Jetzt würde ich mir erst mal eine Pizza holen und dann nach Cannstatt fahren, um mir die Agentur von außen anzusehen. Sicherlich kam mir dann eine Inspiration, schließlich sollte man vor Vorstellungsgesprächen alle nur verfügbaren Infos einholen. Anschließend würde ich erst mal ein schnuckeliges kleines Brainstorming machen, ein paar erste Ideen mindmappen, die Homepage von Düsentrieb analysieren und daraus am nächsten Tag ein originelles Projekt entwickeln, das ich anschließend auf einer Flipchart Lila und Leon präsentieren würde. Aus dem Feedback der beiden würde ich dann das endgültige Projekt für das Vorstellungsgespräch konzipieren. Diesmal würde, ja, musste es einfach klappen.
Heute Abend würde ich dann zur Belohnung für meine konstruktive Arbeit mit Leon ins Kino gehen. Hoffentlich hatte er im Atelier am Bollwerk einen der romantischen Doppelsitzer reserviert. Was war ich früher neidisch gewesen auf die Pärchen, die auf diesen Plätzen kuschelten!
Ich marschierte über die Haußmannstraße zurück zum Ostendplatz und übte dabei schon mal das Vorstellungsgespräch. Seit es diese nahezu unsichtbaren Handys mit Knopf im Ohr gab, wurde man nicht mehr für bekloppt gehalten, wenn man Selbstgespräche führte. Der neue Pizza-Service war auf der Ostendstraße nicht weit vom Polizeirevier und wurde links und rechts von je einer der unvermeidlichen Dönerbuden flankiert. Drinnen staute sich die Hitze.
»Einmal Pizza Vier Jahreszeiten und eine große Cola«, sagte ich zu dem Mann mit der weißen Mütze hinter der Theke und reichte ihm den Bon vom Werbeflyer. »Bitte gleich in Stücke schneiden.«
Neben mir lehnte ein finsterer Typ. Seine Nase war mit einem großen Stück Verbandsmull verpflastert. Ich rückte ein bisschen ab. Hieß es nicht, alle Pizza-Betriebe in Stuttgart würden von der Mafia kontrolliert?
Das Handy des Typs klingelte. »Ja, alles gut. Vorgeschdern Nase operiert. Ja, vorher war krumm, jetzt isch grad.«
In Lilas Vorgärtchen stellte ich einen der klapprigen Gartenstühle auf den schmalen Streifen zwischen Rosen und Hecke und verdrückte die schon ziemlich abgekühlte Pizza in Rekordzeit. Der volle Bauch und die Sonne machten mich schläfrig und ich stellte in der Küche Wasser für einen starken Kaffee auf, um mich für die Herausforderungen des Nachmittags zu wappnen. Strukturiert, wie ich war, beschloss ich, die Zeit nebenher sinnvoll zu nutzen und die schwarzen Socken im Wäschekorb zu sortieren. Unglaublich, wie ähnlich sich schwarze Baumwollsocken sein konnten, und gleichzeitig so verschieden! Die einen hatten ein schmales Bündchen und die anderen ein breites, ziemlich viele hatten Löcher, und ich konnte es anstellen, wie ich wollte, immer blieb eine blöde Socke übrig, die nicht zur anderen übrig gebliebenen passte. Ich fing gerade zum dritten Mal von vorn an, da klingelte das Telefon.
»Mädle, i han dr bloß saga wella, ’s isch so arg schee, dass du jetz nemme so traurich aus dr Wäsch guggsch. Jeden Dag dank i em Herrn Jesus drfir.«
Ich bemühte mich, nicht allzu laut zu stöhnen. »Schön, Dande Dorle, dass du mal wieder drauf hinweist, dass du Leon und mich zusammengebracht hast. Ich hätt’s sonst glatt vergessen.«
War es nicht großartig, permanent daran erinnert zu werden, dass man sein Liebesleben nur mit der tatkräftigen Unterstützung seiner achtzigjährigen Großtante aus der Provinz zu regeln imstande war?
»Wenn i dr Leon net zu meim Geburdsdag eiglada hätt, noo wärsch du heit no alleinschdehend«, sagte Dorle beleidigt.
»Ich finde, der Geburtstag war so schon sensationell. Schließlich hatte niemand damit gerechnet, dass du dich an diesem Tag mit deinem 82-jährigen Freund Karle aus der Theatergruppe des Obst- und Gartenbauvereins verlobst«, stichelte ich.
So ging das Geplänkel eine ganze Weile weiter, mit geringfügigen Abweichungen zu Dorles letztem Anruf vor drei Tagen.
Ich war gerade wieder mitten in meinen Socken, als das Telefon erneut klingelte. Bestimmt hatte Dorle etwas total Wichtiges vergessen.
»Mösenfechtel, Arbeitsagentur.«
O nein! Meine Arbeitsberaterin!
»Frau Praetorius, wir haben schon länger nichts von Ihnen gehört. Was machen Sie eigentlich so den lieben langen Tag?«
»Gerade im Moment bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch nächste Woche vor«, sagte ich und ließ blitzschnell die schwarzen Socken fallen. »Außerdem wissen Sie doch, dass ich mich permanent bewerbe und schon mehrere Vorstellungsgespräche hatte.«
»Sie sind aber immer in der Endrunde aus dem Rennen geflogen.«
Klar, weil meine Mitbewerberinnen blonder, vollbusiger und charmanter waren, dachte ich grimmig.
»Es gibt im Augenblick eben wenig Jobs, wegen der Krise.«
»Danke für den Hinweis, darauf wäre ich als Ihre Arbeitsberaterin überhaupt nicht gekommen. Sie müssen sich eben allmählich umorientieren! Wenn Sie nicht demnächst etwas in Ihrer Branche finden, schlage ich Ihnen Stellen in der Gebäudereinigung oder in der Gastronomie vor, da bringe ich Sie sofort unter, und wenn Sie nicht annehmen, kürzen wir Ihnen die Bezüge.«
Großartige Perspektive! Ich sah mich im Geiste mit einem Gips am Bein, weil ich über den Putzeimer gestolpert war, oder hohe Reinigungsrechnungen bezahlen, weil ich beim Edelitaliener den Chianti auf dem Armani-Kostüm anstatt im Weinglas servierte.
»Schicken Sie uns bitte umgehend eine Kopie der Einladung zu diesem Vorstellungsgespräch!« Sie legte auf, ohne sich zu verabschieden.
Ich gab dem Wäschekorb einen wütenden Tritt.
Nun war es aber höchste Zeit für meinen Ausflug nach Cannstatt. Da der Nachmittag nun sowieso schon halb hinüber war, beschloss ich, durch den Park zur Rosensteinbrücke zu laufen. Das war ein gemütlicher, kleiner Spaziergang und dann konnte ich dort Kurzstrecke lösen und die U13 zum Augsburger Platz nehmen. Schließlich bewegte ich mich zu wenig. Fand Leon jedenfalls, der vom AOK-Stäffeles-Walk schwärmte und nicht müde wurde, auf meine schlechte Kondition hinzuweisen, besonders, wenn er sich in seinem eng anliegenden Laufdress aufmachte, um auf dem Blauen Weg zu joggen. Meist überbrückte ich die Zeit mit Nostalgie-TV und ging eigentlich nur mit, wenn ich mal wieder ungestört auf Leons sehr ansprechenden Hintern glotzen wollte. Zum Blauen Weg hinaufzuklettern war schon Sport genug. Dort wartete ich dann auf einer Bank, bis Leon mit seinen Runden fertig war. Stuttgart war einfach zu hügelig und Entspannung gehörte schließlich auch zu einem gesunden Lebenswandel. Vielleicht konnte ich diese Woche ja noch eine heimliche Trainingseinheit einlegen? Dann würde ich nächstes Mal triumphierend an Leon vorbeiziehen und den Anblick seines offen stehenden Mundes voll auskosten.
Leon. Ich würde ihm eine klitzekleine SMS schicken. Nicht zu lang, schließlich wollte ich nicht den Eindruck erwecken, ich sei emotional total abhängig von ihm. Nur so eine Denkandichdankefürdenkaffee-SMS. Leider fand ich das Handy nicht. Ich hatte es wohl in der Reinsburgstraße liegen lassen. Egal. Leon wusste auch so, was ich für ihn empfand. Ich tauschte meine Jeans gegen ein abgeschnittenes Exemplar und zog ein bauchfreies Top an. Dass ich dünn wie eine Bohnenstange war – nicht von ungefähr nannte mich mein Vater »Böhnchen« –, hatte zumindest im Sommer seine Vorteile.
1 Beim Schwaben setzen die Füße direkt an der Hüfte an. Sich hartnäckig haltende Gerüchte, wonach der Schwabe an sich ein beinloser Watschelzwerg ist, entsprechen nicht der Wahrheit. Tatsächlich ist das Wort »Beine« dem Schwaben gänzlich unbekannt, weshalb er das Wort »Fieß« für Beine und Füße gleichermaßen benutzt. Im vorliegenden Fall meint Herr Tellerle wahrscheinlich seine Beine.
2. Kapitel
I muss die Stroßaboh noh kriega,denn bloß dr Femfer brengt mi hoim.
Ich lief über die Baumann-Staffel, kreuzte die Hackstraße und gelangte nach wenigen Minuten über den Steg in den Schlossgarten. Wie immer an schönen Tagen wimmelte es hier von Spaziergängern, Inline-Skatern und Radfahrern, die den Park mit seinem prächtigen alten Baumbestand bevölkerten. Ich ging über die Brücke Richtung Neckar. Hier war es definitiv vorbei mit der Parkidylle. Vom Pragsattel herunter schob sich die Blechlawine und teilte sich weiter Richtung Cannstatt oder B 10. Auf der anderen Straßenseite umlagerten Schulklassen und Familien die Wilhelma. Weil gerade der Dreizehner an der Rosensteinbrücke hielt, spurtete ich zur Haltestelle und entging haarscharf der Stoßstange eines hupenden Daimlers.
Eine Hälfte des Stadtbahnwagens war komplett von einer lärmenden Schulklasse belegt, die gerade von einem Ausflug in die Wilhelma kam. Während die Jungs sehr authentisch den letzten Boxkampf von Juan Carlos Gómez nachstellten, sangen die Mädchen zur Musik aus ihren Handys inbrünstig »Poker Face« von Lady Gaga. Im hintersten Eck saß die Lehrerin und starrte angespannt zum Fenster hinaus. Alle übrigen Fahrgäste drängelten sich in der anderen Hälfte des Wagens zusammen.
Leider war ich noch nicht in dem Alter, wo ich sagen konnte, lasst mich bitte hinsitzen, und schwanger war ich auch nicht. Ich musste mich mit einem Stehplatz neben einem Kinderwagen begnügen. Hinter dem Kinderwagen stand der Kindsvater. Er guckte immer mal wieder in den Wagen und sagte »Dutzidutzi«. Aus reiner Gewohnheit musterte ich ihn unauffällig. Meine Single-Zeit lag ja noch nicht so lange zurück. Eigentlich sah er ganz nett aus – groß, schlank, mit dem üblichen Bauchansatz, der bei Männern ab einem bestimmten Alter unvermeidlich schien, Designerbrille – aber irgendwie auch ziemlich spießig in dem grauen Anzug, der nicht so richtig zu dem Baby passte. Wahrscheinlich brachte er es widerwillig in die Kita, weil seine Frau in einer tränenreichen Auseinandersetzung damit gedroht hatte, mit Kind und Erspartem in Rio de Janeiro abzutauchen, wenn er sich nicht mehr in die Kinderbetreuung einbrachte.
Väter mit Babys waren nicht sexy, und außerdem hatte ich ja jetzt Leon, darum schenkte ich ihm keine weitere Beachtung.
»Augsburger Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts«, sagte eine freundliche Stimme aus dem Off. Vor einiger Zeit waren in der Stadtbahn Gott sei Dank diese hilfreichen Ansagen eingeführt worden. Früher hatten sich an den Haltestellen ja geradezu tumultartige Szenen abgespielt, wenn die Leute übereinanderfielen, weil sie nicht wussten, ob der Ausstieg rechts oder links war!
Ich schob mich an dem Kinderwagen vorbei, um auszusteigen. Der Vater blickte erst mich und dann das Gefährt bedeutungsvoll an. Die meisten Haltestellen in Stuttgart waren mittlerweile barrierefrei, aber diese schien nicht dazuzugehören. Der Kerl kriegte offensichtlich den Mund nicht auf, um zu fragen, ob ich ihm helfen würde. Typisch Mann! Das kannte man ja. Konnten nicht nach dem Weg fragen und nicht um Hilfe bitten! Also packte ich, ohne lang zu fackeln, hinten an den Rädern an, er nahm den Schieber und wir bugsierten den Kinderwagen über die ausgeklappte U-Bahn-Treppe hinunter auf die Straße. Zum Glück war es so ein hypermodernes Teil mit leichtem Alugestell.
Komischerweise bedankte er sich gar nicht und sah mich stattdessen schon wieder so erwartungsvoll an, so, als sollte ich etwas sagen. Mir fiel Leon ein, der sich manchmal taubstumm stellte, weil er kein Schwäbisch konnte. Vielleicht war der Kerl auch auf den Trick gekommen oder er war wirklich taubstumm, und da ich keine weitere Zeit verlieren wollte, sagte ich: »Bitte, gern geschehen, schönen Tag noch«, sehr deutlich und vollkommen dialektfrei, damit er es mir von den Lippen ablesen konnte, und wandte mich zum Gehen.
Da kriegte er den Mund plötzlich ziemlich weit auf und rief mir hinterher: »Moment, wo wollen Sie denn hin, Sie können doch den Kinderwagen nicht einfach an der Haltestelle stehen lassen!«
Ich drehte mich verdutzt um. »Wie meinen Sie das? Was habe ich denn mit Ihrem Kinderwagen zu tun?«
»Mein Kinderwagen? Ich dachte, das sei Ihrer!«
»O Gott!«, sagte ich und spürte, wie mir die Knie schwach wurden. Katastrophen-Gen, welcome back. Es hatte nur ein bisschen Urlaub gemacht oder war in Kur gewesen. Kindesentführung, fünf Jahre Hohenasperg oder Stammheim, das fehlte noch in meinem hübschen Lebenslauf, und anstelle eines Passbildes würde ich ab sofort die erste Seite der BILD-Zeitung beilegen: »BRUTAL! Arbeits- und Kinderlose entführt aus Frust Stuttgarter Baby aus Halbhöhenlage« oder so ähnlich, und darunter ein Bild von Pipeline P., mit schwarzem Balken über den Augen, dabei waren meine Augen das Einzige, was ich an mir attraktiv fand. Ob es im Gefängnis wohl einen gut aussehenden ledigen/geschiedenen Polizeipsychologen gab, der mich ein bisschen therapieren würde und mir die Geschichte mit dem Katastrophen-Gen abnahm? Wahrscheinlich musste ich noch eine grausame Kindheit im Heim dazuerfinden.
»Wir müssen erst mal von der Straße weg«, sagte der Typ, was eigentlich ganz vernünftig klang, da die Bahn längst weg war und wir mitten auf einem stark befahrenen Platz standen, Lkw-umtost, im Gleisgewurschtel zweier sich kreuzender Stadtbahnlinien. Wir gingen nach links über die Schienen und überquerten die Straße. Zum Glück fiel mir in dem Moment ein, dass der Mann an sich ein einsamer Wolf ist und seine Probleme am liebsten im Alleingang löst, damit er sich dann an der Kneipentheke oder in der Sauna vor den Kumpels mit seinen Taten brüsten kann: »Da hab ich doch letztens diesen fremden Kinderwagen am Hals gehabt ... und diese Schnecke, die hatte wirklich keinen Plan ...«
»Hören Sie, so ein blödes Missverständnis, also, Sie kriegen das schon hin, ich bin da ganz zuversichtlich. Ich muss dann, tschü-üss.«
Er sah mich streng an. »Kommt nicht in die Tüte. Wir haben uns das zusammen eingebrockt, jetzt löffeln wir es auch gemeinsam aus.«
Ich nickte ergeben. Auch das noch. Teamworker statt lonesome cowboy. Genauer betrachtet war es ja vielleicht gar nicht so schlimm, und wenn es Leon nicht gäbe, würden wir bei unserer Goldenen Hochzeit einmal mit nostalgisch-wehmütigem Blick unseren Enkeln erzählen, wie wir uns kennengelernt hatten: »Also, er stand da wie ein Depp vor mir ...«, »... also ich dachte, ist die Frau denn vollkommen bescheuert ... und das Kind im Kinderwagen brüllte ...«
Das Kind in dem orangefarbenen Superkinderwagen brüllte tatsächlich. Ich guckte es mir zum ersten Mal genauer an. Zum Glück war es kein so ganz kleines Kind mehr, ein Mädchen oder ein Junge, und schätzungsweise zwischen zwei und zwölf Monaten alt. Die ersten Passanten drehten sich missbilligend nach uns um, weil wir Rabeneltern tatenlos zusahen, wie sich das Baby immer mehr in Rage brüllte.
»Wir müssen etwas unternehmen!«, zischte der Kindsvater, der keiner war. Wie hieß er überhaupt? Wahrscheinlich Waldfried oder Helmar oder Roger, deutsch ausgesprochen.
»Äh, ich hab’s nicht so mit Kindern«, sagte ich. »Ich steh mehr auf Pizza.«
Menschen unter sechs Jahren gehörten einfach nicht zu meiner Peergroup, und bloß weil ich die Frau war, sollte ich das Balg zum Schweigen bringen! Hatte ich es mir doch gleich gedacht, dass der Typ die Verantwortung für die Kindererziehung abwälzen wollte. Waldfried fluchte laut und ordinär, was ich sehr unpassend fand, in seinem grauen Anzug und dann noch vor dem Kind, zerrte das Kleine aus dem Wagen und schüttelte es zur Beruhigung, was uns weitere strafende Blicke der Passanten eintrug. Auch wenn ich mich mit Babys kein bisschen auskannte, hatte ich doch gewisse Zweifel, ob man sie wie einen Martini von James Bond behandeln sollte. Das Baby schien der gleichen Meinung zu sein, es würgte und spuckte empört auf Waldfrieds Jackett.
»Nicht so wild schütteln!«, sagte ich beschwörend. »Das ist bestimmt total ungesund.«
»Kannst es gern haben, wenn du’s besser weißt«, zischte er und schubste mir das Baby auf den Arm.
Aha, wir waren also zum Katastrophen-Du übergegangen. Ich kannte das schon. In Extremsituationen war selbst im förmlichen Deutschland »Sie« einfach nicht angebracht.
»Was soll ich denn jetzt machen?«, sagte ich und blickte verzweifelt auf das brüllende Bündel mit dem knallroten Gesichtchen auf meinem Arm. Es war ganz schön schwer.
»Keine Ahnung. Du bist doch die Mutter!«
»Wahrscheinlich hat es Hunger. Also Stillen übersteigt definitiv meine Fähigkeiten. Vielleicht gibt’s irgendwo ein Fläschchen?«
»Das Kind ist doch schon viel zu groß zum Stillen!«
»Ach, dann will es vielleicht laufen?«, sagte ich hoffnungsvoll.
Waldfried stöhnte. »Dafür ist es doch noch viel zu klein!«
»Zu groß, zu klein – du scheinst dich ja prächtig mit Kindern auszukennen«, sagte ich spitz. »Warum kriegst du es dann nicht ruhiggestellt?«
»Wir müssen jetzt erst mal abhauen«, flüsterte Waldfried. »Demnächst ruft jemand die Polizei.«
»Wir sollten sowieso ganz schnell die Polizei benachrichtigen. Wir können doch nichts dafür, es ist ja alles nur ein Missverständnis! Und die Mutter steht sicher Todesängste aus!« Ich versuchte, mit einer Hand in meiner Umhängetasche zu wühlen. Das Baby rutschte gefährlich tiefer. Dann fiel mir ein, dass das Handy in Leons Wohnung lag.
»Polizei? In meiner Position? Das kann ich mir nicht leisten.«
»Seit wann fahren Menschen, die eine Position haben, in Stuttgart Stadtbahn wie die Normalsterblichen?«
Er sah sich mit gehetztem Blick um und flüsterte: »Ich kandidiere für die Bundestagswahl und bin auf dem Weg zu einem Wahlkampftermin. Öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad, so wie der Boris Palmer, das kommt gut an beim Wähler. Aber einen Skandal kann ich mir absolut nicht erlauben!«
Mir kam sein Gesicht überhaupt nicht bekannt vor. Andererseits sahen die Kandidaten auf den Plakaten alle aus wie doofgeklont – Jackett, Krawatte, wenig Haare, dümmlichvolksnahes Grinsen.
Plötzlich war in der Ferne ein munteres Tatütata zu hören. Der echten Mutter musste ja auch allmählich aufgefallen sein, dass der Kinderwagen fehlte! Lange konnten wir nicht mehr fackeln. Meine Hände waren feucht vor Nervosität. Hoffentlich glitschte mir das Baby nicht aus den Fingern.
»Was machen wir jetzt?«, fragte ich panisch.
»Wir deponieren den Kinderwagen vor dem nächsten Polizeirevier. Ich kenn’ mich hier aus, das ist in der Wiesbadener Straße, gleich um die Ecke. Dann rufen wir anonym von einer Telefonzelle aus an und erklären, was passiert ist. Zur Entschuldigung schicken wir dem Kind ein Sigikid-Schnuffeltuch und die Sache ist aus der Welt.«
Geniale Idee, schließlich gab es auch überhaupt keine Zeugen. Und standen Telefonzellen nicht mittlerweile auf der Liste der bedrohten Arten? Andererseits war ich im Moment komplett ohne Position und konnte es mir nicht erlauben, ein Gerichtsverfahren an den Hals zu kriegen, auch wenn man uns am Ende ganz sicher wegen Mangel an Beweisen freisprechen würde.
Wir bogen nach rechts in eine breite Straße mit frei stehenden Häusern ein, ich mit dem Kind, das erstaunlicherweise aufgehört hatte zu brüllen, was mir einen Blick mit dem Titel »Auch-wenn-sie-es-abstreiten-Frauen-sind-von-Naturaus-hormonell-für-die-Kinderbetreuung-vorgesehen« eintrug, und er mit dem Kinderwagen. Ich versuchte, mich ganz natürlich zu verhalten, wie eine glückliche junge Mutter eben, lächelte freundlich nach allen Seiten und es fiel bestimmt kaum auf, dass er mit dem aerodynamischen Wagen überall dagegenbumperte und ich das Baby ziemlich wackelig auf den Armen balancierte.
»Wie heißt du überhaupt?«, fragte er unvermittelt. Nanu, das wurde ja auf einmal richtig persönlich.
»Ich heiße Line.«
»Caroline also?«
»Nein. Pipeline.«
Ich erntete einen dieser fassungslosen Blicke, an die ich seit 32 Jahren gewöhnt bin.
»Mein Vater war Ingenieur und hat in Russland eine Pipeline gebaut«, erklärte ich. »Dort hat er meine Mutter kennengelernt. Das Ergebnis war ich.«
Und das Katastrophen-Gen schlug zum ersten Mal zu und die Baustelle versank im Chaos, aber das sagte ich natürlich nicht laut.
»Interessant. Was hat deine Mutter dort gemacht?«
»Sie war als russische Dolmetscherin getarnt. Aber eigentlich war sie Spionin. Industriespionage.«
Das mit der Spionage war frei erfunden, aber mir war angesichts der äußeren Umstände nach einem bisschen mehr »Drama, Baby« zumute. »Und du, wie heißt du?«
»Jonathan. Meine Freunde nennen mich John-Boy.«
Nein, wie süß! Leider wurden wir in unserem netten Wie-heiß-ich-wie-heißt-Du, dessen logische Folge eigentlich Was-machst-du-was-mach-Ich und anschließend Sollen-wir-nichtmal-zusammen-was-trinken-Gehen gewesen wäre, von einem unangenehmen Geräusch unterbrochen. Tatütata, vielstimmig. Das war nicht nur ein Streifenwagen.
»Verdammter Mist«, zischte John-Boy und fiel in Schweinsgalopp.
Ich rannte hinter ihm her. Nun war es schon deutlich schwieriger, entspannt in alle Richtungen zu lächeln. Das Baby hingegen schien sich an dem flotten Tempo nicht zu stören und begann sogar, fröhlich zu gurren.
An der nächsten Kreuzung legte John-Boy eine Vollbremsung hin. »Gleich rechts ist das Polizeirevier. Wir spurten jetzt über die Kreuzung und rein in den Kurpark.«
»Das ist doch viel zu riskant«, jammerte ich.
»Nein, im Gegenteil. Alter Indianertrick. Das beste Versteck der Rothäute ist direkt vor der Nase der Bleichgesichter. Sobald alle Streifenwagen weg sind, stellen wir das Kind vor dem Revier ab und verduften.«
Das klang ziemlich schlau. Ich hatte früher nicht Indianer, sondern Doktorspiele gespielt und konnte deshalb nicht viel beitragen.
»Kannst du mal gucken, ob die Luft rein ist?«
Typisch John-Boy, den riskanten Job abzudrücken. Ich presste das Kind an mich und spähte vorsichtig um die Ecke. Zwei Beamte sprangen gerade in ein Polizeiauto. Ich zuckte zurück. Das Auto fuhr mit Blaulicht in die andere Richtung. Ich pirschte mich wieder näher heran.
»Die Bleichgesichter sind weg«, flüsterte ich.
Wir trabten über die Kreuzung direkt in den Kurpark hinein und stießen auf ein paar Bänke, die im rechten Winkel zueinander standen. Hohe Büsche würden uns vor neugierigen Blicken schützen. Perfekt! Wir ließen uns erleichtert auf einer Bank nieder, die mit dem Rücken zum Polizeirevier zeigte und von der aus man eine Art Gewächshaus sehen konnte. Ich legte das Kind in den Wagen und schüttelte meine schmerzenden Arme aus. Das Tatütata war verstummt.
»Des isch abr amol a netts Kendle!« Aus dem Nichts war plötzlich eine alte Frau aufgetaucht, die eine Vollbremsung hinlegte, als sie das Baby erblickte. Ich stöhnte innerlich. Das hatte uns gerade noch gefehlt. »Sen Sie nei zuzoga? I han Sie no gar nie gsäh. Was isch’s denn, a Mädle odr an Bua?« Sie stellte den Korb ab, den sie unter dem Arm trug, machte es sich im Stehen bequem und sah uns erwartungsvoll an.
Ich warf John-Boy einen verzweifelten Blick zu. Er sah angestrengt in die Luft, als würde er mich nicht kennen. Rabenvater! Die Farbe des Kinderwagens und der weiße Strampler halfen auch nicht weiter. Ich blickte auf das Kind. Diese weichen Gesichtszüge, das Stupsnäschen – »Ein Mädchen«, sagte ich. Im Chor mit John-Boy, der gleichzeitig den Mund geöffnet hatte, um »ein Junge« zu sagen.
Die Alte sah uns verwirrt an. Na, großartig. Nun fehlte nur noch die Frage nach dem Alter.
Ich beugte mich vertrauensvoll vor. »Wissed Se, mei Maa hätt gern an Bua ghett«, flüsterte ich. »Er muss sich no dra gwehna.«
Die Alte nickte mit aufgerissenen Augen und offenem Mund. »An Stammhaldr«, flüsterte sie zurück. »Ha, Sie sen ja no jong. Des ka ja no komma.« Sie beugte sich wieder über das Kind. »Du bisch a arg siaße Krott, gell!«
Das Kind begann zu brüllen. Blitzschnell packte die Alte das Baby. »Soll i Ihne mol ebbes verrota? Mr muss a klois Kendle mitm Kopf nach onde en d’ Armbeige halda, no schreit’s net. Des han i bei meine femf au emmr gmacht.«
Erstaunlicherweise funktionierte die Methode und das Kind war schlagartig ruhig.
Die Alte rümpfte die Nase. »Des Butzele hot an Stinker gmacht! Des ghert gwickelt!«
Tatsächlich ging ein strenger Geruch vom Babypopo aus, eine Mischung aus Zwiebeln, Knoblauch und Sauerkraut. Puuh. Langsam fing die Alte an zu nerven. Konnte sie unser junges Familienglück nicht in Frieden lassen? Außerdem war es viel zu riskant, das Baby zu wickeln. Erstens hatte ich keine Ahnung, wie man das machte, zweitens war uns die Polizei auf den Fersen und drittens – was, wenn es doch ein Junge war?
»Äh, wir gehen sowieso gleich nach Hause«, sagte John-Boy. »Wir haben auch gar nichts mit, wir wollten nur mal schnell um den Block.«
»Sie missad sichr Kurzarbeit macha«, sagte die Frau mit zitternder Stimme. »Sonschd dädad Sie ja om die Zeit schaffa, so als Maa. Des isch schlemm, des isch arg schlemm, fir so a jonge Familie. Sen Sie beim Daimler on hockad deshalb vor dr Daimler-Gedenkschdäd?« Plötzlich fiel ihr Blick auf den Hightech-Wagen. »Aber Sie hen doch ihr Wendeldasch drbei«, rief sie aus und deutete auf eine Plastiktasche im Untergestell des Wagens, auf der in großen Lettern »Penaten« stand.
»Ach, tatsächlich!«, rief John-Boy in gespielter Überraschung aus. »Wir müssen jetzt aber leider wirklich gehen. Schönen Tag noch.« Sehr bestimmt nahm er der Alten das Kind weg und legte es mir auf den Arm. »Ab zum Polizeirevier«, zischte er mir ins Ohr. »Kind ablegen.«
Wir drehten uns um. Prima. Ein Mann und eine Frau in Polizeiuniform kamen uns auf dem Spazierweg entgegen. Panisch blickte ich in die andere Richtung. Auch von dort näherten sich zwei Beamte. Wir waren eingekesselt.
»John-Boy, wir tun erst mal so, als wäre nichts«, flüsterte ich verzweifelt. »John-Boy?«
John-Boy hatte sich mit hochgerissenen Armen neben dem Kinderwagen auf die Knie geworfen und die Augen fest zugekniffen. Verdammter Feigling! Was sollte ich jetzt bloß machen? Ich konnte die Arme nicht hochnehmen, ohne das Kind fallen zu lassen. Plötzlich tauchte hinter den Polizisten eine weibliche Gestalt auf und raste auf mich zu. Es war die Frau aus der Bahn, die ich für die Lehrerin gehalten hatte.
»Bleiben Sie da weg«, brüllte ein Polizist.
»Ich bin total harmlos, ich tu keiner Fliege was zuleide«, kreischte ich verzweifelt. Ich wurde für eine gemeine Verbrecherin gehalten, dabei schlug ich ja nicht mal Eintagsfliegen tot, weil ich ihr sowieso kurzes Leben nicht vorzeitig beenden wollte. Mit ausgestreckten Armen hielt ich der Frau das Kind entgegen, um der Polizei meine Kooperationsbereitschaft zu beweisen.
»Mein Baby!«, kreischte sie hysterisch und riss mir das Kind aus den Armen. Es begann sofort wieder zu brüllen.
»Ihrem Kind geht es gut«, schrie ich. »Es ist alles nur ein schreckliches Missverständnis.«
»Mein Bugaboo Cameleon!«
»Was?« Jetzt konnte ich nicht mehr richtig folgen.
»Der Kinderwagen! Das ist ein Bugaboo Cameleon mit höhenverstellbarem Schwenkschieber, Aerosleep-Auflage und Aufsatzventil für Fahrradpumpen. Der Mercedes unter den Kinderwagen. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was der kostet? Dafür hat mein Mann ein halbes Monatsgehalt hingelegt! Schon allein der Sonnenschirm kostet vierzig Euro.«
»Ihrem Kinderwagen geht es gut«, sagte ich. Dann sank ich ermattet neben John-Boy in die Knie, wie vor den Traualtar.
Sekunden später hatten uns die Beamten erreicht. »Stehen Sie auf«, sagte die Polizistin. »Was soll der Mist?«
»Wollen Sie uns keine Handschellen anlegen?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Sie haben zu viel ›Die Straßen von San Francisco‹ auf Nostalgie-TV geguckt. Können wir mal Ihre Ausweise sehen?«
Ich sprang wieder auf. »Glauben Sie mir, wir wollten das Kind nicht entführen«, flehte ich die Beamten an und kramte nach meinem Ausweis.
»Das klären wir auf dem Revier«, sagte der Polizist ungerührt.
»Es tut mir leid, ich habe meinen Ausweis nicht dabei«, sagte ich.
John-Boy hielt die Augen immer noch fest geschlossen und rührte sich nicht.
Der Beamte tippte ihn an. »He, Sie. Stehen Sie auf.«
John-Boy sprang auf und zerrte seine Brieftasche aus der Innentasche seines Jacketts. »Hier, mein Ausweis. Ich muss Sie jedoch um höchste Diskretion bitten.«
»Schade eigentlich«, sagte ich, an John-Boy gewandt. »Dies hätte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden können.«
John-Boy antwortete nicht.
Die Alte verfolgte das Geschehen aus einigem Abstand mit offenem Mund.
Einer der Polizisten sah mich schon eine ganze Weile nachdenklich an. Plötzlich lächelte er. »Jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne«, sagte er langsam. »Haben Sie nicht vor ein paar Monaten am Killesberg mit einem Smart einen Zaun umgenietet? Das waren doch Sie, oder?«
Ich lächelte kläglich zurück. »Ich fürchte, ja.« Prima. Ich war also schon polizeibekannt.
Er grinste. »Sie haben uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt mit dem Baby.«
Sein Grinsen in dem heillosen Durcheinander tat mir gut. Hatte er mir damals nicht seine Karte zugesteckt? Wie hieß er noch gleich?
Die nächsten Stunden auf dem Polizeirevier 6 in der Wiesbadener Straße blieben mir nur verschwommen in Erinnerung. John-Boy hatte sofort seinen Anwalt gerufen, der gestikulierend und pausenlos auf dem Handy telefonierend die Gänge auf und ab lief.
Ich hatte keinen Anwalt, durfte aber ein Telefonat führen und versuchte verzweifelt, Leon zu erreichen. Er würde sich sicher schreckliche Sorgen machen, schließlich waren wir zum Kino verabredet. Aber auf dem Festnetz nahm niemand ab, und seine Handynummer hatte ich nicht im Kopf. Ich hinterließ keine Nachricht.
Die Befragungen zogen sich endlos hin. Irgendwann brachte mir Simon, der nette Polizist, einen Kaffee und ein paar bröselige Kekse.
»Danke«, sagte ich. »Das ist wirklich nett von dir. Was machst du eigentlich hier in Cannstatt, warst du nicht vorher am Killesberg?«
»Ach, wir sind doch komplett umstrukturiert worden. Weniger Reviere, weniger Leute, mehr Arbeit.« Er seufzte. »Jetzt schiebe ich eben hier Dienst.«
»Wann darf ich endlich nach Hause? Ich hab meinen Freund nicht erwischt. Er macht sich bestimmt schreckliche Sorgen.«
Simon wich meinem Blick aus. »Du wirst gleich erfahren, wie’s weitergeht.«
O je. Das klang nicht gut. Ein paar Minuten später wurde Simon von einem Beamten abgelöst, dessen Bekanntschaft ich bisher noch nicht gemacht hatte. Seine Dienstmütze hing schief und sein beige-braunes Hemd unter dem grünen Blouson war zu eng für den zu dicken Bauch.
»Okay«, sagte ich kämpferisch. »Wie geht’s jetzt weiter?«
Der Beamte räusperte sich. »Wir haben entschieden, dass wir Sie morgen früh dem Haftrichter vorführen.«
Das hatte ich jetzt von meiner Hilfsbereitschaft.
»Wenn’s unbedingt sein muss«, sagte ich ergeben. »Um wie viel Uhr muss ich wo sein?«
»Sie haben nicht verstanden. Sie bleiben über Nacht bei uns.«
»Bei Ihnen?«
»Nicht bei mir! Auf dem Polizeipräsidium!«
»Hier?«
»Nein. Oben am Pragsattel, in der Hahnemannstraße. Im Polizeigewahrsam.«
»Sie meinen also – Sie sperren mich ein? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst!«
»Nun, es gibt zwei Probleme. Erstens konnten Sie sich nicht ausweisen und zweitens müssen wir noch Ihre Beziehungen zur russischen Mafia überprüfen.«
»Zu welcher Mafia?«, fragte ich entsetzt.
»Ihr Kollege hat uns darauf hingewiesen, dass Ihre Mutter russische Spionin war. Für uns klingt das eher nach Mafia. Und solange das nicht geklärt ist, behalten wir Sie wegen versuchter Kindesentführung über Nacht in der Zelle. Alles Weitere entscheidet dann der Haftrichter.«
Ich stöhnte. »Das war doch nur ein Witz!«
Der Beamte zuckte die Schultern. »Pech gehabt. Sie hätten sich vorher überlegen sollen, was Sie erzählen.«
»Und John-Boy? Muss der auch in die Zelle?«
Der Beamte schüttelte den Kopf.
Das war ja wohl das Allerletzte!
John-Boy sah ich noch einmal kurz auf dem Gang. Er wurde von einer langbeinigen Blondine in Stilettos abgeholt, deren Make-up vor lauter Heulen total verschmiert war. Hätte ich mir ja denken können, dass so ein Typ so eine Freundin hatte. Sie musterte mich mit finsterem Blick. Also wirklich, das war doch alles John-Boys Schuld gewesen! Mit hocherhobenem Kopf stolzierte ich auf ihn zu.
»Ich gehe jetzt in U-Haft«, sagte ich. »Tut mir wirklich leid, dass du nicht mitdarfst. Das wird bestimmt total intensiv. Manche Leute jubeln ja, wenn sie vier Karten für so ein Event im Radio gewinnen.«
»Na dann«, sagte er knapp und sah an meinem rechten Ohr vorbei. »Viel Glück. Vielleicht sehen wir uns in einer Talkshow wieder. Ich bin allerdings ...«
»... beruflich ziemlich eingespannt«, vollendete ich. Ich drehte mich noch mal um. »Für welche Partei kandidierst du eigentlich?«, rief ich.
»PKD. Partei für ein kinderfreundliches Deutschland.«
Am Ausgang wartete Simon auf mich, einen Autoschlüssel in der Hand.
»Ich fahre dich«, sagte er und deutete auf einen Polizeitransporter, der unmittelbar vor dem Revier geparkt war.
»Das ist nett«, sagte ich.
Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie man in die Hahnemannstraße kam, und so konnte ich mich wenigstens noch ein bisschen unterhalten, ehe ich mutterseelenallein in die fürchterliche Zelle musste. Ich steuerte die Beifahrerseite an.
Simon schüttelte verlegen den Kopf. »Du musst hinten einsteigen, fürchte ich.«
Im hinteren Teil waren die Fenster vergittert. Ich hatte vergessen, dass ich eine böse Verbrecherin war, die Simon an der nächsten Ecke mit ihrer Umhängetasche eins über die Rübe pfeifen würde, um das Kind, dessen Geschlecht ich immer noch nicht kannte, samt sündhaft teurem Bungalow meistbietend an eine reiche Moskauer Familie zu verhökern. Ich stieg ein und die Tür rumste hinter mir zu. Es gab keine Gurte und ich musste mich festhalten, um in den Kurven nicht vom Sitz zu rutschen. Da kontrollierte die Polizei die Anschnallpflicht und hielt sich selber nicht daran! Ich würde noch heute Nacht in der Zelle einen Beschwerdebrief schreiben.
Der Polizeiwagen fuhr jetzt eine Auffahrt hinauf. Ein Tor faltete sich zur Seite und schloss sich hinter uns wie von Geisterhand. Niemand wusste, wo ich war. Hier würde ich nie mehr rauskommen!
Simon hielt an und öffnete die Tür. Ich fand mich in einem burgähnlichen Innenhof wieder, in dem Polizeiauto an Polizeiauto geparkt war. Mein kleiner Neffe Salo hätte seine helle Freude gehabt. Ich dagegen hörte nur die Schreie und Schläge hinter den vergitterten Fenstern. Um Himmels willen. Das war kein Polizeipräsidium, das war das House on Haunted Hill.
»Keine Sorge«, sagte Simon. »Die da randalieren, sind Betrunkene in den Ausnüchterungszellen unten. Du wirst in einem ganz anderen Stockwerk untergebracht.«
Das war ja wirklich total beruhigend. Simon führte mich an ein paar rauchenden Polizisten vorbei in das Gebäude. Ein Beamter und eine blonde Frau mit Brille warteten auf mich. Die Frau trug Jeans und eine rote Fleece-Jacke. Sie sah so angenehm normal aus. Ich hatte für den Rest meines Lebens genug Polizeiuniformen gesehen.
»Alles Gute«, murmelte Simon so leise, dass es die beiden nicht hören konnten. »Mach dir keine Sorgen, es wird sich bestimmt alles aufklären. Wenn du magst, ruf mich morgen an.«
Die hellblaue Gittertür fiel krachend hinter ihm ins Schloss. Nur mühsam widerstand ich dem Impuls, hinter ihm herzurennen und an den Gitterstäben zu rütteln. Ich fühlte mich jämmerlich allein.
»Kommen Sie bitte mit«, sagte die blonde Frau und führte mich in einen nüchtern-sterilen Raum, dessen karge Möblierung schon bessere Zeiten gesehen hatte.
»Hier sieht’s ja aus wie im Krankenhaus«, sagte ich.
»Kein Wunder«, sagte die Frau. »Das ist das ehemalige Robert-Bosch-Krankenhaus. Dahinten wurden früher die Leichen aufgebahrt.«
Na großartig. Das wurde ja immer besser!
Die Frau hatte angefangen, auf einem Formular sämtliche Gegenstände einzutragen, die sich in meiner Umhängetasche befanden. Sie legte alles in eine rote Plastikkiste und schob meinen Geldbeutel in einen Umschlag.
»Ihre Armbanduhr, bitte.« Die Uhr wanderte ebenfalls in den Umschlag.
»Und jetzt geben Sie mir bitte alles, was Sie sonst noch lose am Körper tragen, einschließlich BH. Wegen der Selbstmordgefahr.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich trage keinen BH. Und umbringen will ich mich eigentlich auch nicht.«
»Dann unterschreiben Sie jetzt bitte das Formular. Anschließend werde ich Sie abtasten.«
Sie zog Einwegplastikhandschuhe über und tastete mich von oben bis unten ab. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, ich würde mit Leon nach Mallorca fliegen.
»Möchten Sie vielleicht eine Decke für die Zelle? Es ist zwar ziemlich warm da oben, aber so, wie Sie angezogen sind ...«
Sie führte mich in einen angrenzenden Raum, der aussah wie die Kleiderkammer der Caritas. »Möchten Sie auch wärmere Kleider oder reicht Ihnen die Decke?« Sie gab mir eine zerschlissene graue Decke, auf der in grüner Schrift »Polizei BW« stand.
Ich blickte auf die Kleiderstapel. Ich trug nur einen Slip, eine abgeschnittene Jeans und ein bauchfreies Top und die Decke kratzte fürchterlich, aber ich hatte das Gefühl, ich würde in einen unkontrollierten Heulkrampf verfallen, wenn ich jetzt auch noch Altkleider anzog.
»Danke«, sagte ich. »Das reicht so.«
»Ihre Sachen bekommen Sie morgen wieder«, sagte die Frau. »Nachdem Sie beim Haftrichter waren.«
Sie brachte mich zurück zur Pforte. Der Beamte, der mich in Empfang genommen hatte, nahm meine Personalien auf, dann führte er mich in den ersten Stock und öffnete mit einem riesigen Schlüssel an seinem bunten Schlüsselbund die Zelle mit der Nummer 111. Okay, Leon und ich wurden also vom Liftboy auf unser Zimmer gebracht. Leider brach mein Fantasiebild ziemlich schnell zusammen. Auf einer Holzpritsche lag eine dünne Plastikmatratze. Hinter einer Betonabtrennung verbarg sich ein Stehklo. Die Wände waren in verschiedenen Sprachen wüst vollgekritzelt. Was für Dramen hatten sich hier drin bereits abgespielt?
»Ihre Schuhe müssen draußen bleiben«, sagte der Beamte. »Wegen der Selbstmordgefahr.«
Ich blickte ungläubig auf meine dünnen Sandalen und stellte sie brav vor der Tür ab. Irgendwie hatte ich gewisse Zweifel, dass ich am nächsten Morgen Nuss und Mandelkern darin vorfinden würde. Ich warf einen Blick in den Flur. Ein paar Zellen weiter stand ein Paar klobige Männerschuhe. Vielleicht konnten wir uns ja per Klopfzeichen verständigen?