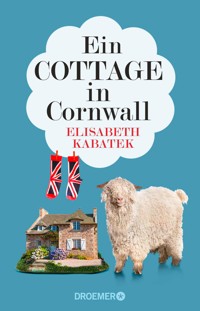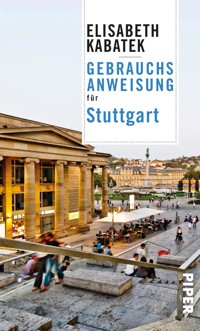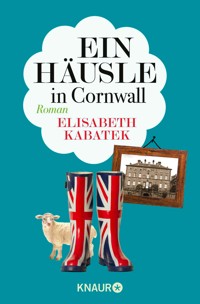9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spiegel-Bestseller-Autorin Elisabeth Kabatek schickt ihre schwäbische Heldin Line in den vierten Fall: Pipeline Prätorius, genannt Line, lebt immer noch in Stuttgart, der wildesten Stadt Deutschlands. Und zieht Katastrophen vollautomatisch an. Eine Heldin zum Verlieben. Das findet auch Leon: Er möchte plötzlich mit ihr ein kuschliges Eigenheim kaufen. Und er will Kinder. O Gott, wie spießig! Pipeline will kein vorgezeichnetes Leben in der Carport-Doppelhaus-Hölle. Da hilft nur noch Tante Dorles unübertroffener Käsekuchen. Sprühend, witzig und mit einer genauen Beobachtungsgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Elisabeth Kabatek
Zur Sache, Schätzle!
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Leon will Nägel mit Köpfen machen und mit Line zusammenziehen. Kann das gutgehen? Leon ist organisiert und ordentlich, Line schlampig und chaotisch. Line verpasst zudem ständig Leons romantische Abendessen, und als sie selbst ein romantisches Abendessen plant, trifft sich Leon überraschend mit einer beruflich erfolgreichen Ex-Freundin. Überhaupt scheint Leon sehr viel Kontakt zu seinen zahlreichen Ex-Freundinnen zu pflegen. Er hat eine ganze Kiste umgezogen, auf der »Alte Liebesbriefe« steht. Natürlich kann Line ihre Neugier nicht bezähmen…
Nach ein paar Monaten des Zusammenlebens schlägt Leon Line vor, langfristig außerhalb Stuttgarts Eigentum zu kaufen, weil Wohnungen in Stuttgart unbezahlbar sind. Zudem bittet er Line, über das Thema Kinder nachzudenken. Line bekommt die Vollkrise: weder fühlt sie sich für Kinder bereit, noch will sie Stuttgart verlassen. Sie hat das Gefühl, in der Falle zu sitzen und reagiert panisch. Die Zukunft erscheint ihr vorgezeichnet und spießig. Als sie in eine U-Bahn-Entführung mit Schießerei gerät, dabei den netten Polizisten Simon wiedertrifft und Leon ein weiteres Mal versetzt, der mal wieder mit einem romantischen Abendessen auf Line wartet, läuft bei Leon das Fass über. Er packt seine Sachen und zieht aus, weil er es, wie er es sagt, mit dem Katastrophen-Gen doch nicht aufnehmen kann.
Ein Arzt erklärt Line: Für alles gibt es eine Erklärung, und das Katastrophen-Gen ist wissenschaftlich nachgewiesen. Sie kann wirklich nichts dafür. Nach neuesten Forschungen sagt die Epigenetik: mit der Änderung des Lebenswandel kann man tatsächlich Gene »abschalten«. Ob in diesem schweren Fall aber gesunde Ernährung und Sport reichen?
Inhaltsübersicht
1. Teil
1. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
2. Teil
2. Teil
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
3. Teil
3. Teil
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22 .Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Danksagung
Songzitate
1. Teil
1. Teil
Der einzige Zeuge
1. Kapitel
Late at night when it’s hard to rest
I hold your picture to my chest
and I feel fine
He du, hinten anstellen!«, brüllte jemand.
»Hinten anstellen? Ihr wollt doch nicht etwa alle …«
»Doch!«, schrien ungefähr fünfzig Stimmen im Chor. Wie ein geprügelter Hund schlich ich mich ans Ende der Schlange. Unfassbar. Die unzähligen Menschen, die das winzige Vorgärtchen in Stuttgart-Gablenberg bevölkerten, veranstalteten keinen Flashmob, sondern interessierten sich alle für die Wohnung? »Offene Wohnungsbesichtigung, Samstag zehn Uhr«, hatte in der Anzeige gestanden. Ein offener Besichtigungstermin ist cool, hatte ich gedacht, weil man sich in aller Ruhe umsehen konnte, ohne einen artigen Eindruck auf blöde Vermieter machen zu müssen. Wenn einem die Wohnung nicht gefiel, zischte man einfach wieder ab, und auf zehn Minuten hin oder her kam es bestimmt nicht an. Leider schaffte ich es erst auf halb elf. Ich war ein bisschen knapp aufgestanden und hatte nur schnell eine Katzenwäsche absolvieren wollen, als Lila ins Bad platzte und mir kommentarlos ein brüllendes, nacktes, vollgekacktes Baby auf den Arm schaufelte. Lila war meine Mitbewohnerin, beste Freundin und seit kurzem Mutter von Zwillingen.
»Müssen die immer alles gleichzeitig machen!«, schimpfte sie und hielt den Hintern von Oskar unter den Wasserhahn. Er schwebte wie ein Barockengelchen auf ihrem Unterarm, während sie ihn geschickt abwusch, in ein Handtuch wickelte und dann Platz für mich und Gretchen machte. Ich versuchte es genauso elegant. Leider flutschte mir Gretchen ins Waschbecken und hinterließ auf meinem Schlaf T-Shirt und auf meinem nackten Arm eine braune Schleimspur.
»Immerhin stinkt Babykacke nicht«, kommentierte Lila mitleidslos. Bis alle Babys und ich wieder sauber und trocken waren, dauerte es eine ganze Weile. Dann bat mich Lila, nach den Wohnungsterminen den Einkauf zu erledigen, und machte noch schnell eine Einkaufsliste. Und nun stand ich also blöd in einem Vorgärtchen herum und guckte schon seit zehn Minuten auf die gleiche Sonnenblume. Wer konnte auch ahnen, dass sich sämtliche wohnungssuchenden Paare Stuttgarts in Gablenberg versammeln würden und ich mich deshalb beeilen musste? Gablenberg galt als Hochburg der Kehrwoche und war im Gegensatz zum Stuttgarter Westen oder Süden alles andere als hip. Leider gab es im Moment massenhaft wohnungssuchende Paare in Stuttgart und viel zu wenig freie Wohnungen, und die waren auch noch schrecklich überteuert. Wenn sich die Schlange bis in den dritten Stock zog, wo die Wohnung lag, würde es knapp werden für meinen nächsten Besichtigungstermin um zwölf. Der war blöderweise fest vereinbart.
Es war ungewöhnlich heiß für September. Vor mir standen adrett gekleidete Paare, unterhielten sich murmelnd oder daddelten auf ihren Handys herum. Einige kannte ich schon von anderen Terminen. Langsam bewegte sich die Schlange Richtung Haustür, immer ein Männchen und ein Weibchen, als würden wir für die Arche Noah anstehen. Lesbische und schwule Paare trauten sich offensichtlich nicht nach Gablenberg.
Mein männliches Pendant saß zur Zeit bei Bosch in China, genauer gesagt in Wuxi in der Nähe von Shanghai. Das war ziemlich unpraktisch, denn rein theoretisch war Leon mein höchster Trumpf. Erst vorgestern hatte mir Harald, Zahnarzt und seit wenigen Wochen Lilas Gatte, die Zeitschrift »Unser schönes Schwabenländle« unter die Nase gehalten. Eigentlich hatte er die Zeitschrift für seine Praxis abonniert.
»Doo guck noo1, Line!«, rief er euphorisch. »Inschenöre sen die beliebdeschde Mieter, noh beliebder als Beamde, Rentner odr Zohärzt! Ond koi Sau will Arbeidslose odr Dagesmitter!« Offensichtlich hatte die Redaktion der Zeitschrift eine Umfrage unter schwäbischen Vermietern gemacht und abgefragt, welche Berufe und Kriterien sie bei der Auswahl von Mietern bevorzugten. Auf der Hitliste rangierte »Ingenieur bei Daimler, schwäbische Sprachkenntnisse, Single, kein Haustier, Wochenendheimfahrer« auf Platz eins, nur knapp vor »Ingenieur bei Bosch, schwäbische Sprachkenntnisse, handwerklich begabt, kein Fernsäh, keine Freunde, kein Frauenbesuch.« Bei Platz zwei gaben die Vermieter zur Begründung an, Ingenieure bei Bosch verdienten gutes Geld, verbrachten die meiste Zeit im Büro, überwiesen die Miete pünktlich, machten gerne, fachmännisch und vor allem umsonst,kleinere Reparaturen im Haushalt und in der Gemeinschafts-Waschküche, waren sauber und ruhig und hatten wegen des hohen Männeranteils in den Ingenieurstudiengängen an der Uni Stuttgart keine Freundin gefunden. Zudem arbeiteten sie bei einem soliden schwäbischen Automobilzulieferer und nicht bei irgendeiner dahergelaufenen ausländischen Firma, von der man nicht wusste, mit welchen dubiosen Produkten sie ihr Geld verdiente und wann sie pleite ging.
Leon hatte aber nicht nur den perfekten Job, er verfügte zudem über einen angeborenen Charme, mit dem er vor allem ältere Herrschaften mühelos einwickelte. Jedenfalls war es in unserem Mietshaus in der Reinsburgstraße so gewesen, wo wir uns kennengelernt hatten. Ich hatte schon jahrelang dort gewohnt, als Leon im fünften Stock neben mir einzog. Nach drei Tagen stellte ihm Frau Müller-Thurgau aus dem vierten Stock zum ersten Mal Donauwellen vor die Tür. Ab diesem Moment wurde Leon lückenlos mit Kuchen, Hefekranz, selbstgemachtem Gsälz und Spreewald-Gurken versorgt, während Frau Müller-Thurgau mir niemals auch nur ein Krümelchen Kuchen anbot.
Wir hatten eigens für die Wohnungssuche ein Foto von Leon inszeniert und auf DIN A5 vergrößert. Leon war in Wuxi ganz früh in sein Büro gegangen, um nicht über seine Kollegen zu stolpern, und ich hatte mich per Skype zugeschaltet und Leon so lange hin- und her arrangiert, bis er extrem vermieterfreundlich aussah. Er saß in seinem schicksten Anzug am Schreibtisch, das Telefon am Ohr und wichtig aussehende Unterlagen, auf denen man das Bosch-Schriftzeichen erkennen konnte, in der Hand, und lächelte. Ich liebte Leons Lächeln! Er war nämlich eher jemand, der grinste, und sich das Lächeln für besondere Gelegenheiten aufsparte. Das Foto war mittlerweile schon ziemlich lädiert, weil ich es immer hervorzog, wenn ich Leon schrecklich vermisste, also sozusagen ständig. Er sah darauf seriös-süß aus, das war vor allem für ältere Vermieterinnen perfekt, und dass er kein Schwäbisch konnte, sah man auf dem Bild zum Glück nicht. Hoffentlich täuschte das große Foto über meinen Mangel an Charme hinweg.
Nach gut fünfunddreißig Minuten Anstehen hatte ich es endlich in die Wohnung in der Schurwaldstraße geschafft. Ich konnte nicht richtig beurteilen, ob sie mir gefiel, da nahezu jeder freie Platz von Menschen ausgefüllt wurde, die gegen die Wände klopften, um die Bausubstanz zu prüfen oder mit dem Meterstab vermaßen, ob das IKEA-Doppelbett ins Schlafzimmer passte. Ohne großen Enthusiasmus schoss ich mit dem Handy ein paar Fotos für Leon. Leider würde auf jedem Foto ein fremdes Pärchen zu sehen sein. Einige Pärchen stritten sich, die einen heftig, die anderen in gedämpftem Ton. In einer Ecke wurde heftig geknutscht und gefummelt. Ich entdeckte noch einen recht hübschen Küchenbalkon, der auf einen begrünten Hinterhof hinausging. Leider platzte ich dort in eine besonders akute Beziehungskrise. Auf einem klapprigen Holzstuhl saß eine Frau, die die Hände vors Gesicht geschlagen hatte und von einem Heulkrampf geschüttelt wurde. Vor ihr stand ein wild fuchtelnder Typ mit einer Wollmütze auf dem Kopf und redete auf sie ein. Irgendwie schien es darum zu gehen, dass er Zusammenziehen schon irgendwie okay fand, aber auf Heiraten und Kinderkriegen echt keinen Bock hatte. Die Frau schluchzte daraufhin irgendetwas von typisch männlichen Bindungsängsten und tickender biologischer Uhr. Ich machte die Balkontür schnell wieder zu.
Die Wohnung kam mir ziemlich dunkel vor und für einen unrenovierten Altbau waren 1100 Euro kalt ganz schön happig, aber so waren die Wohnungspreise in Stuttgart nun mal. Ich würde mich auf jeden Fall auf die Liste der Interessenten setzen lassen. Absagen konnte man immer noch. Jetzt musste ich nur noch den Vermieter finden. In der Küche stieß ich auf eine Frau mittleren Alters im dunklen Business-Anzug, deren Gesicht nicht richtig zu erkennen war, weil es komplett mit Make-up zugekleistert war. Wie eine schwäbische Vermieterin sah sie eigentlich nicht aus. Vor ihr auf dem Tisch lag ein großer Stapel mit Umschlägen. Ich holte tief Luft, zog die Mundwinkel nach oben und segelte auf sie zu.
»Sind Sie die Vermieterin? Ich bin Pipeline Praetorius. Die Wohnung ist einfach … toll. Ja, wirklich. Ich habe schon lange keine so schöne Wohnung mehr gesehen! Hell und geräumig! Ich würde mich gerne als Interessentin eintragen lassen.« Vor lauter Heuchelei klang meine Stimme ganz kieksig.
»Nehmen Sie doch bitte Platz«, sagte die Frau völlig emotionslos. Offensichtlich hielt sie es für überflüssig, sich vorzustellen. »Sicher wissen Sie, dass die Wohnung über Makler vermietet wird? Bei Zustandekommen eines Mietvertrags werden drei Monatsmieten Vermittlungsgebühr fällig.«
»Drei?« Ich schluckte. Da hatte man ja schon ein kleines Vermögen ausgegeben, bevor man überhaupt eingezogen war! »Ich dachte eigentlich, die Wohnung wird privat vermietet. Und sind nicht normalerweise zwei Monatsmieten für den Makler üblich?«
Die Frau lächelte ein süffisantes Lächeln.
»Privat? Ich bitte Sie. In Stuttgart läuft mittlerweile doch fast alles über Makler oder Banken, der private Wohnungsmarkt ist praktisch inexistent, das brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Und wenn Sie sich drei Monatsmieten Makler nicht leisten können …« Sie deutete herablassend hinter mich. Ich drehte mich um. Hinter mir wartete das Pärchenmit der männlichen Bindungsangst und strengte sich sichtlich an, seriös auszusehen und gleichzeitig begeistert zu gucken.
»Doch …doch …«, stotterte ich und versuchte, mir meinen Ärger nicht anmerken zu lassen. Unfassbar, was man in Stuttgart mittlerweile hinnehmen musste! »Bitte setzen Sie mich auf die Liste der Interessenten.«
Die Frau streckte mir einen dicken Umschlag hin. »Es gibt keine Liste. Sie bekommen von mir einen Fragebogen sowie eine Aufstellung der Unterlagen, die wir gerne von potenziellen Mietern hätten. Bitte senden Sie uns die komplett ausgefüllten Papiere bis Dienstag zurück. Sonst können wir Sie leider nicht mehr berücksichtigen. Es gilt das Datum des Poststempels.«
»Aber heute ist doch schon Samstag!«, rief ich entgeistert aus.
Das Lächeln wurde noch süffisanter. »Wissen Sie, wer heutzutage eine Wohnung in Stuttgart, München oder Frankfurt mieten will, der muss sich schon ein bisschen Mühe geben. Sehen Sie es wie eine Bewerbung für einen neuen Job: Gleiche Anforderungen, gleicher Aufwand. Und Wohnen ist nun mal ein großer Teil vom Leben, oder etwa nicht? Gerne weise ich Sie an dieser Stelle noch darauf hin, dass es Ihre Chancen stark erhöht, wenn Ihre Eltern in Stuttgart eine Immobilie in attraktiver Lage besitzen, zum Beispiel in der Halbhöhenlage, und uns diese zum Verkauf anvertrauen. Ich meine, früher oder später müssen sie ja sowieso ins Altersheim! Wenn Sie jetzt bitte die nächsten Interessenten …«
Ich stolperte aus der Küche und die Treppe hinunter. Meine Wangen glühten. Was für eine herablassende Kuh! Leider konnte sie es sich erlauben. Ich suchte schon seit Wochen nach einer Bleibe für Leon und mich und war mittlerweile ziemlich frustriert. Viele Wohnungen waren unbezahlbar und schieden deshalb von vorneherein aus. Manche Vermieter starrten auch völlig ungeniert auf meinen Bauch, um herauszufinden, ob sich bei mir Nachwuchs ankündigte. Zum Glück war ich so dünn, dass ich kein bisschen Bauch hatte. Wenn die Wohnung hübsch und die Miete okay war, bekam garantiert die alleinstehende Frau, die ihre Brüste dem Gesicht des Vermieters entgegenstreckte, den Zuschlag. Viele Wohnungen waren allerdings auch in einem so schlimmen Zustand, dass man erst einmal monatelang hätte renovieren müssen. Dafür fehlte uns aber die Zeit.
In ein paar Wochen würde Leon aus China wiederkommen und wieder bei Bosch in Schwieberdingen anfangen. Dann musste er irgendwo wohnen. Unser kleines Häuschen in Stuttgart-Ost platzte aber jetzt schon aus allen Nähten. Im ersten Stock wohnten Harald, Lila und die Zwillinge in einem Zimmer, ich im anderen. Unten war nur unsere Wohnküche mit Wickelstation, das Bad und die Abstellkammer. Wir hatten zwar noch ein Dachgeschoss, aber das war nicht ausgebaut. Die Küche mussten sich Wutzky, Haralds Hund, und Suffragette, Lilas Katze teilen. Ein Erfolgsmodell war das nicht gerade und immer öfter lagen unsere Nerven blank. Ein paarmal war ich schon zu spät zur Arbeit gekommen, weil morgens so ein Chaos herrschte. Ich musste so schnell wie möglich etwas finden! Leon hatte vorgeschlagen, zur Not übergangsweise ohne mich ins Hotel oder in die Jugendherberge zu ziehen. Wir waren aber schon so lange voneinander getrennt, dass ich die Vorstellung unerträglich fand.
Ich machte, dass ich zur Bushaltestelle in der Wagenburgstraße kam. Der nächste Besichtigungstermin im Stuttgarter Westen klang so vielversprechend, dass ich auf keinen Fall zu spät kommen durfte! Leon und ich wollten wahnsinnig gerne wieder in den Westen ziehen. Schließlich hatten wir uns dort kennengelernt. Außerdem lag die Johannesstraße mit ihrer Baumallee, ihrem Kopfsteinpflaster und den Gründerzeithäusern mitten in einer der hübschesten Ecke von Stuttgart. Leider hatte der 40er Bus Verspätung, und am Hauptbahnhof nutzte es mir gar nichts, wie eine Bekloppte hinunter zur S-Bahn zu rennen, weil ich acht Minuten auf die nächste Bahn Richtung Schwabstraße warten musste. Endlich war ich am Feuersee und stand zehn nach zwölf in völlig verschwitztem T-Shirt vor einem Haus neben einer Müslibar. Das war ja das Schöne am Stuttgarter Westen, überall gab es schnucklige Tagesbars und Cafés!
Ich holte einen Augenblick Luft und malte mir aus, wie ich jeden Tag durch die mächtige verschnörkelte Eingangstür des Hauses hinaus auf die baumbestandene Straße treten und noch schnell einen Kaffee in der Müslibar trinken würde. Ich spürte es ganz genau: Hinter diesen Mauern verbarg sich eine ganz fabelhafte Wohnung mit einem freundlichen, weltoffenen Vermieter, der die Kehrwoche für eine vollkommen lächerliche Erfindung hielt und Leon und mich so gerne in seiner Wohnung haben wollte, dass er als Erstes die Miete um hundert Euro im Monat senkte! Voller Optimismus drückte ich auf die Klingel. Ein Türöffner summte. Das Treppenhaus war hell und großzügig und schien frisch saniert. »Vierter Stock!«, brüllte jemand. Ich hastete die Holztreppe hinauf und kam schweratmend oben an.
Die Tür stand offen, aber niemand war zu sehen. Zögernd ging ich hinein. Die Wohnung schien genauso frisch renoviert wie das Treppenhaus und strahlte etwas Hochherrschaftliches aus. Ich wanderte fast ehrfürchtig durch die Räume und brauchte ungefähr zwei Minuten und siebenundzwanzig Sekunden, um zu wissen, dass ich hier und nirgendwo sonst in Stuttgart wohnen wollte. Besser ging’s nicht. Drei helle, großzügige Zimmer, Stuck an den hohen Decken und Parkett auf dem Boden! Das mittlere Zimmer war zwar ein Durchgangszimmer, aber das war egal. Das würde unser Wohnzimmer sein, mit einem großen Holztisch, an dem wir mit Lila und Harald und Tarik und Manolo sitzen würden, während die Zwillinge auf einer Decke auf dem Boden spielten, und in dem Zimmer rechts daneben würde unser riesiges Lotterbett stehen, in dem wir lottern würden, dass es krachte. Das Zimmer ganz links würden wir als kombiniertes Arbeits- und Gästezimmer nutzen, falls Leons Eltern aus Hamburg zu Besuch kamen. In der Speisekammer würden die Dosen für mein legendäres Chili con carne sin carne lagern, und auf dem winzigen Balkon würden wir an Sommerabenden Wein trinken. Leon würde mir Anekdoten aus seiner Kindheit in Hamburg-Eppendorf erzählen und ich würde mit Geschichten über meine Großtante Dorle kontern. Mein Gefühl hatte mich nicht getrogen: Das war unsere Traumwohnung! Ich hörte Stimmen und mein Herz begann zu klopfen. Ich hatte ich keine Zeit mehr zu verlieren! Wo war der weltoffene Vermieter?
Die Stimmen wurden lauter. Aus einer weißen Holztür am Ende des Flurs trat ein Paar in mittleren Jahren. Bestimmt die Konkurrenz! Der Mann trug Jeans, Jackett und elegante Lederslipper und fotografierte mit einem iPad den Flur. Ich murmelte einen Gruß und drückte mich an ihm vorbei.
»Wir schauen uns nur noch ein paar Minuten um!«, rief die Frau im kleinen Schwarzen. Sie beäugte mich misstrauisch, grüßte knapp zurück und hüllte mich im Vorbeistöckeln in eine Parfümwolke. Hinter ihr tauchte ein schmächtiger Mann im Türrahmen auf. Seine Mundwinkel hingen griesgrämig nach unten und mit seinen abgewetzten Klamotten hätte er prima zu den Pennern am Feuersee gepasst. O je. Das war doch wohl hoffentlich nicht der Vermieter? Angeblich gehörten ihm mehrere Häuser in der Johannesstraße!2
»Pipeline Praetorius, sehr erfreut«, sagte ich und reichte ihm die Hand, wobei ich meinen Oberarm rechtwinklig an den Oberkörper presste, damit man die Schweißflecken unter meinen Achseln nicht so sah.
Der Mann schüttelte schlapp meine Hand, musterte mich wortlos und antwortete dann missbilligend:"Laich, Ewald. Sie sen späd droh. Kommad se rei, hockad se noo.« O je. Das klang zwar gereimt, aber nicht besonders weltoffen. Kein guter Anfang.
»Tut mir leid, Herr Laich«, sagte ich. »Der Bus kam einfach nicht.«
»Mei Erfahrung: wer net kommt zur rechda Zeit, hot au sei Miede net bereit. Ond’s kommad glei die nägdsche Leit. Äll Viertlschdond, gohd’s hier rond.«
Er führte mich in die Küche und schloss die Tür zum Flur. Das war keine langweilige IKEA-Küche, wie sonst in Mietwohnungen üblich, oder eine chromblitzende Kochstation mit computergesteuertem Kühlschrank für Angeber, sondern eine herrlich altmodische Küche mit Charakter! An den Wänden hingen Schränke mit Milchglasscheiben, der Boden war gefliest und der Holztisch sah aus, als sei er frisch gebeizt. Darauf stand eine Flasche Württemberger Wein und ein halb gefülltes Viertelesglas.
»Also die Wohnung ist wirklich schön«, platzte ich heraus. »Wir würden sie sehr gern nehmen.« Ich war schrecklich nervös. Wenn ich es nur nicht versaute!
»Mädle, hock de erschdmol noo, damit mr bessr schwätza koo«, sagte Herr Laich, nahm am Küchentisch Platz, rückte den Stuhl, der direkt neben seinem stand, etwas näher heran und patschte darauf. Dann lehnte er sich zurück und nahm einen tiefen Schluck aus seinem Viertelesglas. »Ond wer isch mir?«
Ich setzte mich. Ob ich in Reimen antworten sollte, um unsere Chancen zu erhöhen? Leider wollte mir nichts einfallen außer »Halt dei Gosch, i schaff beim Bosch.« Das war bestimmt nicht sehr hilfreich.
»Mir, das sind wir, also ich und mein Freund«, erklärte ich, zückte das Foto und hielt es Herrn Laich mit schwitzenden Händen unter die Nase. »Leon. Er wäre sehr gerne mitgekommen, aber er arbeitet gerade in China. Bei Bosch.« Ich hielt es für ziemlich wahrscheinlich, dass sich Herr Laich an der Vermieter-Umfrage in »Unser schönes Schwabenländle« beteiligt hatte. »Leon ist übrigens Inschenör, handwerklich äußerst begabt, sauber und ruhig, und er bekommt keinen Frauenbesuch. Äh, außer mir natürlich, aber ich wäre ja mehr so Mitbewohnerin, kein Besuch.« Was redete ich da für einen Stuss?
»Hen Sie jetzt koi Wohnong?«, fragte Herr Laich und schob das Bild weg, nachdem er einen abschätzigen Blick darauf geworden hatte.
»Doch, doch, aber wir haben Kinder bekommen«, stotterte ich.
»Kender? Also Kender kommad mir net ens Haus! Älles isch frisch saniert! Kender machad Lärm ond Dreck, scho sen die andre Mieder weg!«
»Nein, nein, nicht ich, sondern Lila, also meine Mitbewohnerin, hat die Kinder bekommen!«, rief ich hastig. »Gretchen und Oskar. Zwillinge, was keiner gewusst hat, und deshalb ist jetzt kein Platz mehr für mich, Lila braucht das Zimmer, wir haben nur zwei, und da wohnen wir grade zu fünft, da ist nämlich auch noch Harald, ihr Mann! Deswegen muss ich dringend was finden!«
»Scheener Sauschdall«, knurrte Herr Laich. Er hatte sein Viertelesglas geleert und schenkte sich großzügig nach. »Ond Sie selbr, Sie hen koine Kender?«
»Nein, nein, keine Sorge!«
»Ond wenn Sie jetzt mit ihrm Fraind zammeziehad, wellad Sie noo net heirade ond welche kriega? Sie sen doch sicher au nemme so jong!«
Ich wurde rot. Das Thema hatte ich ja noch nicht mal mit Leon richtig besprochen! »Äh … also … geplant ist nichts«, antwortete ich hastig. »Wir wollen jetzt erstmal nur eine gemeinsame Wohnung!«
Herr Laich sah nicht aus, als würde er sich damit zufrieden geben. Er nahm noch einen Schluck aus seinem Viertelesglas und wartete. Mir fiel mein ehemaliger Nachbar Herr Tellerle ein. »Ich denke nicht, dass wir Kinder anschaffen werden. Die sind ja so kostspielig und man muss ständig Windeln wechseln und ruck zuck, ist die Mülltonne voll und das kann man den anderen Mietern nun wirklich nicht zumuten. Höchstens … ein Aquarium. Genau. Einen Daimler und ein Aquarium. Das macht keinen Krach und ist so beruhigend.«
»Hausdier send abr au verboda!«
»Wir verzichten auf das Aquarium. Kein Problem! Wirklich nicht. Keine Fische, keine Kinder. Wir schaffen nur den Daimler an. Und einen schönen, stabilen Besen für die Kehrwoche. Irgendwas muss man ja machen mit dem doppelten Gehalt!«
»Mir hend an Hausmeischdr. Der isch penibl. Der Staub versuchd sich zom Verschdecka, dr Frieder jagd ihn aus de Ecka.« Herr Laich machte eine bedeutsame Pause. »On der Fraind isch grad fort, hen Se gsagd. Net bloß oms Eck en Waiblenge odr uff dr Alb droba, sondern en China. Soo, soo. Des isch weit. Arg weit.« Er rutschte auf seinem Stuhl ein bisschen näher an mich heran. Eine Mischung aus Zwiebeln, Schweiß und Alkohol stieg in meine Nase. Ich hielt die Luft an.
»Mir kennad doch mitanandr gschirra, mir zwoi. Du willsch obedengd die Wohnong. Ond i will …«
Ich starrte auf mein Knie und stieß entsetzt die Luft aus. Ach du Scheiße. Eine knochige Hand mit einem prunklosen Ehering ruhte scheinbar unbeteiligt darauf. Dann tätschelte die Hand das Knie, das Handgelenk klappte nach oben und Zeige- und Mittelfinger wanderten langsam vom Knie den Oberschenkel hinauf. »Enne-denne-dubbe-denne-dubbe-denne-dalia …«, summte Laich vor sich hin. »Mir treffad ons heit Obend en dr Tabu-Bar em Rotlichtviertl, on du kriegsch die Wohnong«, raunte er. »Muschs ja deim Fraind net saga. Ebbe-babba-bimbio, bio-bio …« Entschieden schubste ich die Hand von meinem Oberschenkel und sprang auf.
»Sie sind doch bestimmt schon siebzig!,« rief ich wütend und wich zurück Richtung Küchentür. »Und verheiratet!«
»Zwoiasiebzig. Aber siebzig isch die neie sechzig!«, zischte Laich. »Noo sens bloß no dreißig Johr Onderschied, des isch gar nix fir en Maa! On meinr Frau ghert zwar des Haus, aber die isch wie dai Fraind weid weg, en dr Kur en Bad Kohlgrub!«
In diesem Augenblick hörte ich das Geräusch von hohen Schuhen auf Parkettboden und atmete erleichtert auf, als die Küchentür aufgerissen wurde. Laich rutschte zurück auf seinen Stuhl. Der lüsterne Blick hatte sich in engelsgleiche Unschuld verwandelt. Die Frau stöckelte mit ihrem Typen im Schlepptau in die Küche, ignorierte mich komplett, segelte auf Laich zu und schnappte seine Hände. Laich guckte ein bisschen schockiert.
»Herr Laich!«, rief sie. »Eeeewald! Die Suche nach Mietern hat ein Ende. Mein Mann und ich haben alles besprochen. Die Wohnung ist einfach fa-bel-haft! Wir nehmen sie. Wo ist der Mietvertrag?«
»Noo net hudla3, I han mi no net entschieda!«, rief Laich und zog seine Hände weg. »Bis om femfe kommad heit no Leit!«
»Aber Herr Laich«, sagte der Mann kopfschüttelnd, schoss ein paar iPad-Bilder von der Küche und winkte mir, zur Seite zu gehen, um auch meine Ecke fotografieren zu können. Ich lächelte doof und bewegte mich nicht von der Stelle.
»Herr Laich. Klasse statt Masse! Wir sind die perfekten Mieter. Meine Frau ist Anwältin in einer einflussreichen Wirtschaftskanzlei und ich bin ein nicht ganz erfolgloser Unternehmensberater, wir haben uns für Karriere statt Kinder entschieden, wir rauchen nicht und wir haben keine Haustiere. Wir brauchen nur ein Plätzchen vor der Tür für unser kleines Porschilein, das Mercedes Coupé und den Smart! Und wir finden die Miete viel zu niedrig. Das ist doch keine Sozialwohnung!« Er fummelte in seiner Jackettasche herum, guckte überrascht, fischte einen zusammengerollten Geldschein heraus und rollte ihn langsam und konzentriert auseinander. »Sie können doch mindestens einen Hunni mehr im Monat verlangen! Der muss auch nicht unbedingt im Mietvertrag stehen!«
»Vermieter wellad koine Awält«, murmelte Ewald Laich, während er gierig auf den Hunderteuroschein starrte. Dann sah er wieder zu mir. »Also, Mädle, was isch?«
Die Frau musterte mich bitterböse und presste dann aus zusammengebissenen Zähnen ein »Konrad-Kevin!« hervor. Der Hunderteuroschein in Konrad-Kevins Hand vermehrte sich wundersam um einen zweiten. Die andere Hand streckte er Laich hin. Alle blickten mich an. Ich schüttelte nur stumm den Kopf. Mit einer blitzschnellen Bewegung schnappte Herr Laich die beiden Geldscheine, stopfte sie in seine Hosentasche und schlug in die ausgestreckte Hand ein.
2. Kapitel
There’s a moon over Bourbon Street tonight
I see faces as they pass beneath the pale lamplight
I’ve no choice but to follow that call
The bright lights the people and the moon and all
Ich glaube nicht, dass Leon dir Vorwürfe machen wird, weil du dich nicht prostituiert hast, um die Wohnung zu bekommen«, sagte Lila. »Im Gegenteil.«
Wir saßen am Küchentisch und stillten. An jeder von Lilas mächtigen Brüsten hing ein Baby und nuckelte. Weil die Zwillinge immer alles gleichzeitig machten, war Lila mittlerweile ziemlich gut im Synchronstillen. Das Synchronstillen sparte zwar Zeit, bedeutete aber auch, dass sie keine Hand frei hatte. Wenn ich da war, war es mein Job, ihr das zweite Kind anzulegen oder die Position der Babys auf der Stillwurst zu korrigieren, wenn irgendwas nicht mehr passte. Lila war schon vor den Zwillingen ziemlich rundlich gewesen, aber dann hatte die Schwangerschaft ihre sowieso großen Brüste in wahre Monsterbrüste verwandelt. Es hatte eine Weile gedauert, bis ich mich an den Anblick gewöhnt hatte, während Tarik, mein bester Freund und einer der angesagtesten Künstler Deutschlands, sich von Lila künstlerisch inspiriert fühlte und sie unbedingt nackt malen wollte, worauf Lila leider überhaupt keine Lust hatte.
»Fleisch«, schwärmte Tarik. »Alles an ihr ist Fleisch, Fruchtbarkeit und Fortpflanzung.« Tarik liebte Fleisch. Nicht umsonst hatte ich ihn bei der Vernissage seiner Döner-Ausstellung kennengelernt.
»Als wir die Wohnung verließen, blöderweise zur gleichen Zeit, sagte die Anwaltszicke herablassend zu mir, vielleicht hätte ich ja im zweiten Anlauf Glück, weil sie nach Eigentum Ausschau halten würden und wahrscheinlich bald wieder weg seien. Das ist doch das Allerletzte, oder?«, sagte ich erbost.
Lila warf mir einen fassungslosen Blick zu. »Das kann dir doch völlig wurscht sein!«, rief sie. »Nimm mir mal Gretchen ab, ich glaube, sie ist satt. Du wärst doch wohl hoffentlich nicht freiwillig bei so einem schwäbischen Lustmolch eingezogen? Wahrscheinlich hätte er morgens vor der Wohnungstür so lange hin- und hergewischt, bis Leon aus dem Haus geht, um dann unter irgendeinem Vorwand zu klingeln!«
»Du hättest die Wohnung sehen sollen, Lila«, murmelte ich düster und klopfte Gretchen auf den Rücken, bis sie ein Bäuerchen machte. Unglaublich, dass ein winziges Baby so laut rülpsen konnte wie ein Brummifahrer, der ein paar Bier zu viel getrunken hatte. An ihrer Hochzeit hatte Lila plötzlich Wehen bekommen. Ein paar Minuten nach Gretchens Geburt war überraschenderweise noch Oskar aufgetaucht. Als ich Lila im Krankenhaus besuchte, erschrak ich ein bisschen. War das normal, dass Babys wie kleine rosa Ferkel aussahen, stellenweise verschrumpelt, und noch dazu völlig glatzköpfig, ohne jeden Flaum auf dem Kopf? Da war doch wohl hoffentlich nichts schiefgegangen? Weil Lila und Harald nichts aufzufallen schien und sie beinahe platzten vor Stolz, hielt ich die Klappe, aber dann sahen mich beide so erwartungsvoll an, also murmelte ich, »Die … die Händchen sind echt niedlich.«
Mittlerweile fand ich sie schon ganz süß, und Oskar fand ich cool, weil er sich offensichtlich beim Ultraschall immer erfolgreich hinter seiner Schwester versteckt hatte, das Schlitzohr. Ich hatte mich aber noch immer nicht daran gewöhnt, dass sich am Ostendplatz oder in der Stadtbahn innerhalb von Sekunden Trauben von Menschen um uns herum bildeten, die einen Blick in den Zwillingswagen erhaschen wollten und dann alberne Geräusche in höheren Tonlagen machten. Ich war zum unfreiwilligen Kindermädchen mutiert. Lila nahm überhaupt keine Rücksicht darauf, dass ich in ständiger Panik lebte, die Babys fallenzulassen oder sonstwie irreparabel zu beschädigen. Sie spannte mich gnadenlos in die Versorgung ihres Nachwuchses ein. Glücklicherweise waren es fröhliche Kinder, die selten weinten, was bestimmt daran lag, dass Lila bei ihrer Hochzeit so viel gelacht hatte, nachdem ich mit einer Wunderkerze Feueralarm im Rathaus und letztlich Lilas Wehen ausgelöst hatte.
»Hast du heute Abend noch was vor?«, fragte Lila.
»Eigentlich nicht«, sagte ich. »Ich kann nicht mal mit Leon skypen, weil er mit seinen Bosch-Kollegen einen Wochenendausflug zur Chinesischen Mauer macht. Er will die Zeit ausnutzen, solange er noch dort ist. Ich dachte, wir beide verbringen einen gemütlichen Samstagabend zu zweit, ich koche uns ein paar Nudeln und du sagst mir, wie ich die Soße machen soll.«
»Klingt gut. Bis ich gegen halb neun einschlafe«, seufzte Lila. »Und Wein darf ich auch keinen trinken, während Harald sich wahrscheinlich gerade umzieht, um dann mit den Zahnarztkollegen nebst mitgereisten Gattinnen irgendwo an der Waterfront Cocktails zu schlürfen.«
Es klingelte. Wutzky sprang auf und bellte. Lila und ich stöhnten. Wir wussten, was als Nächstes kommen würde. Suffragette schoss aus einer dunklen Ecke heraus und fauchte Wutzky an, Wutzky jagte die Katze bellend in der Küche im Kreis herum, die Zwillinge fingen an zu brüllen, die Katze floh auf den Wickeltisch, Lila brüllte:"Lass die Katze in Ruhe, Wutzky!«, ich scheuchte mit der freien Hand die Katze vom Wickeltisch, drückte Lila das heulende Gretchen auf den freien Arm und riss erst die Küchen- und dann die Haustür auf. Die Katze raste mit aufgestelltem Schwanz an Tarik und Manolo vorbei. In meinem Rücken bellte und brüllte es.
»Überraschung!«, rief Tarik. Er trug große Papiertüten, die beinahe sein Gesicht verdeckten. Hinter ihm stand Manolo mit einem Ghettoblaster unter dem Arm. »Wir dachten, für einen Samstagabend ist es euch sicher zu ruhig, und ihr vermisst die wilden Zeiten. Deswegen bringen wir euch die wilden Zeiten ins Haus!« Er streifte meine Wange, stürzte an mir vorbei in Richtung Gebrüll und rief:"Eideidei, wo sind sie denn, meine Schätzchen? Wo sind meine Schnuckelchen?«
»Ich finde es ja schön, dass er sein Schwulsein mittlerweile so offen auslebt«, knurrte Manolo und reichte mir die Hand. »Aber manchmal übertreibt er’s ein bisschen.«
»Tarik macht eben alles mit größtmöglicher Leidenschaft«, sagte ich. »Früher war er ein hundertprozentiger Macho und hat reihenweise seine Studentinnen abgeschleppt, und jetzt ist er hundertprozentig schwul. Komm doch rein.«
»Aber er hat mich noch immer nicht seinen Eltern vorgestellt«, gab Manolo aufgebracht zurück. »Dabei waren wir schon zweimal übers Wochenende bei meinen Eltern im Schwarzwald, und meine Schwester schaut regelmäßig vorbei. Und immerhin wohnen wir jetzt zusammen!«
»Das kommt bestimmt noch«, erwiderte ich munter. »Deine andalusischen Eltern sind wahrscheinlich toleranter als seine türkischen. Ich kann dir sagen, der Abend, als Tarik mich seiner türkischen Großfamilie vorstellte und als seine Verlobte ausgab, war ein ziemlicher Horrortrip.«
Manolo folgte mir in den Flur und schlüpfte aus seinen Wildleder-Clarks. Er war von Beruf Steinmetz und machte Grabmaletogo. Tagsüber trug er eingestaubte Blaumänner und schwere Schuhe. Abends verwandelte er sich in eine obercoole Socke. Mit seiner großen, schlanken Figur und seinen schwarzen, leicht gewellten Haaren konnte er im Prinzip anziehen, was er wollte, es sah gut aus. Heute trug er eine schmal geschnittene knallblaue Baumwollhose, die seinen knackigen Hintern betonte, ein bunt gemustertes Hemd und eine schwarze Jeansjacke. Unter der Jacke zeichneten sich seine prachtvollen Oberarmmuckis ab. Weil er so machomäßig aussah, wurde Manolo in regelmäßigen Abständen von Kundinnen angebaggert, häufig frisch gebackene Witwen aus der Halbhöhenlage, die auf der Suche nach was Jüngerem waren und nicht kapierten, dass er schwul war. Seine Grabsteine waren sündhaft teuer und es galt als schick, einen echten Manolo auf dem Grab zu haben.
In der Küche saß Tarik mit einem Zwilling auf dem Arm und gurrte. Es wunderte mich, dass er mit seinen schwarzen Klamotten, seinem halblangen schwarzen Haar, den Lederbändchen am Handgelenk und dem Totenkopf-Ring am Mittelfinger bei dem Baby nicht wieder Brüllanfälle auslöste. Wutzky hatte sich verzogen. Er hasste Tarik, was auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Wickel-Time!«, rief Lila und streckte mir den anderen Zwilling hin.
»Gretchen oder Oskar?“, fragte ich. Lila weigerte sich, ihre Kinder farblich nach Geschlecht zu sortieren. Meist trugen sie grün.
»Gretchen, aber das hättest du wahrscheinlich demnächst selber herausgefunden.«
»Seit wann wickelst du, Line?«, fragte Tarik. »Ich dachte, das wär nicht so deins.«
»Seit Harald in Kapstadt ist«, sagte ich und warf mich in die Brust. »Schließlich braucht die arme Lila meine Unterstützung und weibliche Solidarität. Und eigentlich ist Wickeln etwas Wunderbares! Dieser total intensive Kontakt zum Baby!« Das war eine glatte Lüge. Bei jedem Wickeln geriet ich in Panik, das Baby könnte vom Wickeltisch plumpsen, und jedes Mal, wenn ich »Alle meine Entchen« anstimmte, um meine Nerven zu beruhigen, hob das große Heulen an, egal, ob es sich um Gretchen oder Oskar handelte. Einmal brüllte Gretchen, obwohl ich gar nicht sang, bis ich endlich merkte, dass ich den Klebestreifen von der Windel an ihrem Oberschenkel statt an der Windel festgeklebt hatte.
»Darf ich’s machen?«, bettelte Tarik. »Bitte.«
»Ich weiß nicht«, gab ich zurück. »Vielleicht ist es Lila nicht so recht, wenn es nicht so professionell gemacht wird.«
»Tu doch nicht so, Line«, sagte Lila. »Klar kannst du wickeln, Tarik.« Tarik gab Oskar an Lila weiter, schnappte sich Gretchen und schnupperte verzückt. »Babys riechen einfach so gut.«
»Kapstadt«, echote Manolo. »Nicht schlecht, da ist jetzt Frühling. Wann kommt Harald wieder?«
»In drei Tagen«, antwortete Lila. »Er hat sich schon vor ewigen Zeiten, als wir noch getrennt waren, zu dem Zahnärztekongress angemeldet. Er wollte dann stornieren, aber es war schon zu spät, das Geld für Flug und Hotel wäre weg gewesen. Ich dachte, die paar Tage kriegen wir rum, Line und ich. Die letzten Wochen waren für Harald ganz schön hart, tagsüber Arbeiten und nachts Windeln wechseln, und Kapstadt war schon immer sein Traum.«
Die letzten Wochen waren für uns alle hart und wir haben alle Ringe unter den Augen, dachte ich, sagte aber nichts. Lila war immer für mich dagewesen, jetzt war es eben mal eine Zeitlang umgekehrt. Ich würde mein Schicksal selbstlos erdulden. Bestimmt wuchs mir schon langsam ein Heiligenschein.
»Wir wollten ein paar Nudeln kochen«, sagte Lila. »Wollt ihr mitessen?«
Tarik hörte auf zu gurren und richtete sich am Wickeltisch auf. »Das habe ich ja ganz vergessen«, rief er. »Ich habe haufenweise italienische Antipasti mitgebracht. Eingelegte Oliven und Salami und Parmaschinken und Pecorino-Käse und Weißbrot! Und alles in Styroporbehältern zum Wegwerfen, sodass ihr gar nichts zu spülen braucht!«
»Super unökologisch, aber das ist mir im Moment völlig egal«, seufzte Lila. »Dann machen wir ein paar schnelle Nudeln dazu. Setzt du Wasser auf, Line?«
Ich füllte einen großen Topf mit Wasser, zündete den Gasherd an und kramte im Kühlschrank nach Fertignudeln. Früher wäre Lila so was nicht ins Haus gekommen.
»Das dauert ja noch. Ich geh solang eine rauchen«, sagte Manolo und verschwand nach draußen.
»Schnell, Tarik, erzähl«, flüsterte ich. »Wie läuft euer Zusammenleben denn so?«
»Line, also wirklich«, sagte Lila tadelnd. »Kaum ist Manolo zur Tür raus, fängst du an, über ihn zu tratschen.«
»Das ist kein Tratsch«, entgegnete ich würdevoll. »Nur rein freundschaftliches Interesse. Sie wohnen doch erst seit ein paar Tagen zusammen.«
Tarik grinste. »Also der Sex ist unglaublich, falls es das ist, was dich interessiert.«
»Tarik! Doch nicht vor den Kindern!«, schimpfte Lila.
»Manolo hat nur ein einziges Möbelstück mitgebracht, einen Kleiderschrank für seine Klamotten, so ein scheußlich bemaltes Bauernteil. Der Schrank ist so riesig, dass er sich morgens darin verläuft. Wir mussten die halbe Wohnung umräumen, um ihn unterzubringen, und er ragt jetzt trotzdem übers Fenster.«
Tarik wohnte in einer Wohnung in der Weißenhofsiedlung, die zwar ausgesprochen schick, aber auch ziemlich unpraktisch war.
»Der Schrank passt auch vom Stil her überhaupt nicht zu meinen weißen Möbeln. Aber Manolo meinte, er braucht Platz für seine vielen Klamotten und er zieht entweder mit Schrank ein oder überhaupt nicht.« Tarik seufzte. »Wenn er nach der Arbeit heimkommt, fläzt er sich erst einmal mit einer Dose Bier auf mein weißes Sofa und dann blockiert er anderthalb Stunden das Bad.«
»Na ja, er wird doch sicher staubig beim Grabsteine klopfen«, entgegnete ich und kippte die Nudeln ins kochende Wasser.
»Das kannst du laut sagen. Der Staub ist einfach überall. Ich hab zwar eine türkische Putzfrau, die kommt aber nur einmal die Woche. Nachdem Manolo den Staub gründlich verteilt hat, geht er ins Bad. Ich schwörich hatte noch nie eine Freundin, die so lange gebraucht hat. Glaub ich wenigstens nicht, ich hab ja nie mit einer zusammengewohnt. Weil ich selber auch ziemlich lange brauche, muss ungefähr drei Stunden, bevor wir abends aus dem Haus gehen, einer von uns ins Bad.« Tarik sah auf die Uhr. »Jetzt ist es kurz vor acht. Manolo ist um vier ins Bad. Um halb sechs war er fertig und dann haben wir …« Tarik fing an zu kichern und kassierte einen strengen Blick von Lila.
« …einen Espresso getrunken. Um sechs bin ich ins Bad und habe mich beeilt, sodass ich um sieben fertig war und wir loskonnten.«
Das war ja schlimmer als bei pubertierenden Teenagern. »Was macht Manolo denn so lange?«, fragte ich.
»Er sagt, er macht gar nichts Besonderes. Er fängt mit Rasieren an, dann duscht er sich, wäscht sich die Haare, macht eine Spülung in die Haare und legt eine Packung auf. Dann macht er ein Gesichtspeeling, gefolgt von einem Körperpeeling, Rasierwasser und Gesichtswasser. Also eigentlich macht er genau das Gleiche wie wir türkischen Heteros.«
»Du bist kein Hetero mehr.«
»Ach ja. Ich vergaß.«
Leon hatte in seinem Bad nur einen Rasierapparat, eine Zahnbürste, Zahnpasta und ein Deo besessen. Zum Duschen und Rasieren hatte er morgens im Bad nur achteinhalb Minuten gebraucht. Ein- bis zweimal im Jahr benutzte er Rasierwasser.
»Das mit dem Zusammenwohnen, das ist schon eine ziemliche Umstellung«, fuhr Tarik fort. »Ich bin’s halt gewohnt, mein eigenes Ding zu machen. Manolo will zum Beispiel abends immer was essen.«
»Essen, igitt! Das ist natürlich eine perverse Angewohnheit«, sagte Lila und streckte Tarik Oskar zum Wickeln hin. »Du kannst einem echt leid tun.«
»Na ja, wenn ich grad eine kreative Phase habe und oben in meinem Atelier bin, dann kann ich meine künstlerische Arbeit doch nicht unterbrechen, um zu essen!«, verteidigte sich Tarik und zog Oskar den Strampler aus, als hätte er in seinem Leben nie etwas anderes gemacht. Beneidenswert.
»Wann geht Manolo denn aus dem Haus?“, fragte Lila.
»Er bringt mir einen Kaffee ans Bett und dann geht er so um halb acht«, sagte Tarik. »Ich dreh mich nach dem Kaffee nochmal rum. Meine erste Vorlesung an der Kunstakademie ist dienstags um zehn.«
»Dann ist es doch kein Wunder, wenn er abends Hunger hat!«, rief Lila. »Schließlich arbeitet er körperlich!«
»Außerdem nervt Manolo ständig, dass er meine Eltern kennenlernen will.«
»Das ist doch verständlich«, warf ich ein. »Schließlich warst du schon zweimal bei seinen Eltern im Schwarzwald und seine Schwester kommt regelmäßig vorbei.«
»Line, du hast meine Eltern doch erlebt! Sie wollen, dass ich eine türkische Frau heirate, und zwar aus Anatolien, nicht aus Istanbul! Sie könnten sich vielleicht zähneknirschend drauf einlassen, dass ich eine deutsche Frau anschleppe. Zur Not sogar eine Schwäbin. Wenn die türkische Frau aber ein spanischer Mann ist, dann stimmen einfach zu viele Faktoren nicht! Sie würden mich sofort verstoßen!«
»Du wirst es ihnen nicht ewig verheimlichen können«, erklärte ich achselzuckend. Die Eingangstür wurde geöffnet.
»Die Nudeln«, sagte Lila. »Die müssten doch längst fertig sein, Line, oder?«
»Ach du liebe Zeit!«, rief ich, rannte zum Herd und kippte die Bandnudeln über dem Spülbecken mit Schwung in ein Sieb. Leider flutschte die Hälfte der Nudeln über den Rand des Siebs hinaus und in das mit Spülwasser gefüllte Becken hinein. Hastig ließ ich das Wasser ab und fischte die Nudeln vom Grund des Beckens. Zum Glück schien niemand etwas bemerkt zu haben und mir knurrte so der Magen, dass ich darauf nun wirklich keine Rücksicht nehmen konnte.
Eine dreiviertel Stunde später war samstäglicher Frieden in der Küche eingekehrt. Ein schlummerndes Baby lag auf Lilas Bauch und ein zweites schnarchte an Tariks Schulter. Auch wir Erwachsenen waren satt und zufrieden, nachdem wir Antipasti und Nudeln verputzt und dazu Wein und Pfefferminztee getrunken hatten. Lila hatte zwar stirnrunzelnd bemerkt, dass die Nudeln irgendwie seifig schmeckten, aber ich hatte nur unschuldig darauf geantwortet;"Das waren die Fertignudeln. Wahrscheinlich schmecken die einfach so.« Leider wurde die Idylle ab und zu empfindlich von Wutzkys Glücksfürzen gestört. Immer, wenn seine Lieben einträchtig beieinander saßen, produzierte er geräuschvolle, widerlich stinkende Fürze. Eine bleierne Müdigkeit stieg in mir hoch. Letzte Nacht hatte ich um drei Windeln gewechselt.
»Wir könnten den Ghettoblaster anstellen und ein bisschen zu türkischem Hip-Hop abtanzen«, schlug Tarik in dem Moment vor. »Nur, weil du Zwillinge hast, ist ja dein Leben nicht vorbei, Lila.«
»Das beruhigt mich ungemein, Tarik, dass mein Leben mit Anfang dreißig noch nicht ganz zu Ende ist. Leider werde ich in ungefähr zwei Stunden wieder Synchronstillen. Ich sammle jetzt also meine Kinderlein ein, lege mich ins Bett und hoffe, dass Harald möglichst bald anruft.«
»Dann gehen wir zum Tanzen eben in den King’s Club«, schlug Manolo vor. »Kommst du mit, Line?«
»Ist das nicht eine Schwulendisco?“, fragte ich.
»Schon. Da gehen aber auch viele Frauen hin, weil sie wissen, dass sie nicht angebaggert werden.«
»Line, tut mir leid, aber du müsstest noch mit Wutzky raus, eh du aus dem Haus gehst«, sagte Lila und stand schwerfällig auf.
»Ich weiß. Ich bin sowieso zu müde zum Weggehen. Außerdem muss ich mir noch diese bescheuerten Unterlagen von der Wohnungsbesichtigung anschauen. Die wollen die bis Dienstag zurückhaben.«
»Ich dachte, die Wohnung war gar nicht so toll?“, fragte Lila und pflückte das zweite Baby von Tariks Schulter.
»Schon. Aber langsam habe ich den Eindruck, wir müssen nehmen, was wir kriegen, sonst schlafe ich mit Leon unter der Brücke«, seufzte ich. Leon. Ich vermisste ihn schon den ganzen Abend schrecklich. Warum musste er in China sein und konnte nicht gemütlich mit uns am Tisch sitzen?
»Mach dir nicht so viele Sorgen, zur Not bringen wir Leon hier auch noch unter«, sagte Lila. »Viel chaotischer kann es doch nicht werden.«
»Hast du nicht noch eine zweite Wohnung besichtigt?“, fragte Tarik.
»Dort kann sie unmöglich einziehen«, wehrte Lila ab. »Der Vermieter hat sie angebaggert.«
Manolo verschränkte die Handflächen ineinander, drehte sie nach außen und drückte die Arme von sich weg. Es knackte laut und vernehmlich. Tariks Augen klebten entzückt an seinen Oberarmmuckis. Gleich würde das Hemd reißen.
»Wenn du möchtest, regle ich das für dich, Line«, sagte Manolo lächelnd. »Sag mir, wo der Typ wohnt und ich garantiere dir, er wird dich in Ruhe lassen. Komischerweise denken die Leute immer, wenn einer schwul ist, kann er andern keine in die Fresse hauen.«
»Nein, nein, ist schon in Ordnung«, entgegnete ich hastig. Tarik hatte mir erzählt, dass Manolo ab und zu als Bodyguard arbeitete. Nur so zum Spaß und nicht, weil er das Geld brauchte.
Eine halbe Stunde später hatte ich Tarik und Manolo verabschiedet, die Küche gelüftet und leidlich aufgeräumt, die Styroporbehälter in den Gelben Sack gestopft, den Müll hinausgebracht, Katzen- und Hundefutter hingestellt und Wutzky, der nicht die geringste Lust hatte, sein gemütliches Plätzchen zu verlassen, an der Leine hinaus und einmal die Neuffenstraße hinunter- und wieder hinaufgezerrt. Es war eine ungewöhnlich laue Nacht für September und ich blieb noch einen Augenblick vor dem Haus stehen, atmete tief durch und dachte daran, wie wenig Lust ich auf Winter hatte. Hinter dem Rondell mit der Linde, vor dem Backsteinhaus, stand ein Polizeiauto. Komisch. Die kleine Neuffenstraße war die friedlichste Straße der Welt. Polizei brauchte man hier wirklich nicht.
Zurück im Häuschen ließ ich mich erschöpft auf einen Stuhl fallen. Aus Lilas Zimmer drang kein Laut. Es war Samstagabend kurz vor zehn und ich wollte eigentlich nur noch eines: ins Bett. Ich war sogar zum Fernsehen zu müde. Ich war zweiunddreißig. Andere Leute in meinem Alter tanzten jetzt ab, lümmelten mit einem Bier in der Hand beim Palast der Republik herum, nahmen an Kennenlern-Kochparties teil oder hatten heißen Wochenendsex. Ich dagegen machte Haushalt und bereitete mich darauf vor, gegen drei Uhr zwei Windeln zu wechseln und gegen sieben Uhr eine Pinkelrunde mit einem furzenden Köter zu drehen, der mich genauso wenig mochte wie ich ihn. Es wurde höchste Zeit, dass Leon zurückkam, wir zusammenzogen und mein Leben wieder lustiger wurde.
3. Kapitel
Looking for fun and feelin’ groovy
Ich lag auf einer weißen Chaiselongue in einem riesigen Wohnzimmer. Die Flügeltüren zum Garten standen weit offen und der Wind bauschte die Seidenvorhänge. Ich trug nichts außer zwei goldene Nipple-Covers mit Troddeln auf den Brüsten und einen hauchdünnen goldenen String-Tanga. Neben mir lag Leon. Er trug nichts außer einem Tablett in der Hand, auf dem eine riesige blaue Weintraube lag. Seit wann hatte er so eindrucksvolleOberarmmuckis? Ich öffnete in Zeitlupe den Mund und Leon ließ eine Traube hineinfallen. Ich kaute langsam. Saft rann mir den Mundwinkel hinunter.
»Willkommen in der neuen Wohnung, Line«, flüsterte Leon. »Höchste Zeit, sie mit heißem Wochenendsex einzuweihen.« Er beugte sich über mich. Seine Hand wanderte langsam von meinem Knie den Oberschenkel hinauf, die andere spielte mit einer Nipple-Cover-Troddel. Ich stöhnte leise.
»Pipeline Praetorius! Hör gefälligst auf zu stöhnen und wach auf!«
Schlaftrunken fuhr ich hoch. Irgendjemand kicherte hämisch.
»Pipeline Praetorius, du hast zwar mittlerweile einen festen Vertrag, aber das heißt nicht, dass man dir nicht kündigen kann!«
O mein Gott. Hatte ich wirklich laut gestöhnt? Ich blickte in die sechs Gesichter, die außer mir die Werbeagentur Friends & Foesausmachten und rutschte in eine aufrechte Position. Arminia (wütend), Benny und Philipp (herablassend amüsiert), Suse, Micha und Paula (entsetzt), starrten mich an, als sei ich eine Erscheinung. Langsam kam ich zu mir. Ich musste irgendwas Schlagfertiges sagen. Etwas total Witziges. Alle würden lachen und schwuppdiwupp wäre der superpeinliche Moment vorbei. Bloß was?
»Es … es tut mir leid, Arminia«, stotterte ich. »Es ist nur so, der Mann meiner Mitbewohnerin ist verreist, und ich musste heute Nacht zweimal raus, Zwillinge wickeln … und davor wollten sie ewig kein Bäuerchen machen …«
Benny und Philipp feixten.
»Viel zu viel Info! Viel zu privat! Und noch lange kein Grund, mitten in einer Besprechung einzuschlafen!«
Philipp grinste jetzt breit. Arminia warf ihm einen bösen Blick zu und zischte: »Da hast du schon einmal einen Vorgeschmack von dem, was dich erwartet! Wer kleine Kinder zu versorgen hat, bringt nicht die volle Leistung!«
Philipps Grinsen erstarb. Seine Freundin war schwanger, arbeitete selber in einer Agentur und bestand darauf, dass Philipp drei Monate Elternzeit nahm. Philipp fand Elternzeit für Männer theoretisch und im Prinzip gut, praktisch hatte er nicht die geringste Lust drauf. Das hatte er blöderweise Arminia gegenüber zugegeben. Seither machte sie ständig spöttische Bemerkungen über Männer, die Memmen waren und wegen der Familie ihre Karriere riskierten.
»Hast du überhaupt irgendwas von Bennys fabelhafter Präsentation mitgekriegt, Line?« Arminias Stimme war noch immer schneidend.
»Äh – klar. Vielleicht fehlt mir das allerletzte Minütchen. Die restliche Zeit war ich voll dabei.«
»Dann kannst du ja sicher nochmal kurz für alle zusammenfassen, um was es geht?«
Nein, das konnte ich nicht. Ich war eingepennt, sobald ich auf dem Stuhl im Besprechungszimmer Platz genommen hatte. Ich starrte auf die Powerpoint-Folie. Ein schlecht gezeichnetes Männchen mit dämlichem Grinsen im Gesicht jonglierte eine Pizza.
»Nun, um einen Pizza-Service«, sagte ich. »Die machen ja oft so schlechte Werbung auf ihren Autos und Scootern wie die da, und Benny entwirft jetzt stattdessen eine total originelle Kampagne.« Schweigen. Benny kniff die Lippen zusammen. Suse, Micha und Paula guckten in verschiedene Ecken.
Arminia stöhnte. »Nein, Line. Es geht nicht um einen Pizza-Service, sondern um einen Food-Drucker, mit dem man Pizzas ausdrucken kann! Eine Revolution im Convenience-Bereich! Und das Männchen ist das superwitzige Strichmännchen, mit dem Benny arbeitet!«
»Oh«, murmelte ich. »Natürlich. Superwitzig, meinte ich doch. Sorry.« Ausgerechnet! Benny war der aufstrebende Nachwuchs und Arminias persönliche Entdeckung. »Bald wird er flügge«, pflegte sie zu seufzen. In wenigen Wochen würde Bennys Trainee-Programm beendet sein und dann sollte er die neue Agentur in Leipzig übernehmen. Pech für Arminia. Niemand konnte übersehen, dass sie unsterblich in Benny verknallt war.
Arminia warf mir einen letzten vernichtenden Blick zu. »Mach weiter, Benny. Wir können nicht warten, bis Line geistig wieder bei uns ist.«
»Vielleicht verrät sie uns ja noch, was sie geträumt hat?«, gab Benny zurück und scannte mich von oben bis unten, als hätte ich keine Klamotten an. Dann drehte er sich wieder zu seiner Präsentation.
In der nächsten halben Stunde kniff ich mich verzweifelt in alle möglichen Körperteile und rieb meine Ohrläppchen, weil mir schon wieder die Augen zufallen wollten. Ich ließ sogar ein Blatt Papier auf den Boden segeln, in der Hoffnung, beim Bücken meinen Kreislauf anzukurbeln. Bennys sterbenslangweilige Präsentation machte es nicht unbedingt einfacher. Arminia warf mir ab und zu prüfende Blicke zu. Die meiste Zeit starrte sie jedoch auf Bennys Folien und kommentierte sie mit entzückten Zwischenrufen. Endlich war es vorbei. Arminia applaudierte und wir anderen applaudierten pflichtschuldigst mit. Benny sagte nichts und lächelte Arminia nur an. Arminia lächelte hingerissen zurück. Wie alt mochte sie sein, Mitte fünfzig? Benny war vierunddreißig und bescheuert, sah aber leider so attraktiv aus wie Hugh Jackman in dem Schmachtfetzen »Australia". Er trug dengleichen Bart wie dieser, aber anstelle eines dreckverschmierten Unterhemds langweilige weiße Hemden und Poloshirts, und morgens rückte er mit einem 3er-BMW an statt auf einem Pferd. Er war der Einzige, der seine Angeberkarre neben Arminias BMW im Hinterhof parken durfte. Seit Monaten behandelte er sie wie einen Kettenhund, dem man ab und zu einen fetten Fleischbrocken hinwirft und dann wieder tagelang hungern lässt. Man hätte Mitleid mit ihr haben können, wenn sie nicht so ein Biest gewesen wäre.
»Und nun an die Arbeit!«, befahl Arminia. »Eigentlich hätte Line dich bei dem Projekt unterstützen sollen, Benny. Dein letztes Projekt in Stuttgart … das möchte ich dir nun aber nicht zumuten. Die Gefahr ist zu groß, dass sie immer noch glaubt, es gehe um einen Pizza-Service. Suse, du wirst Benny zuarbeiten.«
»Aber gern«, sagte Suse und lächelte krampfhaft. Suse war unsere Streberin und sagte immer zu allem Ja und Amen. Ich jedoch frohlockte innerlich. Ich war zwar mal wieder peinlich gewesen, aber dafür musste ich jetzt nicht Bennys Handlangerin spielen! Wir blieben alle brav sitzen, bis Arminia auf ihren kurzen Beinchen aus dem Meeting Room gestöckelt war, ihren Entenhintern breit herausgestreckt. Das ungeschriebene Arminia-Gesetz Nr. zwei lautete, dass Arminia als Letzte den Raum betrat und als Erste verließ. Gesetz Nr. eins lautete, dass Arminia immer recht hatte.
Ich setzte mich an meinen PC und rief meine Mails auf. Micha, der seinen Schreibtisch schräg vor meinem hatte, stand auf und schlenderte heran. Wie immer hatte er Flecken auf dem T-Shirt. Er saute sich ständig ein.
»Ich muss mit dir reden«, murmelte er.
»Ich dachte, wir hätten das geklärt«, zischte ich. Micha hatte mich vor ein paar Monaten angebaggert, dass es krachte. Nur weil er das gleiche kleine genetische Problemchen hatte wie ich, glaubte er, wir seien füreinander bestimmt. Seither waren wir höflich, aber distanziert miteinander umgegangen.
»Nein, keine Sorge«, sagte Micha hastig. »Das habe ich mittlerweile kapiert. Es geht um …« Blitzschnell hielt er mir einen winzigen Zettel unter die Nase, auf dem das Wort »Katastrophen-Gen« zu lesen war. »Hast du in der Mittagspause schon was vor? Wir könnten zu Herbert’z gehen und eine Kleinigkeit essen.«
»Aber ich will nicht mit dir über das … das da reden. Da gibt es nichts zu reden!«
»Hör mich doch wenigstens an, Line. Bitte, nur ein halbes Stündchen. Es ist wirklich wichtig. Ich verspreche dir, wenn du danach sagst, du willst nie mehr, dass ich das …«, er fuchtelte mit dem Zettel vor meiner Nase herum, » …auch nur erwähne, lasse ich dich damit in Ruhe.«
Hinter Arminias Paravent war Stühlerücken zu hören.
»Zwölf Uhr dreißig bei Herbert’z«, flüsterte Micha. »Wir gehen getrennt.« Er hastete zurück an seinen Schreibtisch, wobei er über ein Druckerkabel stolperte. Ich sah konzentriert auf meinen Bildschirm und tat so, als würde ich nicht bemerken, dass Arminia hinter ihrem Paravent hervorlugte, um herauszufinden, wer da im Großraumbüro tuschelte. Was um alles in der Welt wollte Micha mit mir besprechen? Ich hatte irgendwann zufällig herausgefunden, dass auch er das Katastrophen-Gen hatte. In ganz Deutschland waren nur zwei Fälle davon bekannt, und die mussten sich ausgerechnet in Stuttgart in der gleichen Agentur über den Weg laufen!
Gegen zwanzig nach zwölf stand Micha auf, murmelte etwas von Mittag machen und verließ das Büro. Ich folgte ein paar Minuten später. Arminia hing am Telefon, Paula, die Praktikantin, kopierte, und Benny hielt Suse einen Vortrag, der seiner Präsentation ziemlich zu ähneln schien. Niemand schenkte mir Beachtung. Unten auf der Heusteigstraße wandte ich mich nach links. Überall waren Grüppchen von lässigen Leuten auf der Suche nach einem Mittagessen in einer Szenebar. Im Heusteig machte jeder irgendwas mit Werbung oder Kommunikation. Das Herbert’z lag zwar etwas am Rand des Viertels, war aber das Zentrum der Heusteig-Lässigkeit. An dem riesigen, glänzenden Kaffeebereiter traf sich ein nicht enden wollender Strom von Kaffeesüchtigen zu einem schnellen Cortado zwischendurch. Weil ich mich selbst nicht so schrecklich lässig fand, fühlte ich mich dort immer ein bisschen fehl am Platz. Andererseits war die Espressobar weit genug weg vom Büro, sodass wir dort nicht über Arminia, Benny oder Philipp stolpern würden.
Wie immer um die Mittagszeit herrschte Hochbetrieb. Micha war noch nicht da. Mein Blick fiel auf eines der vielen Bilder an der Wand:"Life is short. Eat dessert first!« Der Meinung war ich auch, deswegen hatte ich auf dem Weg hierher ein Schäumle gekauft und sofort verspeist. Blöderweise lag der Bäcker Weible ganz in der Nähe unserer Agentur und ich hatte es noch nie geschafft, daran vorbeizulaufen, ohne etwas zu kaufen. Es half auch nichts, in die andere Richtung zu gehen, denn dort lag der Bäcker Hafendörfer.
Auf der Tageskarte des Herbert’z stand gemischter Salat mit Schafskäse. Das klang ziemlich gesund, vor allem nach dem Schäumle. Ich entschied mich für Bratkartoffeln mit Schinken, Speck und Spiegelei, bestellte an der Essenstheke und schnappte mir den Sofa-Platz an einem der kleinen Holztische. Micha stolperte durch die offene Tür und hängte seine Kapuzenjacke auf den braunen Retro-Stuhl auf der anderen Seite des Tisches.
»Ich habe einen kleinen Umweg gemacht, damit man uns nicht zusammen sieht«, raunte er.
»Übertreibst du nicht ein bisschen? Ich habe übrigens schon bestellt.«
»Ich nehme nur einen Kaffee«, sagte Micha und ging an die KaffeeTheke.
»Was kriegsch du?“, fragte ihn der Mann mit Tirolerhut, der hinter der Theke mit dem riesigen Kaffeebereiter hantierte.
»Einen Milchkaffee, bitte, Marcel.«
Ein paar Minuten später schaufelte ich mir selig Bratkartoffeln in den Mund. »Hast du keinen Hunger?«, fragte ich. Micha schüttelte den Kopf. Kein Wunder, dass er so schmächtig war. An mir war zwar auch nicht viel dran, aber im Gegensatz zu Micha futterte ich wie ein Scheunendrescher. Lila war immer schrecklich neidisch, weil die Kalorien einfach durch mich hindurchflutschten. Micha nahm einen Schluck Kaffee. Ich sah ihn erwartungsvoll an. Er wurde knallrot.
»Also zunächst mal … ich hab mich damit abgefunden, dass aus uns beiden nichts wird. Ich werde dich nicht mehr belästigen.«
»Okay«, murmelte ich erleichtert. Hoffentlich schlug er jetzt nicht vor, dass wir ziemlich beste Freunde werden sollten!
»Ich … ich will’s loswerden«, sagte er, ohne mich anzusehen. »Wenn ich das Katastrophen-Gen nicht hätte, wäre mein Leben viel einfacher! Ich hätte eine tolle Freundin. Ich würde Karriere machen und müsste mich nicht von Arminia tyrannisieren lassen. Vielleicht hätte ich sogar mehr Haar!«
Ich warf einen skeptischen Blick auf Michas hohe Stirn und das wenige Haar darüber. »Ich weiß nicht so recht. Irgendwie habe ich mich an die Katastrophen-Gen gewöhnt, schließlich musste ich mich mein ganzes Leben damit arrangieren. Ich war sogar schon mal eine Nacht in Untersuchungshaft auf dem Pragsattel deswegen.«
»Du hast gut reden. Du hast einen Freund, der sogar mit dir zusammenziehen will! Er muss verrückt sein.«
»Glaub mir, er weiß, worauf er sich einlässt«, erwiderte ich würdevoll, obwohl ich mir da manchmal gar nicht so sicher war.