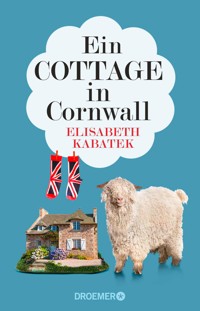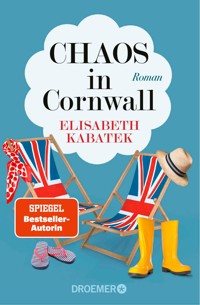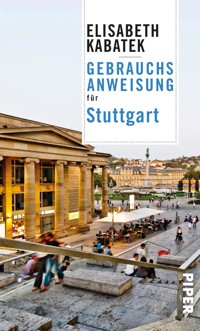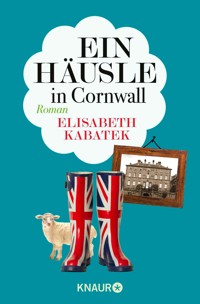Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle sagen Line zu ihr, aber eigentlich heißt sie Pipeline. Pipeline Praetorius (31) lebt in Stuttgart. Sie ist Single. Und arbeitslos. Und sie hat es wirklich nicht leicht. Zwischen Bewerbungsstress und Scherereien mit der Arbeitsagentur treten gleich zwei Männer in ihr chaotisches Leben: Leon, der nette Ingenieur aus Hamburg, leidenschaftlicher Stäffelesjogger und gar nicht intellektuell, und der aufregende amerikanische Fotograf Eric M. Hollister. Und so stolpert Line auf der Suche nach Mister Right zwischen beiden hin und her und von einer Katastrophe in die nächste. Diese quirlige Beziehungskomödie kann so nur in Schwaben spielen. Der bruddelige Nachbar Herr Tellerle und die naseweise Frau Müller-Thurgau überwachen im Treppenhaus Lines Besucher ebenso penibel wie die hundertfünfzigprozentige Einhaltung der Kehrwoche. Für mehr als eine Überraschung sorgt Lines unverwüstliche Tante Dorle, Hüterin eines unübertroffenen Käsekuchenrezepts ... Frei nach dem Motto "Bridget Jones meets Kehrwoche" legt die Stuttgarter Autorin Elisabeth Kabatek einen frechen, turbulenten Frauenroman vor. Zum Brüllen komisch!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Kabatek
Laugenwecklezum Frühstück
Roman
Elisabeth Kabatek ist in der Nähe
von Stuttgart aufgewachsen. Sie studierte
Anglistik, Hispanistik und Politikwissenschaft
in Heidelberg, Salamanca und
Granada und arbeitete in Frankfurt a. M.
und Barcelona. Seit 1997 lebt sie in
Stuttgart. »Laugenweckle zum Frühstück«
war ihr erster Roman. Er setzt sich in
»Brezeltango« fort. »Texte und Songs aus
Laugenweckle zum Frühstück und
Brezeltango« kann man auf der gleichnamigen
CD hören, die im Buchhandel
erhältlich ist; es liest die Autorin. Eine
zweite Fortsetzung ist unter dem Titel
»Spätzleblues« erschienen. Alle drei
Romane sind auch als Hörbuch erhältlich.
www.e-kabatek.de
Für Charo, Fran, Luis, Paco und Sofía
© 2008/2012 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung:
Christoph Wöhler, Tübingen,
unter Verwendung einer
Fotografie von Frank Butzer, Tübingen.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1500-0
E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1501-7
Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-87407-809-2
Besuchen Sie uns im Internet
und entdecken Sie die Vielfalt
unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
1. Kapitel | Montag
I don’t like Mondays
»Name?«
»Praetorius. Mit a-e.«
»Vorname?«
»Pipeline.«
Schweigen.
»Pipeline?«
»Ja, genau.«
»Isch des Ihr Ernschd?«
»Ja.«
Ich saß in Handschellen auf dem Polizeirevier Gutenbergstraße, Stuttgart-West. Der Beamte sah mich über den Rand seiner klapprigen Schreibmaschine hinweg misstrauisch an.
»Kennad Sie des vielleicht buchschdabiere?«
»P-I-P-E-L-I-N-E.«
»Also so wie Englisch?«
»Jaaa! Aber Deutsch ausgesprochen, verd...«
»Bassad Se bloß uff! Sonschd gibt’s no a Azeig wega Beamdebeleidigong!«
»Aber ich weiß doch noch nicht mal, was ich verbrochen habe!«
»Des saga mr Ihne scho no rechtzeidig!«
Ich sprang auf und mähte dabei meinen Stuhl um. Nichts wie raus hier! Leider verweigerten mir meine Beine den Dienst. Sie waren wie Blei. Der Polizist brüllte: »Jetzt au no abhaue wella! Des isch fai Widerstand gege die Staatsgewalt! Ab en d’Zelle, bei Wasser ond Brot!«
Ich fuhr hoch und ließ mich erleichtert wieder in die Kissen fallen. Was für ein schrecklicher Traum! Reichte es nicht, dass mein wirkliches Leben mit Katastrophen gespickt war? Griffen sie jetzt sogar schon auf meine Träume über?
Panisch wollte ich aus dem Bett hüpfen. Bestimmt war ich mal wieder zu spät dran. Duschen, anziehen und auf dem Weg in die Werbeagentur ein Laugenweckle kaufen, ich hatte wirklich keine Zeit zu verlieren. Dann fiel mir ein, dass ich mich mit dem Aufstehen überhaupt nicht beeilen musste. Heute war Montag. Mein erster Montag als Arbeitslose.
Wie oft hatte ich mich danach gesehnt, ausschlafen zu können, wenn wir einen Abgabetermin für ein Projekt hatten und bis kurz vor Schluss Nachtschichten einlegten! Ich blieb liegen und spürte, wie langsam ein schales Gefühl in mir hochkroch. Daran war der Traum bestimmt auch nicht ganz unschuldig. Mein Name, Pipeline, beschreibt ziemlich präzise das ganze Ausmaß der Katastrophe, die vor mittlerweile 31 Jahren im tiefsten Sibirien ihren Anfang nahm.
Meine Eltern hätten mich ja auch Irina oder Anna nennen können. Damit hätten sie mir das Leben leichter gemacht und ich müsste nicht so oft umständliche Erklärungen abgeben. Aber mein ungewöhnlicher Name ist das Ergebnis ungewöhnlicher Umstände ...
Mein Vater, ein bodenständiger Schwabe, arbeitete als Ingenieur bei einem bodenständigen schwäbischen Unternehmen, das sich mit bodenständigem schwäbischem Fleiß und grundsolider Arbeit ein kleines Weltimperium aufgebaut hatte. Mein Vater sah neidvoll zu, wie die Kollegen in den Jahren, als das Wachstum keine Grenzen zu kennen schien, von ihren Arbeitsplätzen links und rechts seines Schreibtisches verschwanden, um einige Jahre später braun gebrannt wieder an denselben aufzutauchen, mittlerweile verheiratet mit glutäugigen brasilianischen Schönheiten, die sie zusammen mit drei kaffeebraunen Kindern in verschiedenen Größen stolz auf der Betriebsweihnachtsfeier präsentierten.
Das Fernweh meines Vaters hielt sich in Grenzen. Er war mit seiner schönen schwäbischen Heimat, mit Strohgäu, Schwarzwald und Schwäbischer Alb ganz zufrieden. Eigentlich war es ihm ziemlich egal, wo er hinfuhr. Hauptsache, es gab in Blaubeuren oder am Titisee einen reellen Zwiebelrostbraten. Aber auf die brasilianischen Schönheiten war er neidisch. Anfang der siebziger Jahre sagte er zu seinem Chef, er würde auch mal gerne ins Ausland gehen, versäumte es allerdings, dabei die brasilianischen Schönheiten zu erwähnen.
Wenige Monate später fand er sich im tiefsten Sibirien wieder, um den Bau einer Ölpipeline zu überwachen, die irgendwann einmal täglich mehr als eine Million Barrel Erdöl von Russland über Polen nach Deutschland transportieren sollte. In Sibirien war es kalt, der Schnee lag hoch und brasilianische Schönheiten waren eher die Ausnahme. Da mein Vater mental auf diese programmiert war, fiel ihm lange Zeit nicht auf, dass die russische Dolmetscherin Olga, die neben akzentfreiem Deutsch perfekt Englisch und Französisch sprach, unter ihrem dicken Pelzmantel absolut entzückend aussah.
Mein Vater beherrschte außer schlechtem Hochdeutsch keine Fremdsprachen, und so musste er die Dienste von Olga ziemlich oft in Anspruch nehmen. Olga ahnte, dass sich tief im Innern dieses hünenhaften, knurrigen Wesens, das seine Gefühlsregungen unter einem dichten Bart versteckte und den fast zugewachsenen Mund nur im Notfall aufbrachte, ein guter Kern verbergen musste, aber mein Vater tat alles, um diesen Kern möglichst geheim zu halten, so dass Olga kurz davor war, ihn samt Pipeline entnervt auf den Mond zu schießen.
Irgendwann half sie mit russischem Wodka nach Dienstschluss nach, und endlich kam es, wie es kommen musste in den bitterkalten sibirischen Nächten. Mein Vater hatte sich bis dahin vermutlich als trinkfest bezeichnet. Er trank zu Hause regelmäßig sein Feierabend-Dinkelacker, ein paar Viertele in geselliger Runde und nach dem Sonntagsbraten bei Muttern selbst gebrannten Zwetschgenschnaps. Am Morgen nach der Wodkaorgie schloss er allein aus der Tatsache, dass sein großer Schädel brummte und eine sanft schlummernde, ziemlich pelzmantellose Olga neben ihm auf den Kissen lag, dass irgendetwas passiert sein musste. Erinnern konnte er sich an nichts.
Passiert war in der Tat etwas. Ich wurde neun Monate später geboren, noch ehe die Pipeline in Betrieb genommen worden war. Es passierte jedoch noch mehr. Der Tag, den mein Vater übel gelaunt mit einem Brummschädel begonnen hatte, sollte ein Katastrophentag werden, der in die Geschichte des Pipeline-Baus einging. Ein Lastwagen, der dringend benötigte Teile geladen hatte, blieb im Schneesturm stecken, im Tanklager flog ein Tank in die Luft, und eine der Spezialmaschinen, die den Graben aushoben, in den die Pipeline verlegt werden sollte, rutschte einen Hang hinunter. Die Maschine erlitt einen Totalschaden. Wie durch ein Wunder wurde niemand bei diesen Vorfällen verletzt.
Mein Vater bemühte sich mit sehr viel Feingefühl, die schlechte Stimmung zu heben, indem er jeden zusammenbrüllte, der ihm vor die Nase kam. Als die komplette Mannschaft abends erschöpft zum Essenfassen in der Baracke antrat, hatte die Köchin, deren fabelhafte Kochkünste bis dahin die Moral der Truppe immer wieder aufgerichtet hatte, den Eintopf so versalzen, dass er ungenießbar war.
Es sollte Jahre dauern, bis es meiner Mutter dämmerte, dass zwischen meiner Zeugung und dem Katastrophentag ein Zusammenhang bestand.
Die Kälte setzte meinen gedanklichen Ausflügen in die Vergangenheit ein Ende. Mein Schlafzimmer verfügte zwar über eine großartige Aussicht über den Stuttgarter Westen bis hinunter ins Zentrum und an guten Tagen bis fast nach Heilbronn, aber nicht über eine Heizung. Die hätte ich an diesem bitterkalten Februartag gut gebrauchen können.
Ich überlegte, ob ich den Tag mit fünf Runden »Gruß an die Sonne« aus dem VHS-Yogakurs beginnen sollte, um warm zu werden. Bei meinem letzten Versuch hatte ich mir dabei einen steifen Hals geholt, also stellte ich mich stattdessen unter die heiße Dusche und drehte das Wasser am Ende auf kalt, aber erst, nachdem ich reichlich Abstand vom Duschstrahl hatte. Dann joggte ich meine fünf Stockwerke hinunter, um mir beim Bäcker um die Ecke ein Laugen zu holen. Wie üblich musste ich mich zwischen den Autos durchschlängeln, die auf dem Gehweg geparkt waren. Im dichtestbesiedelten Stadtteil Deutschlands gab es zu viele Menschen mit zu vielen Autos, und die Menschen hatten keine Lust, eine Tiefgarage zu bezahlen. Man hatte hier deshalb besser keine Kinder. Mit einem Kinderwagen wurde der zugeparkte Gehweg zum Hindernisparcours. Trotzdem wollte jeder im Westen wohnen, inmitten der kleinen Galerien, kreativen Künstler, Bioläden und Szene-Kneipen. Ich hatte richtig Glück, als ich die unrenovierte Wohnung mit verseuchtem Linoleum in der Reinsburgstraße bekam. Die Miete war günstig, weil vermutlich nicht allzu viele Leute mit einem Gas-Einzelofen im Wohnzimmer und keinem Gas-Einzelofen im Schlafzimmer im fünften Stock ohne Aufzug wohnen wollten. Der Vorteil war, dass man den Durchgangsverkehr, der vor allem aus Lkws und Bussen bestand, nicht ganz so laut hörte, und die Abgase schafften es maximal bis zum vierten Stock, da war ich ganz sicher.
Auf dem Rückweg kletterte ich so leise ich konnte die Treppenstufen hinauf. Ich hatte keine Lust, mich den neugierigen Fragen von Herrn Tellerle zu stellen. Er war eine furchtbare Klatschbase, frühpensioniert, folglich immer zu Hause, und er hatte definitiv den schwarzen Kehrwochen-Gürtel.1 Ich nicht, was manchmal zu unüberbrückbaren Differenzen führte. Als ich den dritten Stock erreicht hatte, wurde die Tür aufgerissen. Vor mir stand Herr Tellerle in einer ausgebeulten Cordhose, die von Hosenträgern gehalten wurde. Das farblich an Loriot erinnernde Hemd (graugrünbraun) hatte es nicht ganz in die Hose geschafft. »Grieß Gott, Frau Praetorius. Hen Sie heit frei?«
Ich zögerte. Spätestens nach vierzehn Tagen würde es seltsam erscheinen, dass ich immer noch Urlaub hatte. Wenn meine Vermieterin andererseits spitzkriegte, dass ich arbeitslos war, würde sie mir sofort wegen Eigenbedarfs kündigen. Ich lächelte Herrn Tellerle, wie ich hoffte, entwaffnend an.
»Ich habe mich selbstständig gemacht und arbeite von zu Hause aus«, sagte ich. »Im Zeitalter von Internet – kennen Sie Internet? – ist das ja alles kein Problem mehr. Und jetzt teile ich mir die Zeit selber ein, das ist sehr angenehm.«
Herr Tellerle nickte wohlwollend: »Dann sen Se ja jetzt mee drhoim. Däded Sie wohl mei Aquarium versorge? I gang nämlich in Urlaub nach Malorka.«
Ich starrte ihn entgeistert an: »Sie gehen in Urlaub? Nach Mallorca? Aber Sie gehen doch nie in Urlaub! Außerdem weiß ich nicht, wie man ein Aquarium pflegt.«
»S’isch ja net fir lang. Die Seniorengruppe der Hundesportfreunde Dägerloch macht a Ausfahrt. On des mit dene Fisch zeig i Ihne.«
Er winkte mich in sein karges Heim. Ich war noch nie in seiner Wohnung gewesen und wusste nicht, ob es jemals eine Frau Tellerle gegeben hatte. In dieser Wohnung fehlte jedoch ganz eindeutig eine weibliche Hand. Im Wohnzimmer stand nur ein alter Holztisch, vier stoffbezogene Stühle, ein abgenutztes Sofa und ein Fernseher. Neben dem Fernseher, gewissermaßen als Zweitfernseher, stand das Aquarium. Zwischen grün wallenden Schlingpflanzen zog ein gutes Dutzend Fische in verschiedenen Farben und Größen gemächlich seine Bahn. »Des isch dr Max«, sagte Herr Tellerle und deutete auf einen blasslila Schleierschwanz. »Und des dr Moritz.« Moritz war auch ein Schleierschwanz, allerdings in zartem Orange. »Des sen meine Liebling.« Danach hielt er mir in affenartiger Geschwindigkeit einen Vortrag über Futter und Filter und fuchtelte mit einer Dose Fischfutter vor meiner Nase herum.
»Ond wenn Se welled, dirfet Se sich auch gern amol a Weile vors Aquarium nahocke«, schloss Herr Tellerle und deutete auf das Sofa. »Des isch sehr beruhigend. Ond ihr jonge Leid hen ja oft so a Ooruh em Leib.«
»Äh ja, vielen Dank«, sagte ich. Mein Magen knurrte. Endlich drückte Herr Tellerle mir einen Türschlüssel in die Hand. Ich war entlassen und flüchtete in meine Wohnung.
Düster starrte ich einige Zeit später in meine Kaffeetasse. Was für eine großartige Entwicklung mein Leben genommen hatte. Letzte Woche hatte ich noch einen Job in einer Werbeagentur. Diese Woche würde mein Lebensinhalt darin bestehen, zwei Schleierschwänze namens Max und Moritz zu füttern, weil Herr Tellerle nach Malorka flog.
Ich hatte in Tübingen Germanistik studiert und danach nach langem Suchen eine unbezahlte Praktikantenstelle auf Bewährung bei der Werbeagentur Rolf & Heinz in Stuttgart-West bekommen. Auf Bewährung hieß, dass ich unter der Voraussetzung, ohne Urlaub Montag bis Sonntag zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, von der unbezahlten zur bezahlten Praktikantin, dann zur Volontärin und bei guter Führung zur Junior Texterin aufsteigen konnte. Ich überredete meine Eltern, mich weiter zu unterstützen, bis ich finanziell auf eigenen Beinen stand, und verzichtete auf den Hinweis, dass das ziemlich lange dauern konnte. Nach einem halben Jahr unbezahlten Praktikums, das ich hauptsächlich mit Kaffeekochen, Glastisch abputzen und Kunden empfangen verbracht hatte, stellte mich die Agentur als Volontärin ein und nach einem weiteren halben Jahr, im zarten Alter von neunundzwanzig, als Junior Texterin. Wenigstens bekam ich jetzt statt gar nichts einen Hungerlohn. Nach anderthalb Jahren als Junior Texterin wurde ich zur Senior Texterin befördert (man altert schnell in der Werbebranche), weil ich für eine Eieruhr-Werbung den Spruch »Mach es wie die Eieruhr, zähl die heit’ren Stunden nur« kreiert hatte. Die Werbung zeigte ein lächelndes Ei und war ein großartiger Erfolg.
Nach mir war ein Haufen neuer Leute eingestellt worden, weil es der Agentur hervorragend ging. Wir waren eine junge, aufstrebende Firma, die immer mehr Aufträge bekam, und entwickelten Werbekampagnen für junge, aufstrebende Firmen mit innovativen Produkten, aber natürlich nur für Firmen, die pc, politically correct, waren, weil unsere beiden Gründer und Chefs einen strengen Ehrenkodex hatten. Keine Zigaretten oder Rüstungsfirmen, nur fair gehandelte und garantiert nicht die Klimaerwärmung fördernde Produkte wie Eieruhren, Nordic-Walking-Stöcke oder Espresso-Maschinen mit Fußantrieb. Wir duzten uns alle und hatten wirklich Spaß zusammen, so dass wir gar nicht merkten, wie viel wir arbeiteten, und nach unseren Zwölf-Stunden-Schichten gingen wir immer noch in die Rosenau – das ist eine Kneipe im Westen – und tranken Prosecco oder Weizen. Meine Tante Dorle begann, sich Sorgen um mich zu machen. »Mädle, du schaffsch zviel. So fendsch nie an Maa!« Ich beruhigte sie. Es stimmte zwar, dass ich keine Freizeit hatte, aber weil es den anderen genauso ging, freundeten wir uns alle miteinander an und verstanden uns prima und feierten tolle Partys im Büro. Bloß, irgendwann fingen wir an herumzusitzen, weil die Aufträge wegbrachen. Und dann mussten die ersten Leute gehen. Den Chefs war das ziemlich peinlich, weil wir uns ja alle duzten und befreundet waren, aber was sollten sie machen. Weil ich schon verhältnismäßig lange da war, musste ich nicht gleich gehen, und außerdem hatte ich mit einem der Chefs mal auf einer After-Work-Party ziemlich wild herumgeknutscht. Aber irgendwann machte die Agentur ganz zu und die Leute verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Und das war’s dann. Und nun hatte ich von einem Tag auf den anderen plötzlich ganz, ganz viel Zeit.
Das Telefon riss mich aus meinen trüben Gedanken. Es war Dande Dorle.
»Mädle, i han dr bloß sage welle, dass i an de denk ond jeden Dag dr Herr Jesus drom bitt, dass du a neie Arbeit fendsch.«
Ich schluckte. »Das ist sehr lieb von dir, Tante Dorle.«
»Ond stell dr vor, dai ehemalige Schulkamerade Katrin kriegt Zwilling. Die hen jetzt baut, draußa em Neibaugebied.«
So ging es noch eine ganze Weile weiter, und ich hörte nur noch mit einem Ohr zu, was Dorle erzählte, nämlich dass der Obst- und Gartenbauverein beim bunten Abend den schwäbischen Schwank »Mai Schdickle ghert mir« aufführen würde, und sie, Dorle, die Rolle der unbeugsamen Kleingartenbesitzerin Rosemarie übernommen hatte. Sie kämpfte gegen einen korrupten Bauunternehmer, dargestellt von ihrem Schulkameraden Karle, der ein ganz Fieser war, weil er versuchte, den Gemeinderat zu bestechen, damit er der Umwandlung einer kompletten Schrebergartenkolonie in Bauerwartungsland zustimmte und so weiter und so fort, wie gesagt, ich hörte nur noch mit einem Ohr zu.
Ich wunderte mich zwar ein wenig, dass Dorle auf ihre alten Tage mit dem Theaterspielen begonnen hatte, sie war aber immer für eine Überraschung gut. »Ond ibrigens komm i bald amol zu dir zom Kaffee. Mai Gertrud hot a Schlägle2 ghett ond liegt em Kathrinehoschbidal. Die däd i en de nägschde Däg bsuche on no komm i glei bei dir vorbei.« Damit hatte sie sofort wieder meine ganze Aufmerksamkeit. Ich legte mit gemischten Gefühlen auf. Natürlich war es lieb von Dorle, an mich zu denken – meine Eltern hatten sich nicht gemeldet –, aber ein Besuch von Dorle hieß Aufräumen und Kuchen backen, nicht gerade meine großen Stärken. Und außerdem wusste jetzt auch der Herr Jesus, dass ich arbeitslos war.
Dorle war die Tante meines Vaters, also unsere Großtante, und sie wurde auch von Leuten, die nicht mit ihr verwandt waren, nur Dande Dorle genannt. Sie wohnte im Dorf eine Straße weiter in einem kleinen, mit wildem Wein bewachsenen Hutzelhäuschen, vor dem eine Bank stand, auf der sie an lauen Sommerabenden saß. Aber nur an Samstagen, denn unter der Woche musste sie ja schaffen.
Sie trug ihre Haare zu einem Knoten aufgesteckt und sah, seit ich denken konnte, aus wie hundert Jahre alt. Ihr rundlicher Körper steckte meistens in einer Kittelschürze. Dande Dorle war weich und roch immer nach Essen – nach frisch gebackenem Hefekranz oder Zwetschgenkuchen oder handgeschabten Spätzle. Meine Schwester Katharina und ich verbrachten als Kinder sehr viel Zeit bei ihr. Sie legte ihre fleischigen Arme um uns, wenn wir bei ihr auf der Bank saßen, sie gab uns feuchte Küsse und drückte uns an ihren riesigen Busen, sie machte uns Flädlesuppe und sang mit uns Lieder aus dem Gesangbuch, denn Dande Dorle war sehr chrischdlich. Wir durften ihr zusehen, wie sie abends die Nadeln aus dem Knoten zog und das lange weiße Haar bürstete, das ihr in schweren Wellen auf die Schultern fiel. Aber das Beste an Dande Dorle war ihr Käsekuchen, der leckerste Käsekuchen der Welt, den sie nach einem Rezept backte, das sie niemandem verriet, und das Bild ihres Verlobten. Es stand in ihrem karg eingerichteten, immer viel zu kalten Schlafzimmer auf dem Nachttisch und zeigte einen jungen, schnauzbärtigen Mann in Uniform, der nicht lächelte. Gottfried war aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekehrt. Streng genommen war Dorle also ein ewiger Single, weil sie nie mehr einen anderen Mann angeschaut hatte, aber damit durfte man ihr nicht kommen. Sie selbst bezeichnete sich als Witwe und trug Zeit ihres Lebens schwarz. Katharina und ich liebten es, ehrfurchtsvoll vor dem vergilbten Bild zu stehen. Ach, es war so entsetzlich traurig.
Bevor sie uns abends nach Hause schickte, mussten wir die Hände falten und sie befahl uns und unser Seelenheil dem Herrn Jesus an. Sie beschwor den Herrn Jesus auch, dass sich unsere Eltern mehr um uns kümmern sollten. Mir war es ziemlich peinlich, dass Dorle dem Herrn Jesus so genau sagte, wie es bei uns zu Hause zuging.
Nach Abschluss des Projekts in Sibirien war Olga zu meinem Vater in sein kleines, unbesiegbares Dorf gezogen. Unbesiegbar deshalb, weil es sich hartnäckig und erfolgreich gegen die Eingemeindung durch die mächtige benachbarte Metropole gewehrt hatte. Die Ankunft einer fragilen, dunkelhaarigen Schönheit, die nicht einmal evangelisch war, wirbelte mächtig Staub auf, vor allem in der pietistischen Mafia, die die Einhaltung der Moral im Ort kontrollierte. Noch viel schlimmer als die Tatsache, dass das Hermännle keine Frau aus dem Ort genommen hatte, war natürlich, dass ich schon auf der Welt und er noch nicht verheiratet war. Meine Eltern heirateten evangelisch und ließen mich gleichzeitig taufen, weil meiner Mutter ihre orthodoxe Religion vollkommen egal war und die pietistische Familie sonst meinen Vater verstoßen hätte.
Meine Mutter war nicht dumm. Sie kapierte ziemlich schnell, was in einem Dorf, in dem man Rei’gschmeckten erst in der vierten Generation zutraute, den Hefekranz sachgerecht einzutunken, von einer angeheirateten Russin erwartet wurde. Um akzeptiert zu werden, musste sie sich anstrengen. Mehr noch als eine Einheimische, weil man ihr besonders auf die Finger schaute. Sie musste nachmittags im Garten schaffen und Tomaten setzen, eigene Äpfel ernten und daraus Apfelkompott kochen, die Wäsche draußen aufhängen, am Samstag den Gehsteig kehren und kurz darauf hatte gefälligst der Duft von frisch gebackenem Sonntagskuchen aus dem Küchenfenster zu wehen. Wenn eine Nachbarin aus dem Fenster sah, während sie in ihrer Kittelschürze Unkraut jätete, hatte sie sich stöhnend aufzurichten, die Hand in die Seite zu stemmen, über die viele Hausarbeit und den faulen Ehemann zu klagen und ein ausführliches Schwätzchen zu halten. Und selbstverständlich hatte sie sonntags pünktlich, ordentlich gekleidet und demütig an der Seite ihres Gatten im Gottesdienst zu erscheinen, idealerweise das wundervolle braune Haar zu einem züchtigen Dutt aufgesteckt. Zusätzliche Bonuspunkte gab es für den Beitritt zum Frauenkreis oder Kirchenchor und für akzentfreies Schwäbisch.
All diese Dinge musste sie tun. Oder besser gesagt: Sie hätte sie tun müssen. Olga überlegte eine Weile, betrachtete ihre gepflegten Fingernägel und die durchscheinende, alabasterfarbene Haut ihrer Arme und traf dann eine folgenschwere Entscheidung. Es war ihr vollkommen egal, was das Dorf, Hermännle, ihre Schwiegereltern, Dande Dorle oder ihre Kinder über sie dachten. Von Stund’ an lebte sie frei nach der Devise, dass ihr ein ruinierter Ruf an der Seite eines gut verdienenden Ingenieurs ein entspanntes Leben verschaffte. Schließlich hatte sie nicht in den Westen geheiratet, um weiterhin zu schuften.
Stattdessen lag sie bei gutem Wetter unter einem Sonnenschirm im Liegestuhl, bei schlechtem Wetter oder kühler Witterung auf dem Sofa im Wohnzimmer und las Tolstoi oder Dostojewski. Während anderen Kindern im Vorschulalter Der Kleine Wassermann oder Pippi Langstrumpf vorgelesen wurde, wuchsen wir mit Krieg und Frieden auf, natürlich im russischen Original, und fanden es wunderbar. Später, als wir selber lesen konnten, verschwand Olga ganz allmählich immer mehr aus unserem Alltag. Sie vertauschte das Sofa im Wohnzimmer mit einem Sofa in einem weitgehend unbenutzten kleinen Zimmer im ersten Stock, das wir weiterhin Bügelzimmer nannten, obwohl meine Mutter nie bügelte. Das Zimmer wurde zu ihrem Refugium, in dem sie den Großteil ihres Lebens verbringen sollte. Sie richtete sich das Zimmer gemütlich ein, kaufte bunte Kissen, stapelte Bücher bis unter die Decke, ließ sich von Vater einen Plattenspieler und sämtliche Aufnahmen von Maria Callas schenken und verbrachte dort den Tag. Wenn wir sie sehen wollten, mussten wir anklopfen und sie im Bügelzimmer besuchen. Sie kochte auch nicht und kam nur selten zu den Mahlzeiten herunter. Wenn wir sie fragten, wovon sie sich eigentlich ernährte, zuckte sie nur die Schultern und lächelte.
Katharina und ich gewöhnten uns daran, Schulprobleme, Freundinnenzoff und Liebeskummer miteinander zu teilen, das Haus vor der absoluten Verwahrlosung zu bewahren und uns mittags nach der Schule etwas zu essen zu machen. Wobei man gerechterweise sagen muss: Es war vor allem Katharina, die sich um den Haushalt kümmerte, auch wenn sie eineinhalb Jahre jünger war als ich. Das Katastrophen-Gen, mein kleiner genetischer Defekt, ließ Staubsauger explodieren, Rasenmäher letzte Seufzer von sich geben und Waschmaschinenschläuche platzen. Unschuldig aussehende Lebensmittel, die ich zum Kochen oder Backen verwendete, kochten über, wurden nicht gar oder brannten an, während sie sich unter Katharinas Händen in duftende Speisen verwandelten. Nachdem uns meine Mutter die Sache mit dem Katastrophen-Gen erklärt hatte, machte Katharina den Haushalt und ich leistete ihr dabei Gesellschaft. Die gleichen Geräte, die bei mir explodierten, verhielten sich bei ihr vollkommen friedlich.
Trotz ihrer Absonderlichkeiten liebten wir unsere Mutter abgöttisch. Sie war schließlich tausendmal besser als die schwäbischen Supermütter unser Schulkameraden, die einem samstags Kutterschaufel und Kehrwisch in die Hand drückten. Sie war immer verfügbar, auch wenn sie meistens leicht abwesend wirkte, wenn wir ihr etwas erzählten, und sie brachte uns bei, wie wichtig es war, den schönen Dingen im Leben einen Platz einzuräumen:
»Wenn ihr euch verliebt, achtet darauf, dass der Mann eine Ader hat für Bücher und Musik. Wenn nicht, vergesst ihn sofort.«
Bevor Olga sich im Bügelzimmer eingerichtet hatte, war sie mit uns Kindern ab und zu mit der Straßenbahn nach Stuttgart gefahren, um in die Oper zu gehen. Wir liebten die festlichwürdevolle Atmosphäre, die Kristallleuchter, das Orchester im Bühnengraben und die Dramen, die sich auf der Bühne abspielten, auch wenn wir nicht verstanden, warum dort ziemlich viele Menschen sterben mussten, nachdem sie den nahenden Tod in endlosen Arien angekündigt hatten.
Das mit den Büchern und der Musik war die einzige Lebensweisheit, die uns Olga mit auf den Weg gab, und fast schien es so, als wollte sie uns durch die Blume sagen, dass sie mit meinem Vater die falsche Wahl getroffen hatte.
Unser Vater liebte Olga, war aber hoffnungslos überfordert von ihrer Leidenschaft für die Literatur und die Oper, weil er von beidem nichts verstand. Nach der Rückkehr aus Russland war er zu Bosch in die Forschung gegangen, und seltsamerweise schienen die Arbeitstage dort immer länger zu werden, je älter er wurde. Wenn er nach Hause kam, verschwand er ziemlich schnell wieder im Garten, weil einer ja das Gemüse anbauen musste, oder werkelte irgendwo am Haus herum. Ab und zu wurde er von Dorle herbeizitiert, die unsere Familienverhältnisse dann doch nicht ganz allein dem Herrn Jesus überlassen wollte. Sie war sonst immer die Ruhe und Liebenswürdigkeit in Person, aber in diesen Momenten fing sie laut an zu zetern. Mein Vater, so warf sie ihm vor, würde zu viel arbeiten, wir Kinder bekämen kein vernünftiges Essen und keine geistige Nahrung, so dass er sich nicht wundern müsste, wenn wir anstelle des schmalen, steilen Pfads zum Himmelreich den breiten, bequemen Weg zur Hölle wählen würden, und Olga ...
Wir versteckten uns unter dem Fenster, um den Attacken zu lauschen. Ein, zwei Wochen lang kam Vater dann früher nach Hause, wollte unsere Hausaufgaben sehen und wissen, wie es uns in der Schule ergangen war, und wechselte sogar ab und zu mal wieder ein paar Worte mit Olga. Dann war alles wieder wie vorher.
Ich seufzte. Olgas Lebensweisheiten hatten bisher nicht so richtig gefruchtet. Ich war einunddreißig, arbeitslos und ohne Mann, der Bücher und Opern liebte. Im Studium war ich ein paar Jahre mit Daniel zusammengewesen. Daniel war auch Germanist. Wir träumten von einer gemeinsamen Zukunft bei der Zeit oder beim Goethe-Institut. Eines Tages überraschte ich Daniel spärlich bekleidet in der Bibliothek bei den Mittelhochdeutsch-Regalen, zusammen mit der jungen neuen Professorin, die gerade einen Assistenten suchte. Daniel bekam den Job.
Nun reichte es aber. Für heute hatte ich genug über der Vergangenheit gebrütet. Ich schickte eine SMS an Lila: »Brauche moralische Unterstützung, kommst du heute Abend bei mir vorbei?« Lila war meine beste Freundin und arbeitete als Sozpäd in einer Wohngruppe mit schwer erziehbaren Jugendlichen im Raitelsberg. Wenig später kam die Antwort: »OK, bringe Prosecco mit.«
Ich verbrachte den restlichen Tag damit, meinen Herd zu putzen. Das war schon längst mal fällig. Eigentlich hätte das nicht den ganzen Tag gedauert, aber ich stieß mit dem Ellenbogen die Scheuermilch um, die sich daraufhin großzügig über den Herd ergoss, so dass ich ziemlich viel Zeit benötigte, um die getrocknete Scheuermilch aus den Herdecken zu kratzen. Natürlich hätte ich Bewerbungen schreiben müssen, aber ich war zu deprimiert und hatte noch nicht einmal ein vernünftiges Bewerbungsfoto. Ich wollte mich am nächsten Tag darum kümmern. Oder ich würde Katharina um ein Foto bitten, um meine Chancen für ein Bewerbungsgespräch zu erhöhen. Die Natur hatte über meine Schwester ihr Füllhorn ausgeschüttet. Sie war eine Schönheit, genauso zerbrechlich und zart wie unsere Mutter, mit dem gleichen langen, dunklen, dichten Haar. Mein Haar war zwar auch dunkel, aber ziemlich struppig, so dass ich es immer kurz trug. Dank der grandiosen Erfindung des Wonderbras konnte ich zwar meinen Busen von 70A auf 75C hochrüsten, aber ich war viel zu dünn, obwohl ich mich redlich um eine ausgewogene Ernährung bemühte, indem ich regelmäßig Tiefkühlpizza, Pommes und Lkw3 auf den Speiseplan setzte. Ich war schon immer knochig gewesen. Leider hatte ich von meiner Mutter nur die wunderbaren braunen Augen geerbt. Mein Vater hatte sein handwerkliches Talent und seine imposante Körpergröße ebenfalls für sich behalten.
Kurz vor acht klingelte es und Lila schnaufte meine fünf Stockwerke hinauf. Als ich die Tür öffnete, sah ich, dass vor der Nachbarwohnung Umzugskisten standen. Die Wohnung hatte längere Zeit leer gestanden, worüber ich nicht besonders traurig war. Nicht jeder teilte meine in regelmäßigen Abständen hervorbrechende Leidenschaft für ziemlich heftige Rockmusik und Opernarien, die die Wände erzittern ließen. Ich war wirklich nicht besonders scharf auf neue Nachbarn.
»Junge, Junge, daran werde ich mich nie gewöhnen.« Was an mir zu eckig war, war an Lila zu rund. Eigentlich hieß sie Juliane, doch in der Zeit, als alle Welt Lila Pausen futterte, hatte sie einen Freund, der immer zu ihr sagte: »Du bist so süß wie eine Lila Pause Krokant!« Juliane liebte Schokolade, hasste Krokant, aber Lila gefiel ihr, auch weil sie ziemlich feministisch ist, und so hatte sie den Namen behalten, obwohl der Typ sie irgendwann mit Sandra betrog, mit der er jetzt zwei Kinder hatte und in Korntal in einer Reihenhaussiedlung wohnte. Lila war Mitglied bei Amnesty, Terre des Femmes, Verdi, der Büchergilde, Trottoir und SFsDoKo4. Sie war auch Single. Offensichtlich ließen sich die Männer von ihrem Körperumfang abschrecken. Dabei war Lila lustig, herzensgut und intelligent. Ihr einziger Fehler war, zwanzig bis dreißig Jahre zu spät geboren worden zu sein. Sie hätte besser in die Sechziger oder Siebziger gepasst.
Wir saßen auf meinem durchgesessenen Sofa und futterten Chips.
»Katrin kriegt Zwillinge und zieht in ihr eigenes Haus«, sagte ich und konnte nicht vermeiden, dass meine Stimme weinerlich klang.
»Katrin, wer um Himmels Willen ist Katrin?« Lila schüttelte verwirrt den Kopf. »Und warum habe ich das Gefühl, dass du gleich anfängst zu heulen?«
»Ich heule nicht«, schniefte ich, »ich wär nur so gern normal! So wie Katrin! In der Schule war sie immer die Beste! Sie hatte unglaubliche Pläne! Und dann hat sie diesen Zahnarzt geheiratet und arbeitet jetzt in seiner Praxis als Sprechstundenhilfe!«
»Moment«, sagte Lila. Sie rannte in die Küche und kam mit dem Prosecco und zwei Gläsern zurück. Sie schenkte so schwungvoll ein, dass der Prosecco auf den Teppich schwappte, stieß mit mir an und nahm einen tiefen Schluck. Ich auch. Danach ging es mir besser.
»Du findest es also beneidenswert, dass deine hochintelligente Schulfreundin Katrin als Sprechstundenhilfe Karriere gemacht hat?« Sie schüttelte ungläubig den Kopf.
»Ja! Weil sie natürlich als Frau des Chefs alle anderen Sprechstundenhilfen tyrannisieren kann, wie es ihr passt! Und weil sie jetzt Zwillinge kriegt! Ich werde nie Zwillinge kriegen und in einer Neubausiedlung wohnen!«
Lila schüttelte wieder den Kopf. »Line, hast du heimlich mit Eva Herman telefoniert? Willst du jetzt die Mutter der Nation werden? Du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass du dich plötzlich nach einem Spießerleben mit Vorgärtchen sehnst! Seit Jahren muss ich mir anhören, dass du dich nie entscheiden konntest, was du lieber werden wolltest: Entwicklungshelferin in der Wüste Namib oder Reporterin beim New Yorker, mit dazugehörigem Loft in Greenwich Village, auf dessen Feuertreppe du dann nach Feierabend Moon River gesungen hättest!«
Meine Tränen flossen jetzt richtig. »Schau mich doch an«, flüsterte ich. »Ich bin 31 und habe weder einen Job noch einen Mann. Ich bin ein Versaaaager!«
»Wenn schon, dann eine Versagerin. Trink aus!« Lila schenkte mir sofort nach. Eigentlich war ich nicht der Meinung, dass man Probleme mit Alkohol lösen konnte. Aber heute Abend machte ich eine Ausnahme.
»Also, Line, dann gehen wir das Ganze mal analytisch an. Wie würdest du denn gerne leben?«
Ich schluckte und schloss die Augen. »Vielleicht so: Ich wohne in Stuttgart, hab einen tollen, erfolgreichen Mann, den ich von der Schule kenne und der beim Daimler schafft. Samstags trägt er den Müll raus, wir haben ein eigenes Häuschen mit Vorgarten in Sillenbuch, einen Zweitwagen und zwei entzückende hochbegabte Kinder, ein Mädchen und einen Jungen namens Lisa und Paul, die auf die deutsch-französische Grundschule gehen. In den Sommerferien fahren wir nach Rimini in ein Eurocamp. Ich bin Elternbeirätin und alle zwei Wochen verkaufe ich samstags auf dem Wochenmarkt ehrenamtlich fair gehandelte Produkte aus dem Eine-Welt-Laden. Meine Nachbarinnen grüßen mich und der Metzger spricht mich mit Namen an, alle drei Wochen stell ich die gelben Säcke auf die Straße, bald sind die Kinder aus dem Gröbsten raus und dann steige ich halbtags wieder in meinen Beruf als Fremdsprachensekretärin ein.«
Ich öffnete die Augen wieder. In Lilas Gesicht stand blankes Entsetzen. »Ein Horrorfilm«, flüsterte sie. »Du hast gerade die Eröffnungssequenz von Kettensägenmassaker in Sillenbuch, Teil 1 beschrieben.«
»Wieso denn?«, fragte ich beleidigt.
»Wieso denn?«, rief Lila wütend. »Wieso denn, fragt sie! Weil dein Mann, den du von der Schule kennst, abends keine Überstunden macht, sondern seine Sekretärin vögelt, du vor lauter Langeweile eine Depression bekommen hast und psychopharmaka-abhängig geworden bist, und es dauert nicht mehr lange, bis Paul mit 16 nachts in Sillenbuch einen Inder krankenhausreif schlägt, während Lisa mit 17 ungewollt schwanger wird! Deshalb!«
Ganz offensichtlich würden sich Lila und ich heute Abend nicht einigen, was den optimalen Lebensstil betraf. Zumindest nicht vor der zweiten Flasche Prosecco. Nach der zweiten Flasche hatten wir uns meinungsmäßig schon deutlich angenähert und fanden, dass die größte Misere der Frauen in der Bundesrepublik Deutschland darin bestand, dass die Vielmännerei verboten war. Man hätte sich sonst einen kleinen Harem aus Dienstleistungsberufen halten können, bestehend aus einem Handwerker, einem Zahnarzt, einem Juristen, einem Friseur, einem Finanzberater, einem Fußreflexzonenmasseur und einem Sexgott.
Lila verabschiedete sich mit einem Arbeitsauftrag, bevor sie ihren schwankenden Abstieg durchs Treppenhaus begann. Ich sollte mir zehn Punkte aufschreiben, die ein Single-Leben attraktiv und beneidenswert machten, und ich sollte sie mir selbst per Post schicken. Lila war immer sehr fürs Therapeutische.
1 Kehrwoche, die: Vor allem in Süddeutschland anzutreffende Sitte, deren Ursprung auf den mittelalterlichen Frondienst zurückgeht. Der Lehnsherr (Vermieter/Hausverwalter) zwingt hierbei seine Tagelöhner (Mieter), beim kleinen Frondienst (Treppe) oder großen Frondienst (Hof, Gehweg) meist nicht vorhandenen Schmutz zu entfernen. Dieser Sitte wird häufig durch nachbarschaftliche Spione, Bluthunde oder Mieterhöhungen Nachdruck verliehen.
2 Schwäbischer Euphemismus für Schlaganfall
3 Leberkäswecken
4 Single-Frauen spielen Doppelkopf
2. Kapitel | Dienstag
Goodbye, Ruby Tuesday
Am nächsten Morgen wachte ich später als gewohnt auf. Es war nicht gerade die Edelmarke Prosecco gewesen und ganz Stuttgart, vor allem mein Schlafzimmer, schien unter einer Nebelschwade zu liegen. Ich fand das seltsam, so mitten im Februar. Nach einer kalten Dusche und drei Tassen Kaffee lichtete sich der Nebel immerhin so weit, dass mir wieder einfiel, dass ich ab heute im Hauptberuf Tierpflegerin war. Ich holte mir mein Laugenbrötchen und schaute auf dem Rückweg beim Aquarium vorbei. Ich konnte mich nicht mehr so genau daran erinnern, wann und wie viel ich füttern musste, wollte mir aber auf keinen Fall nachsagen lassen, die Fische hätten Hunger gelitten, und kippte eine ordentliche Portion des stinkenden Zeugs in das Aquarium. Max und Moritz und ihre Kumpels kamen herbeigeschossen und ließen es sich schmecken. Sicher hielt Herr Tellerle sie kurz. Ich nahm mir vor, Herrn Tellerle bei seiner Rückkehr mit glänzend aussehenden, wohl genährten Fischen zu überraschen.
Eigentlich standen Bewerbungsfotos auf dem Programm. Um jedoch meine Moral zu heben, legte ich zunächst eine Liste von zehn Punkten an, die das Single-Leben beneidenswert machten, ganz so, wie es Lila vorgeschlagen hatte. Es dauerte eine ganze Weile, aber anschließend war ich hochzufrieden mit dem Ergebnis:
Zehn Punkte, die ein Single-Leben in einer schlecht heizbaren Mietwohnung im fünften Stock im übervölkerten, verpesteten und durchgehend asphaltierten Stuttgart-West weitaus attraktiver machen als das Leben mit Mann und zwei Kindern im eigenen Häuschen im immergrünen Stuttgart-Sillenbuch:
1. Ein Single kann am Wochenende immer ausschlafen, weil morgens um halb sechs kein dreijähriges Kind ins Bett krabbelt, das seine Füße vorher eine halbe Stunde lang in die Tiefkühltruhe gesteckt hat und Mami in voller Lautstärke seine neue Benjamin-Blümchen-Kassette vorspielen will, die ihm die liebe Omi geschenkt hat, die leider in Wanne-Eickel wohnt und deshalb nie in den gleichen Genuss kommt.
2. Ein Single muss sich nicht mit der Frage auseinander setzen, wie man in einem Land, in dem Kinderhandel verboten ist, ein Kind wieder los wird, wenn man feststellt, dass es ohne doch schöner war.
3. Ein Single kann sonntagmorgens immer auf Vernissagen gehen. (Äh, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Vernissage).
4. Als Single kann man in Ruhe telefonieren und sagt abwechslungsreichere Sätze als »Nicht jetzt, Nepomukschatz, Mami telefoniert jetzt« oder Variante 1: »Nein, die Mami hat gesagt, sie will jetzt fünf Minuten in Ruhe telefonieren« oder Variante 2, »Nepomuk, wir haben aber vorher ausgemacht, dass du mich in Ruhe telefonieren lässt.«
5. Als Single hat man ganz viel Geld und kann übers Wochenende zum Christmas-Shopping nach New York hoppen und sich im Winter auf den Fidschi-Inseln am Strand aalen, während einem gutgebaute schwarze Jungs All-Inclusive-Daiquiris einflößen. Man schlägt sich vor Vergnügen auf die Schenkel, wenn man an Familien denkt, die sich stattdessen in einem völlig überfüllten Eurocamp mit den Zeltnachbarn aus Sindelfingen-Ost zum Grillen treffen, mit ihren Zweijährigen am Strand von Cala Millor Sandkuchen backen und in Windeln und Lebensversicherungen investieren. (Na ja, vielleicht stimmt das doch nicht so ganz, schließlich würde ich in exakt 364 Tagen in den Hartz-IV-Zustand übergehen, und das Arbeitsamt sieht es sicher nicht so gern, wenn man von 347 Euro im Monat nach Hawaii fliegt.)
6. Als Single hat man nicht ständig nörgelnde Kids am Essenstisch, die statt der vollwertigen Tofutaler lieber Würstchen mit Kartoffelsalat, Hamburger oder Pommes essen wollen, sondern kocht stattdessen raffinierte Rezepte aus der Brigitte oder lädt seine Freunde zu Ristretto di faraona con cappelletti all’ortica (Perlhuhnconsommé mit Brennnessel-Cappelletti) ein. Am geschmackvoll gedeckten Tisch unterhält man sich über sein neues Cabrio und wechselt dann zu Kaffee, Likör und Havanna-Zigarren ins Kaminzimmer. (Wenn ich mir’s aber genau überlege, esse ich schrecklich gern Würstchen mit Kartoffelsalat und kann sowieso nicht kochen.)
7. Als Single kann man die Tür offen lassen, wenn man aufs Klo geht. Auch wenn man sie zumacht, läuft man nicht Gefahr, dass ein Mitbewohner, der weniger als 100 Zentimeter misst, gegen die Tür bollert und schreit: »Mama, i muss ganz dringend a Rolle mache.«5
8. Als Single muss man sich nicht ständig Sorgen machen, ob die zweieinhalbjährige Cosima nicht ein paar anständige chinesische Schriftzeichen lernen sollte, damit sie mit drei die anderen Mütter und die Erzieherin im Kindergarten beeindrucken kann, anstatt ihre Zeit im Sandkasten zu verplempern.
9. Als Single kann man jeden Mann ohne/mit feste/r Beziehung in Stuttgart haben. Einfach jeden. Ein Riesensupersonderangebot in Supermärkten, U-Bahnen, Kinos und Kneipen, bei Vernissagen, im Leuze und bei Langen Kulturnächten. Eine riesige Auswahl. Und nicht nur in Stuttgart, sondern in Zeiten der Globalisierung und weltumspannenden Internetromanzen in der ganzen Welt! Also sozusagen alle Männer der Erde! (Warum hat Bob Geldof eigentlich noch nicht an ein Single-Aid-Konzert gedacht?)
10. Als weiblicher Single kann man sich hemmungslos seiner Karriere widmen, anstatt die Bundesrepublik durch das Gebären von mindestens vier gesunden, idealerweise männlichen Nachkommen vor dem demographischen Kollaps zu bewahren. Links und rechts mäht man rücksichtslos die männlichen Konkurrenten nieder und heimst selber die neue Abteilungsleiterstelle ein. (Vorausgesetzt, man hat Kollegen, natürlich, und arbeitet nicht als freiberufliche Fischpflegerin.)
11. Als Single wird man von allen Nicht-Single-Freundinnen und Familienangehörigen beneidet: »Mensch, so gut wie du möchte ich es auch haben. Bei dir klettert nicht morgens um sechs ein dreijähriges Kind ...« (vgl. Punkt 1–10)
Ach, jetzt waren es sogar elf Punkte geworden und ich fühlte mich großartig. Ich schrieb die Liste nochmal sorgfältig von Hand ab, steckte sie in einen Briefumschlag und adressierte sie an mich. Ich war sehr stolz auf mich.
Eigentlich war es jetzt langsam Zeit, sich um Bewerbungen zu kümmern, aber als ich auf die Uhr sah, war es schon elf und mein Magen knurrte. Zeit für einen kleinen Zwischenimbiss. Laugenweckle waren zwar lecker, hielten aber nicht lang vor. Ich machte mir ein Salamibrot und biss gerade hinein, als das Telefon klingelte. Ich beschloss, es klingeln zu lassen, denn entweder war es Dorle oder das Arbeitsamt, und für beide hatte ich noch nicht die Nerven. Der AB übernahm den Job. »Hallo Line, hier ist Lila. Ich weiß, dass du da bist. Anstatt Salamibrot zu essen, solltest du dich um deine Bewerbungen kümmern. Also los, beweg deinen Arsch und lass endlich Fotos machen. Und zwar ordentliche, keine Automatenfotos!«
Das Salamibrot blieb mir im Hals stecken und ich fing an zu husten. Ich wählte Lilas Handynummer.
»Verdammt, Lila, du bist mir richtig unheimlich. Woher weißt du, dass ich Salamibrot esse? Hast du irgendwelche paramäßigen Fähigkeiten?«
»Line, für dich brauche ich keine Parapsychologie. Außerdem habe ich eine Videokamera bei dir installiert. Was ist, gehst du jetzt Fotos machen?«
Ich versprach es ihr hoch und heilig. Kaum war das Gespräch beendet, sprang ich auf, um die Wohnzimmerdecke abzusuchen. Lila hatte doch nicht im Ernst ...? Das Telefon klingelte wieder und der AB sprang an. »Line, du musst die Wohnung nicht nach einer Kamera durchsuchen. Das war ein Witz.«
Ich schlurfte zu meinem Kleiderschrank. Konzentration. Bewerbungen. Fotos. Den Eindruck vermitteln: Hier ist eine kompetente Frau. Ausgesprochen gut aussehend mit einem IQ wie Jodie Foster. Schmeißt jeden Job mit links. Macht freiwillig zwei- bis dreihundert unbezahlte Überstunden die Woche. Ist aber nicht zu intelligent und gefährdet meine Chefposition nicht. Wehrt sich nicht, wenn ich ihre originellen und noch nie da gewesenen Ideen als meine verkaufe. O Gott.
In meinem Kleiderschrank befanden sich Jeans, T-Shirts, Sweat-Shirts und mein Konfirmationsanzug. Die Werbebranche ist modemäßig nicht besonders anspruchsvoll. Da blieb nur das Konfirmationsblüschen. Es war ein bisschen kurz an den Ärmeln, aber das sah man ja auf dem Foto nicht. Dazu legte ich Dorles Konfirmationsgeschenk an, eine Perlenkette von Dorles Mutter. Ich kämmte meine Haare und legte Lippenstift auf. Beim fünften Anlauf traf ich meine Lippen. An Lidschatten wagte ich mich erst gar nicht heran, das ging nur an Fasching.
Ich sah mich kritisch im Spiegel an. Das war doch gar nicht so schlecht. Jetzt musste ich nur noch mein überzeugendes Auftreten überprüfen. Ich ging aus dem Badezimmer, straffte meine Schultern, ging energischen Schrittes wieder hinein und warf mir im Spiegel ein umwerfendes Lächeln zu. Großartig. Genau die richtige Aufmachung, um eine Stelle am Empfang eines Seniorenheims zu bekommen. Wobei man mich durchaus mit einer Heimbewohnerin verwechseln konnte. Okay, dachte ich. Bevor ich jetzt teures Geld in den Sand setze für einen Fotografen, probieren wir das Ganze mal am Automaten.
Ich radelte zum Charlottenplatz. Eigentlich kann man in einer Stadt, in der Porsche und Daimler gebaut werden, nicht Rad fahren, ohne sein Leben zu riskieren, aber ich hatte ja sowieso nicht mehr viel zu verlieren und außerdem wenig Geld. Der Charlottenplatz liegt unten im Talkessel. Ich zischte in halsbrecherischem Tempo die Reinsburgstraße hinunter und musste nur ein einziges Mal einen scharfen Haken nach links schlagen, als ein Autofahrer wie üblich ohne zu gucken seine Tür aufriss.
Irgendwo im Labyrinth der Bahnsteige am U-Bahn-Knotenpunkt Charlottenplatz musste ein Automat für Passfotos stehen, ich konnte mich nur nicht genau erinnern, wo. Ich rollte Rolltreppen hinauf und lief Stufen hinunter. U1 Richtung Fellbach. U4 Richtung Untertürkheim. Wo stand das blöde Ding nur? Ich bog um die Ecke und wurde von einer Rolltreppe ausgebremst, die mit einem Putzeimer verbarrikadiert war. Ein Mann im blauen Arbeitsanzug rannte, einen Putzlappen in der rechten Hand, die Rolltreppe hinauf und weichte dabei die Rolltreppenwand mit dem feuchten Lappen ein. Er musste also schneller rennen, als die Rolltreppe fuhr. Sobald er oben angekommen war, rannte er die normale Treppe wieder hinunter und sauste dann erneut nach oben, nachdem er den Lappen im Eimer ausgewrungen hatte. Ich blieb fasziniert stehen. War das jetzt ein Ein-Euro-Job oder trainierte er für Let’s putz, die jährlich von OB Schuster anberaumte Großsäuberungsaktion? Zu guter Letzt zog er die tropfenden Seiten mit einem Fensterabzieher ab. Ob in anderen Städten wohl auch die Rolltreppen gewienert wurden?
Ich keuchte die Treppe zu Fuß hinauf. Ich war wirklich nicht besonders gut in Form. Oben fand ich den Automaten endlich neben dem Servicecenter der Stadtbahnen. Ich schickte ein Kurzgebet zum Himmel und bat den lieben Gott, dem Katastrophen-Gen eine kleine Pause zu gönnen.
Der Automat sah aus, als könne man nicht so viel falsch machen. Zunächst musste man einen fünf Euro-Schein in einen Schlitz stecken, der Schein wurde angesaugt wie von einem Staubsauger, und dann stellte eine freundliche Frauenstimme jede Menge Fragen und machte Vorschläge. Ob man ein Foto wolle oder mehrere und vier gleiche oder vier verschiedene und farbig oder schwarzweiß ...? Ich wollte vier verschiedene Fotos und gab mir ziemlich viel Mühe. Vielleicht konnte ich ja noch ein Foto für eine Kontaktanzeige nutzen. Ich drehte also den Kopf prüfend hin und her und lächelte und guckte ernst und einmal verträumt und einmal melancholisch, manchen Männern gefällt das ja, und manchmal ließ ich das Bild wiederholen. Ich war bestimmt eine Viertelstunde beschäftigt, dabei war es eigentlich ziemlich eklig in der Kabine. Auf dem Boden lag viel Müll und die Wände waren mit Graffitis beschmiert.
Ich wartete vor der Kabine. Nach drei Minuten blinkte es am Ausgabenschlitz rot, es blinkte und blinkte, Freude, schöner Götterfunken ertönte und endlich kam der Abzug heraus. Leider war mein Kopf auf allen vier Fotos abgeschnitten. Ich sah aus wie ein Eierbecher, weil ich den Drehstuhl zu hoch eingestellt hatte. Ich stellte mir vor, dass die kleinlichen Seniorenheime über solch ein Eierbecherfoto sicherlich missbilligend den Kopf schütteln würden.
Also musste ich nochmal Fotos machen. Da ich keinen 5-Euro-Schein mehr hatte, kaufte ich bei Bäcker Nast eine Laugenbrezel, um einen 20-Euro-Schein zu wechseln. Ich ging zurück zum Automaten, langsam ging es mir auf die Nerven, ich verzichtete auf die Melancholie und machte nur ein Foto mit dem strahlenden Lächeln, das ich vor dem Spiegel geübt hatte. Es sah ein wenig eingefroren aus. Und dann wartete ich. Es blinkte und blinkte und wollte überhaupt nicht aufhören zu blinken. Irgendwann hörte es dann aber doch auf, ohne dass Beethoven sich noch einmal gemeldet hätte. Darauf hätte ich ja verzichten können, bloß war leider auch kein Abzug aus dem Schlitz gekommen. Aaargg!! Ich steckte den Kopf in die schmuddelige Kabine und schrak zusammen, als mir die Frauenstimme direkt ins Ohr säuselte: »Leider gibt es eine kleine Betriebsstörung. Bitte rufen Sie unsere Servicehotline an.«
Mittlerweile musste ich mich beherrschen, um mit meinem süddeutschen Temperament nicht auf den Automaten einzuschlagen. Glücklicherweise gab es direkt neben dem Automaten noch einen zweiten, und ich hatte ja noch einen 5-Euro-Schein. Aber dieser Kollege nahm keine Scheine, sondern nur Münzen. Da meine Münzen nicht ausreichten, ging ich wieder zu Nast und kaufte noch eine Brezel, um an Kleingeld zu kommen. Die Verkäuferin sah mich schon etwas seltsam an. Der zweite Automat war noch lädierter als sein Kumpel und innen saudreckig. Der Vorhang war abgerissen, so dass alle Passanten zusahen, wie ich da drin saß und blöd guckte, und es gab ziemlich viele Passanten.
Ich hatte keine Lust mehr, freundlich, ernst, verträumt oder melancholisch zu gucken, ich guckte allmählich ziemlich böse. Als ich endlich die Fotos in der Hand hielt, sah ich aus wie eine böse, böse Terroristin von al-Qaida, die gerade durch den Staub von Ibn-Al-Chassis gerobbt war. Die Bluse war reinigungsreif. Eine Sekunde lang dachte ich an diesen unglaublich französischen Film über diese unglaublich französische Amélie. In diesem Film war ein Passfoto-Automat etwas ganz Romantisches und führte schließlich dazu, dass die Heldin ihre große Liebe fand. Im U-Bahnhof Charlottenplatz, so viel war sicher, fand man keinen Lover. Nur ein paar Obdachlose und denen schenkte ich die Brezeln.
Obwohl ich auf den Fotos aussah wie Katastrophen-Jenny, hatte ich sie eingesteckt, um sie einem professionellen Fotografen als Beispiel vor die Nase zu halten, wie ich unbedingt nicht aussehen wollte. Für diesen Tag erklärte ich das Projekt für beendet. Die Bluse bettelte um einen mehrstündigen Koch-Waschgang und mein Vorrat an strahlendem Lächeln war für diesen Tag aufgebraucht.
Zurück zu Hause schob ich mir eine halbe Packung Pommes in den Ofen, klatschte eine viertel Flasche Ketchup darüber und aß vor dem Fernseher. Auf Nostalgie-TV lief Daktari. Clarence schielte, was das Zeug hielt, und gleich ging es mir besser. Anschließend weichte ich die Bluse im Waschbecken ein, nahm die Gelben Seiten, schloss die Augen und tippte blind auf irgendeine Adresse in der Sektion Fotostudios.
»Was für Fotos sollen es denn werden?«, flötete eine weibliche Stimme am Telefon, »Passfotos, Bewerbungsfotos, erotische Fotos für den Freund?«
»Äh, Bewerbungsfotos.«
»Dann empfehle ich Ihnen, auf keinen Fall etwas Weißes zu tragen. Das ist die schlechteste Wahl, die Sie treffen können, macht viel zu blass. Also auf keinen Fall das alte Konfirmationsblüschen ausgraben, gell!« Sie lachte sich schlapp. Ich knallte den Hörer auf und sah mir die Automatenfotos nochmal an. Die Bluse war schmutziggrau und machte mich gar nicht blass.
Den Nachmittag verbrachte ich mit Schlafen und surfte ein wenig auf den Seiten des Arbeitsamtes herum. Die Angebote waren großartig: Dringend benötigt wurden Mitarbeiter für Callcenter, Servicekräfte in der Gastronomie, Reinigungspersonal, Ingenieure, Bauarbeiter und IT-Fachkräfte. Allzu lange würde ich meinen Besuch beim Arbeitsamt nicht mehr hinauszögern können.
Um ehrlich zu sein: Ich war deprimiert. Es war zwar nicht besonders schön, täglich 12 bis 14 Stunden zu arbeiten, aber man musste sich nicht ständig darüber Gedanken machen, wie man den Tag herumkriegte. Ich dachte an Lila und konzentrierte mich auf all die positiven Dinge in meinem Leben: Ich wurde gebraucht (was hätten Herrn Tellerles Schleierschwänze ohne mich gemacht?), ich hatte eine fantastische Familie (auch wenn meine Eltern sich etwa so gut verstanden wie Tom & Jerry), ich würde mir für das Wochenende einen Besuch bei meiner reizenden Schwester und ihren entzückenden zwei Kindern vornehmen, und das Tiefkühlfach war gefüllt (Pommes! Pizza!). Ich hatte keinen Freund und es sah nicht so aus, als ob ich in absehbarer Zeit mit meinem ganz persönlichen Helden in den Sonnenuntergang von Stuttgart-Weilimdorf reiten würde, aber so blieben mir Beziehungsprobleme und schmerzhafte Betrugs- und Trennungsgeschichten erspart, was ein unglaublicher Vorteil war.
Da ich mich nicht schon wieder mit Lila betrinken konnte (obwohl, warum eigentlich nicht?), kochte ich abends einen großen Topf Chili con carne sin carne, um mich aufzuheitern. Chili con carne sin carne ist eines der wenigen Gerichte, die ich wirklich gut kochen kann, und meinem Geldbeutel tat es sowieso gut, das Fleisch wegzulassen.
Ich hatte mir gerade den Teller voll geschaufelt und den ersten Schluck Rotwein genommen (wer sagte denn, dass man sich nicht auch alleine betrinken konnte?), als es klingelte.
Ich wunderte mich ein bisschen, denn normalerweise bekam ich keinen unangemeldeten Besuch. Die Kommunikation mit den Nachbarn basierte auf zufälligen Treffen im Treppenhaus, die meistens darauf hinausliefen, dass man meine Art, die Kehrwoche zu machen, kritisierte. Ich hatte mir deshalb für das Treppenhaus einen Schmidtchen-Schleicher-Gang angewöhnt, um möglichst niemandem zu begegnen. Es klingelte zudem nicht nur einmal höflich-abwartend, sondern Sturm. Ich trat auf den Balkon, hängte mich über das Geländer und schielte nach unten, konnte aber niemanden sehen. Ich ging zur Wohnungstür, weil es immer noch wie verrückt klingelte. Vielleicht war Frau Müller-Thurgau aus dem vierten Stock über einer Zigarette eingeschlafen und das Haus wurde evakuiert? Das würde bedeuten, dass ich Herrn Tellerles Aquarium retten musste.
Ich riss die Tür auf. Vor mir stand ein Mann. Äußerst gutaussehend und genau mein Typ! Dunkelblondes, leicht lockiges Haar, groß und fast schlank! Total intensive blaue Augen! Bestimmt ein Künstler! Ich schnappte einen Moment nach Luft. Ich meine, da rennt man sich die Hacken ab, um seinen Traumtypen zu finden, und da steht er einfach vor der Tür! Da gab es doch sicher einen Haken. Wahrscheinlich war er von den Zeugen Jehovas oder Staubsaugervertreter von Vorwerk.
Übrigens schnappte nicht nur ich nach Luft. Der Kerl an der Tür klammerte sich mit einer Hand am Türrahmen fest, keuchte (ogottogottogott), war puterrot im Gesicht und deutete mit der anderen Hand permanent auf seinen Hals.
Ich war mir nicht so richtig sicher, was ich tun sollte. Ich erkannte aber innerhalb von blitzschnellen 25 Sekunden: Dieser Mann hatte ein Problem, und er schien ein gewisses Vertrauen dareinzusetzen, dass ich es lösen konnte, obwohl er mich gar nicht kannte. Und mal ganz ehrlich: Man lässt seinen soeben aus dem Nichts aufgetauchten Traummann nicht auf seiner Türschwelle krepieren. Während mir all diese Gedanken durch den Kopf schossen, röchelte der Kerl weiter. Es schien eine gewisse Dringlichkeit in diesem Röcheln zu liegen.
Mit kühlem Kopf traf ich eine rasche Entscheidung. Ich zerrte ihn mit der einen Hand in die Wohnung und mit der anderen haute ich ihm kräftig auf den Rücken. Das brachte aber rein gar nichts, er keuchte und würgte völlig unbeeindruckt weiter. Mittlerweile war seine Gesichtsfarbe dunkelrot. Kurz-vor-dem-Tod-rot. Ich rannte zum Tisch und reichte ihm das volle Weinglas, er stürzte es in einem Zug hinunter, und weil ich so aufgeregt war, goss ich es gleich wieder voll und leerte es auch mit einem Schluck. Der Kerl japste immer noch! Jetzt halfen nur noch drastische Maßnahmen, sonst würde er hier in meiner Wohnung ersticken. Und ich musste dann seine Eltern anrufen! Ich baute mich hinter ihm auf, presste beide Arme an meinen Körper, ballte die Hände und rammte ihm so fest ich konnte meine beiden Fäuste zwischen die Schulterblätter.
Er flog mit vollem Karacho mit dem Bauch gegen die Tischplatte und dann auf meinen Esstisch, fegte den Teller Chili con carne sin carne auf den Boden und kotzte eine Mischung aus Rotwein und breiartigen Substanzen in blassen Farben auf meine von Dande Dorle geerbte, frisch aufgelegte weiße Tischdecke.
Dann richtete er sich schwer keuchend auf. Er hustete. Er lebte! Ganz schnell schenkte ich ihm ein Glas Wein ein, er kippte es hinunter, ich goss mir den Rest aus der Flasche ein und trank ebenfalls in einem Zug, dann standen wir beide da und grinsten erleichtert. Er zitterte und sah erschöpft aus, an seinen Mundwinkeln klebten undefinierbare Essensreste, sein Hemd war verschmiert, aber langsam wurde seine Gesichtsfarbe normal und sein Atem ging ruhiger.
»Sie ... Sie haben mir das Leben gerettet«, brach es aus ihm heraus.
»Du«, korrigierte ich automatisch. Man siezt keine Lebensretter. Ich konnte nicht aufhören zu grinsen, was nach zwei Gläsern Rotwein, die ich auf fast leeren Magen hinuntergestürzt hatte wie Wasser nach einer Wüstenwanderung, nicht wirklich verwunderlich war.
»Ich bin übrigens Leon«, sagte er. »Dein neuer Nachbar. Eigentlich wollte ich mich auf konventionellere Weise bei dir vorstellen.«