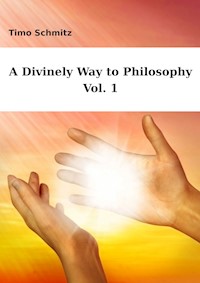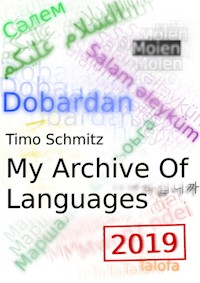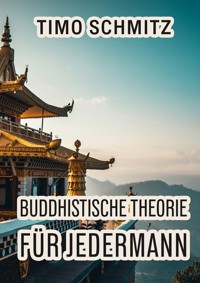
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Buddha TS Publishing
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch möchte dem allgemein Interessierten einen ersten Eindruck in die Tiefe der buddhistischen Gedankenwelt vermitteln und dient der Einführung in die buddhistische Grundtheorie. Dabei versucht der Autor, eine Brücke zwischen westlichem und östlichem Denken zu schlagen und bietet hier und da Anknüpfungspunkte zu westlichen Traditionen wie dem Judentum und Platonismus. Am Ende der Reise, so hofft es der Autor, mag der Leser nicht nur eine theoretische Basis besitzen, sondern die Möglichkeit, sich einer der verschiedenen buddhistischen Traditionen zu öffnen und den Weg des Buddhismus weiter zu beschreiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das 21. Jahrhundert ist geprägt von Höhen und Tiefen. So stehen uns zwar heute viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung als früher, dennoch scheinen die Zeiten der Globalisierung auch verängstigend zu sein. Die Säkularisierung hat sehr viele Vorteile für den Menschen gebracht. Dazu gehört nicht nur die Individualisierung, sondern auch die Möglichkeit, die Vielfalt in der Gesellschaft stärker zu betonen und auszuleben. Gleichzeitig hat die Säkularisierung aber auch starke Probleme hervorgerufen. So ist zwar positiv anzumerken, dass es heute nicht mehr das eine Familienmodell gibt und verschiedene Lebensweisen toleriert werden, aber der aktuelle Werteverfall ist nicht zu übersehen. So wachsen zwar unsere Kinder offener auf, auch in dem Bewusstsein, dass es nicht die eine homogene Masse gibt, welche die Gesellschaft formt, aber der Konsum, die Probleme der Globalisierung, und der Verfall ethischen Bewusstseins führen zu einer Furcht, welche uns ständig begleitet und viele Menschen heute in Depressionen führt. Dabei gebe ich zu, dass ich in meinen jungen Jahren ein sehr individualistisches anti-moralisches Bild entwickelt habe, als eine Art infantile Rebellion, welche zwar ein anarchokommunistisches Weltbild in mir manifestierte, dennoch durch Ansichten, die sich im Laufe der Reifung und der Vernunftausprägung hervortaten, eine fruchtbare Philosophie weiterentwickelten. Nichtsdestotrotz ist ein materielles Weltbild nicht befriedigend, sodass ich auf konservative Werte zurückgegriffen habe und der Meinung bin, dass das Spannungsverhältnis zwischen Gesetz und Individuum gelöst werden kann, und eine Metaxy bilden muss, die stets um ihre Vormacht kämpft. Als solches wird uns die Gesellschaft immer als ein Monster begegnen, welches unsere Eigenarten dem Individuum nehmen möchte, genauso wie unser Individuum zwangsläufig der Masse als ein Monstrum erscheinen muss, welches gegen jede Anpassung im Zusammenleben rebelliert und stets seinen Egoismus im Vordergrund sieht. Die alte indische Gesellschaft war sehr grauenvoll, gebildet durch feste Strukturen und Kasten, welche bereits Siddharta Gautama zur Ernüchterung führten. Auch er rebellierte, wobei die daraus entstandene Religion, der Buddhismus, heute für Hindus eine gravierende Negation, also einen Nihilismus, darstellt. Es ist daher folgerichtig stets falsch, wenn man Buddhismus und Hinduismus in einen Topf wirft.
Dabei ist die buddhistische Philosophie sehr tiefgründig und kann unser Leben bereichern, egal ob man nun eine liberale Werteordnung, wie man sie im 21. Jahrhundert vorfindet, bekundet oder eher konservativ orientiert den Werteverfall betrauert. Der Buddhismus ist ein Schlüssel zur Menschlichkeit, er ist politisch unabhängig, obgleich er sich vor allem bis heute in kommunistischen Staaten gehalten hat, nicht zuletzt da beide Philosophien einen Wert auf Gleichheit und Einigkeit aller Menschen legen. Die Bewältigung dieses Ziels haben beide Philosophienin der Praxis auf ganz verschiedenen Wegen anvisiert. In meinem ersten Buch zum Buddhismus, erschienen im Jahr 2014, merkte ich bereits in der Einleitung kritisch den vermeintlichen Unsinn der Philosophie an. Wie viele Menschen im Alltag, war auch ich damals lediglich in der Schule mit philosophischen Ideenschriften konfrontiert. Dabei liest man gewöhnlich nur kurze Auszüge, nicht selten schlecht gekürzt, und je nachdem wie gut der Lehrer das Thema beherrscht, schafft er es, den Philosophen gut oder schlecht zu erklären. Alles in allem sind also solche gekürzten Ausschnitte für den Philosophieinteressierten eher kontraproduktiv, da es die tiefe Innigkeit der Philosophie unterjocht. Es wird mir wohl jeder zustimmen, wenn ich behaupte, dass es unzureichend ist, einen Ausschnitt aus Platons Höhlengleichnis als die vollkommene Weisheit Platons zu verkaufen.
Nachdem ich mich nun vor allem nach meiner Schulzeit ausführlich mit philosophischen Werken beschäftigt habe, habe ich die Tiefe der Philosophie begriffen und mein damaliges Statement sehr bereut. Die Philosophie ist die Mutter aller Wissenschaft, ohne die das heutige Leben kaum möglich wäre. Wenn man die platonischen Schriften ausführlich liest, so eröffnet sich einem eine ganz neue und ganz andere Welt, als dies uns damals in der Schule vermittelt wurde. Schließlich entschied ich mich zum Studium der Philosophie, welches mich vollumfänglich erfüllt hat, sodass ich nicht nur einen akademischen Abschluss erworben habe, sondern die Philosophie sogar zum Grundkern meines Lebens geworden ist.
Wie jedoch in jeder Wissenschaft in Deutschland, ist die Philosophie sehr eurozentrisch geprägt, sodass auch hier das Weltverständnis nicht selten auf Europa beschränkt ist. Über die Unterpräsenz der afrikanischen Philosophie möchte ich gar nicht erst beginnen, sondern direkt auf das asiatische Verständnis hinweisen. Oft wird man gerade in Europa mit der Frage konfrontiert, ob nun der Buddhismus eher ein Lifestyle, eine Art Trend, oder doch eher eine Philosophie, gar Religion, sei. Bereits 2015 habe ich mich dieser Frage in einer englischen Publikation gewidmet und herausgestellt, dass der Buddhismus eigentlich nicht als Lifestyle gedacht ist, sich als solcher auch gar nicht verstanden sehen möchte. Jedoch ist der Buddhismus sowohl als Philosophie als auch als Religion präsent, und hat als solcher alle Vor- und Nachteile der modernen Buchreligionen. Dabei verstehe ich die Buchreligionen, wie ich 2017 bereits ausführte, nicht nur im abrahamitischen Sinne, sondern gestehe diese Bezeichnung jeder kanonisierten Religion zu.
Eine solche Kanonisierung der Religion bildet auch der Buddhismus. Das Vorhandensein einer heiligen Schrift oder eines Kanons führt auch immer dazu, dass sich automatisch dogmatische Richtungen heraus entwickeln müssen, welche einen hierarchischen Fundamentalismus predigen. Das Bild eines rein friedlichen Buddhismus, welches in Europa oft gepflegt wird, ist daher nicht aufrechtzuerhalten. Tatsächlich ist dagegen die buddhistische Philosophie, wie auch die anderen religionsgeprägten Philosophien (man nehme zum Beispiel den Islam) erst einmal unverfänglich, und daher in jedem Fall betrachtungswürdig. Anders als dagegen den abrahamitischen Religionen, welche sich strikt monotheistisch definieren, hat der Buddhismus kein festes Gottesbild. Denn der Buddhismus an sich ist tatsächlich erst einmal eine philosophische Lehre. Diese hat sich im Laufe der Zeit an die verschiedenen religiösen Vorstellungen vor Ort angepasst und so haben sich sowohl polytheistische als auch monotheistische und in moderner Zeit auch atheistische Formen herausgebildet.
Ich würde gar so weit gehen und sagen, dass dies der Grund dafür ist, warum sich der Buddhismus in antiker Zeit so schnell verbreitet hat und sich dadurch vom Hinduismus emanzipieren konnte, indem er in China als eigenständige Religion eingeführt wurde. Dennoch glauben Buddhisten in Laos heute neben den buddhistischen Werten oft auch an animistische Traditionen und auch in Thailand hat sich der Buddhismus in den traditionellen Volksglauben integriert. Mir selbst wurde der Buddhismus vor allem von Asiaten vermittelt. Mit 17 Jahren entwickelte ich mein erstes Interesse daran, wie man als Buddhist sein Leben besser und geregelter gestalten kann, und verschiedene Buddhisten aus China haben mir die Lehre nähergebracht. Damit konnte ich zentrale Probleme meiner Teenagerzeit anpacken und mich neu orientieren. Schließlich öffnete ich mich mit 18 Jahren weiter den buddhistischen Einflüssen und habe andere Religionen, mit denen ich mich bis dahin beschäftigt habe, vor allem das Christentum, wie es in Deutschland praktiziert wird, und Islam, für mich ausgeschlossen. Es sei hier nur am Rande angemerkt, dass ich jedoch im Laufe der Zeit eine Begeisterung für das Judentum und die Bibel entwickelt habe, nicht zuletzt, da sich im Alten Testament viele östliche Einflüsse (Persien, Mesopotamien, etc.) wiederfinden, sodass ich das Judentum nicht selten als eine Art Buddhismus mit Gott sehe. Gerade in den USA ist die Zahl der Buddhisten mit jüdischem Background in letzter Zeit stark angestiegen, und es hat sich im angloamerikanischen Sprachraum ein eigener Begriff für diese Menschen entwickelt, der „Jubu“ (jüdischer Buddhist). Dabei sollte man dem Judentum aber auch seinen eigenen religiösen Charakter zugestehen, es handelt sich also nicht um eine Kategorie des Buddhismus: vielmehr scheinen beide Religionen sehr kompatibel zu sein, da sie die gleichen Ziele verfolgen. Bevor ich selbst zu einer jüdisch-buddhistischen Philosophie gefunden habe, vertrat ich eine atheistische Linie.
Mein Leser muss weder an Gott glauben, noch Gott ablehnen, da der Buddhismus sehr flexibel ist und die buddhistische Lehre universell erscheint. Auch adressiert der Buddhismus ein Problem, mit dem jeder Mensch im 21. Jahrhundert zwangsläufig konfrontiert wird. Es geht nämlich um die Überwindung des Leidens, und in einer tief verwurzelten kapitalistischen Marktwirtschaft, in der viele Menschen tagtäglich um ihren Arbeitsplatz zittern müssen, ist dieses Leid stets präsent. Die Coronapandemie hat diese Situation nicht gerade entschärft, sondern sogar verschlimmert, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Welt weiter aus ihren Angeln gehoben. Aber auch viele junge Menschen, wissen oft nicht, welche Richtung sie einschlagen sollen. Das moderne Leben ermutigt sie zwar, aber es verängstigt sie auch. Sie haben das Gefühl, keinen Halt zu finden und nicht selten Angst, nicht akzeptiert zu werden. Gleichzeitig machen sie sich Sorgen, ob sie jemals genug verdienen werden, um eine Familie ernähren zu können. Die Oberflächlichkeit der Gesellschaft, die Verflachung durch die Werbung, schürt die Angst der Menschen vor dem Altern, die Angst sich nicht selbst verwirklicht zu haben, wenn man nicht genug konsumiert hat. Der Konsum führt wiederum zu einem schlechten Gewissen gegenüber unseren Ressourcen. Man landet zwangsläufig in einem Teufelskreislauf, zwischen ökologischem Handeln und der Angst jeglicher Selbstexistenz. Dies schiebt sich heutzutage durch alle Schichten.
Der asiatische Zugang hat mir sehr geholfen, und ich finde, dass dieser für viele Gläubige, die östlichen Religionen zugeneigt sind, ein möglicher Weg sein könnte, gleichzeitig der Buddhismus aber deutlich als Antagonismus zum Hinduismus verstanden werden muss. Problematisch ist jedoch die besondere Romantisierung des Buddhismus im Westen und die Stilisierung verschiedener Persönlichkeiten. Dies führt dazu, dass viele Menschen im Westen den Buddhismus nicht wirklich verstanden haben. So habe ich es durchaus erlebt, dass nicht wenige am Buddhismus interessierte Menschen in Deutschland meine Werke stark kritisiert haben, da ihnen diese von mir dargelegte asiatische Denkweise fern ist. Ich möchte dennoch in diesem Werk weiterhin an der asiatischen Denkweise festhalten, ungeachtet davon, dass sie dem ein oder anderen fremd oder neu sein wird. Vielmehr hoffe ich dadurch, die eigentliche buddhistische Philosophie und Lebensweise dem westlichen Leser näher bringen, gleichzeitig aber Chancen und Perspektiven aufzeigen zu können, wie die Gesellschaft im Westen sich wandeln und verbessern kann. In diesem Sinne wünsche ich meinem Leser eine fruchtvolle Lektüre und habe die Hoffnung, dass diese einen neuen Zugang bietet und eventuell sogar ein neues Verständnis des Buddhismus sowie dessen praktischen Nutzen.
Bevor man sich mit den theoretischen Inhalten des Buddhismus beschäftigt, sollte man sich vielleicht erst einmal dem Begriff annähern. So ist offensichtlich, dass das Wort aus zwei Teilen besteht: ‚buddh‘ und ‚-ismus‘. Dabei kommt das Wort ‚buddh‘ aus der Pali-Sprache und bedeutet übersetzt Erleuchtung. Es handelt sich hier also um die Lehre der Erleuchtung, wobei die Erleuchtung – wenig überraschend – das höchste Ziel ist. Als zweites muss man die Frage stellen, wer oder was erleuchtet werden soll. Hier unterscheidet sich der Buddhismus rudimentär vom christlichen – insbesondere dem katholischen – Weltbild, denn bei letzterem gibt es eine Art Priesterkaste (Bischöfe, Papst, etc.), welche einen besonderen Kontakt zu Gott haben soll oder zumindest vorgibt, diesen Kontakt zu besitzen. Beim Buddhismus dagegen liegt die Fokussierung auf jedem einzelnen Praktizierenden. Dies bedeutet also, dass jeder Einzelne die Erleuchtung erlangen kann. Es ist also nicht mehr der Priester, der einem Trost spendet, sondern der Praktizierende muss im Zuge der Praxis den Weg selbst beschreiten. In anderen Worten: Nur der Einzelne alleine kann das Ziel erreichen, er kann keinen Stellvertreter an seine Praxis stellen, welche für ihn dann die Arbeit erledigt. Als drittes stellt sich dann die Frage, warum man diesen Weg der Erleuchtung gehen sollte. Der Buddhismus besagt, dass die Notwendigkeit zur Praxis im menschlichen Leid liege. Da jeder Mensch leidet, möchte der Buddhismus ihm als universelle Lehre eine Erlösung dieses Leids anbieten.
An dieser Stelle mag man sich fragen, ob es nicht absurd ist, jedem Menschen zu unterstellen, dass er leiden würde. Auf der anderen Seite ist es offensichtlich, dass bereits jeder Mensch in seinem Leben leidvolle Erfahrungen gemacht hat. Sei es der Verlust eines geliebten Menschen, eine nicht erwiderte Liebe, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine Situation, die einen wütend macht oder jedwede andere Situation, welche einem unangenehm erscheint. Fakt ist: Jeder Mensch kennt das Gefühl des Schmerzes, der Unlust, schlichtweg das Unangenehme. Daher ist es sinnvoll, das Leid als universelles Problem anzunehmen.
Es ergibt sich daraus auch, dass sich jeder Mensch mit dieser Situation auseinandersetzen und einen Weg zum Umgang mit diesen Gefühlen finden muss. Das Abstruse ist jedoch, dass Leid etwas höchst Subjektives ist, d. h. es gibt nicht das Leid an sich, sondern jeder Mensch leidet anders [Schmitz, 2020]. Auf der anderen Seite ist es offensichtlich, dass es irgendeine Form von Realität gibt, sofern wir nicht Solipsisten sind. Solipsisten glauben, dass im Grunde genommen nur man selbst existiert, was also bedeutet, dass das Leben eine Art Film ist. Im Gegensatz hierzu, geht der Skeptizismus davon aus, dass wir nicht wirklich wissen können, ob bzw. was real ist und was wir uns hinzu erfinden. Die leichteste Form ist der Konstruktivismus, welcher davon ausgeht, dass es draußen eine Wirklichkeit gibt, wir jedoch diese nicht direkt wahrnehmen können und die Realität somit eine Repräsentation der Wirklichkeit sein könnte, aber niemals die Wirklichkeit selbst ist, da wir ihr womöglich Fehler hinzufügen. Dies bedeutet, dass die Realität, so wie wir sie wahrnehmen, in unserem Geist konstruiert wird. Wie Ihnen vielleicht aus meinen früheren Publikationen bekannt sein könnte, ist es kein großes Geheimnis, dass ich mich zum Konstruktivismus bekenne. Es ist ein Fakt, dass wir unsere Umwelt nur durch Sinnesorgane wahrnehmen, welche dann Impulse geben und uns dabei helfen, im Gehirn unsere Wirklichkeit zu erzeugen. Es gibt dabei jedoch keine Garantie, dass das Wahrgenommene auch wirklich so ist, wie wir es wahrgenommen haben [s. hierzu u.a. auch Nagel, 2012; Maturana & Varela, 2015: 33]. Gerhard Vollmer [1983: 29 f.] schlug daher vor, dass es eine Art Passung geben muss, sodass die von uns konstruierte Realität annäherungsweise der wahren Realität entspricht, da wir sonst in der Welt nicht überleben könnten.
Die Suche nach Wahrheit, etwas an dem man sich sicher festhalten kann, brachte mich in der ersten Hälfte der 2010er-Jahre in eine tiefe Sinnkrise, welche ich 2014 ausführlich schilderte. Schließlich musste ich jedoch einsehen, dass Descartes Recht hatte, wenn er daraufhin weist, dass wir schließlich erst einmal nur wirklich sicher sein können, dass wir als denkende Wesen existieren – „je pense, donc je suis“ (cogito ergo sum). Darauf müssen wir aufbauen. Wenn es also da draußen eine Wirklichkeit gibt, welche Wesenheit besitzt, so müssen wir uns doch eingestehen, dass jenes, was keine Wesenheit besitzt, eigentlich nicht wirklich sein kann. Der Buddhismus geht davon aus, dass Leid im Menschen selbst erzeugt wird, folglich also keine Wesenheit besitzt [Schmitz, 2020; vgl. auch Chang-Chien, 2011]. In anderen Worten: Leid ist nichts Reales. Daraus folgt die Erkenntnis, dass Leid die falsche Sicht der Wirklichkeit ist [vgl. Giacobbe, 2007: 13]. Der Buddhismus widmet sich nun diesen negativen Gefühlen und zeigt auf, dass diese kein Bestandteil der Wirklichkeit sind und da sie nun mal kein Bestandteil der Wirklichkeit sind, kann man sie überwinden.
Dies ist auch der Grund, warum jeder die Buddhaschaft erlangen und zum Erleuchteten werden kann. Denn jeder kann mit seinen Gefühlen arbeiten, und auch wenn jeder seine ganz eigenen Gefühle hat, so können wir diese subjektiven Empfindungen durch Sprache pauschalisieren. Denn jeder kann etwas mit Begriffen wie Hass oder Liebe anfangen, obgleich das Gefühl von Hass bei jedem anders ausgeprägt ist. Bevor wir jedoch in die buddhistische Theorie einsteigen, ist es vielleicht sinnvoll einen kurzen theoretischen Abriss zur Entwicklung des Buddhismus darzulegen.