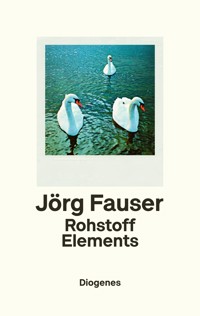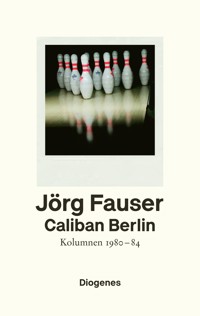
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Box-Abende, ein Papstbesuch, die Demokratie, der Kulturbetrieb und der ganze wunderbare Zeitgeist – der vorliegende Band versammelt 55 entlarvende Kolumnen, die der unkorrumpier-, aber nicht unbeeindruckbare Fauser unter anderem unter dem Namen ›Caliban‹ für das Berliner Magazin ›tip‹ geschrieben hat. Mit Nachworten von Ambros Waibel und Werner Mathes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jörg Fauser
Caliban Berlin
Kolumnen 1980–1984
Mit Nachworten von Werner Mathes und Ambros Waibel
Diogenes
Calibans Kolumne
Blick in die Zukunft
Die Gegend wurde immer trostloser. Hochhauswaben, Ausfallstraßen, Autobahnzubringer, dazwischen in ergrautem Grün Mietskasernen, Reihenhäuser, Einkaufszentren, der TÜV, die Großtankstelle, die Bowlingbahn, die Pizzabude, der ganze Plunder, den die Stadt aufs Land kippt, um es sich einzuverleiben – aber Stadt wird diese Gegend nie. Sie bleibt Zwischenzone. Niemandsland.
Als das Taxi hielt, hätte ich am liebsten gesagt: Warten Sie hier, aber dann fiel mir ein, dass der Mann, den ich aufsuchte, Telefon hatte, also zahlte ich, und das Taxi fuhr weg. Der Himmel zwischen den TV-Antennen war wie eine dunkle Ahnung.
Das Haus war Teil eines Blocks im Stil des sozialen Wohnungsbaus der frühen 50er Jahre – flache Dächer, Treppenhausfenster wie Schießscharten, Anstrich von der Farbe verdünnter Hühnersuppe. Es fehlten nur die Roller vor der Haustür, der Adenauer an der Litfaßsäule und die Capri-Fischer im Radio. Von ihrem Hochsitz im dritten Stock beobachtete mich eine Frau mit blauen Lockenwicklern im Haar. Ein seltsames Lächeln zog an ihren Mundwinkeln. Wusste sie, zu wem ich ging? Ich starrte zurück. Sie zog die Gardinen zu. Ich klingelte.
Der Mann, der mich an der Wohnungstür empfing, war mittelgroß, ziemlich massig, mit einem weißblonden Haarkranz und dicken Brillengläsern. Ich schätzte ihn auf etwa sechzig. Seine Kleidung und die Einrichtung des fensterlosen Zimmers, in das er mich führte, erinnerten auch an alte Zeiten, als die Leute noch mit simplen Gebrauchsgegenständen ausgekommen waren. Der altmodische Bücherschrank enthielt Lexika und Klassik, darunter der ganze Goethe. In einer Ecke stand ein Koffer, als sei der Mann erst gestern eingezogen und erwarte keinen langen Aufenthalt. Wir setzten uns. Mir fiel auf, dass er asthmatisch keuchte. Seine Hände zitterten. Er sah mich an.
»Sind Sie zum ersten Mal bei einem Astrologen?«
Ich steckte mir gerade eine Zigarette an und blies den Rauch weg, um seinem Asthma das Gröbste zu ersparen. Meine Antwort fiel wohl etwas undeutlich aus, denn er sagte mit unnötig lauter Stimme: »Ich bin schwerhörig, ich trage zwar ein Hörgerät, lese aber von den Lippen ab, bitte sprechen Sie deutlich.«
»Sind Sie Astrologe im Hauptberuf?«, fragte ich. Ich ertappte mich dabei, dass ich auf seine Lippen starrte.
»Ja«, sagte er und breitete Papiere aus, »ich mache das, seit ich 18 bin. Vor 30 Jahren hab ich fünf Mark für ein Horoskop bekommen, heute bin ich natürlich teurer. Und nun sagen Sie mir Ihren Geburtstag, Ihre Geburtsstunde und Ihren Geburtsort.«
Ich sagte sie ihm. Dann begann er, mein Horoskop zu erstellen. Bei den Berechnungen benutzte er keinen Taschenrechner. Alte Schule. Seine Hände zitterten zwar, aber er konnte mit dem Zittern umgehen. Ich drückte die Zigarette aus und rauchte dann nicht mehr. Während er berechnete und die Zeichen eintrug, stellte er mir Fragen. Ich hatte nicht vorgehabt, ihm meinen Beruf zu sagen, aber er bekam ihn auch so heraus. Dass ich nicht verheiratet war, machte ihm zunächst zu schaffen, bis er schließlich sagte: »Sie sollten überhaupt nicht heiraten, auf keinen Fall vor Oktober 1981, und nur eine Frau, die geistig zu Ihnen passt. Bei Ihrem Leben kommt nichts andres in Frage.«
Das war mir natürlich schon seit längerem klar, aber gerade weil mir eigentlich fast alles, was er mir sagte, irgendwie schon klar war, hatte ich allmählich das Gefühl, dass er mich ganz schön einkreiste. »Jemand wie Sie kann kein Angestellter sein. Ich wollte auch immer selbständig sein, aber das Leben ist dann schon schwerer, nicht wahr?« Seine Brille funkelte. Ich trug auch eine Brille, aber ich glaube nicht, dass sie funkelte. Ich bekam allmählich einen heftigen Durst und hörte zu, wie er mich auseinandernahm.
»Millionär werden Sie nie werden … Glücksspiel? Vergessen Sie’s … Kinder? Passen nicht zu Ihnen … Die nächsten Jahre werden Sie schon überstehen, Jupiter und Mars sind da recht günstig … Der Wassermann als Ihr Aszendent, der sorgt natürlich für Unruhe … Hab ich Ihnen gleich angesehen, den Wassermann … Hände weg von der Politik, falls Sie nach Bonn gehen wollen, die lassen Sie auflaufen …«
Ich fragte ihn, ob es Krieg geben werde. Er blickte vom Horoskop hoch und sagte ruhig und bestimmt, mit der Erfahrung, die eher dem Überleben zuzuschreiben ist als der Astrologie: »Vergessen Sie nicht, dass wir Deutschen 1941 in Russland eingefallen sind und zig Millionen Menschen umgebracht haben. Die Russen haben für immer ein Misstrauen, aber Krieg werden sie nicht machen, sie haben viel zu sehr gelitten. Ja, der Krieg. Jeder wollte durchkommen. Mit dem Spaten haben sie gekämpft, mit den bloßen Händen. Jeder musste kämpfen.« Er schwieg eine Weile, dann betrachtete er sein Werk: »Sie müssen auch kämpfen, Ihnen bleibt nichts anderes übrig, sehen Sie doch« – er zeigte mir das Horoskop –, »wie sich das alles zusammenballt, das ist Ihr Leben, da müssen Sie durch.«
Ich sah es mir an. Es ballte sich wirklich zusammen. Das tat es bei den meisten anderen auch, ob im Horoskop oder im Leben. Oder waren Horoskop und Leben das Gleiche? Das Horoskop konnte man einstecken. Ich steckte es ein, bezahlte und ging. Draußen war es jetzt dunkel. Ich hatte vergessen, ein Taxi zu bestellen. In der Pizzabude saßen sie bei Bier und Pizza, lachten, starrten ins Leere, stritten sich und machten jedenfalls Feierabend. Ich war von ihnen getrennt. Ich kannte mein Horoskop. Machen die Sterne auch Feierabend? Ich fühlte mich unruhig. Warum hatte er mir nichts Genaueres gesagt? Ich hatte einen Blick in die Zukunft werfen wollen, aber nur das erfahren, was ich schon zu kennen glaubte. Konnte das alles sein? Morgen hatte ich einen Termin bei der Wahrsagerin. Ein Taxi fuhr durch die Zwischenzone. Schon ging der Kampf weiter. Ich stellte mich auf die Straße und winkte. Diesmal hatte ich Glück, das Taxi hielt …
Auch die Wahrsagerin wohnte am Rand der Stadt, wo die Zusammenhänge sich verlieren. Diesmal klingelte ich an einem Appartementhaus im Stil der 60er Jahre, die Gegensprechanlage war schon eingeführt, der Müllschlucker noch kein Allgemeingut. Die junge Frau, die mir öffnete, war recht groß und gut gebaut. Sie hatte dunkle Locken, die ihr Gesicht besonders blass machten. Sie trug eine weiße Bluse über einer schwarzen Hose und bat mich, einen Augenblick zu warten. Ich wartete ziemlich lange vor einem Schrank, der mit Spiegeln verkleidet war. In einer Ecke lag ein Stapel Frauenzeitschriften. Auf einem Tischchen lag eine Zahnbürste über der Telefonrechnung. Ich kam mir lächerlich vor. Die Wände waren dünn, und ich hörte die Wahrsagerin und ihre Kundin in angeregtem Gespräch. Es hörte sich an wie ein Tratsch unter Nachbarinnen. Einmal sagte die Frau: »Wenn der Richter von oben runterblicken würde …« Ich dachte an Jehova, aber die Wahrsagerin ergänzte den Satz: »… er schaut bestimmt von oben rauf.«
Endlich kam ich dran.
Das Wohnzimmer wirkte behaglich. Mir fielen zwei Schreibmaschinen auf und eine Menge Bücher. Durch die hohen Fenster sah man zumindest Höfe und Balkone, den Himmel zwischen den Slips, die an den Wäscheleinen schaukelten. Wir setzten uns an einen Tisch, auf dem ein Manuskript und die Karten lagen, die meine Zukunft wussten.
»Hoffentlich krieg ich’s zusammen«, sagte die Wahrsagerin, »ich bin nämlich voll mit Chinin.« Ich tippte auf Malaria, sie hatte aber nur eine Grippe. Sie sagte, sie sei andauernd krank. Sie gab mir die Karten. Ich mischte. Ich fragte, wie sie zu dem Beruf gekommen sei. Sie sagte natürlich, sie hätte sich schon immer dafür interessiert. Sie sah auch so aus. Sie hatte lange Nägel und viele Ringe an den Fingern und große dunkle Augen, und wenn sie sich beim Weissagen über die Karten beugte und mich fixierte, kam sie meiner Vorstellung von einer kartenlegenden Zigeunerin schon ziemlich nahe. Ich fragte, wie ihr Geschäft ginge. Sie war ausgebucht. Wahrsagen ist eine Wachstumsbranche, wie wir alle sie uns wünschen sollten, und sie hatte eine große Stammkundschaft. Kein Wunder mit diesen Augen. Und sie nahm 60 Mark pro Sitzung. Dafür ließ sich eine Menge Chinin kaufen.
»Ich sage alles, was ich sehe«, sagte sie, bevor sie die Karten aufdeckte. »Ich habe einmal einem Freund prophezeit, dass er in eine tödliche Gefahr geraten wird, und als das eingetreten ist und er überlebt hat, hat er eine Anzeige in die Zeitung gesetzt mit meinem Namen und meiner Telefonnummer. Seitdem ist das mein Beruf, und ich bin auch beim Gewerbeamt gemeldet.« Sie betrachtete die Karten und lächelte. »Sie haben ein ganz schön chaotisches Leben. Und demnächst kommt ein großer Bruch …«
Eine gute Wahrsagerin ist eine Mischung aus Hexe, Krankenpflegerin, Drogenpusher und Lebensberatung. Wenn sie dazu noch eine Frau ist, die gut aussieht, kann das, was sie weissagt, noch so vage sein, der Kunde wird sich nie geneppt fühlen. Er bekommt am helllichten Tag gesagt, was er im Dunkeln schon immer gespürt haben will, und das ist mehr als das mit dem Schampus und der Schickse, die auf Liebling macht.
Als wir durch waren, sagte die Wahrsagerin: »Jetzt lächeln Sie so süffisant.«
»Süffisant? I wo …« Mein Lächeln war nur ein Reflex auf ihr Lächeln, aber genauso gut hätte ich ihr sagen können, dass ich vom Finanzamt wäre. Dabei hatte das, was sie mir weissagte, einen höheren Wahrheitsgehalt als jede Steuererklärung. »Ich habe nur bedacht, was Sie mir gesagt haben.« Es klang ausgesprochen lahm. Vielleicht hätte ich lieber sagen sollen, ich bitte um Ihre Hand, Madame, und mich dann über diese gebeugt wie ein ausgebuffter Handleser, dachte ich. Ich war schon ganz kirre von all der Zukunft, die ich nun wusste.
»Interessieren Sie sich vielleicht für Gedichte?«
»Oh«, sagte ich, »warum nicht?« Ich wusste schon, was kam, und wirklich nahm sie das Manuskript und blätterte darin.
»Ich schreibe nämlich Gedichte«, sagte sie, »das habe ich schon immer getan, und jetzt habe ich sie ins Reine getippt. Darf ich Ihnen eins vorlesen?«
Sie las mir drei vor. Die Gedichte waren nicht ganz so gut wie ihre Augen, aber das sind Gedichte ja selten. Die Worte verschwammen in meinem Hirn, schmolzen wie Schneeflocken in lauen Lüften.
»Das letzte ist das beste«, sagte ich schließlich entschieden. Sie schien sich zu freuen. Wir verstanden uns schon ganz gut. Zwei Profis am helllichten Tag. Im Flur war der dritte Profi zugange. Es war der Mann von der Staubsaugerfirma. Der Staubsauger lief wieder. Das freute die Wahrsagerin noch mehr. Mit dem Staub haben wir ja wirklich Probleme. Ich ging dann. Der nächste Kunde wartete schon. Eine ältere Frau. Sie saß mit einem Ausdruck vor dem Spiegel, den wir vom Wartezimmer der Zahnärzte kennen. Die Zukunft ist eine schmerzliche Sache …
Ich erzählte meine Erlebnisse einer Dame, die sich für alles Außergewöhnliche interessiert. Sie war Feuer und Flamme. »Das möchte ich auch machen! Ich melde mich gleich an!«
»Mach es lieber nicht«, sagte ich.
»Warum?«, wollte sie wissen.
»Weil die Zukunft eine Droge ist«, erklärte ich ihr, »die genauso süchtig macht wie Fernsehen, Koks, Macht, Müßiggang. Ich spüre es ja schon, ich gehe durch die Straße und möchte den Leuten zurufen: Ha! Ihr wisst nicht, was euch blüht! Aber ich, ich weiß, was mir blüht! Und in drei Monaten gehe ich wieder zu der Wahrsagerin, die dann noch ausgezehrter sein wird vom Schicksal ihrer Kunden, und hole mir wieder eine Ladung Zukunft! Und so fort! Das ist ein besondrer Stoff, der Stoff der Zukunft! Der Astrologe warnt mich vor der Politik – wollt ihr nicht auch zu ihm gehen? Die Wahrsagerin prophezeit mir Chaos und Läuterung – habt ihr etwa keine 60 Mark dafür? Glaub mir, die Zukunft ist ein seltsames Gefühl.«
»Und diese Droge soll ich nicht probieren?«, fragte die Dame.
»Das Leben reicht doch«, sagte ich.
(tip2/1980)
Menschen auf Malta
Es ist bald Mitternacht, aber das kleine Hotel in der Nähe des Grand Harbour von Valletta bebt immer noch unter dem Getöse der Handwerker, und die Reisende aus der Schweiz in Zimmer 12 mit den eisengrauen Haaren und der schmalen Börse (schmäler zumal, seit ihr ein Moped-Ganove in Sizilien die Handtasche mit dem Geld fürs Schiffsbillett entrissen hat) nimmt eine zweite Schlaftablette und beschließt, morgen doch ein ruhigeres Quartier zu suchen. Vorübergehend wird das Cumberland Hotel (»quiet family residence«) dann nur noch einen Gast haben, den Dauermieter aus Pakistan, dessen Papiere so unklar wie seine Geschäfte sind, und der lange Stunden des Tages vor einer Tasse Beuteltee im Britannia Restaurant oder auf einem Korbstuhl im Vestibül des Cumberland verbringt, einen Stapel zerlesener Nummern von This Month in Malta im Schoß und viele hundert Jahre Einsamkeit in den Augen. Aber Peter Montebello, Manager eines Reisebüros und seit kurzem Geschäftsführer des Cumberland, dessen mittelalterlicher Charme bisher von der Installierung eines Wasserklosetts nur unwesentlich beeinträchtigt worden ist, weiß, dass er in diesen Wochen auf die Nachtruhe seiner Zufallsgäste keine Rücksicht nehmen kann, wenn er pünktlich zum Saisonbeginn im März der Familienkundschaft mehr bieten will als gruftähnliche Schlafgewölbe, blutgierige Moskitos und einen Blick in den »spanischen Innenhof«. Auf Malta war schon im Mittelalter nicht viel Platz.
Mr. Montebello ist ein Mann Mitte 30, dessen angenehme Manieren von seiner hektischen Betriebsamkeit nur selten durchkreuzt werden. Er ist ein alter Hase in der Tourismus-Branche (seine erste Auslandstour hat er mit 15 Jahren auf die Beine gestellt) und bringt mit der gleichen Selbstverständlichkeit Malteser zu den Fußballeuropameisterschaften nach Italien, mit der er für englische Kunden mit dem Flair für das Besondere sogenannte »medieval evenings« organisiert. Wenn er bei der Modernisierung des Cumberland Hotels zunächst einmal das Büro von Viaggi Montebello auf Hochglanz bringt, dann zeigt sich darin die glückliche Natur des mediterranen Geschäftsmannes, das menschlich Naheliegende mit dem Vorteilhaften zu verknüpfen und es mit lateinischem Augenmaß dekorativ zu gestalten. Dabei hat Montebello in diesen Nächten einen Arbeitstag von 14 Stunden hinter sich. Aber nicht für ihn und nicht für die ebenso hart arbeitenden Ladeninhaber und Marktleute, die Handwerker, die Kneipiers und die fliegenden Händler am Bus-Terminal ist das Denkmal gedacht, das der Minister für Arbeit und Sport am 27. Januar 1980 in Msida der staunenden Öffentlichkeit enthüllt und das auf dieser Insel im Herzen des Mittelmeers einen in Stein gehauenen Gruß von den Stalinalleen dieser Welt hinpflanzt: »Die Werktätigen sind es, die dieses unser geliebtes Land in jeder Hinsicht auf der Straße zu Fortschritt und Frieden vorwärtsbringen.«
Workers’ Monument heißt das Ding also, und wenn es auch nicht sehr viel kitschiger ist als einiges, was man in den zahllosen Barock- und Neobarockkirchen des Archipels sehen kann, ist es doch um vieles geschmackloser: Denn natürlich sind es nicht die »Werktätigen«, die das Land regieren, sondern es ist die Labour Party, an deren Spitze seit 30 Jahren Dom Mintoff steht, Ministerpräsident mit autoritären Neigungen, Vertrauter des Obersten Gaddafi, Leader einer populistischen Bewegung, die das winzige Land auf gefährliche Weise gespalten und an jene Klippe manövriert hat, von der es zum Verlust der bürgerlichen Freiheiten und der staatlichen Unabhängigkeit nur noch ein winziger Schritt ist.
Einer der Arbeiter, die das Workers’ Monument eigentlich ansprechen soll, nennen wir ihn Johnny, geht abends mit mir auf einen Drink in die Strait Street, und weil wir dabei in der Republic Street, dem Corso der Stadt, am Club der Labour Party vorbeikommen, sagt er: »Dieser fucking Labour Club hat wieder einmal alle Lichter an, und der National Club« – wir gehen am Queen’s Place vorbei, und er deutet auf eine verrammelte Tür aus solidem Gusseisen – »hat wieder zu. Da sind diese fucking Labour-Typen letzten Oktober mit Benzinkanistern eingedrungen und haben alles in Brand gesetzt, und die fucking Polizei hat lächelnd zugeschaut, und dann sind sie zum Haus von Eddie« – Dr. Eddie Fenech Adami ist der Chef der oppositionellen National Party – »und haben seine Frau verprügelt, und dann haben sie die Times in Brand gesetzt. Fuck ’em.« Er spuckt aus.
»Und warum?«
»Weil irgendein Spinner mit einer Knarre im Büro von Mintoff aufgetaucht ist und rumgeballert hat.«
»Ein Spinner?«
»Vielleicht war er auch ein Agent. Zeugen, die im Prozess ausgesagt haben, wurden im Gerichtssaal von Labour-Typen zusammengeschlagen. In diesem fucking Land ist eine ganze Menge Scheiße am Kochen, al-madonna!«
Al-madonna ist im Maltesischen ein ziemlich obszöner Fluch, und selbst manches Mädchen in der Strait Street hört ihn nicht so gern. Die Strait Street ist eine enge Gasse, die so etwas wie die »sündige Meile« von Valletta sein soll. In Valletta gibt es womöglich fast so viele Bars wie Kirchen, und in der Strait Street gibt es auf jede Bar fast so viele Mädchen wie Kakerlaken, aber wenn in der Strait Street die Sünde ansässig sein soll, dann muss sie so durchsichtig wie Abendluft und so sanft wie die Lilien auf dem Felde sein, von denen schon Jesus sprach, wenn er an die Liebe dachte. Ich habe mich dort umgesehen und nichts Sündigeres entdeckt als zwei Kakerlaken, die im Playgirl in einer alten Wurlitzer auf Elton Johns Titel Don’t go breaking my heart in den Clinch gingen, eine aus dem Leim gegangene Veteranin mit gebleichtem Haar und einer Schwäche für deutschsprachige Fernfahrer (»Prost, Schätzken!«) und eben die Girls, die, statt etwas so Unökonomisches zu tun wie zur Schule zu gehen, mit ihrer unaufhörlichen Litanei – »Buy me a drink?« – die Menschen der Strait Street vor noch größerer Armut bewahren.
In der Strait Street versaufen Jungs wie Johnny ihren Lohn, bevor sie wieder in die Wüste geschickt werden. Johnny gehört zu den 10000 Maltesern, die auf den Ölfeldern arbeiten (während andre von Gaddafis Polizei im Umgang mit leichten Maschinenwaffen ausgebildet werden), und er verdient in jeweils sechs Wochen Schufterei umgerechnet 2500 Mark. Viel für maltesische Verhältnisse, aber nicht genug, findet Johnny, für sechs Wochen Libyen.
»Magst du denn eure arabischen Freunde nicht?«
»Al-madonna«, sagt Johnny und bestellt eine neue Runde.
Die meisten Malteser, mit denen ich gesprochen habe, mögen die Araber nicht, und sie haben Angst davor, dass ihre Regierung sie an das Gaddafi-Regime ausliefert. Die Malteser fühlen sich als Europäer, und ihre Geschichte gibt ihnen recht. Auf diesen Inseln gibt es Zivilisation seit 3000 Jahren, trafen Karthager auf Phönizier, Römer auf Griechen, Araber auf Italiener, hier war Odysseus bei Calypso zu Gast (»Buy me a drink?«), predigte der schiffbrüchige Paulus, malte Caravaggio sein Meisterwerk Die Enthauptung Johannes’ des Täufers. Malta, in der Mitte des Mittelmeers, auf halbem Weg von Gibraltar nach Zypern, war ein Vorposten Europas und das strategische Herzstück des britischen Empire im Mittelmeerraum. Über Malta leiteten die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Invasion Italiens ein, und im War Museum kann man zwischen den Minen und Stuka-Fetzen und Spitfire-Propellern auch Photos von den Bombenangriffen besichtigen, die die Luftwaffe in der »Schlacht von Malta« flog.
Obwohl seit 1964 unabhängig, hat Malta sich wie wohl alle Länder des alten Empire seine britischen Eigenheiten bewahrt, bis hin zu den roten Briefkästen, dem lauen Ale, dem abartigen Geschmack von Liver & Bacon with Chips & Peas. Bizarr, hier im Herzen des großen europäischen Meers den Fraß aus den billigen »Cafés« von Dover bis Aberdeen vorgesetzt zu bekommen; angenehm zu erleben, wie die Originalität der Malteser durch englische Korrektheit bereichert, aber nicht verwaschen wurde; interessant zu erfahren, dass auch das britische Establishment die Insel nicht aus den Augen verloren hat. An der Bar des Phoenicia, eines Hotels im alten Kolonialstil, treffe ich den Herausgeber einer Londoner Manager-Zeitschrift, der nebenbei Kunst- und Reisebücher schreibt. Er war seit zwei Jahren nicht mehr hier, heute hat er einen Vortrag vor Geschäftsleuten gehalten. Die Spannungen sind ihm natürlich geläufig, die Atmosphäre, sagt er, ist gefährlich, die Schüsse, die jetzt am Hindukusch fallen, sind in Malta deutlicher zu hören als anderswo in Europa, so winzig das Land ist, so unbeträchtlich seine wirtschaftliche Bedeutung, Europa steht auch hier auf dem Spiel.
Ich stehe auf der alten Schussrampe von Mdina und blicke über die Insel. Mdina war die Hauptstadt Maltas, als es zum Königreich Aragon gehörte, hier lebten die städtischen Adligen in einer mit hohen Bastionen bewehrten, engen und dunklen Feste und kontrollierten von dieser einzigen Anhöhe Maltas aus das Land. Mit ihrer Herrschaft war es vorbei, als 1530 Karl V. dem von den Türken aus Rhodos vertriebenen Johanniterorden Malta als neue Heimstatt schenkte. Die Johanniter – eine Art Fremdenlegion Gottes, die sich aus europäischem Adel rekrutierte – sahen richtig voraus, dass die Türken den Versuch machen würden, Europa auch im Westen anzugreifen, es über Italien und Spanien aufzurollen. Die Große Belagerung Maltas durch die Armee Suleymans des Prächtigen im Sommer 1565 ist eine der Sternstunden europäischer Geschichte geblieben. Dass es den Rittern mit ihren maltesischen und europäischen Hilfstruppen, insgesamt kaum 9000 Mann, gelang, die Elitetruppen des Osmanischen Reichs, 40000 Janitscharen und Spahis, die auf 190 Schiffen gelandet waren, entscheidend zu schlagen, wobei die italienischen, spanischen, deutschen und englischen Höfe so gut wie tatenlos zusahen, ist eines der Wunder, die unsre Zeit nicht mehr kennt, wie sie den Glauben nicht mehr kennt (oder nur noch in der Tagesschau wahrnimmt), der dem Schwur der Ritter zugrunde lag: »Wir für unsern Teil sind die auserwählten Soldaten des Kreuzes, und wenn der Himmel von uns verlangt, unser Leben zu opfern, dann gibt es keine bessere Gelegenheit als jetzt. Lasst uns, meine Brüder, zum Heiligen Altar eilen und unsre Gelübde erneuern und durch unsern Glauben an die Heiligen Sakramente uns jene Todesverachtung zueignen, die allein uns unbesiegbar macht.«
Unten liegt das kleine Land, jeder Fußbreit Boden wichtig, gehegt, bewohnt, genutzt, Gozo im Dunst, und ringsum das tiefblaue Meer, manchmal ein weißer Schimmer, ein Schiff. Seltsam, aber vielleicht zwingt gerade die Enge des Raums auch den flüchtigsten Touristen dazu, jeden Schritt seines Wegs achtsamer zu gehen und die Straßen und Häuser, die Gärten und Felder mit dem wenigen, was wächst, genauer ins Auge zu fassen. Dass Reisen zu uns selbst führt, wenn es nicht bewusstlos macht, ist eine alte Wahrheit, die jeder immer neu erfahren darf. Seltsam, auf diesem Felsen im Meer zu stehn und die Schiffe der Eroberer zu sehen, die den Strand verlassen, und dort im blutigen Sand liegt der Körper eines Fremden, der kam, um zu töten, und selbst getötet wurde, und einer nimmt ihm den Armreifen aus Gold, und ein andrer liest die arabische Inschrift vor: »Ich komme nach Malta nicht des Ruhms oder des Reichtums wegen, sondern um meine Seele zu retten.«
(tip4/1980)
Durch Deutschland
Eine Frau in einem Goldlaméanzug zog einen dicken Jungen aus einem Modegeschäft. »Bis nächstes Jahr reicht das, und dann soll Papi dir was kaufen!« Der Junge stand schon vor dem nächsten Schaufenster. An der Ecke erbrach sich ein Bleicher in den Papierkorb. Zwei Polizisten tauchten aus dem U-Bahnschacht auf. Eine verkrüppelte Taube hinkte ihnen hinterher. Der am Papierkorb wischte sich den Schmant von der Lacklederjacke. Die Polizisten beachteten ihn nicht. Mutter und Sohn verschwanden in einer Boutique. Jedes zweite Geschäft war eine Boutique, jedes dritte eine Apotheke. Der Bleiche ging ins Terrassencafé. Früher hatten dort die Pelzhändler und Grundstücksspekulanten ihre blonden Frauen mit Torte gefüttert. Jetzt fütterten die Heroinhändler ihre Kunden mit dem bitteren Zucker des Todes. Ich war wieder in Frankfurt. Auf der Nikolaikirche stand neben dem obligaten Ⓐ – madness …
Durch Deutschland reisen heißt auch, seine Zeitungen zu lesen. In Frankfurt gibt es drei, die diese Stadt und die ganze Republik repräsentieren: FAZ, Rundschau und Pflasterstrand. Liest man alle drei hintereinander, hat man den Zynismus und die Menschenverachtung, mit der das Geschäft der Politik und die Politik des Geschäfts betrieben werden; man hat den Humus, auf dem die Union von Bonzenbürokratie und Big Business gedeiht, die jeder Demokratie hohnspricht und in deren Sumpf auch unser Gemeinwesen umzukommen droht; man kann bis in seine dekadentesten Verästelungen den kulturellen Überbau verfolgen, den sich die Kartelle leisten, solange die Geschäfte nicht gestört werden; und man kann darüber verzweifeln, wie die Sprache der Subkultur in den Sponti-Gazetten verkommt, wo mit andrer Menschen Meinungen umgegangen wird wie weiland, als die morschen Knochen zittern sollten. Der rüde Ton, der dort gepflegt wird, entspricht so perfekt dem Zynismus mancher Leitartikel der FAZ, dass man darüber ins Verwundern kommen könnte, wüsste man nicht, dass alle Politik den Charakter verdirbt, sobald sie ihn mit der Ideologie in Berührung bringt. Dass die Deutschen immer noch Meistertenöre stellen, was die Idealismus-Arien angeht, erfuhr man nach der Wahl in Baden-Württemberg, als Herr Hasenclever vom Lebensraum sprach, den der Deutsche, auf dass sich die Welt begrüne, wiederherstellen müsse. Vielleicht hatte er auch Hitlers Tischgespräche gelesen. Der Spiegel servierte sie uns ja gerade in Appetithäppchen. So gedeiht Wachstum eben aus jeder Kloake.
Ich sah den Vertreter der grünen Schwaben im Fernsehen in einer Imbissstube in der Schillerstraße. ›Zur Tagespresse‹ hieß der Laden. Ich war ganz überrascht, dass es ihn noch gab. Hier hatte ich schon vor 20 Jahren das eine oder andre Bier getrunken, ein Junge mit großen Augen, Samstagabend in der Stadt, später noch eine Bratwurst im Central und ein Spielchen mit dem Automaten, während in der Box Tom Dooley lief, und hatte man alle Groschen verloren, ein langer Heimweg zu Fuß durch die Amisiedlungen und Laubenkolonien unter einem Himmel, der noch frei von Satelliten war.
Die ›Tagespresse‹ schien der einzige Ort in Frankfurt, an dem keine Veränderungen gewütet hatten. Die alten Fettflecken auf der alten Wand, die alten Evergreens in der alten Box, die alten Würstchen auf dem alten Rost. Das wohlige Gefühl von Geborgenheit im vertrauten Dunst von Pisse, Bier und Bratfett. Der alte Fernseher mit seinem wackligen Schwarzweißbild, die alten Typen im Tran davor, die alte Sache mit den alten, aber ewig jungen Frauen, und auch der junge Herr Hasenclever schwärmte von den alten, aber ewig jungen Werten. Vor lauter Rührung bestellte ich ein Rippchen mit Kraut. In der Box sang Heino vom alten Wald. Mochte die Stadt ihre Türme immer höher bauen und mochten ihre Banken vollends futuristischen Bordellen gleichen, mochten die Volksvertreter das Land längst an die Kartelle abgetreten und die Kartelle unsre Zukunft an die schnelle Mark verpfändet haben, mochten die Straßen bald so unbegehbar wie Todesstreifen und die Menschen so vergiftet wie die Erde sein – in der ›Tagespresse‹ war man bei der Zivilisation aus Zeiten geblieben, in denen der Krebs der Geldkultur erst unsre Mägen anfraß und noch nicht unsre Seele zerstört hatte. Das Rippchen schmeckte entfernt, wonach, blieb zu ahnen. Herr Hasenclever holte Luft, und dann ging jemand aufs Klo, und wir hatten Bildstörung. Niemand schien es etwas auszumachen. Eine Frau mit eingefärbten blonden Strähnen in ihrem grauen Haar knabberte am Ohr ihres Begleiters, der bewegungslos auf den Bildschirm starrte. Dann flackerte wieder der Grüne über die Mattscheibe und sagte: »Eine Umwertung aller Werte«, und ich ließ alles liegen und ging …
Wenn man durch unser Land fährt, merkt man es bald: Wie Frankfurt »die Stadt« ist, so ist die BRD »der Staat«. Der Staat ist überall, und alles ist Staat. Nach den Gesamtschulen haben wir nun den Gesamtstaat. Und wenn wir erst die fälschungssicheren Ausweise haben, werden auch die fälschungssicheren Gehirne nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mit den Personaldaten sind dann auch die Personalgedanken gespeichert. Sie werden jeden Morgen mit der Zeitung und jeden Abend mit dem Fernsehen abgerufen und gezählt, dass der Staat weiß, es sind noch alle da. Es darf keiner fehlen, aber hinzukommen darf erst recht keiner. Damit das sichergestellt wird, liegt über dem Gesamtstaat und hinter der Gas-, Ruß- und Bleisphäre noch eine Sphäre, die Kultur. Wir haben, wie jetzt auch von der »liberalen« Presse endgültig festgestellt wurde, zwei Kulturen, d.h. eine Gesamtkultur. Es ist eine Wachstumsbranche. Je mehr Maschinen und je weniger Arbeit es gibt, desto umfassender muss die Zerstreuung organisiert werden. Je weniger sie ausdrückt, umso lauter dröhnt die Musik. Je weniger wir zu sagen haben, desto rabiater gibt sich die Sprache. Was der Gesamtstaat uns wegnimmt, muss die Gesamtkultur uns scheinbar zurückgeben. Die Fabriken dröhnen, die Discos dröhnen, die Politiker dröhnen, die Politisierten dröhnen, die Städte dröhnen, die Himmel dröhnen, die Kultur dröhnt am lautesten – von Dröhnung zu Dröhnung hetzen die Bosse, die Regisseure, die Bandenführer, die Betriebsprüfer, die Pauschalreisenden, die Poeten, die Fernsehpfarrer, die Karnevalsorganisatoren, die Kulturverwalter, die Haus-, Stadt- und Staatsbesorger samt Kind, Kegel und Sicherungsgruppe, eine ganze Bevölkerung wie die Beat Generation, immer on the road – nicht aber auf der Suche nach dem bengalischen Feuer der Ich-Verbrennung, sondern um der Stille zu entgehen, die immer zu sagen scheint: Und siehe, alle deine Werke sind nichts.
Auch ich war unterwegs, mochte nirgendwo innehalten, war zum Kaffee noch in Frankfurt und in Köln schon zum Bier und musste immer weiter. In Oberhausen erwischte mich die Nacht. Die Luft schmeckte nach verkohlten Knochen. Ein eisiger Wind fegte von den Straßen, was nicht im Auto saß. Aber an jeder Ecke standen Türken in ihren Plastikjacken oder Fischgrätmänteln wie im Glanz einer Sonne, die nur für sie schien. Im Hotel Ruhrland lag ein Buch neben der Bibel. Ich schlug es auf. Es war Lyrik, Gottes Hausschuh von Walter Buhrow, Oberhausen 1976. Ich las: »Die Erde hat noch Angst. Der Wind, / der durch die Äste pfeift, ist eisig, / doch ist der Schnee schon harsch wie Grind. / Vor Knospen singt ein Zeisig.« Wer je seiner Ziele so überdrüssig wie seiner Wege in einem typisch westdeutschen Provinzhotel abgestiegen ist, zu müde, um zu schlafen, und zu durstig, um zu trinken, der weiß, dass so ein Buch einen Abend retten kann. Ich las jede Zeile: »Du kannst / eine Seele nicht trinken, / sie läßt / sich nicht keltern wie Wein, / du kannst nur in sie versinken – der Durst / wird unendlich sein.«
Zwei Tage später erwachte ich in einem andren Hotel in einer andren Stadt und wusste nicht, wo ich war. Die Tapete kam mir bekannt vor, auch der Himmel, ein Fetzen bleiches Laken im Fenster, und natürlich das ferne Dröhnen des Verkehrs. Meine Zunge war schwer wie ein Reibeisen, meine Kehle trocken wie ein Kamin. Also durchgemacht, aber wo? Ich wagte einen Blick hinaus. Alle deutschen Städte sehen, wo der Reisende absteigt, fast gleich aus, immer steht da ein Finanzamt, ein Bahnhof, ein Supermarkt, ein Sexkino, und in der Fußgängerzone fiedeln die Straßenmusikanten und piepsen die Computerkassen. Hier stand nun ein Verwaltungstrakt der RWE. Da bist du ja richtig, dachte ich. Weiter hinten schien aber Sonne zu sein, Bäume, ein feiner Dunst zwischen Kirchtürmen und Horizont, und schon fiel mir ein, wo ich abgeblieben war: Wesel, Kreisstadt am Niederrhein, Schillerdenkmal, Willibrordidom, und gestern hatte ich auf einem Parkplatz ein Aquarium mit lebenden Haien gesehen und dann ein Bier getrunken … oder zwei?
Es waren Ammenhaie, wie die Stimme uns mitteilte, die von einem Tonband ablief, fünf fahle Fleischfresser, die in dem engen Gefängnis ihre Runden drehten, bis ihnen der Vorführer mit einem Haken ihr Fressen verabreichte – rohe Brocken Heilbutt. Die Ammenhaie hatten ziemlich große Zähne. Es war die erste Show mit lebenden Haifischen in Europa. »Können die da auch nicht raus?«, fragte ein Steppke seine Mutti. »Nee«, sagte Mutti, »da ist doch lauter Glas drum.« Der Kleine schien nicht überzeugt. Er wusste noch nicht, dass die gefährlichsten Raubtiere um ihn standen.
Auch Wesel hat seine Fußgängerzone, auch in Wesel steht auf dem Dom das schon fast alberne Ⓐ, auch in Wesel heißt die Nachtbar Tabu und gibt es den Scotch Club, wo ich dann mit der Bedienung über das Leben als solches und im Detail palaverte, bis der Laden dichtmachte. Also ging ich mit meinem Nachdurst in die altdeutsche Pilskneipe neben dem Hotel. Es war Samstagmittag, und am Tresen drängten sich die Männer mit den Hüten und den roten Gesichtern. In der Box dröhnten die Pink Floyd: »Just another brick in the wall …«
»Woher sind Sie? München? Menschenskind, und wir hatten gerade Strauß in der Niederrheinhalle. Klar, gerammelt voll, alles für Franz Josef, was trinken Sie, Mann? Ich will Ihnen mal wat erzählen – wenn’s die CDU mit Strauß nicht schafft, braucht sie erst gar nicht mehr anzutreten, dann haben wir nochmal 20 Jahre Sozi, und ich mach dicht und geh nach Australien …«
Auch die Jugoslawen hatten Sorgen, Tito lag immer noch im Koma. »Tito stirbt für uns! Aber wenn die Russen kommen, dann kämpfen wir bis zum letzten Mann! Ja!«
»Dann kommen wir auch wieder«, machten ihm die Routiniers Mut, »dann gibt es glasklar Krieg.«
Das fanden alle in Ordnung. Noch mal Pink Floyd: »We don’t need no education …«
Ich ging dann durch das Städtchen. Wollte zum Rhein. Machte noch in den Marktstuben am Dom Station und kam mit einem seltsamen Mann ins Gespräch. Einer von den letzten Stillen im Land, Reisender für obskure Waschmittelfirmen, klapperte die Wochenmärkte ab. Alles an ihm war gedämpft: das braune, ordentlich gescheitelte Haar, das rostrote Hemd, der dunkelbraune Schlips, der noch dunkelbraunere Anzug aus einem billigen Ersatzstoff, der grünbraun changierende Regenmantel, auch das wettergegerbte Gesicht mit den braunen Falten und den sanftblauen Augen. Er musste weit über 50 sein. Einer mit einem Beruf, den es bald nicht mehr geben wird. Ein Reisender für Firmen, die keiner mehr haben will. Ein Veteran der Bummelzüge und Landstraßen, der Christlichen Hospize und der Stehausschänke im Schatten der Kirchen und Präsidien. Ein Mann ohne Familie, ohne Haus, ohne Zukunft. Aber er machte nicht viel davon her, er trank sein Pils in kleinen Schlucken, rauchte seine Reval mit gedämpftem Behagen und sagte: »Ich brauch ja nicht viel. Um den Kopf wo hinzulegen, ja. Ich hab da einen alten Wohnwagen vorm Wald. Nachher geh ich nach Haus, mach mir meine Bratkartoffeln, ein Ei dazu, und lese. Das genügt doch. Manchmal fahre ich nach Holland rüber, kaufe ein, was es billiger gibt, Zigaretten. Viel ist es ja nicht mehr. Früher hab ich eine Woche Urlaub gemacht, das brauch ich jetzt nicht mehr. Wissen Sie, was der Mensch braucht? Ein Stück Erde, um verbuddelt zu werden. Was machen Sie beruflich? Ah ja, also auch mal hier, mal dort – immer auf Tour …« Wie er das sagte, blickten wir auf alle staubigen Landstraßen der Welt, auf die Busse, die uns dorthin brachten, woher wir gekommen waren, in die alten vier Wände mit den alten Flecken und dem Warten auf den alten Tag.
Wir gingen zum Rhein, standen an einem Kiosk und betrachteten den Strom. Ihm war alles gleich. Die Westfalen tuckerte vorbei, und auf Deck standen die Wochenendausflügler und grölten. Immer muss Lärm sein, überall waren wir ihm ausgeliefert. Unser Grundgesetz sagt im ersten Satz, die Würde des Menschen sei unantastbar, aber das Leben wird immer würdeloser, nur selten trifft man noch einen, der allein mit der unendlichen Schmach des Menschen fertig wird, der verurteilt ist zu Gesamtschule, Gesamtstaat, Gesamtkultur und dem ewigen Gedröhn der Menge. Hier in Wesel hatte ich einen getroffen, schon verschwand er in der Dämmerung am Rhein – hätten wir alle, wir Reisenden, einen solchen Abend.
(tip9/1980)
Box-Abend
»Dann, zum Durchqueren der
Stadt bereit,
in ihren weichen Wagen
Die Dichter und die Boxer …«
Arthur Cravan, Poet & Boxer
Aber außer ihnen durchqueren nicht allzu viele Schaulustige an diesem Abend vor dem Vatertag die Stadt München, um in der Olympiahalle Zeuge zu werden, wie der Mittelgewichtler Georg Steinherr, genannt »Hammer-Schorsch«, als erster Münchner Berufsboxer überhaupt nach dem Lorbeer und der Gage eines Europameisters greift.
Und das stimmt die Freunde des Boxsports nachdenklich und traurig. Wenn sich bei einem solchen Ereignis in der Olympiahalle nur an die 2500 zahlende Zuschauer verlieren, dann wird die Misere schon an den leeren Sitzen greifbar. Walter Staudinger, der mit seiner Peep-Show und dem Las Vegas so etwas wie eine Münchner Entertainment-Größe geworden ist, ist der Manager des melangebraunen Besatzungskindes, und er schustert seit Jahren daran, mit Steinherr als Zugpferd München zu einer Metropole im dahinsiechenden deutschen Berufsboxsport zu machen. Wenn daraus bisher nichts geworden ist, liegt das weniger an Staudingers fehlender Fortüne noch an mangelnden Fähigkeiten des Hammer-Schorsch, der immerhin als sauberer Stilist gilt; eher schon daran, dass das spezifische Münchner Ambiente für den ursächlich proletarischen Boxsport nicht gerade einen gesunden Nährboden abgibt; und wohl auch an der allgemeinen Übersättigung mit blutigen Sensationen, neben denen ein Boxmatch, ausgetragen nach den Regeln des internationalen Boxsportverbandes, wie ein Gänseblümchen in einer Welt von fleischfressenden Pflanzen wirkt. Wenn man dazu noch am Tag des Fights in einer Münchner Tageszeitung liest, dass die Veranstalter Staudinger und Graf im Falle eines finanziellen Misserfolgs daran denken, in Zukunft Boxkämpfe nur noch vor geladenen Gästen aus der ›High Society‹, verbunden mit Galadinner, Preis 500 Mark, zu veranstalten, dann wendet sich der Boxsportfreund mit Grausen. Boxen als Zugabe zur Modenschau oder zur Vernissage, als Anheizer für Schickeria-Soirees und Blutstropfen in den Champagnerkelchen der Boutiquen-Barone – »gestern hatten wir diesen herrlichen Travestie-Abend, heute stellt Konsul Weyer sein Schattenkabinett vor, und morgen boxt dieser wahnsinnig echte Nigger um die Weltmeisterschaft im Silbergewicht, sind wir nicht Spitze, Fonsi?« –, dann lieber gleich den Laden dichtmachen und ein Brett an die Hütte nageln: DAS BOXEN FINDET IN DER BUNDESREPUBLIK ERST WIEDER NACH DEM NÄCHSTEN ZUSAMMENBRUCH STATT.
»Wenn die Menschen wieder Hunger haben«, pflegte Ernst Wagner zu sagen, der bis zu seinem Tod im Februar 1980 Deutschlands älteste Boxschule führte, »dann lernen sie auch das Boxen wieder.«
Nun sind die Dichter versammelt, nun auch in der malvenfarbenen Dämmerung Cravans Geist, nun auch die Herren samt Damen der dem Boxen immer noch in fast rührender Treue verbundenen Gewerbe, nun auch die Männer und Frauen der jugoslawischen, türkischen, italienischen Kolonien – ohne sie sind Boxveranstaltungen in München überhaupt nicht mehr denkbar –, nun auch die Vertreter der Europäischen Box-Union und andere Funktionäre, nun aber nur schwach vertreten der Glitzer, der Möchtegernglamour dieser Provinzstadt – ob Herr Staudinger wirklich an die Bereitwilligkeit dieser Kreise glaubt, den dahinsiechenden Boxsport an ihre Silikontitten zu nehmen? Und nun schlägt auch schon der berühmte Gong.
Kenner sagen, dass die Vorkämpfe oft das Salz in der Suppe sind. Das könnte schon auf den ersten Kampf des Abends zutreffen: Wolfgang Lechner (Erding) – Brahim Ferizović (Jugoslawien), Mittelgewicht, 4 Runden. Zwei robuste Kämpfer, angefeuert von ihren Lokalfans. Der Jugoslawe mit gewaltigen Narben auf dem Bauch. Magenoperation, Messer, eine obskure makedonische Tätowierung? Kein schöner Kampf. Zwei Klopper am Werk. In der 3. Runde macht der Mann vom Balkan Ernst, drängt den Erdinger in die Seile, erwischt ihn voll am Kinn. Die Ecke wirft das Handtuch. Immerhin, ein erdnaher Auftakt. Vielleicht als Augenweide zwischen dem Kaviar und dem Trüffelparfait? »Kellner, räumen Sie ab.« Ein Boxer, der geschlagen in die Kabine geht, hat immer noch mehr Ehre als ein Achtgroschenjunge in Amt und Würden.
Durch die Fenster der Halle, in der so unterschiedliche Veranstaltungen wie das Sechstagerennen oder der eucharistische Weltkongress abgehalten werden, wo Udo Lindenberg nie richtig gehört wird und Didi Thurau allen davonfährt, sickert das letzte Licht. Um den Ring kommt Stimmung auf, als Toni Habermayer (München) in seinem ersten Kampf als Profi den Türken Ethem Özekalin, einen Veteranen zahlloser Vorkämpfe, langsam aber sicher über die 6 Runden niederkämpft. Auch das ist Boxen, wird Boxen immer sein: Für ein paar Mark Gage kämpfen diese zwei von keiner Gnade beseelten und von keinem Stern erleuchteten Männer achtbar, nach Maßgabe ihrer Kräfte, ehrlich und im Einklang mit den Regeln ihres Sports um einen Sieg, der den Sieger nicht reich und den Geschlagenen nicht zuschanden macht. Kämpfen sie am Ende nicht darum, sie selbst zu sein?
»Toni, arbeite jetzt!«
»Toni, du musst entschlossen sein!«
»Toni, marschieren!«
Toni marschiert, Toni ist entschlossen, Toni arbeitet jetzt, und Toni siegt: Dies ist das Salz, das kein Austernsoufflé je bereichern wird.
Im dritten Vorkampf tritt Frank Wissenbach an, amtierender deutscher Meister im Mittelgewicht, einziger Deutscher in den Weltranglisten von WBA und WBC. Ihm genügte eine mäßige Leistung, um vor einigen Monaten seinen Titel gegen Steinherr, den um vier Jahre älteren, aber um viele Kämpfe unerfahreneren, zu verteidigen. Wissenbach ist ein idealer Mittelgewichtler, groß, sehnig, mit Puncherqualitäten, ein schnauzbärtiger Berliner, die Hoffnung. Dass nicht er, sondern Steinherr heute um die Europameisterschaft kämpft, gehört zu den Eigentümlichkeiten des Sports, der eben auch eine Branche ist. Wissenbach fertigt seinen Gegner, den italienischen Meister Lassandro, der sich sämtliche Sympathien schon dadurch verscherzt, dass er fünf Minuten zu spät in den Ring klettert, in zwei Runden ab – mit Nasenbeinbruch, k.o. Ein Kampf, der in der Pause schon vergessen ist. Auch das ist Boxen.
Nach der Pause – dem Pappbecher Bier, den Pikkolos für die Damen, den Toiletten, den Tête-à-tête, dem Branchengeflüster, den letzten Wetten – die erste Überraschung des Abends: Nachdem die Matadore den Ring betreten haben, Steinherr mit seinem italienischen Trainer, dem ›Boxpapst‹ Branchini samt Dolmetscher, und Kevin Finnegan, der Titelverteidiger aus England, steigt Ivan Rebroff in den Ring und singt mit allem Gusto, dessen er fähig ist, die Hymnen – ehrlich: Das Deutschlandlied aus dieser Brust rührt auch den hartgesottensten Vaterlandsverächter. Donnernder Applaus, vielleicht umso lauter, als keiner mitgesungen hat. Ring frei zur ersten Runde.
Und zur wirklichen Überraschung.
Kevin Finnegan ist ein 32-jähriger »no-nonsense«-Nordire, starker Techniker, das weizenblonde Haar korrekt gescheitelt, das Gesicht gezeichnet von harten Fäusten, den Ringschlachten einer Karriere, die große Siege und vernichtende Niederlagen kennt. Wer ihn beim Sparring gesehen hat, gibt dem Herausforderer Steinherr, der dafür bekannt ist, nicht nachsetzen zu können, keine Stamina zu haben, nur minimale Chancen – auch wenn Staudinger einen fast schon aufreizenden Optimismus verbreitet.
Aber schon in den ersten zwei Runden zeigt Steinherr, dass er bei seinem neuen Trainer eine Menge gelernt hat. Der Hammer-Schorsch, wegen einer zwielichtigen Frauengeschichte vor kurzem noch wochenlang in U-Haft, beginnt den Kampf in großer Manier – gute Beinarbeit, die Jabs kommen genau, er erwischt Finnegan kalt: Der Brite blutet. Das Publikum wittert die Sensation. Finnegan rettet sich nur mit Mühe in die 3. Runde, die auch an Steinherr geht. Aber der Schorsch bringt seinen Hammer nicht an, Finnegan wird stärker, der Routinier zeigt seine Erfahrung. Die 5. Runde geht an ihn. Jetzt kommt er, raunen die Fachleute. Die englischen Fans fassen Tritt. Selbst die ständigen Begleiterinnen begreifen, dass sie keine Show, sondern einen Kampf sehen.
Und der Kampf kommt in seine entscheidende Phase – wenn der Titelverteidiger noch einmal seine Krone versilbern will (Finnegan bekommt für den Kampf 85000, Steinherr 30000 Mark), dann muss er mehr zeigen. Aber Finnegan bleibt merkwürdig blass. Das ist der Mann, der all die grandiosen Weltmeisterschaftsschlachten gegen Marvin Hagler und Alan Minter geschlagen hat? Der in Paris Gratien Tonna schlug und zum zweiten Mal nach 1974 den Europameistertitel gewann? Das englische Fernsehen ist dabei. Der Kampf wird auf der Insel übertragen. Muss Britannia auch an diesem Abend geschlagen ihre Wunden lecken? Finnegans linkes Auge ist fast zu. Aber trotzdem geht er. Und Steinherr – eine kleine Sensation schon dies – weicht dem Fight nicht aus, er riskiert den offenen Schlagabtausch, der Mann der Technik und des Schulbuchstils entdeckt sein Kämpferherz.
Das Hemd des Ringrichters ist rot vom Blut des Titelverteidigers.
Wer jetzt noch wettet, setzt alles auf Steinherr.
Und der Kampf geht weiter.
Nach der 10. Runde sagt jeder: Jetzt hat der Schorsch ihn. Wenn er jetzt durchhält, hat er ihn. Alle haben ihn vorn – 7:3, 6:4, jedenfalls vorn. Der Brite muss einen K.o. machen. Und Steinherr wehrt sich erbittert, mehr – er sucht immer noch seine Chancen, bleibt am Mann, bleibt schnell, steckt keinen entscheidenden Treffer ein, bringt zwar auch selbst nichts mehr unter, aber beim letzten Gong ist er ungezeichnet, er hat den Kampf gemacht, weiß Finnegan noch, wo er ist?
Steinherrs Ecke triumphiert. Die Fans stehen Kopf. München hat seinen Europameister. Wir brauchen keine 500-Mark-Shows. Wir dürfen weiter unsre Pappbecher haben, unsre Zigarren auf dem Boden ausmachen, Ivan Rebroff wird die Bayernhymne singen.
Auch Finnegan wird auf den Schultern durch den Ring getragen, aber das ist natürlich Mache, jeder, der nicht am Boden liegt, zieht diese Nummer ab, sie gehört dazu, forget it.
Der Ringrichter gibt das Ergebnis bekannt:
Unentschieden.
Einen Augenblick lang – einen Herzschlag, einen Lidschlag, einen Nervenriss lang – Totenstille, dann bricht der Sturm los. Schiebung, heißt es. Wer kann das schon sagen. Wenn der Herausforderer in seinem Revier den Kampf macht und ihn doch verliert (denn mit dem Unentschieden bleibt Finnegan Europameister), dann heißt das: Seine Fäuste trafen zwar, doch lag kein Gewicht dahinter. Das Gewicht, das wirklich zählt. Mit Steinherr hat der ganze deutsche Boxsport den Titel verfehlt, ist diese Republik dort geblieben, wo sie im Berufsboxsport schon so lange steht: draußen vor der Tür.
Und die Münchner Fans sind eben auch Bundesrepublikaner, auch ihrem Protest fehlt die Stamina, in Spanien, in Italien, in Mexiko müsste die Polizei einschreiten, die Richter wären ihres Lebens nicht sicher, die Halle brennte lichterloh – wir bleiben schön, was wir waren und sein werden, Staatsbürger. Vielleicht verdienen wir doch den 500-Mark-Abend für die Schickeria-Schicksen, Boxen als Body-Show für müde Mädchen, München machts möglich: Und wenn alles nichts hilft, ziehn sie den Boxern Rollschuhe an und machen auch aus der Arena eine Discothek.
Bleibt zu erwähnen, dass im letzten Kampf – diesem undankbarsten aller Kämpfe, wenn die Leute schon gehen und die Putzkolonnen die Eimer aufbauen – Rüdiger Bitterling, eine junge Hoffnung aus Düsseldorf, ein Alternativ-Artist im Ring, seine Fans mit einem schwachen Kampf enttäuschte. Aber er bekam ihn zugesprochen. Auch das ist Boxen – der bittere Geschmack im Mund, wenn dein Favorit enttäuscht und dennoch gewinnt, obwohl der Gegner besser war.
Und der Boxer, der geschlagen ist, er ist eine lange Stunde – manchmal für immer – der einsamste Verlierer auf der Welt. Der Spieler kann sich erschießen, und der Politiker hat die Fernsehroboter, in die er seine Phrasen kotzen kann – »Auch an dieser Stelle möchte ich, Herr Nowottny, meinen Parteifreunden und Wählern danken«, »was unsere Verluste betrifft, Herr Schättle, ergeben die sich ja schon aus unseren letzten Gewinnen« –, aber der Boxer in seiner Kabine hat nur seinen Masseur. Und auch Masseure kneten lieber einen Sieger. Der Beobachter aber, der vor der Olympiahalle schon die ersten Wahlplakate an den Bäumen sieht, wünscht sich, dass auch Politiker dies durchzustehen hätten, allein im Ring mit allem, was sie haben, zwölf Runden, nach den Regeln des internationalen Boxsportverbandes, und, wie Hemingway wusste, winner take nothing.
(tip12/1980)