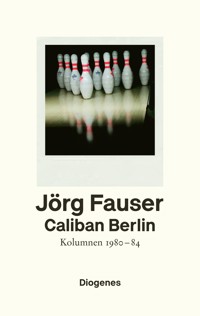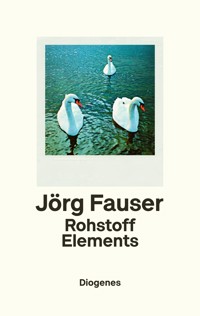20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Caro Carlo«, »Dear Harry« – so beginnen oft die Briefe und Postkarten, die sich Carl Weissner und Jörg Fauser über Jahre schrieben. Darin zu spüren ist stets die große Zuneigung füreinander, während die Themen um oft prekäre finanzielle Situationen, um Urlaube und durchzechte Nächte und um den großen Frust über das Konstrukt ›Literaturbetrieb‹ kreisen. Während Fauser in diesem nie wirklich Fuß fasste, hatte sich Carl Weissner mit den Übersetzungen von Charles Bukowski oder Songtexten von Frank Zappa bereits einen Namen gemacht und tritt oft als Ratgeber, beruhigende Stimme oder auch Lektor auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jörg Fauser | Carl Weissner
Eine Freundschaft
Briefe 1971-87
Herausgegeben und mit einem Gespräch eingeleitet von Matthias Penzel und Stephan Porombka
Diogenes
Eine Freundschaft.
Gespräch zum Briefwechsel zwischen Matthias Penzel und Stephan Porombka
ZWEI AUTOREN IN THE MAKING
So, jetzt noch mal schnell die Augen zu, bevor es losgeht. Lass uns dran denken, was man sich unter einem großen Briefwechsel zwischen zwei Autoren eigentlich so vorstellen könnte. Du fängst an.
Erwarten könnte man so was wie ein schriftliches Werkstattgespräch, wo sich die beiden intensiv über den Fortlauf ihrer Arbeit verständigen. Wo man erfährt, wie einzelne Texte entstehen.
Ja, es könnten sich auch private Welten öffnen, die sonst verschlossen bleiben. Familiäres. Intimes. Geständnisse, Bekenntnisse, geöffnetes Herz und so.
Oder so was: Zwei schreiben sich und leuchten dabei die Welt aus, in der sie leben und schreiben. Und dann sieht man durch die Briefe die Gegenwart aufscheinen: die Literatur, die Gesellschaft, die Leute, die Kultur, die politischen Entwicklungen.
Aber im Briefwechsel von Fauser und Weissner findet man ja all so was eher nicht, oder?
Eingeschränkt. Sie schicken sich schon ein paar Sachen. Bücher, Tonbänder, auch Manuskripte, die im Nachlass als Beilage vorliegen1oder deren Existenz sich eher so als Mosaik aus Antwortbriefen zusammenpuzzeln lässt, sofern sie nicht vorliegen.2
Detailarbeit an Texten: findet eigentlich nicht statt. Privates: komplette Fehlanzeige. Die politischen Entwicklungen: tauchen so gut wie gar nicht auf. Die Umgebung des Literaturbetriebs: in fragmentarischen Hinweisen, alles eigentlich nur in Stücken und Fetzen. Die großen Stories, die pointierten Anekdoten, die zeitgeistigen Reflexionen, die großen Schlaglichter, die sichtbar machen könnten, was hinter der Bühne passiert – das bleibt alles aus.
Man muss die Briefe anders lesen, um mitzukriegen, was Fauser und Weissner hier über Jahre hinweg entwickeln. So eng. So freundschaftlich. Zum Teil so sehr in Not. Und über die ganze Zeit hinweg dann doch mit so wahnsinniger Energie in der Auseinandersetzung mit dem Literaturbetrieb. Die beiden machen ihr Ding.
Da sollte aber bitte jeder Buchstabe großgeschrieben sein: Die beiden machen IHRDING!
Ja, und wenn wir jetzt die Briefe lesen, gucken wir ihnen ziemlich genau dabei zu, wie dieses Ding entsteht. Und das ist schon der Hammer.
Vielleicht muss man sich auch erst noch mal klarmachen, wo beide stehen, wenn ihr Briefwechsel einsetzt. Sie sind ja 1970 erst in the making. Und was sie sich gegenseitig schreiben, wird an diesem Machen ziemlich Anteil haben.
Fauser versteht sich im August 1971 als Schriftsteller. Doch eigentlich ist er einer, der nicht veröffentlicht. In Zeitungen hat er zwei Dutzend Sachen publiziert, aber seinen ersten großen eigenständigen Text Aqualunge bringt der gemeinsame Freund Udo Breger erst Monate nach dem ersten Brief in seinem Kleinverlag. Und Tophane wurde von mehreren Verlagen abgelehnt. Bis sich dann eben Weissner als Außenlektor des Melzer Verlags meldet.
Also sieht Fauser aus wie einer, der gerne möchte, der es aber nicht richtig bringt und abdriftet. Seinen neuen Freunden Breger, Ploog, Weissner stellt er sich körperlich und geistig vor allem in einer Rolle dar: als Junkie.
Fauser, der Junkie. Das ist ja zu einer der beliebten Verkürzungen für den Imagekatalog der Fauser-Fans geworden. Leider. Man muss Fauser schon ein bisschen komplexer sehen, wenn man verstehen will, wie er und Weissner sich da Anfang der siebziger Jahre begegnen. Zunächst ist Fauser nämlich erst mal in der Rolle des Jüngeren, des Kleinen, des Nachrückenden eingeklemmt, der seinen Platz sucht, ihn aber nicht findet oder nicht bekommt. Nicht zuletzt, weil er sich viel zu gehemmt fühlt. Gehemmt von innen, gehemmt von außen.
Fauser gehört ja generell eher zum gehemmten Typus, der immer mal wieder mit Übersprüngen und Radikalitäten an Stellen durchbrechen will, wo keiner damit rechnet. Deshalb auch der Drogenkonsum.
Deshalb auch die Orientierung an Vorbildern, die als Outsider, als Devianten, als Outlaws gelten. Alkoholiker, Morphinisten, Fixer.
Wer süchtig ist und schreibt, bekommt Fausers Bewunderung.
So würde ich’s nicht ausdrücken. Eher so, wie Fauser die Storys von Hans Herbst zusammenfasst: »Darum geht es in diesen Geschichten: um Augenblicke auf der Kippe; um Angst und die Kraft, die die Angst überwindet; um den Tod und das Leben.«3
Das könnte man nun aber auch ziemlich pathetisch finden.
Klar, hey … wir versuchen ja nur einzukreisen, was Fauser vorschwebte. Was ihn störte »an unseren Gegenwartsbelletristen«, hat er Karasek 1984 in einem Interview auch hübsch erklärt: »Diese Pose! Nicht das Ich – wenn sie wenigstens was erlebt hätten, fände ich das ja toll. Meistens haben sie gar nichts erlebt, sondern sie haben halt die kleine Liebesgeschichte und den Kakadu in der Wohnküche, und der Mann ist mal weggelaufen, oder man kriegt keinen Job als Lehrer mehr.«4Fausers Devise: Dann doch lieber mit Narben! Ruhig auch mit offenen Brüchen im Lebenslauf! Ob jetzt Outlaw oder pathetisch: Auf jeden Fall aus Sicht der Personalabteilungen im Rundfunk ungeeignet für Festanstellung. So ein Schriftsteller will Fauser sein.
Ja, er will kein Träumer und kein Erfinder sein. Selbst wenn er sich was spritzt, interessiert ihn nicht so sehr der Abflug, die Verwandlung der Welt, das Eintauchen ins Andere. Der Rausch hat bei ihm immer etwas Kaltes, Hartes. Und richtig kalt und hart wird’s bei Fauser, wenn er wieder runterkommt. Wenn der Rausch nachlässt. Wenn der Körper wieder weh tut. Wenn man die Verwahrlosung der Welt wahrnimmt. Wenn es nach Pisse und Kotze stinkt. Und wenn der nächste Stoff fehlt.
Ja. Er legt’s drauf an, dem Leben ausgesetzt zu sein, Grenzen zu testen, Abenteuer durchzumachen. Davon will er berichten. So wie er es bei Dostojewski und Dickens, Shakespeare und Kerouac gelesen und geliebt hat.
Die harte Nummer, die existentielle Nummer also. Das passt natürlich gar nicht in eine literarische Öffentlichkeit, in der die braven, abgedimmten Autoren und ihre wohltemperierten kritischen Stimmen bevorzugt werden. Und es passt auch gar nicht in eine Zeit, in der im Kursbuch gerade noch der »Tod der Literatur« ausgerufen wurde.
Das sind so die Fronten, zwischen die sich Fauser setzt. Das sind die Positionen und Programme, die er verachtet und von denen er sich mit einem eigenen Programm abgrenzen will.
Kein Wunder also, dass er aus der deutschen Literatur rausspringt. Ihn interessieren die radikalen Experimente anderswo. Deshalb die Hinwendung zur Cut-up-Ästhetik. Zum schreibenden und junkenden Burroughs. Später zum schreibenden und trinkenden Bukowski.
Genau. Diese Orientierung wird ihn eng mit Weissner verbinden. Aber, aber …: Wie sehr Fauser in der Zeit um 1970 wirklich an Cut-ups geglaubt hat, ist nicht so genau auszumachen. Da entwickelt er sich schnell weiter und seilt sich etwa von der ZeitschriftUFOab, in der wild mit Schreibweisen experimentiert wurde. Genauso beschäftigt ihn Bukowski – noch so ein abgewetztes Label! – nach 1977 nur noch nebenher. Er verabschiedet sich und macht etwas Eigenes. Dabei sollte man nicht vergessen, dass Fauser außer den genannten Klassikern auch andere sorgfältig gelesen hat: Fallada, Joseph Roth, Frick, um mal ein paar seiner deutschsprachigen Rolemodels zu nennen.
Aber noch mal zurück. Auch wenn Fauser zu dieser Zeit nicht auf die Junkie-Gestalt reduziert werden darf, dann ist doch richtig: Er wollte viel, hatte aber nichts. Und gut ging es ihm nicht. Im Gegenteil: Er war tatsächlich ziemlich runtergekommen. Dass er da auf Carl Weissner trifft und dass der für ihn da ist, gehört ja zu den Glücksmomenten von Fausers Biographie.
Ach, es ist nicht nur ein Moment. Eigentlich ist der ganze Briefwechsel von diesem Glück bestimmt.
Dabei ist Weissner – ganz anders als Fauser – zum Zeitpunkt der ersten Briefe eigentlich schon eine ernstzunehmende Nummer im Betrieb.
Weissner hat ein Netzwerk. Er taucht von Beginn an als souveräner Netzwerker auf. Schon 1964 hat er hunderte Briefe an Dichter weltweit geschrieben, um sich in »The Changing Guard« einzuklinken, wie es das Times Literary Supplement damals in zwei der Avantgarde gewidmeten Sonderausgaben bezeichnet hat. Das ist Weissners Flucht aus der Enge der BRD mit ihren nazifizierten Restbeständen. Über die Times-Ausgaben ist er auf die rauhen, straighten Wortartisten gestoßen. Das war der Impuls für ihn, in einem nächsten Anlauf auch zu Leuten wie Ginsberg Kontakt aufzunehmen. Oder zu J.G. Ballard in England. Und dann eben auch zu gesellschaftlich Aussortierten, die wie Bukowski in irgendwelchen obskuren Undergroundzeitschriften publizierten. Und weil er sich die ganzen Lektüren nicht leisten konnte, startete er seine eigene Zeitschrift, um die von ihm verehrten Autoren um Texte zu bitten.
Er ist eben nicht nur Netzwerker. »Netzwerker« … das klingt ja mittlerweile sowieso so schlimm. Weissner ist ja immer auch Vermittler, Arrangeur. Und dann eben auch Übersetzer.
Als Weissner 1969 aus New York zurückkommt, hat er jedenfalls eine Menge Kontakte, Texte und Tonbandaufnahmen im Gepäck. Und er hat das Glück, dass sich der Melzer Verlag für die neuen Stimmen, die er da mitbringt, interessiert. Bukowski und Ballard bringt er dort sofort unter. Und als es mit Melzer zu Ende geht, übersetzt er Andy Warhol für KiWi.
Und mitten in diese Aktivitäten hinein taucht Fauser auf.
Das war etwa ein halbes Jahr vorher. Oder ein Dreivierteljahr. Allerdings ist da alles ziemlich nebulös. Selbst 2003konnten sich weder Breger noch Ploog, noch Weissner an viel mehr erinnern als an Fausers Angewohnheit, bei Besuchen erstmal im Bad zu verschwinden, wo dann danach blutverschmierte Tupfer im Abfalleimer lagen. Wann das erstmals der Fall war, konnten alle nur annähernd einkreisen. Maria Fauser hat sich erinnert, allerdings mit fast neunzig Jahren!, wie bei ihnen zu Hause jemand vom Melzer Verlag anrief und ihr Sohn da so zugedröhnt war, dass er fast die Treppe runtergefallen ist, als er an den Apparat gerufen wurde. Sie erinnerte sich, wie ihr Sohn den Hörer hielt und wenig mehr als nur »Ah« und »Oh« stammeln konnte. Das dürfte nach seinem Umzug aus Göttingen gewesen sein. Vor oder nach dem Türkei-Aufenthalt Ende 1970. Als Fauser bereits beauftragt war, für twen über Junk und Apomorphin zu schreiben.
ALLE BRIEFE SAGEN JETZT, JETZT, JETZT
In dieser vernebelten Zeit liegt der Startpunkt für die 107 Briefe und Postkarten, die sich die beiden über sechzehn Jahre hinweg schreiben. Wobei Fauser eindeutig mehr schreibt.
Was wir allerdings nicht wirklich sehr genau bestimmen können. Wir wissen nur: Weissner ist der bessere Archivar. Der hebt alles auf, was ihm Fauser schickt. Vielleicht ist es gar nicht so zufällig, dass er mit dem Brief anfängt, in dem klar wird, dass sich mit Benno Käsmayr auch noch ein anderer Verleger für Tophane interessiert. Aber natürlich hebt Weissner Briefe auch auf, weil er generell ganz feinnervig ist für diese Art von Kontakten. Und weil er eben weiß, dass er an einem Netzwerk werkelt, in dem später alles noch mal von Bedeutung sein kann. Übrigens hat er damit recht behalten. Die Briefe, die Weissner von Ginsberg zum Beispiel bekommen hat, hat er später amerikanischen Universitäten vermacht. Die haben natürlich vor Freude in die Hände geklatscht, dass Weissner so früh die Originale gesichert hat.
Fauser hat diese feinnervige Art nicht so.
Nein, Fauser hat das nicht so. Fauser ist als Mensch, aber auch als Autor tendenziell eher mit sich selbst verstrickt. Er ist viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Fakt ist auf jeden Fall: Einige der Briefe, die Weissner an Fauser geschrieben hat, sind verschwunden. Mit dem, was er aufhebt, verfährt er auch anders. Er locht Weissners Schreiben …
Oha, das treibt den Bibliophilen ja die blutigen Tränen in die Augen!
… und dann heftet er sie ab.
Es braucht ziemlich lange, bis hier im Buch der erste Weissner-Brief auftaucht.5 Da hat man von Fauser schon zwanzig Stück gelesen.
Aber fest steht, dass auch Weissner bis dahin schon viel in die Beziehung investiert hat und die beiden längst dabei sind, gemeinsame Ideen und Projekte und Programme zu entwickeln.
Und eine gemeinsame Poetik, eine gemeinsame Ästhetik des Hin und Her des Briefeschreibens.
Unbedingt, ja.
Wenn ich die Briefe lese, höre ich ja immer die Schreibmaschinen klappern.
Fauser schreibt auf einer Olympia Reiseschreibmaschine, eine DeLuxe SM3, die ihm in Göttingen Nadine Miller kauft, finanziert von ihrem Studiengeld oder aus Einkünften als Nachtschwesternhilfe.
Wie die beiden schreiben, ist so interessant. Das Erste, was einem auffällt, ist: Vor allem schreiben sie gern immer nur auf einer Seite. Es gibt nur ganz wenig Briefe, auf denen auf der zweiten Seite weitergeschrieben oder noch ein zweites Blatt in die Maschine gespannt wird.
Das ist so auffällig, dass man eigentlich sagen muss: Die beiden bespielen ihre Blätter wie eine Art Bildfläche, in die sie den Text so reinhämmern, dass er als Ganzes Gestalt annimmt.
Vielleicht kann man das eine schreibmaschinelle Bewegungsfigur nennen.
Unbedingt. Man sollte sich deshalb die Briefe immer wieder im Original anschauen, um sich klarzumachen, was da jedes Mal passiert, wenn die sich an den anderen wenden.6Immer geht es darum, in einen Flow hineinzukommen, der über die Seite rauscht und dabei eingehämmerte Spuren hinterlässt.
Oben aufs Blatt wird zuallererst so quasi-rituell Datum und Adresse getippt …
… und schon geht es stakkatomäßig los. Es werden dann in hoher Geschwindigkeit Infostücke, kurze Einfälle, Erinnerungen, Ideen und immer eher so Notizartiges manchmal geradezu telegrammhaft aneinandergehängt …7
… dann immer mit diesen drei Punkten dazwischen, die eigentlich für Gedankenpausen stehen, aber von Fauser und Weissner so lückenlos eingesetzt sind, dass immer das letzte Infostück direkt mit dem nächsten verbunden wird.
Stimmt. So ruckelt es von Stück zu Stück. Aber es ruckelt so schnell, dass sich der Eindruck einer durchgehenden Schreibbewegung ergibt. Das wird dadurch verstärkt, dass sich die beiden wenig für Absätze interessieren. Das erhöht die Rasanz des Ganzen.
Dazu kommt die eigenwillige Groß- und Kleinschreibung. Und Fauser lässt gern Kommas weg.
Haha, ja, und weil die Briefe auch oft so eng geschrieben sind, muss man sich beim Lesen richtig konzentrieren.8Man muss geradezu in den Text hineingehen und sich mitreißen lassen und vielleicht noch laut mitsprechen, damit man überhaupt mitkommt.
Laut mitlesen! Das ist gut. Dann spürt man auch, dass die beiden gerne so schreiben, als wäre es gesprochen. Es soll so klingen, als sei es ohne großes Nachdenken, ohne Kontrolle, ohne Pose, ohne großen Anspruch reingetippt.
Das ist ganz wichtig. Guckt man sich den Briefwechsel an, hört man die ganze Zeit die Maschinen klappern. Und zugleich hört man sie sprechen.
Das treiben die beiden ja nochmal weiter, wenn sie in ihre Briefe mit Kugelschreiber oder Filzstift reingehen und Pfeile reinsetzen und noch was dazuschreiben. Immer dann wird noch deutlicher, dass diese Briefe eben auch Textbilder sind, in denen eine ganz harte, schnelle, maschinelle, zugleich aber direkte, aufs Unmittelbare, auch aufs Authentische angelegte Bewegung vorgeführt wird.
Wenn man das nicht als etwas Zufälliges versteht, sondern als etwas, womit die beiden schreibend experimentieren, um sich einzugrooven und um Effekte auszuprobieren, dann sieht man auch: In diesem Briefwechsel wird durch die Praxis des Briefeschreibens hindurch programmatisch darüber nachgedacht, wie man eigentlich schreiben will und wie man sich dabei als Autor versteht.
Also: hartes, schnelles, maschinelles Schreiben, das zugleich direkt ist, unmittelbar, authentisch, in nervöser Bewegung.
Genau darum geht es bei den beiden ja die ganze Zeit. Schon beim bloßen Durchblättern der Briefe kriegt man immer wieder mit, dass sie sich deutlich gegen andere Schreibweisen abgrenzen. Sie verachten das Pseudo-Poetische.9
Und sie machen sich über alles meta-mäßig Reflexive lustig.
Ja, Fauser und Weissner wollen nichts, was feingeistig nach oben steigt oder ansatzweise irgendeinen Ehrgeiz in diese Richtung entwickelt. Konsequenterweise verabscheuen sie die Literatur, die eine besondere Tiefe behauptet. Gegen jede Form von schwiemeliger Andeutungsliteratur setzen sie das Straighte, das Direkte, das Rauhe. Es geht um das, was gerade passiert, was gerade zu sehen ist, was einem jetzt durch den Kopf geht. Alle Briefe sagen Jetzt, Jetzt, Jetzt. Jeder Anschlag tackert den Moment fest.
Deswegen liest es sich dann auch immer wieder so, als sei es so hingesprochen. Mündliches wirkt unmittelbar.
Genau, und deswegen gibt es diese zusätzlichen Kritzeleien auf den Blättern, weil darin noch mal das direkte, persönliche Einschreiben in die unmittelbare Gegenwart sichtbar wird.10
Damit wird dann natürlich auch klar, warum die beiden viel lieber nur auf einer Seite schreiben. Es gibt eben nichts zu drehen und zu wenden. Es gibt eben keine Tiefe. Keine Komplexität. Keine untere oder obere Ebene. Es gibt nichts Gefaltetes, Dazugelegtes,11 Ergänzendes.12 Es gibt nur das, was man auf den ersten Blick sehen kann.
Prinzipiell richtig! Wir hatten vorhin gefragt, warum man es hier nicht mit einem Briefwechsel zu tun hat, in dem sich zwei Autoren gegenseitig und voreinander öffnen und in ihre vermeintlichen Tiefen und Abgründe hineinschauen lassen. Der Grund dafür lautet: Solche Autoren wollen sie nicht sein. Sie wollen so nicht schreiben.
Genau deshalb fehlt in diesem Briefwechsel auch das Intime, das Familiäre. Fauser und Weissner verweigern sich jede Poetisierung oder Auratisierung ihrer Existenzen. Sie verweigern sich mit Absicht der längeren Reflexion. Es sind immer Nachrichten aus dem Hier und Jetzt der Werkstatt, in denen die Performance des rauschhaften Stakkatoschreibens an der Schreibmaschine direkt mit sichtbar gemacht wird.
Gleichwohl gibt es natürlich doch eine Menge auratisch Elaboriertes. Die beiden schreiben ja mitunter wie snobistische Nerds, die sich nur noch mit so hin- und hergeworfenen Stichworten,13 Zitaten,14 Anspielungen auf Literatur,15 Radio,16 Fernsehen und Popmusik17verständigen.
Die arbeiten natürlich an ihrem großen Gegenkanon. Sie verabscheuen nicht nur die etablierten Formen von Autorschaft. Sie wollen auch neue Formen setzen. Neue Texte, neue Songs, neue Leute. Und dazu gehört dann immer auch: eine neue Form des eingeweihten Kommunizierens.
Auf diese Weise poetisieren und auratisieren die beiden sich dann eben doch.
Nur geht’s um eine andere Poetik.18
Und es geht um eine ganz andere Aura als die, die im deutschen Literaturbetrieb bekannt ist.
Genau, letztlich geht es auch ganz konkret um ihr eigenes Schreiben jenseits dieser Briefe. Damit wird dann eben auch klar, dass dieses Hin und Her zwischen den beiden als ein intensives, folgenreiches, ja letztlich ganz erfolgreiches Making of zu lesen ist. Auch wenn es oft so hart, so verkürzt, so knapp, so rauh, so hingewischt, so hingerotzt wirkt …
… besser muss man sagen: gerade weil es oft so hart, so kurz und knapp, so rauh, so hingewischt, so hingerotzt wirkt!
GROSSER BRUDER, KLEINER BRUDER: PARTNERS IN CRIME
Wobei aber gilt: Beide haben unterschiedliche Anteile an diesem Making of.
Oder besser: Beide nehmen unterschiedliche Rollen ein.
Du hast ja schon drauf hingewiesen, dass Fauser eigentlich immer eher in die eigenen Problemlagen verstrickt ist.
Ja, Fauser ist der Gehemmte, der Mittel und Strategien der Enthemmung oder Entspannung braucht.
Weissner macht da einen grundsätzlich entspannten Eindruck. Eigentlich ist es egal, wo man den Briefwechsel aufschlägt: Weissner ist offen. Zugewandt. Hilfsbereit.
Die beiden sind ein bisschen wie großer und kleiner Bruder. Wobei Weissner natürlich der große Bruder ist.
Aber ein guter großer Bruder!
Ja, richtig, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Weissner kümmert sich mit der Kraft, der Energie, der Übersicht des Älteren um den Jüngeren, der nicht so richtig klarkommt. Oder der zumindest auf Hilfe angewiesen ist.
Deshalb müsste man sagen: Dieser große Bruder ist so souverän, dass er in ganz verschiedene Rollen schlüpfen kann. Zu Beginn der Freundschaft agiert Weissner eher wie ein Therapeut. In den ersten Briefen lesen wir, dass Fauser Weissner gegenüber so stolz ist, überhaupt etwas produziert zu haben, um damit wieder ein bisschen in Schwung zu kommen.19 Fauser tut das, weil ihm Weissner geraten hat, schreibend von den Drogen wegzukommen. Zu diesen Ratschlägen gehört übrigens auch das Briefeschreiben selbst. Weissner trägt Fauser auf, dass er jeden Monat einen Brief schreiben soll. Und zwar eine Seite lang. Keine unnötigen Abschweifungen. Kein Verzetteln. Nur straight, was ihm gerade in den Sinn kommt.
Was ja eigentlich heißt, dass der Briefwechsel zwischen Fauser und Weissner auch in stilistischer Hinsicht aus einer therapeutischen Intervention heraus entsteht …
… und sich dann aus dieser Praxis heraus verselbständigt. Wobei das Therapeutische, das Stützende, das Helfende weiterhin ganz wichtig bleibt. Schreiben, lesen, leben sind bei Fauser ineinander verzahnt, wie ja auch Katja Kullmann in ihrem Vorwort zum Band mit Fausers Literaturkritiken so schön gezeigt hat.20
Aber vielleicht können wir jetzt mit diesem Briefwechsel etwas genauer sagen, wie das Leben, das Schreiben und das Lesen aufeinander bezogen sind – und was sich daraus ergibt. Ich würde in diesem Zusammenhang gerne über das ominöse »Harry« sprechen.
Ja, das ist wichtig. Am Anfang unterschreibt Fauser seine Briefe noch mit »Jörg«. Und so spricht ihn Weissner auch an. Und dann steht da irgendwann »Harry«. Fauser unterschreibt so. Und Weissner eröffnet seine Briefe mit »Harry«.
»Harry Gelb« ist Jörg Fausers literarisches Alter Ego. Schon im zweiten Brief taucht das auf.21Im zehnten unterschreibt er mit »Harry« – weil die beiden den Gedichtband arrangieren, der zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht mal in Gedanken Die Harry Gelb Story heißt. Harry Gelb wird dann in Rohstoff zehn Jahre später zur großen Romanfigur. Vergessen sollte man dabei aber nicht: Fauser spielt grundsätzlich und gern mit Decknamen. Das tut er auch 1980 noch, als er beim Tip Kolumnen als »Caliban« veröffentlicht. Laut Nadine Miller ist es typisch für Junkies, vielleicht auch für jeden gehemmten, zartfühligen Dichter, dass er dauernd neue Rollen annimmt oder ausprobiert. Bei Fauser sind das immer wieder richtige Maskeraden. Er ist ein Meister im Verstellen. Mit Lust an Häutungen, Neuanfängen …
Aber im Briefwechsel mit Weissner legt er sich auf »Harry« fest.
Right, das erste Mal unterschreibt er so im Brief vom 22. Januar 1973. Und Weissner steigt im ersten von ihm erhaltenen Brief aus dem Juni 1975 ganz selbstverständlich drauf ein. Fauser wird dann auch seine allerletzte Postkarte noch mal mit »Harry« unterschreiben.
Dass Fauser nun auch im Briefwechsel mit Weissner in diese Harry-Rolle schlüpft, sagt über die Freundschaft der beiden ganz viel. Denn zuallererst wird damit ja eine literarische Figur, die Fauser mit dem eigenen biographischen Material formt, sozusagen: re-realisiert. Fauser identifiziert sich mit seinem eigenen Entwurf. Er spielt seine selbst konstruierte Rolle nach. Er schreibt sich damit aus der alten Identität heraus in eine neue hinein – und probiert sie Briefe schreibend wieder aus.
Und Weissner erlaubt ihm das. Lustig oder markant: Der wird zwar mit zig Deck- und Kosenamen angesprochen, signiert aber konsequent mit »Carl«, ein einziges Mal ergänzt mit dem von Pélieu22ersonnenen Carl-le-Nègre.23
Weissner öffnet ihm einen Bewegungsraum, in dem Fauser diese Identität ausprobieren kann. Und dieser Raum ist der Briefwechsel. Im Hin und Her mit Weissner darf Fauser »Jörg« sein, der »Harry« spielt, um ein anderer zu werden.
Interessant ist, dass Weissner Fauser dabei so gut wie nie zu lenken scheint. Jedenfalls nicht offen.
Weissners Strategie folgt dem Prinzip der Ermutigung.
Und das scheint so simpel. Er ermutigt Fauser einfach, das auszuprobieren, was ihm sowieso liegt. Um sich mit Strategien der Enthemmung in einer literarischen Figur zu erfinden, die er auf sich zurückprojiziert, um ein Schriftsteller zu werden.
Und bei dieser Verwandlung hilft Weissner ihm noch in ganz anderen Rollen. Auf jeden Fall ist er eine Art Berater, an den sich Fauser wenden kann, wenn es um abgeschlossene oder nächste Projekte geht.24
Und er ist auch derjenige, der Fauser kurz mal zurückpfeift, wenn der zu weit wegstreunt von dem, was sie sich vorgenommen haben. O-Ton Weissner: »Mit Alles wird gut beim ersten Lesen noch ein paar Schwierigkeiten. Schreibe hebt mir zu sehr ab in Richtung Feuilleton«.25 Auf jeden Fall kann sich Fauser darauf verlassen: Wann auch immer er etwas Neues geschrieben hat, das er in Zeitungen, Zeitschriften oder bei Verlagen oder beim Radio unterbringen will, kann er sich an Weissner wenden.
Ich finde, das sind mit die erstaunlichsten Briefe, also die von Weissner, in denen er schon bei zarten Anfragen Fausers oder als Antwort auf eigentlich fast unverschämt direkte Bittbriefe in aller Ruhe sein Netzwerk aktiviert. Am 18. Feb. 1972 zum Beispiel: »Bitte schreibe mir alsbald wegen Melzer, und auch überhaupt!« Oder am 13. Juni 1975: »schreib mir bitte wies war und schick möglichst 1 Cassette«. Am 21. Nov. 1976 schreibt Fauser: »Frage: weißt Du wem man das da schickt?« Dann legt Weissner richtig los. Er nennt Kontakte. Dann notiert er Adressen. Dann öffnet er Türen. Dann gibt er Hinweise, wie bestimmte Personen anzusprechen seien.26
Ja, er ist so freundlich, so großzügig. Wir lernen Weissner in diesem Briefwechsel als einen Menschen kennen, der geduldig mitdenkt, Probleme antizipiert.
Es ist eben kein Zufall, dass er Übersetzer ist. Das ist nicht nur ein Job für ihn. Das speist sich aus tieferliegenden Energiereservoiren. In der Beziehung zu Fauser merkt man, wie gut es Weissner tut, selbst Gutes zu tun: Sachen aufzunehmen, zu verstärken und weiterzureichen. Und Verknüpfungen herzustellen, um Leuten zu helfen.
Und das macht er nie, wo alle schon alles haben. Weissner macht das nicht fürs Ego. Ihm geht’s nicht darum, möglichst viele einflussreiche Leute zu kennen. Wir haben vorhin gesagt, dass ihn mit Fauser ja vielmehr das Interesse für das Deviante, für das Andere, das Ausgeschlossene, das Noch-Nicht-Etablierte verbindet. Schon ganz früh in den Sechzigern interessiert sich Weissner in den USA für den sogenannten Underground. Von da holt er die Autoren ab. Von da nimmt er sie mit und übersetzt sie. Räumlich und sprachlich. Er holt sie nach Deutschland. Er vermittelt sie hier. Er gibt ihnen hier eine Stimme. Er will sie hier etablieren. Er ist als Übersetzer dabei immer auch eine Art Schmuggler, der versucht, etwas Unerhörtes, Unerlaubtes in den etablierten Literaturbetrieb hineinzubringen.
Fauser passt natürlich genau in dieses Schema. Als Weissner Fauser begegnet, setzt dieser Kümmerreflex ein. Dem will er helfen. Den will er vermitteln. Er will ihn an sein Netzwerk anschließen, um ihn in den Betrieb reinzubringen.
»Kümmerreflex«, naja, das klingt mir zu sehr nach Helfersyndrom. Ich meine, wie zerbrechlich Künstler so sein können, war Weissner bewusst – auch als leidenschaftlicher Fan von Bebop-Musikern. Wobei man übrigens auch noch mal betonen muss: Fauser ist ja nicht völlig hilflos. Fauser gehört zu denen, die sofort große Energien freisetzen, wenn sie merken, dass sie angenommen und unterstützt werden. Da muss ihn Weissner oft bloß mit kleinen Gesten aktivieren.27Manchmal muss er ihn nur inspirieren.28Manchmal muss er ihm auch nur kurz versichern, dass er da ist.29Zack, und schon setzt Fauser seine Produktion in Gang.
Setzt sich hin, tippt was, schickt es ab, fragt nach, bittet um Resonanz.
Fast wie ein Refrain.30Oder wie so ein roter Faden, der sich durch den ganzen Briefwechsel zieht und erst gegen Ende etwas ausdünnt oder verbleicht.
Wenn man sich die ganze Werkausgabe jetzt anschaut, wird einem erst mal klar, dass Fauser eine phänomenale Produktionsmaschine gewesen ist, die durchgehend gelesen und geschrieben und sich um Publikationen bemüht hat und sie dann realisiert hat: in Büchern, in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und Fernsehen, auch Film.
Selbst in Songs.31Und das ganz ohne Weissners Zutun.
Und was man auch sehen kann: Fauser ist dabei genau wie Weissner ein Schmuggler für Literatur, die ausgeschlossen wird, die übersehen wird, ignoriert wird, verachtet wird. Auch Fauser interessiert dieses Spannungsfeld von Underground und Establishment. Nicht zuletzt, weil es genau dieses Feld ist, in dem er sich bewegt.
Absolut. Das ist es, was jetzt in diesem Briefwechsel so schön und im Detail zu verfolgen ist. Fauser und Weissner waren »partners in crime«.
Yes, das klingt sehr gut. Wenn der Briefwechsel mal verfilmt wird, schlagen wir als Titel »Ihr Verbrechen war die Schmuggelei« vor.
Fauser kommt hierbei immer doppelt vor. Als Schmuggler. Und als Schmuggelware. Vielleicht sogar dreifach: Er schmuggelt ja, was er in der Korrespondenz ausprobiert, auch in seine Texte rein.32
Wobei man sagen muss: Die beiden waren ein ziemlich erfolgreiches Schmugglerpaar, oder!? Erfolgreich waren sie bei der Vermittlung von Autoren aus dem Underground. Und erfolgreich waren sie mit ihrem Projekt, Fauser vom unbekannten Außenseiter in einen weitgehend anerkannten Journalisten, Redakteur und Romanschriftsteller zu machen.
Um auch nochmal an die therapeutische Intervention am Beginn der Freundschaft zu erinnern: Weissner wollte Fauser stabilisieren. Er wollte seine Potentiale freilegen und fördern. Er wollte ihn selbständiger, selbstbewusster werden lassen. Und, ja: Auch das ist gelungen. In diesem Briefwechsel sehen wir Fauser zusehends »erwachsener« werden. Er steckt Absagen und Krisen besser weg. Die Amplituden werden insgesamt kleiner. Er kümmert sich immer selbständiger um die eigenen Sachen. Er fängt ab 1975 sogar an, nun umgekehrt Weissner ein paar Bälle zuzuspielen.33
Wobei die beiden aber nie wirklich die Rollen tauschen. Sie bewegen sich ein bisschen auseinander. Je mehr Fauser für sich selbst arrangiert, umso weniger ist er auf Rückmeldung und Unterstützung angewiesen. Und umso weniger schreiben sie sich.34
Und wenn sie sich schreiben, wird das zum Ende hin oft formelhaft. Das klingt dann manchmal so, als wollten sie sich an die frühen intensiven Austauschzeiten erinnern, in denen sie dieses gemeinsame Ding, das sie vorhatten, überhaupt erst mal herausarbeiten mussten.35
SCHMUGGLER IM LITERATURBETRIEB
Lass uns eben noch mal etwas genauer über dieses »Ding« sprechen. Ich würde mal sagen, dass dieses »Ding« aus ganz vielen Dingern besteht. Das große Projekt wird in vielen kleinen Projekten verfolgt. Die beiden schieben praktisch immer mehrere Sachen parallel an.
Da stimme ich zu. Das lässt den Briefwechsel manchmal auch wie eine Art Dickicht erscheinen.
Aber wie ein Dickicht voll exotischer Gewächse, irrer Abwege, bisweilen auch abstruser Keimlinge.
Abstrus und oft auch schwer zu entziffern. Manchmal werfen die ja auf den Schreibmaschinen ihren Newsticker an und werfen sich Stichworte zu, die man nur versteht, wenn man ins Dickicht hineingeht und das Netzwerk rekonstruiert, aus dem das alles hervor- und in das dann auch alles wieder hineingeht.
Stimmt. Aber trotzdem. Das Ziel Nummer 1 lautet: Harry veröffentlichen!
Kann man so sagen. Wie gesagt, schon vor dem Start der Korrespondenz sind Aqualunge und Tophane abgeschlossen. Bei Die Harry Gelb Story erleben wir live mit, wie die Gedichte entstehen und wie sie arrangiert, präsentiert werden und wie Titel fürs Ganze ausprobiert werden. ZumSchneemann fallen Arbeitstitel,36 die bisher nie irgendwer erwähnt hat – doch der Austausch zum Manuskript fand offenbar mündlich statt.37
Gleichzeitig gibt’s ja Gasolin 23.
Für die Beziehung von Fauser und Weissner ist dieses Zeitschriftenprojekt absolut zentral. Das zwingt die beiden nämlich über Jahre hinweg, ihre eigene Position im literarischen Feld zu klären. Wer eine eigene Zeitschrift macht, kommt ja nicht drum rum, sich über das eigene Programm Rechenschaft zu geben. Immer wieder. Man muss sich gegen andere Programme abgrenzen. Man muss sich über Autoren verständigen und sich fragen, ob sie zur eigenen Mannschaft gehören oder nicht. Und, na klar, man muss sich dann über ganz konkrete Texte auseinandersetzen. Und zwar bis ins Detail hinein, wenn man sie redigiert und für die Ausgabe aufbereitet. Das ist das Alltagsgeschäft. So eine Zeitschrift herauszugeben, das ist so wie ein Bootcamp für Autoren und Autorinnen, wo man sich unter erhöhtem Druck Stufe um Stufe hochtrainieren muss.38
An Fauser kann man den Zuwachs an Muskeln und Skills direkt sehen. Mit dem Gasolin-Projekt steigert er sich. Es gibt ihm was zu tun. Zum Sondieren, zum Lesen, zum Schreiben. Das erdet ihn. Das fokussiert ihn. Das zwingt ihn tatsächlich dazu, sich über das klarer zu werden, was er machen will. Vor allem auch: was er nicht machen will.39
Und es verbindet ihn stärker mit Weissner. Man sieht an den Briefen, in denen es um die Arbeit an den jeweils nächsten Ausgaben geht, sehr schön, wie gut die beiden sich aufeinander einschwingen. Wenn da die Texte anderer Autoren über ihre Tische gehen, schreiben sie sich meist nur kurze Kommentare, blitzartige Einschätzungen, pointierte Polemiken.40Manchmal ist es nur so eine Art Augenzwinkern, das sie tauschen. Und nie gibt es Streit. Eigentlich gibt es nicht mal so richtig zwei Meinungen. Die beiden treiben die Entwicklung ihres Programms wirklich auf selber Wellenlänge voran.
Allerdings ist das alles nicht wirklich erfolgreich.
»Erfolgreich« oder »nicht erfolgreich« ist bei solchen Projekten vielleicht erst mal die falsche Unterscheidung, würde ich sagen.
Naja, wenn man guckt, wie viel Gasolin-Hefte verkauft worden sind, wer sie tatsächlich gelesen hat und auch darauf reagiert hat, dann kann man natürlich schnell denken: Das war nichts. Wenn man dann noch bedenkt, dass jede Ausgabe ein echter, vor allem immer langwieriger Kraftakt war, schon allein wegen der Gestaltungsfrickeleien mit Letraset, wegen der unsicheren Finanzierung, wegen der aufwendigen Organisation von Druck und Versand …41