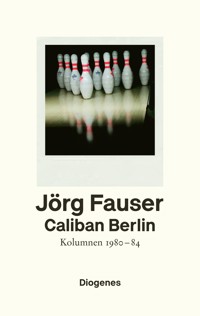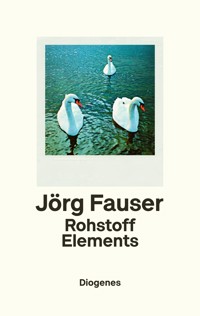21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als 12-Jähriger regt er sich in einem Brief an den Vater mordsmäßig über einen Schriftsteller auf. Und mit nicht einmal 14 schreibt er über eine Bundestagsversammlung und schwärmt über den jungen SPD-Mann: »Schmidt aus Hamburg! Es war großartig! Hinreißend!« In jedem Brief zeigt sich eine neue Facette des weitsichtigen Beobachters, leidenschaftlichen Schreibers, unbestechlichen Journalisten und eben auch liebevollen sowie rebellischen Sohns Jörg Fauser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jörg Fauser
Man hängt halt so an dem, was man hat
Briefe an die Eltern
Zusammengestellt, herausgegeben und mit einem Vorwort von Peter Graf, sowie einem Nachwort von Ronja von Rönne Mit Faksimiles von Briefen und Postkarten
Diogenes
»Und daß wir alle manchmal so fürchterlich gegeneinander standen, gehört vielleicht dazu.«
Vorwort von Peter Graf
Ich bin Jörg Fauser persönlich nie begegnet. Ich kenne sein Werk, für das ich mich als Jugendlicher zu begeistern begann. Und viele der Schriftsteller, die Fauser verehrte oder mochte, habe ich als Jugendlicher und junger Mann ebenfalls für mich entdeckt. Und wenn ich auch nicht Schriftsteller geworden bin – und auch nie werden wollte –, so prägten mich diese intensiven Leseerfahrungen doch, und sie spielten eine nicht unbedeutende Rolle bei meinem eigenen beruflichen Werdegang. Je mehr ich las, umso mehr begann ich mich für die Verlage zu interessieren, die die Bücher verlegten, die ich gerne las. Ich wollte wissen, wie Verlage arbeiten und was nötig ist, um aus einem Manuskript ein Buch zu machen, das in den Buchhandlungen liegt und in den Zeitungen besprochen wird. Folgerichtig wurde ich irgendwann Lektor und später Verleger.
Ein erster Schritt in diese Richtung war, ähnlich wie bei Jörg Fauser, die Herausgabe einer Literaturzeitschrift. Hier konnte man im Kleinen die Abläufe erproben, die auch bei der Verlagsarbeit relevant sind. Es folgten Hospitanzen bei mehreren Verlagen. Die für mich prägendste Erfahrung war diesbezüglich ein mehrmonatiges Praktikum bei Rogner & Bernhard, damals noch unter der Leitung von Antje Landshoff-Ellermann und ihrem Programmleiter Klaas Jarchow, also bei ebenjenem Verlag und unter den Fittichen jener Verlegerin, die Anfang der 1980er-Jahre wichtige Werke Jörg Fausers verlegt hat. Die Wochen dort führten nicht nur dazu, dass sich mein Wunsch, für Verlage zu arbeiten, verfestigte, im Nachhinein bin ich sehr erstaunt, wie viel ich in der eigentlich kurzen Zeit lernte: über das Büchermachen, über den Umgang mit Autorinnen und Autoren, und ich bekam sogar eine ziemlich genaue Ahnung davon, wie eine Verlegerin oder ein Verleger sein musste, um gut zu sein. Andererseits weiß ich heute, dass das kein Zufall gewesen ist, denn unter den Verlegerinnen und Verlegern, die in den 1960er- und 1970er-Jahren im deutschen Sprachraum kleine Verlage gründeten, waren Persönlichkeiten, die mit ihren Ideen und Verlagsentscheidungen die Verlagslandschaft grundsätzlich erneuerten und den Grundstein für all jene legten, die heute verlegerisch arbeiten. Sie setzten nicht nur neue Themen und boten Autorinnen und Autoren, die in den großen, etablierten Verlagen nicht vorkamen, eine verlegerische Heimat, sie veränderten gemeinsam mit diesen neuen Stimmen in der Literatur den Literaturbetrieb und beinflussten das gesellschaftliche Leben nachhaltig. Antje Landshoff-Ellermann ist eine von ihnen.
Bei der Lektüre von Jörg Fausers Briefen an seine Eltern bin ich immer wieder auf Menschen gestoßen, denen ich bei meiner Arbeit für Verlage und als Verleger in den zurückliegenden 25 Jahren begegnet bin. Nicht zuletzt Jörg Fausers Mutter, die ich auf einer Frankfurter Lesung kurz kennenlernen durfte.
Diesen Briefband, der viele, aber längst nicht alle Postkarten und Briefe Fausers enthält, das gesamte Konvolut der ca. 400 erhaltenen Briefe und Postkarten hätte den Umfang dieses Buches gesprengt, ist deshalb geradezu eine Ehre für mich, und ich bin dankbar, dass mich Jörg Fausers Briefe auf eine Zeitreise mitgenommen haben, die sein Leben und das Leben seiner Eltern betrifft, die aber auch viel von der alten Bundesrepublik erzählt, jenem seltsam versehrten und biederen Land, in dem auch ich aufgewachsen bin.
Als ich Der Schneemann las, war ich fünfzehn, als Rohstoff erschien, siebzehn. Ich verkehrte damals nicht mit Menschen aus Fausers Generation, ich interessierte mich nicht einmal für die Belange von Dreißig- oder Vierzigjährigen, aber ich ließ mich, wie alle jungen Menschen jeder Generation, für mein eigenes, gerade erst beginnendes Leben von Büchern, Filmen, Musik und Diskursen inspirieren, die Menschen dieser Generation schufen oder prägten. Meine Freunde und ich woben all diese Einflüsse ein in das in uns entstehende Weltbild, in das Lebensgefühl, das sich langsam entfaltete, in die Träume und Albträume oder Wünsche, die uns umtrieben. Aber unser Koordinatensystem war ein anderes. Wir waren, weil jung, unerfahren, aber auch neugierig und unverbraucht, hoffnungsfroh. So durchlebten wir die späten 1980er-Jahre. Unbelastet von dem ideologischen Ballast der vorangegangenen Generation, fanden wir unsere Vorbilder unter den Menschen, die quer zum Mainstream standen und ihr Ding machten. Das Establishment (oder das, was wir dafür hielten) verachteten wir ebenso wie Parteien oder Institutionen.
Jörg Fauser war für die jungen Leute, die damals ähnlich dachten und leben wollten wie ich – und das waren nicht wenige –, als Vorbild sehr geeignet, weniger in dem, was er verkörperte, sondern weil er Helden schuf, die uns gefielen, weil er den richtigen Ton traf und eine Wirklichkeit beschrieb, in der wir uns zurechtfanden, ohne uns damit auszukennen. Und was man bei ihm nicht fand, konnte man bei Wolfgang Welt lesen oder sogar bei Peter Kurzek. Dann hatte man einerseits einen recht guten Kompass, um dieses Land zu verstehen, andererseits ahnte man, dass auch das eigene Leben Nischen bereithalten könnte, die zu finden und schrittweise zu besetzen offenbar möglich war; was Hoffnung machte.
In die Rezeptionsgeschichte eines Werkes fließt viel ein, die Beweggründe der Leserinnen und Leser, die dazu führen, ein Werk zu lesen, finden zumeist aber wenig Beachtung, und fast völlig im Dunkeln bleibt, was die oder der Lesende aus einer bestimmten Lektüre mitnimmt und verbindet mit all den anderen losen Fäden seines gegenwärtigen oder zukünftigen Lebens, in dem ja alles enthalten ist, was ihn ausmacht oder ausmachen wird. Manche Einflüsse bleiben prägend, andere werden bedeutungslos: Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Literatur ist in besonderer Weise geeignet, sich immer wieder aufs Neue in das eigene Leben einzuschreiben, nicht nur durch das, was sie schildert, sondern durch den Vorgang des Lesens an sich, der, verglichen beispielsweise mit der Betrachtung eines Bildes oder eines Filmes, langwieriger ist und wohl auch kontemplativer. Liest man ein Buch über Tage hinweg, wird es nicht nur Teil des eigenen Alltags, der Alltag hat Einfluss auf das Leseerlebnis und verstrickt sich womöglich sogar mit der Handlung. Und wer viel liest, von Kindesbeinen an, dem hilft das Lesen des einen Buches bei dem Verstehen des anderen, Vorlieben kristallisieren sich heraus, man lernt zu vergleichen, häuft, ohne es recht zu merken, Wissen an, und wird Buch um Buch zum verständig Lesenden. So ein Leser ist Jörg Fauser gewesen. Und sehr früh reifte in ihm der Plan, Schriftsteller zu werden. Es war kein Traum, den er hegte, es war eine Aufgabe, der er sich ein Leben lang stellte. Wer Jörg Fausers Briefe an seine Eltern liest, begleitet den Leser und werdenden Schriftsteller auf seinem Weg, aber vor allem zeugen Jörg Fausers Briefe von der unumstößlichen Liebe, die er für seine Eltern empfunden hat. Und dieser in die Geschichte der Bundesrepublik eingebettete Gedankenaustausch zwischen Mutter, Vater und Sohn ist nur deshalb erhalten, weil Fausers vor allem Briefe schreibend miteinander in Kontakt standen. Das Telefon spielte eine untergeordnete Rolle, heutige Kommunikationsmittel waren gänzlich unbekannt. Das alles macht die Briefe zu einem ebenso ergiebigen wie berührenden Dokument eines Schriftstellerlebens, das, vielfach etikettiert, bekannt zu sein scheint, aber doch facettenreicher war, als die Rezeption seines Werkes vermuten lässt.
Man muss, glaube ich, an dieser Stelle nicht viel über das Leben von Jörg Fausers Eltern vorwegnehmen, man lernt sie, auch wenn ihre Briefe an den Sohn in diesem Band nicht abgedruckt sind, im Laufe des Briefwechsels gut kennen. Und wie viel Einfluss die Schauspielerin und der Maler auf den Lebensweg des Schriftstellers gehabt haben, offenbart sich ebenso. Im Elternhaus Jörg Fausers gab es viel Geist und wenig Geld, und dies war ein guter Nährboden, um den eigenen Weg erstaunlich früh ziemlich unbeirrt einzuschlagen.
Im August 1978 schreibt Jörg Fauser an seine Eltern: »Daß ich überhaupt etwas ›erreicht‹ habe, verdanke ich vor allem euch, nämlich Euren Erfahrungen, Einsichten und vielem anderen, das zusammen ein Leben ergibt, und wenn auch das, was ihr ›erreicht‹ habt, von der Gesellschaft, dem ›Markt‹ nicht annähernd gewürdigt wird (wie sollte es das auch?), ohne all das wäre meine Existenz und vor allem meine Schreiberei gar nicht denkbar.« Das ist weitaus mehr als ein pflichtbewusster Dank des nun 34-jährigen Autors, der sich seinen Wunsch, Schriftsteller zu sein, tatsächlich erfüllt hat. Es ist ehrlich empfunden, auch wenn dieses kurze Zitat unterschlägt, wie steinig Fausers Weg gewesen ist und wie sehr seine zeitweilige Drogensucht und seine Alkoholprobleme die Beziehung zu seinen Eltern belasteten. Sich von den Eltern loszusagen, sie enttäuschen zu müssen, um auch gegen ihren Widerstand das zu tun, was man tun zu müssen glaubt, ist in jeder Eltern-Kind-Beziehung schmerzhaft und gehört fast immer dazu. Dass man diese Phase überwindet und wieder zueinanderfindet, kommt glücklicherweise ebenfalls oft vor, selbstverständlich ist es nicht. Fünfzehn Jahre vorher, 1963, Jörg Fauser ist 19 Jahre alt, ist sein Verhältnis, insbesondere zu seinem Vater, reichlich zerrüttet. Flehentlich bittet er in einem Brief: »Bitte laßt es nicht soweit kommen daß ich euch hassen muß.« Dazu kommt es nie. Weder hasst Jörg Fauser seine Eltern, noch lassen sie ihn fallen. Da ist zu viel, was sie miteinander teilen: nicht nur das gleichermaßen ausgeprägte Interesse an dem kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben ihrer Zeit, das über Jahrzehnte hinweg rege diskutiert wird, nicht nur die Leidenschaft für Literatur, die ebenfalls alle drei eint, die Grundlage sind ähnliche Erfahrungen, die den Schriftsteller mit der Schauspielerin und dem Maler verbinden, aber getragen wird dies alles, so hat man von außen betrachtet den Eindruck, durch das hohe Maß an Offenheit und Vertrauen, das für das Verhältnis dieser drei Menschen prägend gewesen zu sein scheint.
Denn zwei Jahre später, Jörg Fauser hält sich gegen den Willen seiner Eltern bei seiner Freundin Stella in England auf, schreibt er bereits an seinen Vater: »Wie groß jedenfalls auch die Schwierigkeiten zwischen uns im täglichen Zusammen- oder Nebeneinanderleben, in dessen Gewohnheiten und den Anschauungen und Empfindungen sein mögen, so spielen sie doch keine Rolle neben dem Wichtigsten, das ich in all diesen Jahren erlebt habe und das mir aus meiner Jugend bleiben wird vor allem anderen: der zähen Arbeit, die Du in Deiner Kunst geleistet hast, den Gesprächen, die wir darüber führen, und den Bildern selbst. Gerade weil ich kein Maler geworden bin, wird mir jedes Wort, das ich schreibe, gewichtiger; und das Maß, mit dem Du gemessen hast, und die Beharrlichkeit, mit der Du an Deiner Kunst festgehalten und sie entwickelt hast, werden mir Vorbild sein und sind es schon bei meiner Arbeit. Daß ich wenigstens durch, von Dir gelernt habe, kann ich Dir mit Sicherheit sagen, auch wenn Du es jetzt noch in dem, was ich schreibe, nicht erkennst.«
Und wenig später, immer noch in England, gibt er in einem weiteren Brief an seinen Vater zu verstehen: »In einem Fall allerdings können wir uns wohl nie einigen, dem meiner Zukunft nämlich. Ich halte mich weder für ein Genie noch sonst irgendwas, aber ich kenne mich gut genug um zu wissen daß ich keinen Akademiker, auch keinen geheuchelten, keinen Lektor etc. abgebe. Ich werde nicht auf die Universität zurückkehren, weil ich mich schlichtweg dort langweile u. weil es Zeitverschwendung ist.«
Jörg Fauser muss auch in dieser frühen Phase seines Lebens das Leben seiner Eltern nicht infrage stellen oder gar verachten, um Herr über das seinige zu werden. Er muss sich in einigen Dingen behaupten. Und das tut er. Danach ist wieder Raum für Offenheit, und deshalb lässt er sie auch teilhaben an den Zweifeln, den prekären Lebensumständen, den Momenten des Scheiterns, die es immer wieder gibt. Oft, so meint man aus den Briefen herauszulesen, sind seine Mutter und sein Vater die ersten Leser seiner Gedichte und Prosatexte, und ihr Urteil ist ihm wichtig. Er kann, auch wenn er noch kaum etwas zu Papier gebracht hat, Sätze wie: »Allmählich wird mir die Literatur mehr als nur eine Spielart des Lebens, nämlich (mein) Leben selbst.« schreiben, ohne dafür insgeheim belächelt zu werden. Und je beharrlicher er seinen Weg geht und je mehr er auf diesem Weg vorankommt, umso mehr wächst das Vertrauen in die Entscheidungen des Sohnes, und Stolz macht immer häufiger den Sorgen Platz, die zu Beginn vorherrschen.
Jörg Fausers Briefe an seine Eltern sind mal kürzer und mal länger, eilig und nur hastig hingeschrieben kommen sie einem nie vor. Die Korrespondenz mit seinen Eltern ist ihm wichtig. Er gibt Auskunft über sich und über die Texte und Projekte, an denen er gerade arbeitet, reagiert auf Dinge, die im vorausgegangenen Brief der Eltern gestanden haben, und insbesondere wenn er auf Reisen ist oder sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einzuleben versucht, bekommen sie einen literarischen Ton, in dem sein Talent als Schriftsteller aufscheint. Das gilt in besonderer Weise für seine Türkei- und Orientbeschreibungen, und man wünscht sich sehr die Reisebücher herbei, die Jörg Fauser gerne geschrieben hätte, aber nie geschrieben hat. In einem seiner Briefe aus dem Jahr 1965 steht der Satz: »Zyniker bin ich insofern, als ich weiß, daß alles, was mir begegnet, mir auch zugute kommt; ich bin ein Verwerter.« Vor allem aber war Jörg Fauser auch ein pointierter Beobachter. Über seine ersten Tage in Rohrbach, wo er seinen Zivildienst in einem Krankenhaus antritt, gibt er zu Protokoll: »Diese Nonnen haben es mir angetan, ich kann mich nicht von ihnen losreißen. Hier sammle ich Material, bis ich nur so platze. Manchmal könnte ich schreien vor Vergnügen. Dann das dünne trockene Husten. Sterbende alte Männer. Einer, der mich beim Füttern fragt: Ei ich hab ja immer noch die Auge offe, ja gehe die denn gar net zu, desch is ja toll.
Das eigentlich Interessante hier ist, daß ich auf diese Weise mit Typen des deutschen Volkes zusammenkomme, die einem Asphaltliteraten eigentlich höchst selten unter die Nase kommen – pfälzischen Winzern, badischen Eisenflechtern, schwäbischen Handwerkern etc. Wir haben auch bzw. hatten einen Herrn Jan Kozak aus Galizien (jetzt Bergzabern) und einen Herrn Jura Mosjuk aus der Ukraine (jetzt Lörrach) bei uns – beide 1941 ins Reich gekommen. Man schaut also dem Volk aufs Maul – und so hautnah wie im Krankenhaus wohl nie mehr.«
In Göttingen angekommen, schreibt er im Mai 1969 über seinen neuen Wohnort wenig schmeichelhaft und im Geiste Franz Josef Degenhardts: »Göttingen als Szenarium eines mittleren deutschen Miefs fasziniert mich enorm: der unverwechselbare Krankenhausgeruch unter den Röcken der veronal- und kalkgegilbten alten Frauen, die Atmosphäre des Verkrüppelten, die durch die Fachwerkgassen und über die Plätze geistert, über die nachts der betrunkene Sang der Korpsbrüder leiert, gestanzt mit den spitzen Schreien und Gesten der von Gottes bösen Engeln hierher verpflanzten Griechen oder Spaniern, diese Brackwasser, in denen die weißen Haare verschimmelter Professoren mit türkischen Furzen und dem Mörtel der verfallenden Kirchen zu einem Brei zusammenwachsen, aus dem im nächsten Jahr farblose Gänseblümchen sprießen werden – pssst! bald schlagen die Uhren Mitternacht, die Gardinen werden zugezogen, die spitzen Nasen legen sich zwischen zwei Wärmflaschen und den Postkarten der verschollenen, bankerotten, ausgebombten Jugend zur Ruh – der Wind schwappt Regen auf den Wall, wo zwischen Höfen und Gärten der Frühling Wurzeln zu schlagen versucht … in den feinen Lokalen sitzen die Familien der habilitierten Krüppel und weiße Finger stochern, gespenstisch im weißen, pulvrigen Licht, das fette Fleisch von Tellern, die längst geleert sind.«
Immer wieder gibt es Überlegungen von ihm, Deutschland zu verlassen, aber eigentlich weiß er, dass er nur in Deutschland eine Chance haben wird, von der Schriftstellerei und dem Schreiben auch leben zu können. So belässt er es bei ausgedehnten Auslandsreisen und begibt sich, als es ihm möglich ist, freudig auf die Reisen nach Amerika und Asien, die er beruflich unternehmen kann. Ansonsten beginnt er sich mit Deutschland zu arrangieren, denn er weiß, dass er in Deutschland den Stoff für seine Geschichten aufsammelt, und sein Heimatland, das ihm mitunter Hölle ist, ist ihm zugleich Verheißung, wenn die Städte München oder Berlin heißen. Und das, obwohl es ihm seine finanzielle Situation oft unmöglich macht, eine richtige Wohnung zu mieten. Er schlüpft irgendwo unter, lebt in engen und mitunter unmöglichen Wohnverhältnissen und begnügt sich. Mit wie wenig er sich lange Zeit zufriedengibt, um als Schriftsteller leben zu können, ist beachtlich. Selbst als er es geschafft hat und auch finanziell auf besseren Füßen steht, schreibt er an seine Eltern: »Mir geht es ja momentan so gut, daß ich mir Bücher u. Zigarren u. sogar eine neue Matratze kaufen kann, aber ich lebe nicht in dem Gefühl es müßte so weitergehn. Nicht, weil ich ein Außenseiter bin, sondern weil ich ein literarisches Werk schaffen will (u. die junge Generation hat das Recht auf ihr Werk wie ich auf meins) u. doch nie wissen kann ob mir dafür einer auch noch Geld gibt.« Das ist keine Koketterie (oder nur ein wenig), sondern eine durch Erfahrung erworbene Gewissheit, die auch die Eltern kennen. Und so verwundert es nicht, dass sich auch der Vater gegenüber dem Sohn nicht scheut, seinem Unglück darüber Ausdruck zu verleihen, dass er zwar durchaus bekannt und mit Ausstellungen und Preisen gesegnet gewesen ist, aber andererseits im Verlauf seiner Karriere oft genug als »Ernährer der Familie« ausfiel, und darauf angewiesen war, dass seine Frau diese finanzielle Schieflage durch ihre Arbeit aufwog. Und die Antwort Jörg Fausers ist, man kann es nicht anders sagen, von großer Zärtlichkeit. Wie überhaupt durch das Lesen der Briefe eine Seite an ihm sichtbar wird, die jene, die ihn kannten, sicher nicht überrascht, die aber auch nicht unbedingt ins Bild passt, das man sich von Jörg Fauser macht und das Jörg Fauser womöglich als Wunschbild von sich selbst in sich trug. In einem seiner Gedichte heißt es:
ein Mann wie ein Rausch, ohne Zukunft, Berserker
ohne Bar ohne Frau ohne Schwert,
an der Loire ein Mann, er badet
in Bildern, in Prosa, in Wein,
er badet im Land, in der Sonne, im Blut
und tut alles unter der Fahne
des Winters, er weiß, es gibt
Liebe nicht so, Lämmer nicht so noch Heilige,
er sonnt sich in Schnäpsen, in Frauen,
in Prosa, in sanfter, vernünftiger
Metzelei…
Man muss solche Zeilen, die jahrzehntealt sind, nicht ernst nehmen, um sie wahrhaftig zu finden. Es reicht, die Sehnsüchte, die sich dahinter verbergen, irgendwann einmal geteilt zu haben. Dann haben sie Bestand. Und in Musik verpackt wären sie ein Lied, das viele mitsingen. Rotzigkeit und Melancholie waren Fauser immer wichtiger als Coolness. Sie ist bei ihm oft nur Fassade und Zeitgeist und kaum von Bedeutung. Sein Blick auf das eigene Leben war hingegen unaufgeregt lakonisch: »Grund zum Heulen gibt es keinen, und es wird sich auch nie was ändern, also gibt es auch keinen Grund zum Juchhu, das sage ich seit längerem allen, die mich danach fragen; sehr beliebt werde ich freilich nicht damit«, heißt es in einem der späteren Briefe an seine Eltern. Auch das hat Bestand, an manchen Tagen zumindest, wie auch die Briefe Sinn ergeben, die er schrieb, auch wenn er einmal zweifelnd anmerkte: »Briefe entstehen ja in gewissen Abständen, und was dann natürlich ist, wirkt – gesammelt – bisweilen gradezu abwegig.«
Das Gegenteil ist der Fall. Sie geben Auskunft und Orientierung und unterhalten, und in ihnen spiegelt sich nicht nur das Wesen des Verfassers wider, sondern auch die Zeit, in der sie entstanden sind. Wer solche Briefe empfangen hat, hat als Vater oder Mutter wenig falsch gemacht, und der, der sie schrieb, war ein guter Sohn.
Berlin, im Februar 2023
Die Briefe
Hinweis zur Lesart:
In Spitzklammern < > sind die Kommentare, die in den Originalbriefen handschriftlich ergänzt wurden. In eckigen Klammern [ ] sind die Ergänzungen des Herausgebers.
Den 23.3.58
Lieber Papi!
Von Donnerstag bis Samstag habe ich ununterbrochen Bundestag gehört. Es war hochinteressant. In erster Linie geht es um die Atomare Aufrüstung der Bundeswehr1. Es kam zu zeitweise tollen Szenen. Am Donnerstag sagte Erler, die Reden der Regierungsparteileute und die Atmosphäre des Hauses erinnere ihn an eine Szene im Berliner Sportpalast 1943, als Goebbels fragte: »Wollt ihr den totalen Krieg?« Daraufhin marschierten CDU und DP geschlossen hinaus. Später sprach Reinhold Maier. Es war irrsinnig! Mit seinem dünnen Fistelstimmchen machte er Strauß fertig. Erstmal fing er an, als er Strauß gehört habe, sei er an das gut deutsche Sprichwort erinnert worden: Von alledem wird mir so dumm, als ging mir im Kopf ein Mühlrad rum. Dann erzählte er, wie er im 1. Weltkrieg bei der schweren Artillerie gewesen sei, und übertrieb – echt schwäbisch – seine Taten. Nun, dann sagte er: Diesem Mann (Strauß) würde ich nicht einmal ein Feldgeschütz anvertrauen. Wer so spreche, der schieße auch. So spreche auch kein Bundesverteidigungsminister, sondern der Reichskriegsminister. – Und in diesem Ton ging es weiter. Am Freitag sprach erst einer von der DP. Es war ein Erznazi. Sein Ton hat mich richtig an die Reden und Zitate erinnert, die in dem Dokumentenbuch über das dritte Reich stehen. Es gab einen riesigen Krawall, als er zu den Sozis sagte: »Gott möge einen Atomkrieg verhindern (wenn sie [die CDU] es nicht vermag, dann berufen sie sich auf Gott!), falls sie noch an Gott zu glauben vermögen!« Nachmittags sagte dann Helene Wessel, sie habe den Eindruck, als ob bei der CDU u. DP der Glauben an die Atombombe stärker sei als der Glaube an Gott!
Aber am tollsten wurde es gestern vormittag. Erst sprach – sehr gut – Carlo Schmidt. Die meisten Worte waren Fremdwörter, und er zitierte u.a. Pascal, Hebel, Schiller usw. Und dann, nach ein paar langweiligen Rednern, kam ein SPD-Mann. Ein noch ganz junger, Schmidt aus Hamburg. Es war großartig! Hinreißend! Phantastisch!
Erst mal zitierte er, in Bezug auf die 251CDU-Mitglieder, »Psychologie der Massen«. Die CDU tobte! Dann beschrieb er Strauß: »Intelligent, meine Herren, aber gefährlich!« Schließlich sagte er: »Atombomben in der Hand eines Herren Jaegers (CDU) können die Schatten eines 3. Weltkrieges heraufbeschwören!« Und er schloß zur CDU gewandt mit den Worten: »Legen Sie Ihren deutschnationalen Größenwahnsinn ab!« Du kannst Dir vorstellen, wie die CDU-Leute, und, wie Döring (FDP) sagte, ihre Untermieter, die DP, tobten! Dann stand Kiesinger auf und schrie mit vor Empörung zitternder Stimme, das Haus müsse sich schämen ob solcher Worte! Dieser … hat es gerade nötig! Na wartet! Schließlich wurde die Debatte abgebrochen und auf Dienstag vertagt. Nachmittags kamen dann Kirn sen. und jun.2 und haben mit mir debattiert. – Das ganze Zeug hat mich nur in meinem Entschluß, Politiker zu werden, bestärkt. Jetzt erst recht! Aber sowie ich die Macht habe, lasse ich sie alle aufknüpfen. Und dann wird der Bundestag geschlossen. Nur kein Parlament!
Viele, viele, viele Grüße Dein Sohn Jörg!
Den 7. April 1958
Lieber Papi!
Vielen Dank für Karten und Briefe. Vielen, vielen, 1000fachen Dank für das Geschenk. Es muß ja toll sein! Ich glaube, es ist besser, wenn Du es in Rom3 behältst, dann sparst Du Porto und ich habe es gleich an Ort und Stelle und kann mir die abgebildeten Bauwerke gleich ansehen.
Am Freitag waren Mami und ich in einem tollen Film, mit Charles Laugthon und Marlene Dietrich: »Zeugin der Anklage«4. Einfach toll! Laugthon spielt einen entsetzlich dicken, herzkranken Strafverteidiger. Er kommt gerade, von einer kindischen Krankenwärterin bewacht, aus dem Krankenhaus ins Büro und soll sich sehr schonen und keine großen Fälle mehr machen. Kaum ist er da und soll ins Bett gehen, da kommt ein Kollege und bringt ihm einen neuen Klienten. Dieser, ziemlich unvermögend, ist verdächtigt, eine sehr wohlhabende Frau umgebracht zu haben, mit der er bekannt war. Die Frau, schon älter und verwitwet, bemuttert ihn. Er ist mit einer Deutschen verheiratet, die er nach dem Krieg als Besatzungssoldat kennengelernt hat. (Das ist Marlene Dietrich.) Er sagt, sie könne beweisen, daß er schon zu Hause war, bevor der Mord begangen wurde. Dann kommt raus, daß die Ermordete ihr Testament geändert hatte und ihm 80000 Pfund vermacht hat. Jetzt ist er natürlich schwer verdächtig. Also, der Prozeß beginnt. – und als Kronzeugin der Anklage tritt die Frau des Verdächtigen auf. Sie war, als sie ihn heiratete, schon verheiratet und ist also ein richtiges Biest. Sie sagt, ihr Mann sei erst eine Stunde später gekommen und habe ihr gesagt, er habe sie umgebracht. Es gelingt aber Laugthon, sie unglaubwürdig zu machen und der Verdächtige wird freigesprochen. Da aber kommt die Sensation: seine Frau, die vom Volk verprügelt wird, kommt zu Laugthon, der einsam auf seinem Bänkchen im Gerichtssaal sitzt, und sagt, daß er sie (die alte Dame) tatsächlich umgebracht habe. Sie selbst (M.D. hat L. kompromittierende Briefe zugestellt, um sich unglaubwürdig zu machen. Als dann der nun Freigelassene kommt, sagt er frisch heraus, daß er sie selbstverständlich umgebracht hat (in England darf niemand 2mal wegen derselben Sache vor Gericht kommen) und die beiden sind glückselig, er nur anscheinend, denn plötzlich kommt ein hübsches, junges Mädchen und gibt sich als seine Verlobte zu erkennen. Da erkennt M.D., daß er sie betrogen hat und bringt ihn um. Ein wirklich ausgezeichneter Film! (Schauspielerisch) –– Mami hat mir zu Ostern ein einfach hinreißendes Buch geschenkt: »Die Iden des März5« von Thornton Wilder. Ich finde es großartig!
Anbei die »La famille«, Nr. 5.
Das Wetter ist mal wieder kalt, aber wenigstens scheint die Sonne. Und in Rom? Regnet es immer noch? Daß es Kakerlaken, Mäuse, Ameisen, Skorpione und dergleichen gibt, finde ich großartig. Wie im alten Rom! Die sind wahrscheinlich auch nicht so schnell wegzukriegen wie die Steine!
1000 Grüße und Küsse
Dein Sohn Jörg!
Frankfurt a.M., den 18. Mai 1958
Lieber Papi!
Vielen Dank für Briefe und Karten.
Nun zum Thema Religionsunterricht. Deine Ansichten sind zwar, wie immer, sehr weise, nur bei diesem Religionslehrer undurchführbar, weil er mich nicht drannimmt, wenn ich sie äußern wollte. Und gegen diese Waffe kann man nicht aufkommen. Bei jedem anderen Lehrer wäre ich nicht ausgetreten, denn ich trete ja nicht wegen dem Fach, sondern wegen dem Lehrer aus. Mit dem letzten Religionslehrer – einem Pfarrer – konnte man sich sehr gut unterhalten. Warum: weil er nicht so fanatisch wie der derzeitige ist, und weil er bemüht war, stets sachlich und objektiv zu sein.
Wenn übrigens überzeugte Christen ebenfalls austreten, dann siehst Du, dass ich kein alleinstehender Nörgler und Phantast bin, sondern dass alle gegen diesen Lehrer sind. Ich wäre sehr gern im Religionsunterricht geblieben, weil mir das Fach gefällt und weil es sehr interessant sein kann. Aber so geht es nicht.
Übrigens kann ein Referat meiner Ansicht nach sehr wohl persönliche Gedanken enthalten. Herr Venz, mein Lehrer, dankte mir sogar für das, wie er sagte, »vorbildlich gehaltene Referat!« Entweder ist also Herr Venz ein Dummkopf, oder Du bist ein weiser Gott und unsterblicher Denker. Über beide Dinge kann man sich unterhalten, doch wenn ich so objektiv wie Du sein soll, dann möchte ich weder das eine noch das andere annehmen. – – Ich entfache auch keineswegs, wie Du es annimmst, einen Aufruhr, sondern es löste sich eine mit großer Spannung erwartete Debatte aus, wobei die Hitzigkeit einiger Leute keine Rolle spielt.
Gestern waren Mami und ich auf Sabines Geburtstag eingeladen, und heute geh ich zu Kirns.
Übrigens: Herr Marloth hat mich zu seinem Geburtstag eingeladen!
Er ist ------ am 26. Mai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mami lässt dir sagen, sie habe mit Helmut Fotos ausgesucht, die sie zu
herrn doktor franu roh,
münchen
(Einmal und nie wieder! 0,0)1
schicken will. Ob Du damit einverstanden seiest?
Und wie geht es Dir?
Hast Du die Hitze bisher gut überstanden? Wie wird das im Juli sein ?!?!
Es grüßt Dich 1000000000000000fach
Dein
sturer Sohn Jörg!
P.S.: Ob ich ein guter Politiker werde, wird die Zukunft und werde ich entscheiden!!!!!!!!!!!!!!!!! Und niemals Du!!!!!!!!!!!!!
BILDUNG! – – – BILDUNG!
Für meinen Lieben Paps zu seinem
.......... Geburtstag
Früh ist’s am Morgen, die Hähne kräh’n, bei Meiers heißt’s zur Schule geh’n!
Mann und Kinder wirft sie hinaus: »Jetzt herrscht die Bildung im Haus!«
Zu putzen und schrubbern, das braucht sie nicht, o nein!
Das schafft das Dienstmädchen schon allein.
So döst sie ein Weilchen noch vor sich hin und denkt an den Verein für Hölderlin,
wo sie am Sonntag beigetreten. Heute um fünf also bei den »Drei Musketen«.
Von vier bis fünf bei Hölderlin, von sechs bis acht ins Musikhaus hin,
wo Frau Anette Geige spielt. – – – – Beim Aufstehn um halb neun: Natürlich wieder nicht gespült!
Ach, diese Männer, wie »edel«, nein – – eitel besser, seufzt sie und spült widerwillig Teller und Messer.
Dann genießt sie ein warmes Bad, und nachdem sie gefrühstückt hat,
gehts an die Arbeit. Arbeit: Das heißt sich bilden.
Doch um eins ist es aus mit der Bildung, denn da stürmen wie die Wilden
Mann und Kinder in das Haus. Nun heißt es Essen kochen,
denn das hat sie versäumt, und stattdessen von der guten, vollkommenen Bildung geträumt.
Nach dem Essen gehts weg. Vorher gabs Streit und sie sagte zum Mann: Du ungebildeter Dreck. .....
Sie geht ins Café und genießt unter gebildeten Menschen einen gebildeten Tee.
Dann zu Hölderlin, wo es sehr schön ist und wo man so herrlich die Zeit vergißt.
Auch bei Frau Nette ist es ganz wundervoll, und zuletzt singen sie alle in Dur und Moll.
Es ist schließlich zwanzig nach acht. Sie geht nach Hause, ganz sacht.
Der ungebildete Dreck ist weg und sie legt sich ins Bett und sagt: Es hat ja doch keinen Zweck!
Mai 1958
Dein Jörg-Sohn
Den 28.5.58
Lieber Papi!
Vielen Dank für die Karten. Es sind jetzt 79!!!!! – Am Pfingstmontag war ich bei Marloths. Der Hausherr hatte Geburtstag. Er gab sich sehr leutselig und war sogar so gnädig, mit uns Sterblichen zu spielen, wobei er furchtbar verlor.
Später kamen dann die Richterschen Eltern, geradewegs aus »Mutter Courage« (es hat eine tolle Kritik: bestes Stück (und Aufführung) seit Jahrzehnten). Gert hatte nur etwa ¼ kapiert, was sich am besten in der Frage spiegelt: »Wann war das doch noch mal?«
Gestern wollten Mami und ich mit Richters eine Taunuswanderung machen, aber es wurde nichts draus, weil es morgens regnete. Dafür sind wir nachmittags in den Stadtwald. Es war sehr schön. Es gibt da einen kleinen See, den Maunzenweiher; da müssen wir auch mal hin, er ist wunderbar. Anschließend waren wir noch auf dem Wäldchestag.
Michael hat von »Mohrle« Aufnahmen gemacht, wenn sie was geworden sind, schicken wir Dir welche. »Mohrle« ist einfach drollig.
In Italien ist ja alles beim Alten geblieben, nur die Monarchisten sind eingegangen. Klar. Dadurch Neofaschisten 4.stärkste Partei. In der Zeitung stand, die Faschisten seien in ein Ghetto der Juden gekommen, hätten sie verprügelt, »Heil Hitler« geschrien und Hakenkreuze an die Wände gemalt. In ein paar Jahren wirds sicherlich bei uns genauso zugehen.
Es grüßt Dich 1000000 mal
Dein Sohn Jörg!
Den 17.6.1958
Lieber Papi!
Vorhin war ich in »Der dritte Mann«.
Ganz großartig! Der beste Film aller Zeiten – zumindest der beste Film, den ich je gesehen habe. Er ist mindestens eine Klasse besser als »Julius Caesar« – und das will was heißen! Was für eine unheimliche Spannung! Im Kino war es so leise, daß man Mohrle gehört hätte, wäre er herangeschlichen. Die Leute waren so gefesselt, es hätte ein Brand ausbrechen können, sie wären nicht weggegangen; jedenfalls ich nicht. Toll! Einfach hinreißend! Die Jagd in den unterirdischen Kloaken gehört zu dem Phantastischsten, was ich je sah, hörte oder las.
Viele Grüße und bis in 3 Wochen – Jörg!
Den 9.9.58
Lieber Papi! […] Zur Zeit lese ich Die Geschichte der Deutschen Revolution6 (von 1918/19). Im Internationalen Arbeiterverlag 1929 erschienen. Die ersten Jahre der Weimarer Republik, von der kommunistischen Warte aus gesehen. Von Kirn. Hinreißend! Was für ein Unterschied zum bonbonrosa Stampferlein! Ha! Vor allen Dingen tolle Illustrationen, Pamphlete, Zeitungsausschnitte, Plakate usw. Als ich gestern bei Kirn war, habe ich zum ersten Mal die Internationale gehört. Ein erhebender Augenblick! Toll! Kirn hat mehrere Platten geliehen, mit der Internationalen, der Marseillaise, der polnischen Hymne und der Hymne der UdSSR. Diese war ganz wunderbar, ein richtiges Musikwerk. Hinreißend …!
Mohrle ist das eitelste Tier, das ich je gesehen habe. Wo er auch ist, er leckt sich. Es ist irre, wenn man ihn beobachtet. Er kommt ins Wohnzimmer, guckt uns mit seinem etwas gemischt melancholisch-neugierig-vorwurfsvollen Blick an – und läßt sich schwer auf den Boden fallen, woselbst er sich zu lecken beginnt. Dies äußerst ausführlich. Dann schleicht er auf den Gang, läßt sich schwer auf den Boden fallen und beginnt von neuem die Leckerei. Das setzt sich dann auf der Chaiselongue fort. Selbst wenn er nach irgendetwas springt, muß er sich schnell vorher noch putzen, wenigstens übers Pfötchen lecken.
Das für heute! Dein Sohn Jörg!
Den 19.10.58
Lieber Papi!
Seit gestern liege ich im Bett, Mami hat mich angesteckt, aber morgen steh’ ich wieder auf.
Die Karten, die Du geschickt hast, sind ja toll, aber ich finde es unmöglich und werde es niemals glauben, daß Florenz schöner ist als Rom. Du warst ja da und sagst, daß Rom schöner sei, und ich glaube es auch.
Was kann schöner sein als Rom? Der Dom allerdings muß ja toll sein. Was mir aufgefallen ist: sowohl der Dom von Orvieto als auch die von Siena und Florenz haben einen Teil der Außenwand schwarz-weiß gestreift, das sieht komisch aus. Weißt Du, warum das so ist?
In 12 Tagen bist Du wieder da, dann ist der Tag gekommen, den Du als »Deinen 9. November« bezeichnet hast.
Bis dahin
noch viel Vergnügen!
Dein Sohn Jörg!
Frankfurt, Den 15.V.1960
Lieber Papi,
Du hast ganz recht: vive la France! Vive Lyon!7 Du wirst eingesehen haben, wie töricht es war, über Lyon zu spotten. So etwas kann man nur durch heiße Liebe wiedergutmachen, und dies scheint ja bei Dir der Fall zu sein. Gefällt Dir dann Arles auch so gut? Hoffentlich.
Hier ist alles sehr ruhig. Gestern war ich bei Thomas Kirn. Es ist ziemlich heiß. EIne Klassenarbeit haben wir noch nicht geschrieben, sonst in der Schule alles in Ordnung.
Ich habe »Des Teufels General« gelesen und es mittelmäßig gefunden. Wie geschickt sich Zuckmayer um eine eigene Meinung drückt, das ist schäbig. Außerdem finde ich, daß man Leuten wie dem Udet, denn der soll Harras ja sein, kein Denkmal, und sei es auch ein schlechtes, zu setzen braucht.
Übrigens eine sehr erfreuliche Nachricht, die Du vielleicht schon kennst:
Dein Nebenbuhler und sog. »Gatte« deines Rackers, Charvier, ist in eine Nervenheilanstalt gebracht worden.
Jetzt oder nie! Oder hast du dir im süß-wilden Lyon einen neuen R. angelacht? Das passiert jedem, müßte also auch dir passiert sein.
Den 18.V.60
Was sagst Du zur »Gipfelkonferenz«? Rätsel über Rätsel! Aber nicht besonders kritisch die Situation, finde ich. Und Du?
Heute nachmittag, 17:30h, ist der Ali kastriert worden. Ein bedeutender Augenblick! Er wurde, bis auf den Popo, in eine dicke Decke gewickelt und von einem Gehilfen festgehalten; sein Mißfallen äußerte er durch Röcheln und ersticktes Schreien. Dann wurden ihm rund um den Popo einige Haare abgeschnitten und – unter bestialischem Geschrei – zwei Betäubungsspritzen – nur lokal – in den Geheiligten gestoßen. Und dann ein Schnitt – die Zierde der Männlichkeit werden herausgezogen und abgeschnitten (er hatte schon ziemlich viel an männlichen Attributen!) und schließlich alles mit ein paar Stichen zugenäht. Und dasselbe auf der anderen Seite. Sehr harmlos! Ali merkte nicht viel und scheint auch nichts zu vermissen. Mami saß bleich auf einem Stuhl. Ein kleiner Leckerbissen für Dich, den verhinderten Chirurgen! Das hätten wir auch unten im Keller machen können!
Ich fahre jetzt natürlich in das Lager bei Worms; demnächst fülle ich die Anmeldung aus.
Und nun sei herzlich umarmt
von deinem Sohn
Jörg Christian
Viel Spaß, viel Freude, alles Gute!
Den 19.5.60
Lieber Papi,
heute das neue Telefonbuch: ein einziger Schock!
Ein Beispiel:
Wich H KfzRep Werkst Alte Falter-7
oder
Fauser A Mal ImBurgfeld-48
oder
Werner K Eisen W Anne Frank-22
Keine vollen Vornamen! .... Straße fällt weg! Abkürzungen, wo es nur geht! Platz sparen – die Post!! Sagenhaft!
Und es regnet, fließt, platscht, trieft ohne Unterlaß!
Was meinst Du? Soll ich in diese Theater-A.G. gehen?
Der Xenophon ist wirklich nicht besonders. (Es heißt:) Die ganze Zeit: … von dort marschiert er (Kyros mit Rebellen-Armee) nach x. Da hielt er sich drei Tage auf.
Dann marschierte er in drei Tagesmärschen, so und soviel Meilen, nach soundso. usw. Interessant ist, daß Xenophon in fast jeder Stadt einem alten griechischen Mythos begegnet, irgendeiner Fabel. Einmal soll da irgendein Halbgott einen anderen getötet haben, oder in der und der Quelle gebadet haben. Das ist für die Griechen natürlich interessant. Überhaupt ist die Situation recht knifflig: Kyros will sich gegen seinen Bruder Artaxerxes, den regierenden Großkönig, erheben; er sammelt in Sardes, seiner Provinzhauptstadt, eine Armee aus rund 13000 griechischen Söldnern und ca. 30000 Persern. Dann marschiert er los, unter dem Vorwand, die Preider, einen räuberischen Stamm, zu bekämpfen.
Unterwegs geht ihm der Sold aus.
Die Soldaten beginnen unruhig zu werden. Da erscheint – dea ex machina – eine gewisse Kilissa, die Frau des Königs von Kilikien. Diskret verschweigt Xenophon – vielleicht weiß er es auch nicht – den näheren Grund ihres Kommens und ihre Beziehungen zu Kyros; die müssen aber ziemlich intim sein, denn plötzlich hat er wieder Geld, und die schöne Kilissa begleitet ihn auf dem weiteren Marsch.
Das sind so kleine erfrischende Geschichtchen, aber ein trockener Schulmeisterstil!
Den 22.V.60
Lieber Paps,
heute Mami Geburtstag: wir erwarten zwischen sechs und sieben Personen. Jetzt, 10 Uhr morgens, ist es aber noch ruhig. Ich habe das Frühstück gemacht, und wir sind schon früh aufgestanden. Ali läßt es ja nicht zu, daß man länger als ½9h im Bett bleibt. Er ist ein richtiger Tyrann.
Gestern habe ich nun endgültig das Formular für das Wormser Lager ausgefüllt. Ich bin ziemlich gespannt und freue mich eigentlich schon darauf. Außerdem bin ich froh, daß es nicht so weit ist und vor allem nicht im Ausland. Ich glaube, daß ich in der nächsten Zeit vor allem mal Deutschland näher erforschen werde. Schade, daß kein Lager in Bayern ist, Bayern würde mich ziemlich interessieren.
Hier ist das Wetter kühl und schmutzig: miese und trist. Ich hoffe, daß Du in Arles besseres Wetter hast. Wie toll, daß Du einen Stierkampf gesehen hast. Was hälts Du nun davon, da Du jetzt informiert bist?
Heute nachmittag werde ich Dir weiteren Bericht vom Verlauf der Feierlichkeiten geben.
Abends ½9h.
Lieber Papi,
es – das Fest – verlief, wie immer, sehr lustig, heiter, gemütlich – mit einem Wort: nett. Da waren: Annemarie und Michael, Oma, Marei und Sabine.
Mami bekam von Annemarie, Michael und mir eine Pommes frites-Pfanne, die sie sich ja schon lange wünschte. Sie ist ganz patent, glaube bzw. hoffe ich. Außerdem habe ich ein paar Küchen-Tips aufgeschrieben, einen speziell für anspruchsvolle Leute, einen für derbere Geschmäcker, wie z.B. für mich.
Übrigens: wie ist das Essen in Arles? Ich fand das französische – d.h. das der Madame Deporoq bzw. das des »Lycée du Parc« – sehr gut und abwechslungsreich, wenngleich ich manchmal Lust auf Kartoffelklöße oder Pfannkuchen hatte.
Oma war lustig wie immer, Michael humorvoll leicht-ironisch wie immer, Annemarie still-selig wie immer, Marei – wie immer – eine Mischung aus Langeweile, Burschikosität, guter Laune und Studentenhaftigkeit, Sabine naiv-nett-einfach-intelligent wie immer, Mami müde und guter Laune wie meistens und ich schweigsam-leicht abwesend wie stets – so verlief das Fest wie immer.
Das wäre dieser Geburtstag; und aus der Betonung des »dieser« siehst Du, daß ich die Überleitung zum nächsten gefunden habe.
Gerade habe ich überlegt, daß dies der vierte Geburtstag hintereinander ist, an dem ich Dir aus weiter Ferne gratulieren muß: 1957: Du Laigueglia, ich Welscheid; 1958: Du Rom; 1959: ich Lyon; 1960: Du Arles. So wünsche ich Dir also zum vierten Male aus weiter Entfernung alles, alles Gute: gute Ideen, guten Verkauf, Tod aller Feinde, eine folgsame Familie, süße Racker, gutes Licht, keine erheblichen Preissteigerungen, Gesundheit, gute Laune und, nicht zuletzt, den Hauptgewinn im Lotto (übrigens: M. und ich haben heute keins richtig); ich glaube, das wäre so das wichtigste; wenn Du noch irgend etwas hast, dann wünsche ich Dir das auch noch; irgend einer der zahllosen Götter und guten Hexen und Feen möge Dir alles erfüllen, so wie im Märchen.
Vor allem aber wünsche ich Dir, daß Du Deine eigentliche Heimat, Italien, im kommenden Jahr wiedersehen kannst, Italien, zu dem Du vielleicht mit dem griechischen Vers sagen kannst:
῏Ω πατρίς, εἴδε πάντες, οἵ ναίουσί δε,
σὅτω γιλοι῀εν ὡς ἐγώ. Καὶ ρ῾α˛δίως
σἰκοι῀μεν ἄνσε, κοὐδὲν ἄν Πάσχοις καόν.
Das heißt ungefähr:
Wenn doch, mein Land, alle, die Dich bewohnen,
Dich liebten gleich mir.
Dann würdest frohere Menschen Du bergen,
nur Liebe sähest Du, mein Land, wie die meine.
Das klingt im Deutschen zwar wie lauterer Kitsch, ist aber im Griechischen herb und schön, eben echt griechisch.
Es lebe die Schönheit!
Au revoir! Bonne chance! Jörg
Zürich, den 1.4.61
Chers parents,
mir geht es ausgezeichnet!
Heute morgen war ich im Kunsthaus, in der ägyptischen Ausstellung: großartig! In Frankfurt mehr darüber. Übrigens, der Zug fährt hier Mittwoch um 9h früh weg, ich werde also gegen 15h in Frankfurt sein. Am Donnerstag war ich nachmittags mit David in der Stadt; abends allein, Fernsehen, grausig, vor allem das schweizerische. Und überhaupt! – Gestern großartiges Mittagessen (Schaschlik). Nachmittags mit dem Schauspieler Dickow8, den ich schon vor vier Jahren hier kennengelernt habe, Reini und David im Wald spazieren. Abends waren Susis Mutter und die Dickows hier. Für morgen hat uns Susis Mutter zum Essen eingeladen. Am Montag gehen wir vielleicht in »Mutter Courage« (mit der Weigel9), wenn es keine Karten gibt ins Kino: Wir Kellerkinder.
Dienstag werde ich einkaufen, und Mittwoch gehts zurück.
Es gefällt mir wirklich sehr gut, ich bin zufrieden und gesund. Nur das Wetter ist grausig.
Ich hoffe es geht euch auch gut und daß Papi die zwei einsamen Tage gut hinter sich bringt.
Also ciao bis Mittwoch!
1000 Grüße!
Jörg
13.7.63
Liebe Mami, lieber Pappi,
ich bin mir völlig im klaren darüber, welche Reaktion dieser Brief auslösen wird; während der vielen Monate, in denen das, was ich euch jetzt zu sagen habe, sozusagen zur Reife kam, hatte ich ja auch genug Zeit, mit auszumalen, was passieren wird.
Es wäre völlig abwegig zu denken, ich sei nur wegen Stella10 hier.
Einmal muß ich sagen, daß ich es, schlichtweg, weder bei euch (obwohl ich sehr wohl weiß, daß ihr wahrscheinlich die besten Eltern seid, die ich mir für mich denken kann) noch auf der Schule noch überhaupt in Deutschland noch lange, noch zwei Jahre, um genau zu sein, aushalten kann.
Und da ich, aus eurer Sicht: leider, keinerlei Ehrgeiz habe außer dem, ein paar gute Gedichte zu schreiben und so, wie es mir möglich ist, für das einzutreten, wovon ich glaube, es sollten alle Menschen dafür eintreten – da ich sonst keinerlei Ehrgeiz habe, sehe ich nicht ein, warum ich mich noch zu alledem zwingen wollte.
Ich weiß genau, daß mein Vater, er vor allem, davon überzeugt ist, ich sei einzig und allein nach London gefahren, um mich hier herumzutreiben, und wegen Stella.
Diese Annahme ist falsch. Es wäre, glaube ich, ziemlich gefährlich, auf ihr zu beharren: ihr könnt mich zwar mit gesetzlichen Mitteln dazu zwingen, noch zwei Jahre in Frankfurt und bei euch zubringen zu müssen: aber seid davon überzeugt, daß ich, sooft es nur ginge, wieder das täte, was ich gerade getan habe. Allmählich werde ich unempfindlich gegenüber anderer Leute Meinung von mir, auch eurer (da ich ohnehin weiß, daß mein Vater mich für eine Niete und einen Taugenichts und Versager hält, womit er, aus seiner Sicht, völlig recht hat). Ich bin hier zum ersten Mal in meinem Leben glücklich, auch ohne viel Geld, ohne warmes Essen oder sonstigen Luxus. Ich könnte es überall sein, wo ich für mich leben kann und nicht für andere Leute. Soll ich euch zuliebe etwas tun, das ich hasse? Die Zeiten sind vorbei.
Ich werde auf keinen Fall (dazu könnt ihr mich nicht zwingen!) weiter in die Schule gehen. Ich möchte, so wie hier, viel schreiben können; und, solange ich mich davon nicht ernähren kann (ich habe wirklich nicht viel nötig; das sehe ich, sehr befriedigt, hier), werde ich arbeiten, es gibt genug. Warum ich euch das nicht alles schon gesagt habe? Weil ich weiß, wie derartige Diskussionen bei uns vonstatten gehen. Warum um Himmels willen könnt ihr mich nicht so leben lassen, wie ich es gern möchte? Warum überlaßt ihr nicht meine Zukunft mir? Ist nicht Pappi auch Maler geworden, obwohl seine Eltern sicher andere Pläne hatten? Hat er nicht das getan, was er wollte? Und Mami? Ich flehe euch an: laßt mich doch, auf mein Risiko hin, tun was ich will! Ich weiß, daß ich euch sehr unglücklich mache. Wir machen uns gegenseitig unglücklich. Ich kann ebensowenig aus meiner Haut heraus wie ihr aus der euren.
Ich flehe euch an – laßt mich doch!
Ich schicke euch ein paar Gedichte mit, eins habe ich hier geschrieben.
Ich hoffe, daß die Frankfurter Hefte konkret was drucken werden, ich bin in Verbindung mit ihnen. Wenn ich genug zusammenhabe (im Augenblick etwa 40, seit einem Jahr, als die besseren) werde ich es wohl irgendeinem Verlagsmenschen geben. Aber darauf kommt es mir im Augenblick nicht an. Es kommt mir nur darauf an, daß ihr mich irgendwie verstehen könnt und mich nicht zwingt, das zu tun, was ihr wollt.
Natürlich könnt ihr mich hier von der Polizei holen lassen. Aber ich komme doch sowieso zurück! Glaubt doch nicht, ich sei wegen London hierhin gefahren – hier habe ich nur Ruhe (und ein Mädchen, das ich sehr gern habe und das mich sehr gern hat – das ist aber auch alles, wirklich!)! Wenn ihr mich polizeilich zwingt, gleich zurückzukommen, dürft ihr die völlige Gewißheit haben, daß ich bei der nächsten Gelegenheit dasselbe tun werde, und, wenn ich 21 bin, nichts mehr mit euch zu tun haben werde.
Es tut mir leid, daß ich euch die Ferien vermiese, vor allem für Mami. Ich kann’s nicht ändern.