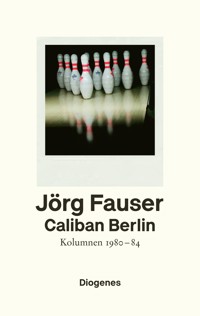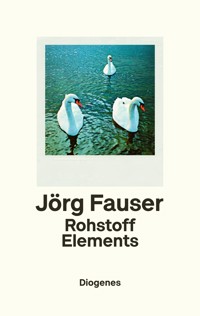20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
»Uns ist vorgehalten worden, wir hätten das Gedicht aus seinen hehren Gefilden auf die Müllkippe gezerrt. Nach diesem Weltbild besteht unser Publikum aus ungewaschenen Rüpeln ohne Bildung, aus Haschern, Huren, Junkies … In Wirklichkeit setzte sich unser Publikum natürlich – wie das unserer Kritiker – aus kontaktscheuen Stenotypistinnen, aus Deutschlehrerinnen mit zwei Siamkatzen, aus ebenso vielen Pfarramtskandidaten wie Zollinspektoren zusammen. Und hier und da ein Schwerverbrecher; das kommt davon, wenn man die Leute lesen lernen lässt.« (Jörg Fauser im ›tip‹ 22 / 1980)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jörg Fauser
Ich habe große Städte gesehen
Die Gedichte
Mit einem Vorwort von Björn Kuhligk
Diogenes
Vorwort
Das letzte Mal Fauser? Ich feierte meinen Geburtstag, und A. drückte mir ein Geschenk in die Hand. Es war die Erstausgabe von Fausers Essay-Sammlung Blues für Blondinen. Er sagte: »Ich hatte kein Geschenk. Ich hab’s aus meinem Bücherregal gezogen, ich dachte, es gefällt dir.« Treffer.
Das erste Mal Fauser? Es war 1995 in Hamburg. Ich hatte angefangen, Gedichte zu schreiben und Gedichte zu lesen. In einem Antiquariat kaufte ich mir einige Anthologien, um einen besseren Überblick zu bekommen. … OVERSEAS … CALL … war dabei, eine Anthologie, in der Gedichte deutschsprachiger Lyriker versammelt waren, die sich mit den USA auseinandersetzten. Darin fand ich einige Gedichte von Jörg Fauser, darunter 604 Riverside Drive. Ich lasse mich von Gedichten aufhalten, sie gehören zu meinem Leben, ich kann Zeilen auswendig, und aus diesem Gedicht sind es einige, und sie begleiten mich seit 1995. Ich denke manchmal, wenn ich noch spät unterwegs bin und durch fast leere Straßen laufe: »Es ist lange nach Mitternacht / und die Musik ist verstummt.« Nein, es sind keine großen Zeilen, warum müssen Zeilen auch groß sein? Sie haben sich eingeprägt, und das genügt. Und am Ende dieses Gedichtes wird es dann doch noch groß: »Neon Radar in Amerikas Gehirnzellen / was tu ich hier / worauf warte ich / auf Schlaf nein / auf Medusa / auf Rausch minus Horror / auf den irren Bomber / der uns alle / weckt«. Treffer.
In einem Berliner Antiquariat in einer kleinen Straße in Kreuzberg, auf dem Sprung in die nuller Jahre, fanden regelmäßig Lyriklesungen statt. Es war meist voll, und manchmal fand ich einen Platz auf der Wendeltreppe. In dem Lyrikregal stand Goethe, Trotzki und das Glück, und Max, der Antiquar, ein netter Typ, der, egal wie warm es war, eine Wintermütze trug, wollte nicht mit mir handeln. »Das ist Fauser, Erstausgabe, tut mir leid, geht nicht!« Also bezahlte ich die 30 Mark, obwohl ich das Geld nicht überhatte.
In den nuller Jahren schrieb ich hin und wieder Buchbesprechungen für das Berliner Stadtmagazin tip. Ich achtete darauf, keine Lyrik zu besprechen. Ich wollte nicht über Gedichte schreiben, ich schrieb selbst Gedichte, und zwischen Gedichten und mir gab es zu wenig Abstand. Als 2005, im Rahmen der Werkausgabe, die der Alexander Verlag herausgab, Fausers Gedichte erschienen, dachte ich, es ist egal. Ich rief Ingo Schütte, den damaligen Textchef an – Fauser und Schütte sind Redaktionskollegen gewesen –, und schlug ihm einen Text über die Gedichte Fausers vor. Wir diskutieren nur kurz und dann sagte er: »Eine Seite für den guten Fauser!«
»Einen Schriftsteller, der nicht gelesen wird, halte ich für eine pathetische und sinnlose Figur.« Seitdem ich diesen Satz von Fauser das erste Mal hörte, lässt er mich nicht mehr los. Pathetisch, ja, unbedingt! Aber auch gleich sinnlos? Es war Fausers 25. Todestag. Das Berliner Lichtblick-Kino war brechend voll. Zusätzliche Stühle wurden aufgestellt. Christoph Rüters Dokumentation wurde gezeigt, in der Freunde und Weggefährten zu Fauser befragt werden. Der legendäre Herausgeber Martin Compart sitzt zum Beispiel mit großer Sonnenbrille in einer abgedunkelten Wohnung und sagt, dass Jörg für ihn kein Alkoholiker, Kunstpause, sondern ein ernsthafter Trinker war. Ein Ausschnitt aus der Sendung Autor-Scooter wurde eingebaut, in der Hellmuth Karasek Fauser interviewt, und Jürgen Tomm, der etwas abseits an einem Tisch sitzt, versucht, mit Hilfe von Zuschauerfragen, die telefonisch eingehen und, auf Karten notiert, von einer jungen Frau an den Tisch gebracht werden, Fauser zu provozieren. Fauser sieht in seinem Anzug aus wie ein Verwaltungsangestellter. Er fummelt hin und wieder an seiner Krawatte herum. Er antwortet ruhig und überlegt. Fauser schrieb in einem Essay über Joseph Roth, wenn die Literatur nicht bei denen bleibe, die unten seien, dann könne sie gleich als Party-Service anheuern. Da sitzt er also zwischen denen, die nicht unten sind, und erzählt anderen, uns und den Fernsehzuschauern, die auch nicht unten sind, dass Martin Walser einen schlechten Schreibstil hat. Anschließend saß ich mit einem Freund in der Kastanienallee auf Klappstühlen mit schalem Bier in den Gläsern, und wir bekamen Regen auf den Kopf. Ich schrieb Gedichte, ich war eine pathetische Figur.
Vor zwei Jahren brannte der Goethe-Turm in Frankfurt-Sachsenhausen ab. Jedes Mal, wenn ich die Verwandtschaft in Frankfurt besuchte, gingen wir mit den Kindern wegen des Waldspielplatzes dorthin und stiegen auf den Turm. Wenn ich dann oben stand und die Türme des Bankenviertels sah, dachte ich Fausers Zeilen: »wenn wir in Tanger wären / könnte ich sogar / mit dir sterben / es regnete IG Farben / in Frankfurt/Main«. Treffer.
1973 erschien Fausers erster Gedichtband Die Harry Gelb Story im Maro Verlag, 1979 sein zweiter Gedichtband Goethe, Trotzki und das Glück bei Rogner & Bernhard. Drei Jahre nach seinem Tod editierte sein Freund Carl Weissner bei Rogner und Bernhard eine Gesamtausgabe, 2005 nahm sich der Alexander Verlag Fausers Werk an und gab es erneut heraus. Nun halten Sie diese Ausgabe mit den gesammelten Gedichten Fausers in den Händen, die aus den beiden erwähnten Bänden sowie verstreut publizierten Gedichten besteht. Sie werden, sollten Sie mit der Lyrik Fausers vertraut sein, auf einige Gedichte stoßen, die Ihnen unbekannt sein werden, da sie in keiner der bisherigen Gesamtausgaben vertreten sind. Dies ist nun – so hoffen wir – das Buch, in dem die Gedichte Jörg Fausers komplettiert sein dürften, und es heißt: Ich habe große Städte gesehen.
»Ich habe große Städte gesehen
und habe die großen Städte immer geliebt,
ihre Frauen, ihre Bars, ihre
Dämmerungen vor dem Gebrüll
der Maschinen und dem Sturm
auf die Bastille,
Berlin, Paris, New York,
eine Straßenecke in Schöneberg
erregt mich tiefer
als der Schnee
auf dem Mont Blanc
oder die Wälder
im Untertaunus«
In diesen ersten beiden Strophen lassen sich die Themen, die Fausers Gedichte prägen, mühelos ablesen. Sie werden in diesem Buch kein einziges Naturgedicht finden, warum auch? Die Natur hat Fauser in der Literatur nicht interessiert, und sie gehörte vielleicht nicht zu den Orten, an denen sich Fauser bewegte. Die Dinge, die Fauser beschrieb, waren nah an seinem eigenen Erleben.
Sie werden in diesem Buch auf Gedichte stoßen, die in der Realität verankert sind, auf Gedichte, die autobiographische Züge haben, die in Marokko, New York, Paris und München angesiedelt sind. Auf Gedichte, die in einfacher, zugänglicher Sprache gehalten sind. Es gibt in diesen Gedichten keinen hohen, keinen abgeklärten Ton. Fauser hätte es gekonnt, keine Frage, lesen Sie seine klugen, wortgewandt formulierten Essays über Literatur. Sie werden auf Gedichte stoßen, die Sie vielleicht an US-amerikanische Gedichte aus den 70er Jahren erinnern, an Charles Bukowski, Jack Kerouac oder William S. Burroughs. Gedichte, geschrieben von einem, wie es in seinem Roman Rohstoff heißt, »Außenseiter, der bei den Außenseitern auf der Außenseite sitzt«. Diese Gedichte erzählen, sie bleiben selten stehen, sie treiben voran. Fausers Gedichte sind auf das Wesentliche zusammengezogene, kondensierte Kurzgeschichten.
»Morgens stellte sie mir Eistee ans Bett
und ging raus um die Hunde zu füttern.
Ich trank den Tee, zog mich an
und tappte durch den Wohnwagen
in die Sonne:
meilenweit nichts als Sandwüste
und Staub und drüben die violetten Berge
und 40 Grad im Schatten, wenn es Schatten
gegeben hätte.«
Sie werden auf Gedichte stoßen, die deutlich machen, dass Fauser genau und neugierig hinsah und denen, die er porträtierte, zugewandt war.
»Ein grauhaariger Herr nimmt am Nebentisch Platz,
sagt zum Kellner »Das Gleiche wie immer«
und bekommt: einen Kaffee,
ein Eisbein, einen Underberg.
Sorgfältig raucht er eine Juno,
zahlt, geht. Kein Wort zu viel.
Die Musikbox spielt Wenn ich denk dass ich denk«
Sie werden Gedichte über die Sehnsucht nach Liebe lesen, Gedichte über die Einsamkeit, Gedichte aus dem Trichter der Depression, und gerade die Gedichte, die einen auf dicke Hose machen, hinterlassen eine Traurigkeit, weil sie schlichtweg lächerlich sind, geschrieben von einem Macker, wie man diese Typen in den 70ern nannte, der später eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern heiraten wird. Sie werden in den Gedichten auf Frauen treffen, die auf Äußerlichkeiten reduziert sind, die als Stichwortgeberinnen oder Projektionsflächen fungieren. In anderen Texten, die Fauser im Laufe seines Lebens schrieb, setzte er sich, wie die Journalistin Katja Kullmann herausarbeitete, mitunter distanziert und ironisch mit seinem Männerbild auseinander. In der langen Erzählung Alles wird gut findet sich eine Stelle, die sich wie eine Reflektion darüber liest: »… Anus, Schwanz, Schwellfleisch, Mösenmilch, das sind doch alles nur Chiffren, die für etwas ganz anderes stehen, und das ist die Lebensangst, und deshalb die Pumpe voll Power, die Macht.«
Fast in jedem Gedicht gibt es mindestens ein alkoholisches Getränk. Fauser ging an gegen sich selbst, sei es als Süchtiger von Heroin und später Alkohol, sei es als Irrender, der sich schreibend suchte, »der auf dem Grund der Gläser angelangt ist / und immer noch nichts gefunden hat / außer der alten Hure Hoffnung«. Sei es als Wütender, der, die bundesdeutsche Gegenwart vor der Nase, Gedichte schrieb, die Vernichtungsphantasien nahekommen und am Ende des Gedichts, aus dem sogleich ein zitierter Ausschnitt folgt, der Regen »die Paradiese blank wäscht und ertränkt«.
»… die Sozialscheißer
hab ich über und die Klugscheißer,
die Dröhner und die Drohnen,
ihre Antiquitäten und Badewannen
und billigen Sprüche, ihre Pelzmäntel
und ihre ausgepowerte Phantasie, ihre
Harmlosigkeit, die sie so furchtbar macht,
ihre Ferienreisen und ihre Bürgerinitiativen,
ihre verchromte Seele und ihr
drittes Programm,
die Kinos hab ich über
und die Biergläser,
die Geographie und die Bettlaken«
Das Gedicht schraubt sich so tief in die Wut hinein, dass selbst die Geographie und die Bettlaken zu Zielen werden. Immer wieder finden sich in seinen Gedichten die Adjektive irre und kirre, das Wort Flackern, das Beschreiben der oberflächlichen Psyche, wenn der Körper mit dem Abbau von Substanzen zu viel zu tun hat und der Kopf nicht mehr nachkommt und zu flackern beginnt. Die Fokussierung auf Jörg Fausers Süchte, das Kaputte und das Heruntergelebte überdecken die politische Komponente, die seine Gedichte haben (»CSU in jedem Briefkasten«), sein Anschreiben gegen die Soldatengeneration, die Täter, die Kriegsversehrten, die in den 70er und 80er Jahren die deutsche Gesellschaft prägten. »Hier hatten sie ihre Lieder / gesungen, hier ihren / Hölderlin gelesen, hier / waren sie geschlachtet worden / und hatten geschlachtet, / hier kommen wir her.«
In der Fernsehsendung Autor-Scooter sagte Fauser: »Ich möchte mich ungern als Schriftsteller bezeichnen. Ich bin Geschäftsmann. Ich vertreibe Produkte, die ich herstelle.« Was für eine auf das Ökonomische heruntergebrochene, unterkühlte Betrachtung dessen, was es bedeutet, Schriftsteller zu sein! Eine trotzige Zurückweisung der eigenen Kreativität, die vielleicht auf die Ablehnung zurückzuführen sein mag, die Fauser erfuhr, als nach seiner öffentlichen, im Fernsehen übertragenen Lesung um den Ingeborg-Bachmann-Preis das Jury-Mitglied Marcel Reich-Ranicki sagte: »Dieser Autor hat hier nichts verloren.« Er hatte auf Druck seines Verlages an dem Wettlesen teilgenommen, und er hatte dort tatsächlich nichts verloren, was auch? Er schrieb journalistische Texte, Kolumnen und erfolgreich Songtexte für Achim Reichel und Veronika Fischer und stand für vieles, was konträr zu dem gerichtet war, wofür die zumeist älteren Herren standen, die in der Jury saßen und das Wort an sich rissen.
1986, ein Jahr vor seinem frühen Tod – er wurde nachts bei München auf der A94 betrunken als Fußgänger von einem Lastwagen überfahren –, formulierte er die verbitterte Selbstauskunft: »Keine Stipendien, keine Preise, keine Gelder der öffentlichen Hand, keine Jurys, keine Gremien, kein Mitglied eines Berufsverbands, keine Akademie, keine Clique; verheiratet, aber sonst unabhängig.«
Noch 40 Jahre nach ihrer ersten Publikation scheinen Fausers Gedichte eine zeitlose Anziehungskraft zu haben. Die Orte sind andere geworden, das Personal verhält sich ähnlich. Morgens komme ich oft an einer Kneipe vorbei, die rund um die Uhr geöffnet hat und deren Inneres mit ihren an der Decke befestigten Instrumenten ein bisschen aussieht wie das Oberstübchen eines Alkoholikers nach dem dritten Bier des Tages. Sie beherbergt die Profis aus der Nachbarschaft, Stimmen aus dem Innern dringen nach draußen, 8 Uhr morgens. Ein Junkie, gekrümmt wie ein Embryo, hockt an der nächsten Straßenecke, und die Alkis mit ihren Hunden sitzen müde beim Frühstücks-Bier auf den Wartebänken des U-Bahnhofs. Es gehört zu meiner Gegenwart, und ich denke oft darüber nach, warum es kaum Schriftsteller*innen gibt, die sich mit diesem Teil unserer Realität beschäftigen.
Wenn die Tanzbären der Postmoderne ihre nächsten effektiven Sachen geschrieben haben, die Nähe und Auseinandersetzung vermeiden und die so schnell verhallen wie Jean Baudrillards These vom Ende der Geschichte nach dem Einsturz des World Trade Centers, und wenn dann auch der übernächste heiße literarische Scheiß vorbeigezogen ist, werden Fausers Gedichte immer noch Leser*innen haben. Wie gut, dass er weder eine pathetische noch eine sinnlose Figur ist. Es braucht keine Vehikel als seine Texte, um das, was er schrieb, am Leben zu halten. Aber warum gibt es keinen Literaturpreis, der seinen Namen trägt? Einen Preis, mit dem Literatur ausgezeichnet wird, die bei denen ist, die unten sind? Für eine Literatur, die sich nicht scheut, die merkwürdige Unterscheidung zwischen ernsthafter und unterhaltsamer Literatur in die deutsche Biotonne zu treten? Es ist Zeit dafür.
Björn Kuhligk
An London
London, lass ihn nicht im Stich, den schwächsten deiner Verehrer.
London, verlass mich nicht,
denn wie soll ich weiden mein Bedürfnis in der Sozialen Marktwirtschaft,
wohin ich gehör laut Personalpapier, wenn ich
es nicht gelernt hab’ wie die ordentlichen Leute?
London, ich bin nicht ordentlich,
ich hab’ meinen Schlafsack verschlampt in deinem Norden
und dreimal an den Buckingham Palace gespuckt und um meinen
Schlips gewürfelt in Soho und ihn verloren.
London, du bist nicht verloren,
du wirst in Whitehall verschachert, gewiss,
aber in Fulham getröstet, nie aufgegeben –
und wie schmiegt sich Hampstead zärtlich an dich!
London, du weißt, ich muss noch eine Weile sein in der Specköde,
wohinein mich mein Unglück geboren hat,
aber bald werde ich zurückkommen zu dir,
meiner Geliebten,
und wir werden die Feste feiern mit unseren Brüdern
im dunklen Notting Hill,
und werden in der Nacht deine Lieder hören
in Finsbury Park,
wenn der Nebel steigt.
Und ruhelos sind wir, unterm scheinheiligen Himmel,
belad’nem Gewölk, leider etwas verseucht,
und wir fragen nicht, wovon das Geld kommt,
das wir nicht haben, und brüten nicht über den Umsturz,
der nie kommt,
London, da verschachern wir unser Gesangbuch;
da verladen wir unser Geheimnis.
London: da bin ich zu Haus.
Da bin ich zu Haus,
wo das Jahrhundert sich selbst frisst
für drei Penny im East End,
da bin ich zu Haus, wo ich unter angeschimmelten
Hüten spaziere auf Oxford Street um drei Uhr nach Mittag,
da bin ich zu Haus und allein,
ruhelos, fraglos.
London, wenn dein Gesicht sich öffnet am Abend
auf weinenden Straßen.
London!, wo der kalte Wind die Saiten streicht,
da freu’ ich mich des Lebens:
schon geht der Rauch mir voraus
zu den Wolken.
Und das ist meine Epoche: Jeden Tag
ein Weltrekord! Jeden Tag eine neue Erfindung!
Jeden Tag eine neue Bombe! Und jeden Tag
wählen die Lämmer den Metzger zum König!
Aber das schert mich nicht, nein.
Ich stelle keinen Weltrekord auf, ich erfinde nichts,
ich bin selbst die Bombe, ich bin Lamm
und Metzger und König.
Ich bin mein eigner Bruder und töte mich täglich
im Krieg – da ist immer irgendwo Krieg – und überlebe doch alle.
London, du wirst nichts mehr überleben,
du bist längst verschachert, verramscht und verkauft,
und darum liebe ich dich,
liebe ich dich unter strontiumbeladenen Wolken,
liebe ich dich unter deiner Haut von Ziegeln und Blech,
liebe ich dich, wo die Leute mit Fingern auf dich zeigen,
liebe ich dich unter deinem Rock von Nebel und Rauch,
liebe ich dich
und werde kommen zu dir bald und mein Gesicht betten
auf deinem Stein, wo dein Herz ist.
Da magst du mich lassen,
da werd’ ich zufrieden sein,
da bin ich zu Haus.
Frankfurter Hefte1, 1964
Spaziergang in Hackney
Für Papi
24.12.64
1
Hier bin ich,
empfangen und eingeweiht in Hackney North Sixteen,
kein Fremder am ersten Tag
im nördlichen Sommertag Londons.
Und nun getaucht in blauen Samt die Stadt
getaucht und Turm und Park und alle Gassen
getaucht und Hundeschwanz und Kindgeburt und
Fliegentod
und frommer Bart getaucht und Ziegeldächer
und Totschlag Schlussverkauf getaucht und auch die
Bomben alle
in Sommers feinen Sand getaucht.
Und das Licht apfelfarben in Baum und Strauch.
Und Kinderlachen – leiser die Klingel des Eisverkäufers,
nah –
alte Frauen in Pantoffeln Zigarettengepaff aus
Schimmelmündern
sagen einander das Wetterneuste oder gewohntes Gekeif
an Ecken –
»Alte Schlampe diebische Fotze verkommene Hexe« dies
der Todfeindin
von nebenan –
dann kleinere Explosionen (in Sommers feinen Samt
getaucht) und das Jüngste
plärrt im Garten, das den Tag verbringt mit warmer
Erde, Schlaf
und bäuchlings großen Wundern.
Aber gelbe Stille zumeist!
Dort der Psalm der ernsten Sonnenblumen.
Empfangen und eingeweiht. Nur manchmal bang?
Ich habe die Einladung.
Und gehe in der Musik gemacher Fantasien, weit stehen
meine Fenster
offen, bin ich
ein freundlich braun und still geöffnetes Haus.
Dort schlägt eine Tür. Ein Alter geht über die Straße, im
schwarz
geknöpften langen Mantel. Langsam geht ein alter Mann,
geht auf die Mauer zu von ungefähr, in deren Schatten ich
lehne,
geht ein alter Mann mit breitem hohen Hut.
Schlappen weite Hosenbeine schwarz, geflickt.
Geht grauer Bart, ins Buch geneigt.
Dort geht ein alter Mann, liest heilige Kapitel.
2
Mein Alter bist auch du wehklagend und mutlos beizeiten
durch das Meer gegangen, hast in Furcht dem Herrn
gedankt
und im Hunger gesonnen im Hader: dass er uns
auswählen musste,
aus tausend Völkern uns!
Warst auch du trunken und hast gejohlt im Götzentanz mit
allen
und in der Nacht einen Sohn gezeugt im schieren Suff
in schmatzenden Küssen begraben die zitternden Brüste
der Frau
die erschrockenen Augen in rasselndem Schnarchen?
Später gewiss warst du fromm, älter geworden.
Länger sahst du dem aufwärts strebenden Rauch nach.
Langsamer wurden die Seiten bedacht.
Eines Abends hieß es: es sind neue Machthaber. Davon,
erzählt
mir dein Bart, verstandest du nichts.
Sahst du dich, ein wunderbar entdeckter Patriarch und
neuer
Stammesführer, den verstreuten Herden grollenden
Zuspruch
und Gottes Segen gewähren?
Ach, mit den Jahren und Zeitungen neigte sich deine Stirn,
sanken in ihre Höhlen die Augen zurück, wurden
unverständlich
deine Reden, die Gebete beinah stumm.
Nicht mehr von Widdern und Frauen, auch von den Toten
nicht,
sondern von Kinderspielen und Lehrern, Mahlzeiten
und Sommerfahrten auf dem Fluss, grünen Kähnen
hinterm Schilf,
träumtest du.
Einmal nachts hast du ganz leise gekichert. Bald starb die
Frau.
Und keine Flöte spielt dir, keine Tochter bürstet dir den Hut.
Lange gefallen der Tempel
Jerusalem.
Lange ist dein Sohn, lange dein Bruder
erschlagen.
Lange tot die Frau, tot
der Freund.
Lang gewachsen der Bart, geneigt der Leib
in Gicht.
Lange lange Zeit.
Im Sand klagen, im Wind die verwehten, verschütteten
Kinder.
3
Und Hackney North Sixteen,
schon färben Schatten den Samt.
Dort geht ein Alter über die Straße, liest heilige Kapitel.
Nach Staub schmeckt auch die gelbe Frucht.
Jene Schönheit sieh, die der Gräser, den Psalm der
Sonnenblumen,
und dort den alten Mann.
Ich sehe,
und halte, empfangen, eingeweiht, zu Haus,
vor ein Gesicht
eine Hand.
Von der Unberührbarkeit der Erde
Für Mami
24.12.64
Ich weiß die Erde ist unberührbar
in ihrer einfachsten Blume.
Ich weiß es wird mir nie gelingen
ihre Schönheit auszusprechen, und ohne ihre Täler und
Gärten
auf allen Wegen begangen zu haben
werde ich sterben.
Blätter und Schatten
verlassen die Erde nie,
das Wasser in den Flüssen und die Steine der Berge
überleben auch mich.
Ich ging von irgendwo hierher,
ich werde gehen von hier in ein anderes Hier
lautlos in der überfüllten Welt
der Tode und Wiedergeburten, der angstschreienden
Städte.
Ich werde ein Haus bewohnen
und vielleicht ein anderes,
werde meinen Namen in die Tür schreiben wo ein
anderer war
und ein anderer sein wird nach mir,
ich werde mit wenigen leben und wenige
verlassen,
und werde zur Tür hinausgehen, durch die ich eintrat,
ohne Trauer, ohne Freude und Verlangen,
unbemerkt von den Tälern und Gärten der Erde
werde ich sterben.
Spätsommer in Hertfordshire
Wir versuchten es auf der Wiese neben der Fabrik,
Keksfabrik, Fahrradfabrik, aber ich schaffte
es nicht, zu viel Bremsen und Ameisen, und
im Hintergrund am Teich die Angler, ich schaffte
es nicht. Dann gingen wir was trinken,
und später noch mal auf dem Boden vor dem TV,
und ich schaffte es wieder nicht. Schau, Stella,
vielleicht morgen. Ich rollte mir eine Kippe,
ging raus und hielt meinen Daumen in den Nieselregen.
Irgendein Irrer trat auf die Bremsen und hielt.
Wohin willste?
Keine Ahnung.
Steig ein.
Ein Ire, Sonntagsanzug, zu klein, schäbig,
besoffen wie tausend Matrosen.
Meine Alte hat’s gerade geschafft, gerade eben hattses
geschafft, sagt er und gab Gas.
Was geschafft?
Mann, das Baby. Nach 12 Monaten. Stell dir
das vor. ’ne Tochter.
Wo willste hin? Ich hatte immer noch
keine Ahnung. Dann bistu mein Gast!
Muss nur noch Milch holen fürn Tee.
Wir fuhren, er fuhr, er raste, ich paffte.
Wir hielten kreischend, wieder eine Fabrik,
ich blieb im Wagen, er verschwand. Mir war
alles gleich. Ich hatte es nicht geschafft.
Er kam zurück mit ’ner halben Flasche Milch.
Glück gehabt, sagte er, ’n Kumpel von mir
hatte gerade Schichtwechsel.
Wir fuhren weiter. Wir hielten, stiegen aus.