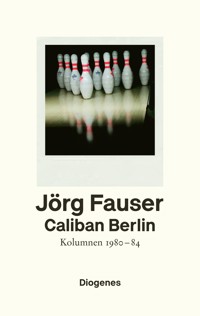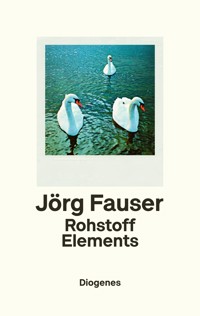20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesen Texten, die Jörg Fauser von 1963 bis 1987 verfasste, lernen wir ihn als Schwärmer und Fan kennen, aber auch als Zerpflücker und Lästerer. Manches darin ist gemein, anderes strotzt vor Bewunderung. Ein abwechslungsreicher Band, der Texte über Autoren von Gryphius bis Grass beinhaltet, der einen Hörfunkbeitrag über die Kriminalliteratur und ein Gespräch mit Bukowski liefert, der peinliche Literatentreffen erlebbar macht und bei alldem immer eines zeigt: Fausers Liebe zur Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jörg Fauser
Der Klub, in dem wir alle spielen
Über den Zustand der Literatur
Mit einem Vorwort von Katja Kullmann
Diogenes
Vorwort
Jörg Fauser, das war doch dieser Suff-Schreiber, nicht wahr? Der Typ, der fast jeden Abend an einem Kneipentresen hing und die Blondine am Zapfhahn abspannte und sich von anderen zerknitterten Typen grummeliges Zeug erzählen ließ und auch selbst gern seinen Weltbetrachtungssenf in den Nikotinnebel greinte und sich alles merkte oder gleich auf einem Thekenzettel notierte, um später am Schreibtisch mindestens ein Gedicht aus all dem Palaver zu stricken.
Fauser, das war also doch der, der aus dem krummen Alltag erzählte, von schmierigen Handelsvertretern, Drogen-Druffis, Aushilfskriminellen, vom »täglichen Überleben«1 der sogenannten kleinen Leute. Ein Experte des Sich-Durchschlagens, Fachmann des Geradeso-über-die-Runden-Kommens.
Starb er schließlich nicht sogar selbst einen so lausigen Loser-Tod, wie nur Jörg Fauser ihn hätte erfinden können? Stockbesoffen eierte er im Juli 1987, in der Nacht nach seinem dreiundvierzigsten Geburtstag, nach einer Männerrunde in einem Münchner Vorstadt-Puff, zu Fuß auf die Autobahn und lief einem Lkw in die Spur. Zack – verreckt auf deutschem Asphalt, krepiert am Strand einer großen Stadt2. Was für ein Abgang. Praktisch ja schon wieder eine Story. Fast zu schön, um wahr zu sein.
Zeitlebens galt er als Outsider im Literaturbetrieb, und einigermaßen gern hat er damit geprahlt. Kein Ehrenpreis, kein Stipendium, keine Fördergelder, kaum mal eine Erwähnung und schon gar kein Lob in einem der großen Feuilletons: Oft und ausführlich sprach und schrieb Jörg Fauser über die eigene Prekarität und die Ignoranz, die er im sogenannten Kulturestablishment festzustellen glaubte. Er wusste sich zu wehren. Die Schmach des Übersehenwerdens hat er zu einer Tugend umgemünzt, das Außenseitertum hat er zum einzig wahren Nimbus stilisiert. Ja: Das Nicht-richtig-Dazugehören – und der trotzige Versuch, genau daraus etwas zu machen, im Schreiben wie im Leben –, war (und ist) ein fester Bestandteil des von Jörg Fauser selbst mitkreierten Mythos Jörg Fauser.
»Ich glaube nicht, daß die Figuren, an denen ich interessiert bin, reine Asoziale, Außenseiter sind. Alle haben einen Bezug zur Gesellschaft, und zwar einen ganz starken – mal mehr, mal weniger. Es ist nur eine Gesellschaft, die sie einfach nicht reinläßt. […] Die Form von Bestätigung, die man von der Gesellschaft braucht – das prägt diese Leute. Das sind nicht Leute, die von sich aus sagen: Ich will damit nichts zu tun haben«3, sagt er einmal in einem Interview, und beinahe klingt das so, als spräche er nicht über sein Roman-Personal, sondern über sich selbst.
Drei Jahre vor seinem Short-Story-artigen Tod scheint er mit dem Gedanken zu flirten, vom ewigen Geheimtipp mit Underground-Aura vielleicht doch noch zu einem anerkannten Autor zu werden.
Gerade ist er vierzig geworden, endlich verdient er nennenswertes Geld mit seinen Büchern. Seine autobiographisch getönte Junkie-Geschichte Rohstoff ist im Ullstein-Verlag erschienen, solides Hardcover, schicker Schutzumschlag, und sein Kriminalroman Der Schneemann wird in mittelgroßem Stil verfilmt. Zur Überraschung vieler Vertrauter und Fans tritt Fauser im Juni 1984 dann bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur an, beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im österreichischen Klagenfurt – ausgerechnet bei einem Hochamt der »vermuffte[n] wie versumpfte[n] Haupt- und Staatskultur«4, über die er seit Jahren lästert.
In der Jury sitzen drei Platzhirsche aus jenem Segment: Peter Härtling, Walter Jens, Marcel Reich-Ranicki. Fauser trägt einen Text vor, in dem es um ein Liebespaar im Zypern-Urlaub geht, um den Geschlechterclinch und enttäuschte Romantikhoffnungen, und erwartungsgemäß wird sein Beitrag von den Herren Kritikerpäpsten verrissen. Ein mäßig talentierter Unterhaltungsschriftsteller sei Fauser. Einer, der Kunst nicht könne, über das Triviale nicht hinauskomme und auf den Spielplätzen der ernsthaften Literatur nichts verloren habe.
»Herr Fauser, wollen Sie etwas sagen?«, fragt der Moderator den Autor nach dem Gemetzel vor laufenden Kameras.
»Nein«, sagt Fauser, packt sein Lesemanuskript und geht5.
Sowenig die »Kassenwarte und Rentenbearbeiter unseres bundesrepublikanischen Schrifttums«6 mit seinen Geschichten anfangen können, so sehr interessiert sich die Alternativszene (Fauser) für sein Schreiben. Und so bekommt er einige Monate nach dem Klagenfurter Showdown im Ruhrpottmagazin Marabo die Gelegenheit zu erklären, wie er sich den geeigneten Umgang mit »brauchbarer Literatur«7 vorstellt:
»Ich finde, Literatur gehört in den Supermarkt, zwischen das Getränkeregal und die Kasse. Erst soll man Möhren kaufen, die Tiefkühlkost, die Butter, das Brot, und dann einen langen Blick auf das Getränkeregal werfen […] und wenn das geregelt ist und auch noch die Zigaretten und der Pfeifentabak eingepackt sind, dann müßte der Blick auf einen Stand fallen, auf dem einige gute Titel stehen. Das kann alles sein, auch Schopenhauer, es muß ja nicht alles Konsalik sein, was da steht. Es muß den Zugang erleichtern.«8
Was soll das überhaupt: das Schreiben? Worüber denn? Wie muss es klingen? Wie kann es funktionieren? Für wen? Und vor allem: Was ist das eigentlich für eine Figur – der Schriftsteller?
Immer wieder hat Jörg Fauser sich und anderen diese Fragen gestellt, und immer wieder hat er sie selbst beantwortet – in Essays, Kolumnen und Rezensionen, oft auch im direkten Gespräch mit anderen Autoren, in Interviews, Hausbesuchen, Reportagen.
Für seinen Junk- und Eckenlieger-Stoff ist er bekannt, wurde er einst belächelt, wird er bis heute verehrt. Sein eigentliches, vielleicht wichtigstes Thema, der Stoff, an dem er sich so leidenschaftlich aufgerieben und abgearbeitet hat wie an kaum einem anderen, geht dabei oft unter. Klänge es nicht so salbungsvoll, so komplett unfauserig, könnte man sagen: Die Literatur als solche war die Recherche seines Lebens. Von ebenjener Spur handelt der vorliegende Band.
Tagebücher hat Jörg Fauser, soweit bekannt, nicht hinterlassen. Solcher Schmus war nicht sein Ding. Statt sich in die »Labyrinthe der deutschen Innerlichkeit«9 zu begeben, belauschte und erforschte er lieber die »gesegnete Wirklichkeit«10, die ihn umgab, draußen, wo es öfters auch mal stank und nervte.
Dennoch haben die Texte, die hier versammelt sind, einen beinahe tagebuchähnlichen Effekt. Achtunddreißig Fauser-Überlegungen zum Schreiben an sich, dem eigenen und dem Schreiben anderer finden sind zwischen diesen Buchdeckeln. Sie sind chronologisch nach ihrem Erscheinen geordnet – den ersten Text verfasste er noch als Schüler, den letzten wenige Monate vor seinem Tod –, und sie erlauben in etwa das, was Fauser selbst bei so vielen Autoren suchte: einen intimen Blick in den Maschinenraum des Schriftstellers, seinen Kopf.
Ob es sich um Beiträge für große Illustrierte wie Playboy und Stern handelt, für kleinere Magazine wie Sounds und Transatlantik oder für längst vergessene Mikro-Blätter wie UFO und Zoom: Neben seinen Romanen, Erzählungen und Gedichten hat Jörg Fauser ein umfassendes zweites Werk hinterlassen – eine eigene kleine Literaturwissenschaft.
Stets aufs Neue ist er dabei zu der Frage zurückgekehrt, was »realistische zu populärer, populäre zu realistischer Literatur machen kann«11. So formuliert er es in Der Klub, in dem wir alle spielen, einer Buchbesprechung, die er 1982 für das Berliner Stadtmagazin tip schrieb und die dem vorliegenden Band den Namen gibt.
Die Texte, in denen Fauser sich mit der Literatur im Allgemeinen und Besonderen auseinandersetzt, zeigen den hochgebildeten und ziemlich ehrgeizigen Menschen, der hinter all den lässig erzählten Loser-Storys steht; den anspruchsvollen, manchmal missgünstigen, meist aber souverän selbstironischen »altmodischen Romantiker« und »verschrobenen Individualisten«12; den Vielleser, Schwärmer und Fan, das Lästermaul und den Studierenden auf Lebenszeit. Sie beleuchten den ideellen und künstlerischen Werdegang eines Mannes, der sich »seine Neugier nicht zuschütten lassen [will] und sein Mitleid«13 – und der doch ständig und vor allem um die eigene Selbstverortung kreist. Fausers Gedanken zu Plot, Stil, Sound, zu Produktionsbedingungen und zum Betrieb sind auch als »biographische Skizzen« zu begreifen, wie der Schriftsteller, Fauser-Kenner und Fauser-Fan Friedrich Ani es einmal formulierte14.
»Als ich jung war, wollte ich Schriftsteller werden. Schriftsteller erklärten das Leben, Schriftsteller gaben ihm einen Sinn, Schriftsteller, Dichter waren meine Helden, Helden in einer bedrohlichen, bedrohten Welt. [S]ie führten ein exemplarisches Leben, waren Vorbilder.«15 So intensiv Fauser sich als Erwachsener mit Rand- und Unterschichtsmilieus beschäftigt, immer wieder mit den Groben und Schlechterzogenen, so behütet und gebildet, sozusagen unproletarisch ist er selbst aufgewachsen. Man muss wohl von einer bescheidenen urbanen Boheme sprechen: der Vater Arthur ein feinsinniger prekärer Kunstmaler; die Mutter Maria eine feinsinnige prekäre Schauspielerin; der Haushalt voller Bücher; der Sohn Jörg Christian ein innig geliebtes, bisweilen vielleicht sogar verhätscheltes Einzelkind, ein naseweiser Gymnasiast.
Schon »mit sechs, sieben Jahren« habe er die Theaterstücke des Vormärz-Dramatikers Christian Dietrich Grabbe »komplett gelesen«16, erzählte Fauser über sich selbst. Andere erinnern sich an einen Zehnjährigen, der »über Dostojewksi redete, Shakespeare zu adaptieren suchte und sich Gedanken zur SPD machte«17, wie Fauser-Biograph Matthias Penzel bemerkt.
Gleich der erste Text in diesem Band lässt die ausgeprägten Ambitionen des jungen Mannes aufblitzen: Und was sind unsere Taten18 lautet der Titel, Fauser schrieb ihn für die linksliberal gepolten Frankfurter Hefte, als er noch nicht mal zwanzig war. Es geht um den Barock-Dichter Andreas Gryphius, und der postadoleszente Kritiker befindet wohlwollend: »Wohl nur selten hat, zumal in Deutschland, ein Dichter so klar, so hart zugreifend und in derart tief tönender Sprache zugleich die doch so sorgsam und umfassend um menschliche Bedeutungslosigkeit errichteten Schutzwälle zerschlagen.«19 Sogleich nutzt er die Gelegenheit, die »abgelenkten und ablenkenden Modernismen jeder Generation« zu bespötteln und von »künftigen Düsternissen« und der »Wasserstoffbombe« zu raunen20.
Zum einen klingen jene Zeilen selbst so »tief tönend«, als ob der sehr junge Mann, der sie formuliert, lieber schon ein ganz alter wäre, als ob er sich vorgenommen hätte, den bürgerlich-bildungshuberischen Tonfall möglichst originalgetreu zu imitieren.
Zum anderen hat Fauser hier schon das Leitmotiv formuliert, dem er selbst in seinem weiteren Schreiben folgen wird: die »Schutzwälle zerschlagen«, die um »die menschliche Bedeutungslosigkeit« errichtet sind, den Blick in die dunklen Ecken nicht scheuen.
Der Dichter sei »nur Stellvertreter […], Zeuge für die Namenlosen und ihr Chronist«21, befindet er wenig später und stellt sich selbst das Zeugnis aus: »Ich teile in ausreichendem Maße die Gedankengänge des Durchschnitts.«22
Keineswegs durchschnittlich ist die Bandbreite seiner Belesenheit. Else Lasker-Schüler, George Orwell, Joseph Roth, Hans Fallada, Raymond Chandler, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Charles Bukowski, Hans Frick: Sie alle bewundert Fauser auf die eine oder andere Art, sie alle liest er über die Jahre immer wieder, und manchen von ihnen reist ist er bis in deren Wohnzimmer hinterher.
Dabei haben es ihm vor allem »die Amerikaner« angetan: »Ich bin ein Kind der amerikanischen Freiheit – ich wünsche Amerikas Politik zum Teufel und liebe seine Literatur.«23 Mit analytischer Brillanz untersucht der Leser Jörg Fauser die Methoden anglo-amerikanischer Autoren und schaut sich manche Tricks für sein eigenes Schreiben ab: vom afro-amerikanischen Schriftsteller Chester Himes das »szenische Fingerspitzengefühl« und den »harten und poetischen Realismus des Blues«24; von Raymond Chandler und William S. Burroughs das Prinzip des Set, den filmischen Blick: »Atmosphäre, Licht und Schatten, der Hut auf dem Vertiko […], Geräusche von der Straße, vielleicht eine Blume im Haar des blonden Mädchens«25; vom Polit-Thriller-Spezialisten Ross Thomas die Konzentration auf den Plot und den »sarkastisch-lakonischen Tonfall«26.
Sosehr er manche für ihr Schreiben liebt, so inbrünstig verachtet er andere, etwa den bundesdeutschen Großschriftsteller und Ex-Wehrmachts-Soldaten Martin Walser. Oder den »Oberpauker der Literaturnation«27 und, wie sich erst nach Fausers Tod herausstellt, Ex-SS-Mann Günter Grass. Die Vielfalt der Fauser’schen Schimpf- und Kampfbegriffe kennt keine Grenzen. Über »Sensibilisten [, die] eine Literatur der Ängstlichkeit und Wehleidigkeit«28 produzieren, zieht er her. Über schreibende »Fraktionen der Sozialarbeiter und Psychotherapeuten«29 und über den Typus des literarischen »Agitprop-Federfuchser[s], der vom Parkett der relativen, wenn auch erstickenden Sicherheit«30 operiert.
Gleich, ob es um einen Autor von dies- oder jenseits des Ozeans geht: In fast all den Elogen und Verrissen wird Fauser an der einen oder anderen Stelle emotional, geht ihm die Lakonie mitunter flöten, kippt er ins Hitzige, klingen seine Urteile manchmal hart, aber ungerecht.
Ja, in seinen journalistischen Arbeiten, wenn er nicht als fiktive Figur, sondern als Fauser himself spricht, scheint manchmal eine bitterernste Seite auf, die nur wenig Spaß versteht. Die Ansprüche, die er an sich selbst und andere Autoren stellt, ereichen stellenweise fast schon biblische Höhe: Da hat man es direkt mit den Klöpsen Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit zu tun, mit »moralischer Kraft«31, »existentieller Erfahrung«32, »Substanz«33 und »Stehvermögen«34, mit dem »eigentliche[n] Thema aller Kunst […]: Schuld und Sühne«35.
Live und in Farbe dabei zu sein, die »genaue Kenntnis des Materials«36, ist für Fauser die Grundvoraussetzung für den »demokratischen Realismus«37, den er sich von der Literatur erhofft. Und wenn er solcherlei tatsächlich einmal lesend entdeckt, wenn er festzustellen glaubt, »daß es keinen Unterschied zwischen dem Schreiben und dem Leben«38 eines Autors gibt, überschüttet er denjenigen mit Lob.
»Frick war dort, und er kann darüber schreiben«39, merkt er etwa über den Ex-Hilfsarbeiter, Ex-Büroangestellten, Ex-Handelsvertreter, Ex-Alkoholiker Hans Frick an, dessen Tagebuch einer Entziehung ihn beeindruckt. Den Junkie und Trinker in sich selbst kennt Fauser nur zu gut. Und so gerät seine Rezension von Fricks Entzugsbericht beinahe zu einem Re-Enactment, jedenfalls zu einem lebendigen, reportagehaften Text, wie man ihn im Feld der Literaturkritik nur selten findet. Ebendies macht Jörg Fausers feuilletonistische Texte so einzigartig: Es gelingt ihm, selbst den stillen Vorgang des Lesens als eine Erfahrung zu schildern, die einem bis ins Mark gehen kann. Mit jedem Satz will er zeigen, wie viel die Literatur mit dem »echten Leben« zu tun haben kann – wie die Realität sich also verschriften lässt, ohne sie dabei zu verkünsteln oder gar zu verkitschen:
»Ich habe Fricks Tagebuch in einem Stück gelesen, an einem nebligen Novembernachmittag in Frankfurt. Auf der Zeil gehen die Neonlichter an und illuminieren eine gespenstische Konsumlandschaft, in der sich Leichen auf Urlaub wie unter Wasser bewegen. Alte verkommene Männer mit geschlossenen Augen am Fuß der Rolltreppen der B-Ebene, diesem Spiegel unserer Lebensqualität. Stunden der Imbissstuben und Stehbierhallen, der Angst vor der Nacht. Aus dem Pissoir an der Friedberger Anlage taumelt ein Betrunkener, schäbiger Mantel vom Sozialamt, eine halbgeleerte Flasche Schnaps in der blutverkrusteten Hand […] Aussatz. Gewiss doch: Früher hätten wir euch alle vergast. Man kommt von Fricks Buch zurück wie von einer Reise – Bilder haben sich unter Schmerzen festgesetzt. Alptraumsplitter an der Peripherie des Bewusstseins, bis man sich umsieht und erkennt: Der Alptraum ist kein Traum, er ist Realität und schließt alles ein.«40
Fausers Schwärmen ist elektrisch, es vibriert, statt die Dinge zu verklären. Und das liegt auch daran, dass er meist sich selbst ins Spiel bringt, seine Zweifel, seine Skepsis sich selbst gegenüber. Als er vierzig ist, fährt er in die schleswig-holsteinische Kleinstadt Neumünster, wo einer seiner weiteren trinkenden und schreibenden Helden, Hans Fallada, einst lebte und unter seinem bürgerlichen Namen Rudolf Ditzen als Anzeigenverkäufer für die Lokalzeitung arbeitete, und Fauser fragt sich:
»Was hatte ich mir eigentlich gedacht, nach Neumünster zu fahren, fünfzig Jahre nachdem Ditzen die Stadt für immer verlassen hatte? Eine literarische Entdeckungsreise – Spurensicherung im Hinterland? Das war ja lächerlich.
[…] Ich hockte im Fleckenkieker, starrte nach draußen, starrte nach drinnen, ich saß mir gegenüber und starrte auf mich selbst. Wer bist du? Was hast du zu sagen? Und wenn du es gesagt hast, bist du dann davon erlöst? Ich räusperte mich. Schreiben als Erlösung, also, mein lieber Scholli, sagte ich zu meinem Gegenüber, jetzt kommen wir aber ganz schön ins Schleudern. Wenn wir jetzt noch das Heil und den Himmel dazutun, dann läuft es uns aber als Fußschweiß aus den Löchern in den Socken, es wird hier wohl nicht auffallen, aber stinken tut es doch.«41
Ein paar Jahre zuvor ist er nach Los Angeles gereist, um Charles Bukowski für ein Playboy-Interview zu treffen. Viele Fragen, die Fauser an sein, nun ja, Idol richtet, sind welche, die er genauso auch an sich selbst immer wieder stellt, unverkennbar versucht Fauser, die Begegnung auch zu einem Abgleich mit seiner eigenen Biographie zu nutzen. Besonders deutlich wird das bei der Frage nach dem leidigen Geld. »[Ich schob] elf Jahre lang Nachtschichten als Briefsortierer. Zum Schreiben brauchte mich da niemand zu ermutigen«42, sagt Bukowski. Bei Fauser selbst klingt das an anderer Stelle so:
»Hätte ich […] nicht eine Reihe von Jobs wie Gepäckarbeiter oder Nachtwächter gehabt, würde ich nicht für Rundfunk/TV/bürgerliche Feuilletons/Nackedeimagazine usw. schreiben, könnte ich mir die ›Alternativ-Szene‹ gar nicht leisten. Ich und alle anderen, die schreiben, weil Schreiben das A und O ist und Überleben sonst nicht lohnt.«43
Die Literaturkritik nennt es gern Welthaltigkeit, aber ein so großes Wort braucht es gar nicht, es ist doch ganz einfach: Wer nicht von Haus aus mit Geld gestopft ist, der muss anschaffen gehen, der muss sich unter die Leute mischen, muss tatsächlich, schon fürs pure Überleben, »live und in Farbe« dabei sein und sich dabei auch mal die Hände schmutzig machen. Nur so entsteht, mit Fauser gesprochen, »eine Literatur der Erfahrung, der Welt, des gelebten Lebens«44.
An Jack Kerouac beeindrucken ihn dessen »Jobs als Eisenbahn-Bremser, Obstpflücker«, »Waldhüter, Hilfsarbeiter«45. An Else Lasker-Schüler bewundert er das wechselhafte Dasein »in billigen Hotels und Pensionen«, den »Verzicht auf eine solide Existenz im bürgerlichen Sinne« – »[Sie blieb] arm und wurde allenfalls ärmer«46. In Dashiell Hammett verehrt er den »Autodidakt[en], der mit 14 von zu Hause fortlief und sich in vielen Berufen versuchte«47, und im britischen Thriller-Autor James Hadley Chase sieht er den »Vertreter« und »Klinkenputzer«, den »Kaufmann, der mit Geschichten [handelt] wie andere mit Südfrüchten«48.
Auf sich selbst wendet Fauser ein ähnliches Bild an: »Ich bin Geschäftsmann. Ich vertreibe Produkte, die ich herstelle, und das ist ein Geschäft. Writing is my business.«49 Dieses Business führt er als äußerst penibler Buchhalter:
»Verdient habe ich […] keine Ehrennadel des Bundesministeriums für Familie und Gesundheit und keinen alternativen Europa-Wanderpokal, sondern Geld, und zwar so viel: für meine drei Bücher bis Ende 1976 rund 600 Mark, für die Cassette nullkommanull Mark, für die Zeitschriften-Maloche insgesamt ca. 3000 Mark […] Ach ja, und dann bekam ich mal von einem Kleinverleger, der eine große Zeitung machen wollte, 50 Mark Vorschuss auf eine Kolumne, und nach der ersten Nummer wurde die Zeitung eingestellt. Macht summa summarum 3650 Mark in fünf Jahren und neun Monaten, macht pro Monat 52 Mark 90 – und damit gehöre ich wahrscheinlich noch zu den Großverdienern der Branche.«50
Die Unabhängigkeit von der staatlichen Kulturproduktionsbürokratie und ihren schönen, satten Geldern ist hart, sie führt zu einer »Literatur ohne Zensor, ohne Finanzamt, ohne Buchhalter und ohne Bankkonto, ohne Brot und ohne Preis«51. Vor allem ermöglicht sie aber ein Schreiben, wie Fauser es vorschwebt, wie er es für richtig hält: »Wenn Literatur nicht bei denen bleibt, die unten sind, kann sie gleich als Party-Service anheuern.«52
Ein politischer Schriftsteller im engeren Sinne war Jörg Fauser nicht. Wollte er auch nie sein. So aufmerksam er den Parteienzirkus in der alten Bundesrepublik beobachtete und in seinen journalistischen Texten kommentierte – besonders gern mit Blick auf die SPD, auch auf das Phänomen Helmut Kohl –, so strikt hielt er die Tagespolitik aus der Literatur heraus.
»Die deutsche Tradition ist: Der Schriftsteller nimmt an der Politik aktiv teil. Das halte ich für nicht gut. Die enge Teilnahme an irgendeiner politischen Gesinnung, wie auch immer, kann der Schriftstellerei nur schaden. Was nicht heißt, daß ich als Privatperson oder politischer Typ, wie jeder andere auch, nicht einen politischen Standpunkt hätte oder mich nicht engagieren würde. […] Allein die Darstellung der [Macht] reicht schon. Da muß ich mich nicht in Mutlangen hinsetzen, das würde ich nicht machen.«53
Zu den aus heutiger Sicht schwer verdaulichen Texten in diesem Band zählt Das Risiko der Erkenntnis54, Fausers Betrachtung zu einem Streit um den Stahlhelm-Schriftsteller Ernst Jünger. 1982 soll der mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main geehrt werden. Einige Abgeordnete der gerade erst gegründeten Partei Die Grünen protestieren dagegen. Sie sehen in dem Nationalisten und Militaristen – »Ich hasse die Demokratie wie die Pest« (O-Ton Jünger) – einen »ideologischen Wegbereiter des Faschismus«, der nie eine »klare Stellungnahme« zum Nazi-Regime abgegeben habe. Fauser wiederum sieht in Jünger den »letzten großen deutschen Stilisten« und im Aufschrei der Grünen eine Einmischung von »Sittenwächtern« in die »Freiheit des Menschen« und auch der Kunst. Er wittert einen »miesen Blockwartsmief«, »geistiges Schnüffelantentum«, Anzeichen einer »Gesinnungsdiktatur« und dröhnt dabei in etwa so, wie man es heute von sogenannten Neuen Rechten kennt.
Plötzlich verteidigt er hier die Entscheidung einer durch und durch bürgerlichen Literatur-Preis-Jury. Wo er sich sonst über »drollige Robben, niedliche Vögel, Fachwerkhäuser oder Pferde im Morgentau«55 und literarische »Indianerspiele« für die gestressten Herzen des Mittelstands« echauffiert, scheint er beim »Naturforscher« Jünger auch »Meditationen über Sanduhren, Schleifen und Schmetterlinge« etwas abgewinnen zu können. Anerkennend stellt er heraus, dass Jünger stets versucht habe, »in allen Wandlungen sich treu zu bleiben, und das heißt vor allem: sich jedem politischen Zugriff zu verweigern«.56
Die notorische Verweigerung (von was auch immer, Hauptsache erst mal nein sagen) und das unbedingte Sichselbstreubleiben: Auch so kann Pathos klingen. Pathos Fauser’scher Fasson.
An der jüdisch-deutschen Avantgardistin Else Lasker-Schüler gefällt ihm, dass »auch nach 1933 keine Gedichte von ihr bekannt sind, die als Flugblätter verwendbar wären, wie man das heute gelegentlich von Schriftstellern verlangt. […] Bis zuletzt blieb sie im Privaten, für sich, ihrem Schicksal vollkommen treu«.57
Bei Hans Fallada zeigt er Verständnis für dessen Flucht in die innere Emigration, in die private »Welteinsamkeit« während des Nazi-Terrors, und dafür, dass Fallada sich »anzupassen« versuchte und beim Schreiben »in unverfängliche Themen« auswich.58
Im krassen Gegensatz dazu hält Fauser an anderer Stelle aber fest, dass der ebenfalls von ihm verehrte Joseph Roth ins Exil floh und radikal »mit jedem brach«, der in Nazi-Deutschland blieb.59 George Orwell und Ernest Hemingway genießen seinen Respekt, weil sie im Spanischen Bürgerkrieg gegen den Faschismus kämpften.
Am früheren DDR-Oppositions-Schriftsteller Erich Loest gefällt ihm wiederum, dass dieser eigentlich »unauffällig« leben und »sich aus politischen Querelen heraushalten«60 habe wollen. Loest sei »den dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus« gegangen, »den Weg zwischen den Elfenbeintürmen und den roten Fahnen, dort, wo die Risse sind, die durch uns alle gehen«.61
»Die Risse, die durch uns alle gehen« – Jörg Fauser hat sie nicht nur rings um sich wahrgenommen, in der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft:
»Und wie war das, bitte, mit diesem Untergang gewesen? Was war denn untergegangen? Der Staat war da, die Politik war da, die Kirche war da. Das Geschäft blühte, die Polizei blühte, die Wissenschaft blühte. Auf den Trümmerplätzen waren jetzt Terrassencafés, und nicht die Dichter berührten das Blau des Himmels, sondern die Flugzeuge und Wolkenkratzer. Die Mörder saßen mit den Opfern am Tisch. Tranken sie Brüderschaft?«62
Etliche »Risse« hat er auch in sich getragen. Beziehungsweise verdrängt. Nicht alle Unterdrückten und Ausgegrenzten genießen bei Herrn Jörg Christian Fauser die gleiche Solidarität. Für den Kampf gegen Rassismus hegt er große Sympathien, was sich etwa in seinen Elogen auf die afro-amerikanischen Schriftsteller James Baldwin und Chester Himes zeigt. Für den Kampf gegen Sexismus hat er hingegen kaum etwas übrig. Vielmehr zeigt er sich belustigt bis belästigt vom »Feminat«63 und witzelt in allerfeinst chauvinistischer Manier über »resolute Studentin[nen], [die] ihr Strickzeug wegräumen und erklären, die spezifische Problematik der Frauen sei auch diesmal wieder zu kurz gekommen«.64
Womöglich ist es für alle Beteiligten, sowohl für den Autor Fauser als auch für seine Leserinnen und Leser, ein Riesenglück, dass er den großen politischen Roman nie geschrieben hat. Ja, vielleicht war das die klügste Entscheidung, die Jörg Fauser schreibend je getroffen hat: seinen tagesaktuellen politischen Jähzorn in einzelne journalistische Texte auszulagern, statt seine Romane und Gedichte damit zu verkleistern. Danke, Jörg, ist besser so!
Man kann sich wirklich wunderbar aufregen und aufreiben an manchen Texten in diesem Buch, und das in zwei Richtungen: Man kann sich mit Jörg Fauser oder über Jörg Fauser aufregen.
In jedem Fall kann man von Jörg Fauser lernen, wie man sich aufregt, und zwar so, dass die Lektüre der Aufregung ein Vergnügen ist, bestes Entertainment.
Insbesondere der Text Leichenschmaus in Loccum65 sei in diesem Zusammenhang empfohlen: ein Crashkurs in Sarkasmus, Stufe III, für Fortgeschrittene. Fauser ist zu einer Literatur-Tagung an der evangelischen Akademie im niedersächsischen Dörfchen Loccum geladen, und die Absage, die er an den zuständigen »sehr geehrten Herrn Prof. Dr. Ermert« formuliert, gehört wohl zum Fiesesten, was ein redlich ums Wohl der Literatur bemühter Akademie-Mensch zu lesen bekommen kann. Tot wie der Mürbeteig einer »niedersächsischen Pizza« sei das »deutsche Tagungsleben«, schreibt Fauser und lästert über die »seltsame Mischung aus älteren silbergrauen Herren mit Bügelfalte und den Halfzware-Typen mit ihren Wuschelkopfgefährtinnen und dem Army-Schlafsack«, die »auf dem »ästhetischen Niveau« eines »Volkshochschulkollegs« oder einer »soziologischen Gartenlaube« über Kriminalliteratur reden wollten.
Was für ein Snob, dieser maulige, nölende Typ – nicht wahr?
»Was, wenn er tatsächlich ein Stipendium für die Villa Massimo bekommen hätte? Er hätte sich natürlich dort einquartiert«66, mutmaßte ein temporärer Weggefährte Fausers, der frühere tip-Chefredakteur Werner Mathes, zwanzig Jahre nach Fausers Tod. »Seine Attacken […] waren auch so eine Attitüde, die nicht immer ehrlich war. Ich denke auch, daß sein früher Tod heute manches verklärt, was so klar gar nicht war.«67
Da ist sie wieder: die Verklärungsgefahr, die doch so überhaupt nicht zu Jörg Fauser passt. Die Textauswahl in diesem Band soll ihr entgegenwirken. Im Idealfall lädt das hier gesammelte Material zum konstruktiven Streit mit Fauser ein. Zum Mitschwitzen, wenn er sich an der Frage der »künstlerische [n] Integrität«68 abarbeitet. Zur Zustimmung, wenn er beklagt, dass im Literaturgeschäft oft »Bluffer den Geschmack angeben, dem nur Bluffer noch Reize abgewöhnen können«.69 Und zum Widerspruch, wenn er in seinem »heiligen Zorn« (Friedrich Ani) wieder einmal »etwas zu tief in die Harfe griff« (Werner Mathes).
Jörg Fauser konnte nicht nur motzen, er konnte auch sehr großzügig sein. Statt seine Quellen, Stichwortgeber, Inspirationen geheim zu halten, hat er sie freimütig in die Welt gestreut, sozusagen nach dem Prinzip sharing is caring. Seine Texte über Literatur sind Anregungen, da weiterzulesen, wo er selbst intensiv geforscht hat, seinen Faden aufzunehmen, den Jörg-Fauser-Kanon fortzuspinnen, die Jörg-Fauser-Schule am Laufen zu halten.
Auch er selbst hat gern Tipps von denen aufgenommen, die er mochte. »Von John Fante hörte ich zum ersten Mal im September 1977«70, erinnerte er sich einmal. Charles Bukowski hatte ihn auf diesen italo-amerikanischen Autor gebracht. »Zwei Jahre später fand ich in der Bücherabteilung von Karstadt am Münchner Nordbad die amerikanische Taschenbuchausgabe eines neuen Romans von John Fante […] Ich las das Buch an einem Nachmittag […] das Buch eines Mannes, der von Anfang an wusste, was Schreiben war.«71 Enttäuscht, vielmehr entsetzt ist Fauser allerdings von dem Vorwort, das Bukowski dazu geschrieben hat: »Vielleicht war Bukowski übergeschnappt oder drosch im letzten Stadium irgendeines quasi religiösen Deliriums Texte in die Maschine, die wie Konfirmanden-Aufsätze klangen … oder wie die Literaturseite von Christ und Welt. Ich las Fante.«72
So sollten wir auch hier verfahren: Das Vorwort schnellstmöglich vergessen – Fauser lesen.
Katja Kullmann, Berlin im Sommer 2020
Und was sind unsere Taten
Andreas Gryphius wurde 1616 zu Glogau in Schlesien geboren, verlor früh die Eltern, besuchte die Schule inmitten der Katastrophen des Dreißigjährigen Krieges, begann früh zu schreiben und wurde, einundzwanzig Jahre alt, von seinem Mäzen zum Dichter gekrönt. In Holland, an der Universität zu Leyden, hielt er vier Jahre später Vorlesungen über Logik, Anatomie, Geographie, Geschichte, Mathematik, Astronomie und römische Altertümer; er schrieb etwa zehn Schauspiele, einen Roman, wurde zum Begründer des deutschen Trauerspiels, übersetzte, verfasste wissenschaftliche Werke, war ein Bewunderer des Kopernikus und glaubte doch an Geister. Im Alter von vierunddreißig Jahren ging er, als Landessyndikus seines heimatlichen Fürstentums, in die Politik, worin er, wen wundert es, Bedeutendes geleistet haben soll. Als er sechsundvierzig war, nannte man ihn den Unsterblichen. Zwei Jahre später, am 16. Juli 1664, starb er an einem Schlaganfall.
Ich bin nicht mehr denn du; ich bin, was du gewesen;
Bald wirst du sein, was ich. Mein Wissen, Tun und Lesen,
Mein Leben, meine Zeit, mein Name, Ruhm und Stand
Verschwanden als ein Rauch. Die leichte Hand voll Sand
Verdeckt denselben Leib, den vorhin viel geehret,
Den, nächst der Fieber Glut, itzt Fäul und Stank zerstöret.
Beweine, wer du bist, nicht mich, nur deine Not!
Du gehst, indem du gehst, und stehst und ruhst, zum Tod.
Derart beschaute dieser Mann, ein Wunder an Gelehrsamkeit, an Kraft und Tätigkeit, sich selbst, sein Werk, seine Welt – und, machen wir uns nichts vor, die Welt aller Tage.
Wohl nur recht selten hat, zumal in Deutschland, ein Dichter so klar, so hart zugreifend und in derart tief tönender Sprache zugleich die doch so sorgsam und umfassend um menschliche Bedeutungslosigkeit errichteten Schutzwälle zerschlagen.
Dass dies, für einen Platz an der Sonne in der Gunst der Nachwelt, keine Empfehlung war und ist, versteht sich von selbst. Über die Verbannung mehr oder weniger des ganzen Barock aus dem Vorfelde der deutschen Literatur vor allem durch das neunzehnte Jahrhundert wurde auch Gryphius dem großen Publikum entzogen. Erst unser Zeitalter, das mit seinen Kriegen und Verwüstungen, Hoffnungen und Verzweiflungen, mit Rausch und später Ernüchterung allerorts zurückzukehren scheint zu den Zeiten der Inquisition und der Verbrannten Erde, zu Massenwahn und neuen Philosophien, zu Galilei und den Scheiterhaufen (einen freilich wo nicht verfolgten, so ausgebeuteten Galilei), hat sich auch des Gryphius wieder besonnen.
Was bilden wir uns ein? Was wünschen wir zu haben?
Itzt sind wir hoch und groß, und morgen schon vergraben;
Itzt Blumen, morgen Kot; wir sind ein Wind, ein Schaum,
Ein Nebel und ein Bach, ein Reif, ein Tau, ein Schatten.
Itzt was und morgen nichts; und was sind unser Taten,
Als ein mit herber Angst durchaus vermischter Traum?
Von Brecht das Gefälle hinab zu Rühmkorf: Sie alle sind Nachfahren jenes fast vergessenen schlesischen Dichterfürsten, wie die Ängste, Nöte, Träume, die »herbe Pein« des Andreas Gryphius uns als eine Grunderfahrung der Menschen in dieser Welt gewiss sind. Die abgelenkten und ablenkenden Modernismen jeder Generation halten nicht viel her neben jener Poesie, die geboren ist aus den Ruinen eines Saeculums, sei es nun das des Dreißigjährigen Krieges oder das der Wasserstoffbombe.
Hans Magnus Enzensberger, der die verletzte Trauer und den stolzen Zorn über die Erbärmlichkeit seiner Zeit mit Gryphius teilt, und der die vorliegende Ausgabe herausgegeben hat, lässt in seinem Gedicht geburtsanzeige vernehmen:
wenn nicht das bündel das da jault und greint
die grube überhäuft den groll vertreibt
was wir ihm zugerichtet kalt zerrauft
mit unerhörter schrift die schiere zeit beschreibt
ist es verraten und verkauft.
Wer immer diese »unerhörte Schrift« schreibt, wir haben sichere Hoffnung, dass er in künftigen Düsternissen ebenso wie in vergangenen irgendwo einige wird betroffen machen.
Andreas Gryphius: Gedichte. Ausgewählt von Hans Magnus Enzensberger. Insel-Verlag, Frankfurt/M. 1962, 71 Seiten, Pappband, DM3,–
Prinz von Theben
Ihr Mythos lässt sich so schwer in Fakten eines bürgerlichen Lebens übertragen wie eine orientalische Legende. Die Chronisten haben es schwer mit ihr, die sogar, als sie einen wesentlich jüngeren Mann heiratete, den Schriftsteller Herwarth Walden (ein Name, den sie ihm gab und unter dem er bekannt wurde), ihr Geburtsjahr neun Jahre vordatierte und so, als man ihren 50. Geburtstag feierte, schon fast sechzig war. Und heute, 23 Jahre nach ihrem Tod, steht sie geheimnisvoll und rätselhaft und eigentlich jenseits von tot oder lebendig vor uns, wie man sich die Märchenerzählerin Schirasade ja auch nicht begraben vorstellen mag: Im Fabelreich stirbt man nicht. Die Durchdringung ihres Lebens mit ihrer Poesie bis zu jener Vollendung, in der eins mit dem anderen unauslöslich verbunden ist, macht – abgesehen von der Gewalt ihrer poetischen Sprache, der Tiefe und Weite ihrer Imagination, der klassischen Einfachheit ihrer Form – heute so sehr wie eh und je die Faszination ihrer Gestalt und Dichtung aus.
Das Land ihrer poetischen Fabel ist nicht das Traumreich einer Irren oder einer halluzinierten Ästhetikerin, errichtet auf dem Flugsand von Hirngespinsten, der unserer täppischen Schritte spottete. Beileibe nicht. Seine Landmarken und Bausteine und Wegweiser sind so irdisch und menschlich wie nur irgend möglich (mag sein, dass darin für uns, Kinder einer der kreatürlichen Sinnlichkeit feindlichen oder ihrer nicht mächtigen Zivilisation, eine Schwierigkeit des Zutritts liegt): der Körper der Frau und der des Mannes; das ganze Gefälle unserer Passionen, Liebe, Hingabe, Scham, Schmerz; und die Verzweiflung eines Menschen, der sich wehren muss gegen die Fesseln einer engen und sehr kalten Welt.
Das poetische Werk von Else Lasker-Schüler ist also keine Traumfabrik, der Weg zu ihm keine Flucht aus dieser Welt; im Gegenteil: ein sehr schmerzliches, sehr bewusstes Innewerden der Realität des Menschen, »mit den Füßen im Schlamm, mit dem Kopf in den Sternen«.
An meiner Wimper hängt ein Stern,
Es ist so hell,
Wie soll ich schlafen –
Und möchte mit dir spielen
– Ich habe keine Heimat –
Wir spielen König und Prinz.
Diese Verse – gerichtet an einen Mann, den sie Giselheer den Knaben, Giselheer den König, Giselheer den Heiden und den Barbaren nannte, und der im bürgerlichen Leben Dr. med. Gottfried Benn hieß – geben einen außerordentlichen Aufschluss über den Stern, unter dem ihr Leben stand, und ein immer wiederkehrendes Thema ihrer Gedichte: »Ich habe keine Heimat – Wir spielen König und Prinz«. Auf den ersten Blick zwei Feststellungen, die nichts miteinander zu tun haben, nur aus der scheinbaren Beiläufigkeit, dem halblauten Tonfall, der Einfachheit der Worte schließen wir auf die Bestimmtheit, mit der hier gleichsam das Gerippe eines Menschenlebens nicht bloß angedeutet, sondern von allen Hüllen getrennt wird, in einer endgültigen, unpathetischen Klarheit, wie eine Gebärde, die Schmerz, Trauer, Verlassenheit und auch Hoffnung zugleich ausdrücken könnte – und die Gedichte der Lasker-Schüler sind vielleicht genau das: Ergänzung, Weiterführung, Vervollkommnung der Gefühlssprache, die der menschliche Leib nur stammeln, nur radebrechen kann.
Mit der Vernunft und Unvernunft unserer Tagesgeschäfte hat ihre Dichtung nichts zu tun. Wo andere Poeten zu siedeln und Wurzeln zu schlagen und heimisch zu werden vermögen, in den Bereichen der Politik etwa, wo sich von der Realität so angenehm abstrahieren lässt, dass am Ende eine neue Wirklichkeit in Sicht ist, wenn auch nur als Fata Morgana über die Durststrecke der Reise in die Neue Welt, war sie vollkommen undenkbar. Ihrem Wesen nach, nicht einer poetischen Attitüde zuliebe, war sie eine echte Vagabundin. Obwohl in den zwanziger Jahren allgemein bekannt und gefeiert, blieb sie arm und wurde allenfalls ärmer. Seit ihrer zweiten Ehescheidung, 1912 von Walden, lebte sie in billigen Hotels und Pensionen. Wohnung, Geld, Ansehen, Sicherheit – der Verzicht auf eine solide Existenz im bürgerlichen Sinne kam aber bei ihr nicht der Beitrittserklärung für den Untergrund gleich. Dem ist ja der Spießer nicht gleichgültig, der auf ihn schimpft; und wer sein Lager in die Gosse verlegt, neidet am Ende doch dem Milchmann Heim und Herd. Else Lasker-Schüler bedeutete all das nichts. Sie wurde gleichsam im Exil geboren, sie betrachtete die Welt wie ein Verbannter die Fremde, in die es ihn verschlagen hat. Freilich geht ins Exil nur, wer eine Heimat hat; ihre Heimat, die des Prinzen Jussuf von Theben, war das Land ihrer poetischen Fabel: »Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam im Rheinland. Ich ging bis 11 Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf Jahre im Morgenlande, und seitdem vegetiere ich«, so ihr Lebenslauf, den sie 1920 für die Anthologie Menschheitsdämmerung schrieb. Angesichts dieser Selbstdarstellung und Selbststilisierung erübrigen sich die Versuche einer Dokumentation: Man kann dieses Leben nicht anders darstellen als sie selbst, ihm keine bessere Legitimation verleihen als ihre eigene – ihr Werk.
Das großbürgerlich-jüdische Elternhaus; die Heirat mit dem Arzt Lasker und mit Walden; die Treffpunkte der literarischen Avantgardisten und ihres Gammlergefolges im Vorkriegsberlin, die Tischchen im Romanischen Café, das Hotel Koschel am Nollendorfplatz, wo sie wohnte; selbst Palästina, das sie später sehen konnte, und Jerusalem, wo sie, ein Märchen war Wirklichkeit geworden, im Morgenland lebte und 1945 so arm wie eh und je starb: Stationen eines Exils, das von keinen Schlagbäumen begrenzt, an keinen Ort gebunden, von keinem Pass abhängig war; sie erfüllte die These, dass die Heimat des Dichters ein von seiner Imagination geschaffenes Land ist, sein Werk. »Mein Reich ist nicht von dieser Welt« – mit diesen Worten formuliert der angeklagte Messias nicht nur die Situation eines Exils, er erklärt zugleich das Tribunal dieser Welt für nichtig, weil nicht zuständig. Seine Worte sind auch für den Dichter gültig, und nicht nur für den, der seinen Beruf von der Berufung des Priesters herleitet. Gültig umso mehr für eine Frau, die so bewusst Jüdin war wie Else Lasker-Schüler, eine Frau, die ihre Religiosität, ihre Gottessehnsucht mit der Leidenschaft einer Liebenden erlitt, ertrug und beschrieb. Die Mystifikation, die Legenden, die Spiele, mit denen sie ihr Leben umgab, entspringen wohl zum Allerwenigsten künstlerischen Motiven; vielmehr machte sie diesen Schutz, den sich ein verletzter Mensch gibt, um nicht sterben zu müssen, zur Kunst und hob ihn damit wieder auf eine Ebene, die uns zum Schweigen zwingt. Ihre Heimat war kein Arkadien; Weltflucht muss ihr Ziel nicht außerhalb der Welt haben, sondern in ihrem Zentrum selbst, dem Herz des Dichters:
Ich will in das Grenzenlose
Zu mir zurück,
Schon blüht die Herbstzeitlose
Meiner Seele,
Vielleicht – ist’s schon zu spät zurück!
O, ich sterbe unter Euch!
Da ihr mich erstickt mit Euch.
Fäden möchte ich um mich ziehn –
Wirrwarr endend!
Beirrend,
Euch verwirrend,
Um zu entfliehn,
Meinwärts!
Die Flucht zurück, »meinwärts«, unter solchem Aspekt betrachtet, erklärt sich vieles in diesem Leben: die Unrast, der Überschwang zahlreicher Liebesaffären und Freundschaften, der am Ende fast immer in Qual umschlagende Sinnesrausch, in die ihre Leidenschaft sie stürzte, die sich offenbar nur in fernsten Höhen, untersten Tiefen, niemals im netten, erträglichen Mittelmaß einrichten konnte. Zuflucht war dann immer die Dichtung, das Wort; Rettung vor der buchstäblichen Selbstzertrümmerung, mit der der ekstatische Mensch symbiotisch lebt. Dass solche Dichtung mit dem L’art pour l’art der poetischen Rechenmeister, die mit Dämonen umgehen wie mit Logarithmentafeln, nichts zu tun hat, versteht sich wohl auch noch heute von selbst. Die Lasker-Schüler hat allerdings meiner Generation, deren angehende Dichter wieder einmal den menschlichen Körper entdeckt haben, wenn auch meist nur als Klavier oder Absteigequartier, einige Lektionen in Scham und Stolz und Aufrichtigkeit zu erteilen. Ihre Liebesgedichte machen mich unserer heutigen Sexualrevolutionäre lachen, die anscheinend außerstande sind, ihrer Gefühle anders denn durch Obszönitäten Herr zu werden.
Die dich umarmt,
Stiehlt mir von meinen Schauern,
Die ich um deine Glieder malte.
Ich bin dein Wegrand,
Die dich streift,
stürzt ab.
Egozentrik, Elfenbeinturm, Flucht aus der Realität: Den Germanisten darf man getrost die Deutungen überlassen. Es hat für mich den Anschein, als wäre heute dieser Planet überlaufen mit Alles- und Jedesdeutern, Erklärungen, Unter- und Hintergrundsanalysen im Dutzend an den Straßenecken erhältlich, und je wissenschaftlicher, desto wohlfeiler; Mythen werden entzaubert und fernsehgerecht serviert, Rätsel und Abenteuer verlieren ihren Platz in unserem wohlorganisierten Dasein, der Mond gar ist vollends entlarvt: ein Haufen kalter Steine. Wenn wir fortfahren, unseren Geist und unsere Phantasie auf diese Weise zu verarmen, wird unseren Nachfahren eines Tages keine andere Wahl bleiben als die, entweder die Erde den Robotern zu überlassen oder die Maschine zu zerstören, damit die Kraft unserer Imagination nicht in den Fallen des Fortschritts gefangen und gezähmt werde. Je geschäftiger heute viele Dichter die Leugnung ihrer Tradition, die Verstümmelung ihres Handwerks und den Ausverkauf ihrer Unabhängigkeit an Ideologien politischer oder technischer Herkunft betreiben, desto großartiger nehmen sich dagegen Legende, Leben und Werk der Lasker-Schüler aus, desto eindringlicher liest sich die Dichtung vom Weg zurück, zum Ursprung der Kunst, »meinwärts«.
Dieser Weg und die kompromisslose, nur allzu oft von schierer materieller Not bedrohte Haltung, mit der Else Lasker-Schüler ihn ging, machen es uns vielleicht auch verständlich, dass auch aus der Zeit nach 1933, aus der Zeit von Tyrannei und Krieg, aus der Zeit der fast völligen Vernichtung ihres Volkes, keine Gedichte von ihr bekannt sind, die als Flugblätter verwendbar wären, wie man das heute gelegentlich von Schriftstellern verlangt. Anders als etwa Nelly Sachs konnte sie nicht die Sache ihres Volkes zu ihrer eigenen Sache machen. Die Nachrichten, die sie in Jerusalem erhielt, hätten sie krank und verstört gemacht, heißt es. Aber es gibt kein Gedicht von ihr, das sich mit dem Schicksal ihrer Glaubensgenossen oder mit dem Krieg beschäftigte. Bis zuletzt blieb sie im Privaten, für sich, ihrem Schicksal vollkommen treu:
Engel meiner Brüder
Heben mich
Aus dieser Welt voll Schmerz.
Ich bin so müde
Tag und Nächte trennen sich.
Ich lasse meinen Leib gehüllt in Flieder
Dem letzten Tag des März.
Ich schaue Gott im Himmelssüde …
So stirbt der Mensch und du und ich.
Sie starb, so wird berichtet, am 22. Januar 1945, 78 Jahre alt, nach schwerem Todeskampf, in Jerusalem. Zwei Jahre später schrieb der Rabbiner, der sie beerdigt hatte, in einem Brief: »Else Lasker-Schüler wurde auf dem Jüdischen Friedhof auf dem Ölberg beigesetzt, in dem Teil, der für die berühmten Persönlichkeiten bestimmt ist, nächst der Henrietta Szold. Die Beerdigungskosten und die für den Grabstein wurden von ihren Freunden hier getragen.« Ob ihr Grab noch erhalten ist? (Der Friedhof befindet sich auf der jordanischen Seite des Ölbergs.) Manche Menschen auf der Erde sterben nicht. Sie dürfen nicht sterben, weil sonst alle Hoffnung auf ein Überleben des Menschen nicht möglich sein wird. Ich glaube, dass Else Lasker-Schüler zu diesen Menschen gehört. Ein Schlaf geht zu Ende, aber der Traum geht nur fort und nicht für immer, er kommt zurück; Träume sterben nicht. Ein Leib endet in Asche und Staub, nicht aber das Unsterbliche im Leben – Erinnerung, Legende, Poesie: Es liegt an uns, ob wir überleben auf dieser Erde; es liegt an uns, welche Dimensionen wir uns erkämpfen.
Der Kösel-Verlag hat ihre Gedichte, reich ausgestattet mit einem Faksimile des Buches Theben, ihren Illustrationen, Fotografien, einem Lebenslauf herausgegeben (erwähnenswert auch das Sonderheft mit Äußerungen von Zeitgenossen über die Dichterin). Es ist ein schönes, außerordentlich geschmackvolles Buch geworden. Es wird dazu beitragen, dass Werk und Legende der Else Lasker-Schüler, solange deutsche Dichtung dauert, nicht vergehen werden.
Else Lasker-Schüler: Sämtliche Gedichte. Herausgegeben von Friedhelm Kemp, in Zusammenarbeit mit Margarethe Kupper. Kösel-Verlag, München 1966, 368 Seiten, Leinen, DM12,80. Band 134 der Reihe »Die Bücher der Neunzehn«.
Günter Eich: Prosa
In den Gedichtbänden Zu den Akten (1964) und Anlässe und Steingärten (1966) hatten wir die Entschiedenheit bemerken können, die Konsequenz, mit der Eich seine Konzeption von Dichtung, um nicht zu sagen: eine Strategie, entwickelte, und zwar ausschließlich an der Sprache und seiner Imagination entwickelte, nicht an den Menschen.
Eich sicherte gleichsam die Sprache gegenüber allen ihr innewohnenden Verführungen derart ab, dass er damit eine Qualität erreichte, deren Stärke es war, Poesie und Prosa, Lyrizismus und Epigramm in einem Maß zu vereinigen, das in diesem Land heute unerreicht ist: spröde, hart und genau gegen sich selbst, zugleich funkelnd und ins Schwarze treffend, noch wenn sie schier unergründliche Seitenwege betrat:
Der Ausblick, allmählich
verfärbt von Leim,
Deckblätter und Straße
zerschnitten
vom selben Messer.
Die Asphaltierung ist
geplant wie das Sterben.
Aus diesem Material, aus dieser Sprache, aus ihrer Poesie führt der Weg zur Prosa, die Eich in den letzten Jahren geschrieben und 1968 vorgelegt hat. Sie erregte Aufsehen; sie hat die Kritik gespalten, zu Entgleisungen nicht geringer Art geführt, sie hat ihre Leser in erhebliche Verwirrung, ja, in Ratlosigkeit gestürzt. Je länger ich mich mit diesen Texten befasse, um doch endlich einer angemessenen Beurteilung fähig zu sein, desto häufiger mischen sich blitzende Lichter voreiligen Verständnisses mit dunklen Ahnungen und schierer Verzweiflung – zu keinem guten Ende, will mir scheinen. Vielleicht sind es aber ebenjene Lichter, die Gesten des Abhakens, wenn man glaubt, verstanden zu haben, eingeweiht zu sein und nun endlich Mitteilung machen zu können, die den Gang in den Labyrinthen, in den neominoischen Höhlen der fast babylonischen Sprachverwirrung des Günter Eich so sehr erschweren; vielleicht kommt es hier darauf an, die Metaphern und Metamorphosen der Dunkelheit nicht zu begreifen, sondern eins mit ihr zu werden, den Sprung, wenn man so will, in ihren Abgrund zu wagen, der ja nicht unbedingt bodenlos sein muss: Nicht nach Ninive geht der Weg, er führt in den Bauch des Wals; wer Jonas nicht sein will, dem sind gewiss die Maulwürfe am wenigsten zu empfehlen.
Dass die Maulwürfe, die Eich in die Welt gesetzt hat, literarische Texte sind, Beschreibungen verschiedener Gegenden, deren Details, deren Gerüche uns bisweilen bekannt, äußerst befremdlich zum andern vorkommen, dass wir zum Schluss bei aller Verwirrung, den Fallen und Finten, den Ungereimtheiten und den manchmal aufblinkenden Geistern eines spezifischen Irr-Seins noch entkommen zu sein, dennoch sagen müssen, diese Gegenden ergäben unsere Welt: All das sagt wenig, sagt fast gar nichts. Ich lasse Eich das Wort zu seiner Präambel:
Was ich schreibe, sind Maulwürfe … Meine Maulwürfe sind schneller, als man denkt. Wenn man meint, sie seien da, wo sie Mulm aufwerfen, rennen sie schon in ihren Gängen einem Gedanken nach, an eingesteckten Grashalmen könnte man ihre Geschwindigkeit elektronisch filmen. Wir sind da, könnten sie rufen, aber der Hase täte ihnen leid. Meine Maulwürfe sind schädlich, man soll sich keine Illusionen machen. Über ihren Gängen sterben die Gräser ab, sie machen es freilich nur deutlicher. Fallen werden gestellt, sie rennen blindlings hinein. Manche schleudern Ratten hoch. Tragt uns als Mantelfutter, denken sie alle.
Diesen Text (er ist bei weitem der verständlichste, soll heißen: üblichste aller) germanistisch zu analysieren, wissenschaftlich zu zerschneiden, um nachher ihn wieder zu einem nunmehr erfassten Großen und Ganzen zusammenzuflicken, wäre, will mir scheinen, die verkehrteste Methode, Eichs Prosa zu begegnen. Nehmen wir stattdessen das Wort »Präambel« in dem üblichen Sinne: Vorwort zu einer Verfassung, dem Grundgesetz etwa. Wer in den beiden Bändchen blättert, wird bemerken, dass bei allen Witzen, aller – bisweilen durchaus nicht gelungenen – Sprachakrobatik, allem Spintisieren, abseitig mit Gräsern und Krumen Zwiesprache haltenden Attitüden Eich hier eine Art Gegenwelt, einen Staat im Staat oder auch – alter Anarchist, der er zu sein beliebt – Anti-Staat errichtet, eine Karikatur, die die Falschheiten, die Barbarei, die Unterdrückungsmethoden des Staates oder der Welt, in der Eich mit uns lebt, sehr genau, bissig wie ein rechter Maulwurf aufdeckt, eine Karikatur jedoch, bei der am Ende das Gelächter im Halse stecken bleibt, denn die boshaft-lässigen Striche, mit der sie gezeichnet ist, enthüllen einleuchtend, wie es um diese Gesellschaft und ihre Verfassung bestellt ist:
Die Spitzenschleier, spanische Mantillen, die Garrotte, Maschinengewehre, Prozesse, Hausverwalter, eins greift ins andere, praktisch und voll Harmonie, der Hunger und die Preise, die Menschenfrage, geschrien, geflüstert, ungedacht, fotografiert und auf Bänder genommen, alles ein Sommertag aus dem Paul Gerhardtschen Barock. Badminton und Unterwasserjagd sind dazugekommen, aber das Blut ist revolutionär konservativ rot über jeder Hautfarbe …
Aber alle politisch gemünzten Texte, das Blut und die Tränen und die langsamen Foltertode, mit denen die Landkarte dieser beileibe nicht surrealen Landschaft gezeichnet ist (Mädchenhaut an Gummiknüppeln … Notstand … Napalm …), sie sind doch immer nur ein Teil des Zustandes, den wir hier erfahren, vielleicht untrennbar mit ihm verzahnt, aber dennoch nur ein Teil. Eich ist alles andere als einer unserer Agitprop-Federfuchser, der vom Parkett der relativen, wenn auch erstickenden Sicherheit revolutionäre Aufforderungen in die Weltbühne schickt, nach Vietnam oder anderswohin. Vielleicht tun wir gut daran, uns an das zu halten, was Eich vor vierzehn Jahren für Benders Anthologie Mein Gedicht ist mein Messer schrieb:
Ich bin Schriftsteller, das ist nicht nur ein Beruf, sondern die Entscheidung, die Welt als Sprache zu sehen. Aus (der) Sprache, die sich rings um uns befindet, zugleich aber nicht vorhanden ist, gilt es zu übersetzen … Erst wo die Übersetzung sich dem Original annähert, beginnt für mich Sprache.
Eine solche Haltung ist nicht nur die dem Dichter einzig angemessene Haltung, sie allein befähigt ihn auch, im turbulenten Chaos gleichzeitig sich überstürzender Vorgänge und im Dickicht einander widersprechender Verhältnisse das magische Gleichnis des Menschen in der Umarmung seiner Zeit zu erkennen und der Gewalt der realen Maschinen, Gesetze, Bajonette die Gewalt des Nicht-Greifbaren, Immateriellen, Sinnlichen, die Macht der Vorstellung entgegenzusetzen, die unbegreifliche Gegengröße der künstlerischen Imagination als höchsten Ausdruck eigentlichen Widerstandes transparent zu machen.
Denen, die nicht begriffen haben, dass nichts anders geworden ist, nur manches differenzierter und zugleich auch barbarischer, monströser, an den Methoden der Ausbeutung, der Unterdrückung und auch der Literatur, denen, die nicht einsehen, dass die Literatur sich nicht geändert haben kann, da weder ihre Produzenten noch ihre Konsumenten noch die Regeln ihres Marktes noch die Regeln dieser Gesellschaft überhaupt noch die Strukturen und Kräftefelder verändert sind, innerhalb derer Literatur und alle Kunst eine Wirkung auszuüben vermag: Ihnen zeigt Eich mit seinen Maulwürfen, dass Literatur und Kunst ihrer Gesellschaft, den Zuständen der Welt immer einen Gedanken, eine Hoffnung und Erkenntnis voraus sein muss, will sie nicht untergehen wie die Schlösser vergangener Zeiten. Eichs Sprache ist das Prisma eigentlicher Dichtung, das die unsichtbaren oder verzerrten, entstellten unbegreifbaren Dinge erst wieder als Strahl, als Licht, als schwindende oder zunehmende Kraft beweist. Literatur ist nicht nur nicht unmöglich, sie ist notwendiger denn je, wenn die Beschreibung des Menschen und seiner verfallenden, im Verfall ihn langsam tötenden Welt nicht verzichten will, Mensch und Welt zu erhalten – wenn nichts mehr ist, kann nur wenig noch verändert werden außer dem Nichts, das unveränderbar und endgültig und das uns drohende Urteil ist.
In einem Essay über Henry Millers Wendekreis des Krebses schreibt George Orwell, der moderne Mensch, der von der Zivilisation perfekt gedrillte moderne Mensch trage als größten Wunsch das Verlangen in sich, in der kosigen, warmen Sicherheit des Wals zu sitzen, in jenem riesigen behaglichen Leibesinneren, das ihn gegen alle Gefährdung durch eine ebenso technisierte wie ihm unheimlich gewordene, seiner Kontrolle entzogene Umwelt schütze, diesen Schutz stelle er sich gerne transparent vor, als eine Art massives Plexiglas, das ihm wohl den Blick nach draußen gestatte, diesem Blick jedoch auch die Schärfe und Weite nehme, um ihn, den Menschen, nicht um seine Ruhe, seinen Schlummer, seinen Verstand zu bringen; nichts Besseres, als von einem solchen Fisch verschluckt zu werden, in der Tat, und je unfreiwilliger – solange nur unausbleiblich –, desto angenehmer für den tiefen Schlaf seines Gewissens.
Einer der Texte in Eichs Maulwürfen ist »Jonas« überschrieben, und in ihm sieht sich der Schriftsteller in der Rolle des Wals, der den Auftrag erhalten hat, einen gewissen Jonas zu suchen und zu verschlingen.
Mein Auftrag Jonas, ja, so begriff ich’s allmählich: Keine Familie ist für mich vorgesehen und kein Exil. Nur Jonas, für nichts anderes sperre ich das Maul auf. Meine süßen Kinder, die an den Hebriden spielen, ich habe euch vergebens geboren. Nur Jonas, nur Jonas. Ich bleibe ein unwürdiges Beispiel, ein Bote, ein Zufall, den man gerade braucht.
Aber ich finde Jonas nicht, er kommt nicht, ich suche weiter. Der Text ist mir nicht mehr genau im Gedächtnis. Hieß es nicht etwa, dass Jonas mich verschlingen sollte?
Vielleicht ist es wirklich nur noch ein Zufall, dass es noch Dichter gibt, die ihre Kunst und ihre Berufung nicht für ein Linsengericht hingeben.
Ich weiß es nicht, weiß nur, dass wir solche Dichter bitter benötigen in einem Augenblick, da der Mensch nicht mehr begreift, worin er lebt, mit wem, wofür, da er es vielleicht nicht mehr begreifen kann, weil er es nicht mehr begreifen soll, aber auch, weil jene Dichter, die keinen Auftrag haben, seine Seele in Abrede stellen, das Einzige, was weder verkäuflich noch zu manipulieren, ja, wie einige noch glauben, nicht zu töten ist. Wenn Trauer noch Sinn hat und Schmerz und das Gefühl von Verlassenheit an den Rändern seines Herzens – hier ist der Dichter, der nach der Sprache sucht und sie bisweilen findet, es mitzuteilen. Wenn es noch einen erkennbaren Rauchfaden herber Hoffnung gibt, Günter Eich teilt auch ihn mit:
Aber die Kraniche sagt ihr, und das ist wahr.
Günter Eich, Maulwürfe. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1968, 76 Seiten, broschiert, DM10,–
Günter Eich: Kulka, Hilpert, Elefanten. Literarisches Colloquium, Berlin 1968, 22 Seiten, broschiert, DM2,–
Über das Bonner Kleinverlegertreffen
Das ganze Gelaber dieser straight-press-Typen ist völlig out of touch mit dem, was wirklich läuft: Wenn der Untergrund nicht bald yippie-politisch und radikal-anarchistisch-aktionistisch wird, hat er keine Chance. Die Mini-Scheißer, die im eigenen Saft suhlen, sind ebenso reaktionär wie Imhoff mit seiner Egosupermegalomanie & die Hare-Krishna-Schluchzer – keep going – Jerry Rubin: Jeder Guerillero muss wissen, wie er das Terrain der Kultur, die er zu zerstören sucht, nutzen kann.
Cut-up
Ende der 50er-Jahre empfahl der amerikanische Maler Brion Gysin dem Schriftsteller William Burroughs, der noch am Naked Lunch schrieb – Burroughs, der inzwischen alle Vorstellungen von einem herkömmlichen »Schriftsteller« gesprengt hat, wird zwar auch bei uns jetzt viel zitiert, aber immer noch kaum gelesen –, die in der Malerei von den Kubisten zuerst benützte Technik der Montage auf seine Texte zu übertragen. Diese Technik wurde unter der Bezeichnung »cut-up« bekannt: Man zerschneidet eine Textseite in vier Teile und arrangiert die Teile neu, man macht dasselbe mit mehreren Seiten und erhält dadurch nicht nur neue Einsichten in das Nervensystem der Worte und Wortverbindungen, man erkennt auch, dass sich ganz klare, erzählende Prosa mit Hilfe dieser Methode und der später von Burroughs aus ihr abgeleiteten Variante des »fold-in« (man faltet eine Seite in der Mitte, legt sie über eine andere und erhält dadurch eine neue) schreiben lässt. Die »Message« und »Resistance«-Botschaft solcher Texte lautet (Burroughs): »den fixierten Sinn der Sätze zerschneiden … Lautverschiebungen herbeiführen … gedankenlose Touristen des Worts einer Vibrationsmassage unterziehen … DAS WORT fällt … und mit ihm DAS BILD dessen, was es bezeichnet. Durchbruch im Grauen Raum.« Und, fügt Carl Weissner hinzu: »Dem Durchbruch im Grauen Raum der Hirnmasse muss ein systematisches Vermessen der Bereiche folgen, die dabei erschlossen werden.«
Die Autoren des »cut-up« und »fold-in« sind Koordinatenpunkte nicht nur des amerikanischen, englischen und französischen Undergrounds. Auch bei uns erkennt man zusehends, dass mit den herkömmlichen linear-fixierten Schreibweisen die komplizierten Nervensysteme des Innenraums und die technologisch beherrschte, medienmanipulierte Außenwelt nicht mehr zu erfassen sind. Der Horror wie die Chancen, die die neu erschlossenen Räume uns bieten, verlangen von engagierten Schriftstellern mehr als bloße Wiedergabe längst vermessener Gebiete des Geistes, bloße Reproduktionen millionenfach reproduzierter Situationen. Wenn das Schreiben noch einen Sinn haben soll – und mit ihm das kreative Leben überhaupt –, muss es sich solcher Techniken bedienen, die jahrtausendalte Zwänge des Sehens und Denkens aufzubrechen imstande sind.
ZOOM wird regelmäßig Texte vorstellen, die die Resistance-Botschaft weitergeben. Texte, die dazu auffordern, verändert zu werden, Texte, die dazu auffordern zu verändern.