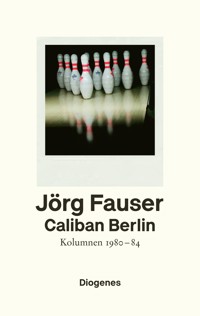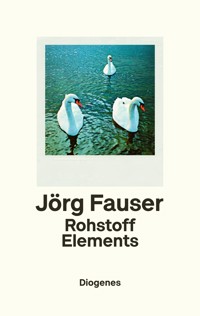11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Bergungsexperte für außergewöhnliche Fälle« nennt sich Heinz Harder, arbeitsloser und abgebrannter Illustriertenschreiber, in der geschalteten Anzeige. Seine erste Klientin ist reich und schön, und für den »Journalisten, Detektiv und Ritter« wird es zunehmend gefährlich zwischen den windigen Geschäftsmännern in illegalen Clubs und mysteriösen Kunst-Sekten, wohin ihn die Spur der verschwundenen Tochter führt. Mit einem Nachwort von Friedrich Ani.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jörg Fauser
Das Schlangenmaul
Roman
Mit einem Nachwort von Friedrich Ani
Diogenes
Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange,
die da heißt Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt,
und ward geworfen auf die Erde,
und seine Engel wurden auch dahin geworfen.
Offenbarung 12,9
1
Als die Presslufthämmer mich weckten, träumte ich gerade vom Krieg. Ich brütete über einer Story, die sich nicht schreiben ließ, dann zerrissen Explosionen den Himmel, und der Alte schrie mir zu: Wenn du mit dem Thema nicht klarkommst, schmeiß ich dich endgültig raus.
Vorsichtig streckte ich die Hand aus und berührte etwas Weiches. Ich machte die Augen auf und blickte in das Gesicht der Thailänderin. Sie schlief fest. Na gut, dachte ich, Deutschland hat noch einen Krieg verloren, aber du liegst im Bett der Sieger. Allmählich brachten die Presslufthämmer mir bei, wo ich war. Berlin, Anfang November. Montagmorgen. Sonne, viel zu viel Sonne über den Dächern. Ich griff nach einem der Gläser neben dem Bett, erwischte einen Schluck abgestandenen Wodka mit Tonic. Dann eine Zigarette. Frühstück à la carte. Mein Herz fing an zu hämmern. War wohl etwas grob, gestern Nacht. Die letzten Stunden fehlten mir. Genau genommen auch die letzten Tage. Nuchali lächelte im Schlaf. Für mich gab es nichts zu lächeln. Ich war achtunddreißig und pleite.
Es klingelte.
Post. Telegramm. An die Arbeit, Harder.
Ich versuchte durch den Spion zu linsen, aber der war so verschmiert, dass ich nichts erkennen konnte. Ich zog den Gürtel meines alten Boxermantels zu und machte die Tür einen Spalt auf. Ein kleiner, stämmiger Mann, ungefähr mein Alter. Rosa Gesicht, spärliche blonde Haare. Adretter Regenmantel, weißes Hemd, Schlips und strahlendes Vertreterlächeln.
»Guten Morgen. Herr Harder?«
»Mhm. Und wer sind Sie?«
»Wiglaff, Herr Harder. Von der Steuerfahndung.« Eine Hundemarke kam zum Vorschein. »Ich darf doch annehmen, dass Sie mit meinem Besuch gerechnet haben. Gestatten Sie?«
So war das also. Ein Vertreter des Staates. Ich dirigierte ihn in die Küche. Wiglaff sah sich aufmerksam um, registrierte die leeren Flaschen, die unausgepackten Umzugskisten im Wohnzimmer, die kahlen Wände, den Müll auf dem Balkon. Durch seine Augen sah es sicher aus wie die Station eines Mannes auf der Flucht.
»Zu diesem Blick darf man Ihnen ja gratulieren, Herr Harder. Dafür zahlt man gern etwas mehr Miete, stimmt’s?«
Ich zuckte die Achseln und holte zwei halbwegs saubere Tassen aus der Spüle. Dann setzte ich Wasser auf.
»Trinken Sie eine Tasse mit? Gibt aber nur Pulverkaffee.«
»Vielen Dank, gern. Kann ich hier etwas Platz machen?« Wiglaff schloss seinen Aktenkoffer auf und entnahm ihm einen Schnellhefter. Der Vorgang Harder, Heinz. »Wie gesagt, mit meinem Besuch müssten Sie ja gerechnet haben. Allein in den letzten fünf Monaten hat das Finanzamt Ihnen vier Mahnungen geschickt, und es war ja auch eine Betriebsprüfung angekündigt.«
»Ich war verreist.«
»Aber eine amtliche Zustellung haben Sie angenommen.«
»Wissen Sie, heutzutage ist so viel gleich amtlich, wer blickt da noch durch.«
»Haben Sie denn keinen Steuerberater?«
»Soll ich dem auch noch Geld in den Rachen schmeißen? Worum geht es denn eigentlich?«
»Sie haben ja Humor, Herr Harder. Es geht natürlich um Ihre Steuerschulden. Das heißt, es geht jetzt auch um den begründeten Verdacht der Steuerhinterziehung.«
Ich schluckte. »Steuerhinterziehung? Da fahren Sie aber ziemlich schweres Geschütz auf.«
Er nickte und blätterte in der Akte.
»Herr Harder, nach unseren Unterlagen haben Sie in den Jahren 1977 bis 1982 Einkünfte aus selbständiger Arbeit als freier Journalist in Höhe von etwa 150000DM nicht versteuert – und auch keine Mehrwertsteuer dafür abgeführt. Das macht mit Verzugszinsen inzwischen eine Steuerschuld von 51374,54 DM – ohne Mehrwertsteuer. Da Sie auf entsprechende Kontrollmitteilungen und Aufforderungen des inzwischen für Sie zuständigen Finanzamts Charlottenburg-Ost nicht reagiert und auch einen Betriebsprüfungstermin nicht eingehalten haben, hat sich das Finanzamt veranlasst gesehen, die Unterlagen an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Tja, und da bin ich nun, Herr Harder.«
Nur ruhig Blut, dachte ich. »Nehmen Sie Milch?«
»Vielen Dank, nur Zucker, bitte.«
»Zucker gibt’s keinen. Ist doch ungesund, das Zeug.«
»Tatsächlich? Dann trinke ich ihn schwarz.«
»Zigarette?«
»Französische? Danke, die sind mir zu stark.«
Er rauchte eine von der kastrierten Sorte. Dafür nahm er drei Löffel Pulverkaffee. Wir legten eine kurze Pause ein, bis die Gifte wirkten. Ich starrte durchs Fenster. Auf dem Altbau gegenüber, in dem nur noch ein paar türkische Familien und eine WG die Stellung hielten, lagen wie Farbkleckse die bunten Decken vom Sommer, als die Freaks auf dem Dach gepennt hatten. Die Novembersonne sah kräftiger aus als die im Sommer, aber jetzt pennten nur noch die Tauben da oben. Das Haus stand wie ein verrotteter Zahn zwischen den Neubaublöcken. Ich sah Wiglaff an.
»Was ich nicht verstehe, ich hab die ganze Zeit doch Steuern bezahlt.«
»Aber nicht für die Einkünfte von der Frauenzeitschrift in München. Die vier großen Serien, erinnern Sie sich?«
»Dieser Mist? Das war doch meine Frau. Können Sie sich vorstellen, dass ich für eine Modezeitschrift schreibe?«
»Für Geld, Herr Harder? Jedenfalls sind die Honorare an Sie gegangen.«
»Zwei Drittel sind an meine Frau gegangen. Meine Exfrau. Unter dem Mist stand mein Name, aber doch nur, weil ich mit diesen Serien besser im Geschäft war.«
»Ihre Exfrau sieht das aber etwas anders.«
»Was erwarten Sie von einer Exfrau in dieser Branche?«
»Da habe ich noch keine gesicherten Erfahrungswerte, Herr Harder. Die Frage ist aber dann die, warum haben Sie die Angelegenheit nicht längst aus der Welt geschafft?«
Ich zuckte die Achseln. »Das mit dem Finanzamt hat immer meine Frau gemacht.«
»Von der Sie seit fünf Jahren geschieden sind.«
»Und was wird nun? Wollen Sie pfänden?«
»Aber ich bitte Sie.« Wiglaff drückte seine Zigarette aus und nahm noch einen Schluck Kaffee. »Wissen Sie, als ich Ihren Vorgang auf den Tisch bekam, hab ich gleich gedacht, das ist ein Fall, den man differenziert sehen muss. Ich bin nämlich Spezialist für die freien Berufe, was könnte ich Ihnen über meine Kundschaft erzählen, Bühne, Film, Showgeschäft …«
»Erzählen Sie nur, ich bin ganz Ohr.«
»Damit Sie dann hingehen und einen Artikel daraus machen, und sei es für eine Modezeitschrift!«
»Das wäre doch was. Aber aus dem Gewerbe bin ich raus.«
Sein Lächeln verschwand. »Ja, was machen Sie denn dann, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben?«
»Ich seh mich gerade nach etwas Neuem um.«
»Das hört man natürlich nicht so gern, Herr Harder. Der Kasus Knacktus ist ja wohl, wie wir das mit den Ratenzahlungen machen.«
Allmählich kam er zur Sache. »Mit welchen Ratenzahlungen?«
»Sie stehn mit 50000 Mark bei Vater Staat in der Kreide, mein Bester.«
»Das krieg ich schon hin«, sagte ich souverän. »Wenn ich was an Land ziehe, sind es immer dicke Brocken.«
Gerade diesen Augenblick suchte Nuchali sich aus, um einen Blick in die Küche zu werfen. Sie hatte sich ein Laken umgewickelt, aber es gab noch genug zu sehen. Wiglaff bekam kaum den Mund zu. Differenzen, wohin man blickte.
»Oh, Joe, du hast Besuch? Ich muss bald weg, weißt du.«
»Ich komme gleich«, sagte ich, »geh schon mal ins Bad, Darling.«
Sie warf mir einen strahlenden Blick zu, von dem der Steuerfahnder auch noch etwas abbekam, und verschwand. Wiglaff räusperte sich. Ich kam ihm zuvor.
»Meine Verlobte, Herr Wiglaff.«
»Ah ja?« Das Misstrauen stand ihm im Gesicht. »Ich wusste gar nicht, dass Sie Joe heißen.«
»Sprechen Sie Harder mal aus, wenn Sie Asiate sind.«
»Ich verstehe. Gut, Herr Harder, bleiben wir bei Ihrer Steuersache. Als Spezialist für freie Berufe kenne ich die Schwierigkeiten, mit denen viele in diesen Berufen zu ringen haben. Vor allem, wenn Sie dann auch noch Aussteiger sind.«
»Ich bin kein Aussteiger. Als Aussteiger säße ich wohl kaum hier.«
»Haben wir alles schon gehabt, Herr Harder. Zwanzig-Zimmer-Villa im Grunewald, ich hab damit nichts mehr zu tun, Herr Wiglaff, ich bin ausgestiegen. Aber irgendwie müssen wir ja zu Potte kommen. Diese 50000, die stehen nun mal im Raum. Und die Einspruchsfristen haben Sie ja alle verstreichen lassen.«
»Was schlagen Sie denn dann vor?«
»Sie haben natürlich Ihre Kontoauszüge der letzten Jahre zur Verfügung?«
»Wieso, müsste ich?«
»Sechs Jahre, Herr Harder. Sechs Jahre müssen Sie Ihre Kontoauszüge aufbewahren.«
»Seh ich so aus, als ob ich viel aufhebe?«
»Ich würde diese Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, Herr Harder. Sie müssen Ihre finanziellen Verhältnisse rekonstruieren und in den Griff kriegen. Wenn ich von Ihnen nicht bald höre, müsste ich eine Durchsuchung durchführen.«
»Was hab ich zu erwarten? Knast?«
Wiglaff packte den Schnellhefter ein und verschloss sorgfältig seinen Aktenkoffer mit den Staatsgeheimnissen. »Vorsatz der fortgesetzten Hinterziehung – Knast nicht gerade, aber eine saftige Geldstrafe schon. An Ihrer Stelle würde ich mir sofort einen Steuerberater nehmen.«
»Sollte ich nicht lieber eine Bank überfallen?«
»Aber Herr Harder, Sie als Journalist. Da wird Ihnen doch etwas Originelleres einfallen.«
Ich brachte Wiglaff zur Tür. Nuchali plätscherte unter der Brause und trällerte etwas, das sich wie eine fernöstliche Version von Yesterday anhörte.
»Und singen kann sie auch«, sagte Wiglaff.
»Nuchali hat ein Musikstudium an der Akademie von Bangkok absolviert. Wie geht das nun weiter, Wiglaff?«
»Am besten wäre, Sie machen eine Anzahlung. Sagen wir in einer Woche? Fünftausend Mark? Zeigen Sie uns Ihren guten Willen, dann kommen wir Ihnen auch entgegen.«
»Ich hätte das gern schriftlich.«
»Sie werfen ja doch alles Amtliche weg.«
»Und wie erreiche ich Sie?«
»Hier ist meine Karte.«
»Wer sagt mir überhaupt, dass Sie echt sind?«
»Ihre Erfahrung. Und verlassen Sie nach Möglichkeit nicht das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik, das könnte leicht zu Missverständnissen führen. Tschüs!«
Wiglaff marschierte zum Fahrstuhl. Bevor er einstieg, schenkte er mir noch ein Lächeln. Vielleicht war er schwul.
»Schönen Gruß an Ihre Verlobte!«
»Wichser.«
Ich machte die Wohnungstür zu und ging mit Wiglaffs Karte zum Telefon. Ich wählte die Nummer, die auf der Karte stand. Niemand hob ab. Ich suchte mir aus dem Telefonbuch eine Nummer heraus, ließ mich ein paarmal hin und her verbinden, fragte dann nach Wiglaff. Herr Wiglaff ist jetzt nicht da. Ich legte auf.
»Das Schwein ist tatsächlich bei der Steuerfahndung«, sagte ich zu Nuchali, als sie aus dem Bad kam.
»Wer war das, Joe?«
»Die eiserne Ferse des Staates.«
Sie lachte. Sie fand alles zum Lachen, was ich sagte, und wenn sie wirklich mal nicht lachte, dann wusste ich, dass ich in meinem nächsten Leben auch nichts zu lachen hätte.
»Willst du noch mal, Joe?«
Ich ließ den Boxermantel fallen. Wer weiß, wann du wieder zum Zug kommst, dachte ich, jetzt, wo auch noch die Steuerfahndung hinter dir her ist. Als wir im Bett lagen, klingelte das Telefon. Ich langte mir den Hörer über Nuchalis blauschwarze Haare, die meinen Bauch bedeckten. Nach Wiglaff konnte es nur noch aufwärtsgehen.
»Harder.«
»Ich rufe auf das Inserat an. ›Bergungsexperte für außergewöhnliche Fälle‹. Sind Sie das?«
Eine angenehme, weiche Frauenstimme. Eine Stimme, die nach Geld klang.
»Ja«, sagte ich, »das bin ich.«
2
Am Flughafen Hannover-Langenhagen mietete ich einen silbergrauen Honda Accord. Als ich losfuhr, war es früher Nachmittag, die Sonne schien noch kräftiger als in Berlin. Bei Altwarmbüchen führte die Autobahn durchs Moor. Ich erinnerte mich noch an die Proteste, die es damals gegen den Bau der Autobahnstrecke gegeben hatte. Sie hatten natürlich nichts genützt. Im Moor gab es eben wenig Arbeitsplätze, seit die KZs nicht mehr in Betrieb waren.
Hannover, immer für eine richtig schmutzige Geschichte gut. Sozis, Gewerkschaften, Krisenbranchen, Wohnungsbau, Banken, Bahlsen, der ganze Klüngel, der auf Macht und Masse baute. Ich hatte früher manchmal reingerochen, aber die Stories waren kaum unterzubringen gewesen, und jetzt, wo der gigantische Beschiss klar zutage lag, konnten die Leute ihn nicht mehr ab. Und ich war nicht mehr im Geschäft.
Nachdem ich durch Ricklingen war, nahm ich die B 217 Richtung Hameln. Flaches, nahrhaftes Land, flimmernd in einem verspäteten Altweibersommer. In Weetzen rauchten die Schlote der Zuckerfabrik. Rüben, dicke Bohnen, Kartoffeln. Am Horizont zog sich der dunkle Kamm des Deisters hin. Traktoren waren unterwegs, Lieferwagen, Vertreter, der Bund. Krähenschwärme. Und Leute wie ich, denen das Wasser bis zum Hals stand. Ich fuhr durch Holtensen, und bei dem Schild SAUPARK-ELDAGSEN kurz vor Springe bog ich ab und fuhr den Hügel hoch. Volksen. Feine Gegend. Erst Klinkerhäuschen und Opel, dann, am Hang hoch, Bungalows, Villen, die großen Daimler, und auch mal ein Porsche. Auf dem Hang dichter Wald. Ich fand die Straße, parkte eine Ecke weiter. Bis auf eine Frau, die in einem Garten arbeitete, war niemand zu sehen. Ich atmete tief durch. Nach Berlin fast ein Ozonschock. Und dann der weite Blick über die Ebene. Das wollte alles bezahlt sein.
Ein großes Grundstück mit Fichten und Blautannen, genug Platz für einen Garten, eine Doppelgarage und einen weißen Bungalow in der Form eines L, das auf dem Kopf stand, der Seitenflügel zur Straße hin eine riesige Fensterfront. Die Zufahrt zur Garage war verschlossen, auch die schmiedeeiserne Tür in der niedrigen Mauer, die das Grundstück umgab. Ein diskretes Namensschild: N.S.-S. Die einzigen Geräusche, die zu hören waren, Vogelgezirpe, das Grummeln des Verkehrs auf der B 217, vergrößerten nur die Stille. Ich drückte auf den Klingelknopf neben der Sprechanlage. Ich musste ungefähr eine halbe Minute warten.
»Ja, bitte?«
»Harder aus Berlin.«
»Oh, kommen Sie doch rein.«
Sie betätigte den Öffner. Von nahem gesehen schien der Garten etwas vernachlässigt, Geräte lagen herum, verfaultes Obst, Blumen hätten geschnitten werden müssen, und einige der Platten, die zur Haustür führten, waren lose. Die Haustür ging auf, ein schwarzer Hirtenhund begrüßte mich begeistert, und die Frau, die da stand, war bestimmt nicht die Haushälterin.
»Ich finde es toll, dass Sie gleich gekommen sind«, sagte Nora Schäfer-Scheunemann, nachdem der Hund, den sie Sascha nannte, sich etwas beruhigt hatte.
»Ich hatte den Eindruck, dass die Sache eilt«, sagte ich, nachdem ich meine Stimme einigermaßen unter Kontrolle hatte.
»Wie sind Sie auf die Idee mit dem Bergungsspezialisten verfallen, Herr Harder?«
Wir saßen in dem Zimmer mit der Fensterfront. Zimmer klingt zu mickrig. Es war ein großer Raum, mindestens 150 Quadratmeter, der in verschiedene Bereiche aufgeteilt war, eine rustikale Essecke, eine mit Bücherregalen abgegrenzte Fernsehecke, eine Sitzecke, deren Mittelpunkt eine Sofa-Diwan-Kombination aus verschiedenfarbigen Leder- und Stoffteilen abgab, dazu noch bequeme alte Ledersessel und ein niedriger Glastisch. Die Teppiche hatten das sachte Glühen alter Perser, die Bilder an den Wänden waren Abstrakte, die an die 50er Jahre erinnerten, in dem offenen Kamin lagen noch Holzscheite vom letzten Winter, der Blick durch die Fensterfront war bestimmt viel Geld wert. Aber der auf Nora Schäfer-Scheunemann war besser.
»Ich wollte mal etwas anderes machen, etwas Ausgefallenes, berufsmäßig Exotisches«, erklärte ich. »Aber nicht in der Heide als alternativer Heidschnuckenschäfer oder Gold schmuggeln in Fernost, sondern etwas, das schon noch mit meinem Beruf zu tun hat. Nur viel direkter in der Ausführung.«
Sie runzelte die Stirn, und sie war eine Blondine, die sich das erlauben konnte, ohne dümmlich zu wirken. Nora Schäfer-Scheunemann war fast so groß wie ich, und ich bin eins achtzig, schlank, aber nicht mager, hatte eine modisch strähnige Frisur und ein schmales, nicht ganz symmetrisches Gesicht mit weit auseinanderstehenden blaugrünen Augen, einen vollen Mund, der am besten aussah, wenn sie kurz mit der Zunge über die Oberlippe fuhr, einen makellosen Teint und lange Beine. Auf den ersten Blick konnte man sie für eine von den typisch hannoverschen Blondinen aus gutem Haus halten, die so unantastbar aussehen, als ob sie auch auf dem Höhepunkt der Lust nur reinstes Hochdeutsch sprechen; aber wenn man die Augen und den Mund lange genug betrachtet hatte, kam man zu dem Schluss, dass die Höhepunkte, die sie versprachen, völlig anders sein würden. Ich schätzte sie auf Ende dreißig, Anfang vierzig, aber sie konnte auch zehn Jahre jünger – oder zehn Jahre älter sein.
Sie trug etwas Weißes und Cremefarbenes aus Seide, das ihren Körper umfloss, eine Andeutung von Parfüm, und außer einem Ring nur eine Perlenkette, die so simpel aussah wie alles, was wirklich seinen Preis wert ist. Um die Nase mit den zwei Steilfalten, die sie gar nicht erst mit Make-up zu verdecken suchte, lag eine Härte, die seltsam kontrastierte mit dem Schleier, der ihr Gesicht zu verhängen schien – und ich glaube nicht, dass der von der Herbstsonne im Zimmer kam oder von meinem Anblick. Eher schon von dem, was ich gesagt hatte.
»Das müssen Sie mir etwas genauer erklären, fürchte ich.« Sie beugte sich in ihrem Sessel vor. »Was haben Sie beruflich bisher gemacht?«
»Ich war Journalist«, sagte ich, »habe von der Pike auf gelernt, habe dann vor allem Serien gemacht, aber dazwischen auch andere Sachen, Werbung, PR …«
»Journalist!« Die Kerben um ihre Nase vertieften sich. »Dann machen Sie das womöglich nur, um hinterher einen Artikel zu schreiben?«
»Auf keinen Fall, Frau Schäfer-Scheunemann. Ich arbeite nicht mehr als Journalist. Nur schadet dieser berufliche Background bei dem Job nicht.«
Sie sah mich schweigend an, wie eine Ware, die man sich per Katalog ins Haus geholt hat, und nun weiß man nicht, was man damit anfangen soll. Ich trug meine übliche Kluft, dunkles Hemd, dunkle Hose, weißer Lederschlips und die maßgeschneiderte Lederjacke, die mir immer noch eine Nummer zu groß ist. Meine Stiefel waren nicht geputzt, und das Hemd war auch nicht gerade frisch, aber ich hatte mich rasiert, und es gibt Frauen, die finden, ich sehe erst gut aus, wenn ich drei Tage durchgemacht habe. Schließlich sagte sie:
»Haben Sie die Jacke jemandem abgenommen?«
»Ja, aber bei einem Pokerspiel.«
»Ich hatte das Gefühl, dass Sie wie ein Spieler aussehen.«
»Kennen Sie viele?«
»Einige schon, Herr Harder. Ich spiele selbst ganz gern. Allerdings nicht Poker, sondern Roulette.«
»Dazu braucht man ein ziemlich hohes Startkapital.«
»Braucht man das nicht immer im Leben? Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, was Sie trinken möchten.«
»Ein Glas Milch wäre mir recht.«
»Milch?«
»Kein Alkohol bei der Arbeit, ist mein Prinzip. Und Milch hat einen höheren Nährwert als Kaffee.«
»Sie können so viel Milch bekommen, wie Sie wollen.«
Sie besorgte mir einen Krug, sich selbst mischte sie einen Campari-Soda. Ich bot ihr eine Zigarette an, aber sie schüttelte lächelnd den Kopf. Die Sonne spielte mit ihrem Haar, und sie spielte mit ihren Perlen, und sie sah aus wie ein Titel für eine der smarten Frauenzeitschriften – oder wie eine Million, an die man noch schwerer rankam als an die auf der Bank.
»Darf ich fragen, wie alt Sie sind, Herr Harder?«
»Sagen Sie einfach Harder. Ich bin achtunddreißig, eins achtzig groß, wiege ohne Socken 84 Kilo, geschieden, ein Kind, rauche 30 bis 40 Zigaretten am Tag, trinke außer Milch am liebsten Wodka, habe keine abgeschlossene Schul- oder Hochschulbildung, spreche mangelhaft Englisch und genug Französisch, um notfalls zurechtzukommen, habe mir meine Brötchen immer selbst verdient, wie, wissen Sie schon. Ach ja: vorbestraft.«
»Warum?«
»Trunkenheit am Steuer, und dann habe ich mal einen Polizisten verprügelt. Seitdem habe ich eine Brücke oben rechts und manchmal eine Hörschwäche im rechten Ohr, aber das kann auch Einbildung sein.«
»Und das hat Ihnen beruflich nicht geschadet?«
»Warum sollte es? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.«
Sie nickte, als hätte sie das auch schon immer vermutet.
»Lebt Ihr Kind bei der Mutter?«
»Anna? Sie besucht ein Internat in England. Sie ist jetzt zwölf.«
»Ist das nicht schrecklich teuer?«
»Meine Exfrau verdient nicht schlecht. Und ich trage natürlich auch etwas dazu bei.«
»Sehen Sie Ihre Tochter oft?«
Ich steckte mir die Zigarette an, blies den Rauch weit ins Zimmer und schlug die Beine übereinander. Durch die Fensterfront drang das ferne Mahlen des Verkehrs. Als das Haus gebaut wurde, war der noch weit weg gewesen.
»Ich sehe nicht, was meine Tochter mit dem zu tun haben könnte, womit Sie mich beauftragen wollen«, sagte ich.
»Ich versuche nur, mir ein Bild von Ihnen zu machen. Und zu diesem Bild gehört auch, dass Sie eine Tochter haben. Schließlich muss ich ja wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann.«
»Das mit dem Vertrauen gilt für beide Seiten, Frau Schäfer-Scheunemann.«
»Haben Sie das schon oft gemacht, etwas geborgen?«
»Ich habe eine gewisse Erfahrung darin.«
»Und worum hat es sich dabei bisher gehandelt?«
»Sie werden verstehen, wenn ich da nicht ins Detail gehen kann. Die absolute Diskretion, die ich Ihnen zusichere, sichere ich jedem zu, der meine Hilfe in Anspruch nimmt.«
»Sie sind aber doch kein Privatdetektiv?«
»Ich lehne alles ab, was amtlich ist. Ich arbeite dazwischen, wenn Sie mich verstehen.«
Ihre Augen konnten schimmern wie Opale. Sie pickte einen Krümel von der Lippe, betrachtete ihn einen Augenblick stirnrunzelnd, zog dann ihr Kleid um sich, als habe ein kühler Windhauch sie gestreift, und sah mich seufzend an.
»Ich weiß nicht, ob ich Sie verstehe. Ich versuche es. Ich versuche auch, Ihre Anzeige zu verstehen.« Sie hatte die Zeitschrift mit der Anzeige aufgeschlagen auf dem Glastisch, nahm sie zur Hand und las sie vor, wie sie sie wahrscheinlich schon dutzende Mal vorgelesen hatte, sich, dem Hund, dem großen Haus.
»›Sind Sie verzweifelt? Wissen Sie nicht mehr weiter? Haben alle üblichen Instanzen versagt? Dann wenden Sie sich an Ihren Bergungsexperten für außergewöhnliche Fälle, Berlin, Postfach, oder im Notfall Telefon …‹ Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Herr Harder. Ich muss wohl ein Notfall sein. Bekommen Sie viele Anrufe?«
»Nicht so viele, dass ich mir schon einen Anrufbeantworter zulegen müsste.«
»Aber Sie leben von dieser – hm – Arbeit?«
»Sonst säße ich nicht hier.«
»Verstehen Sie sie als eine Art Lebensberatung?«
»Ich ziehe den Ausdruck Krisenhilfe vor.«
»Aber es gibt keine Referenzen, keine Legitimationen bei dieser Arbeit. Niemand ist verpflichtet, Ihnen eine Auskunft zu geben.«
»Sie wären überrascht, was man alles erfährt, auch wenn man kein amtliches Dokument vorlegen kann. Aber wenn es Ihnen um Referenzen geht – rufen Sie Kriminaloberrat Smetana bei der Berliner Kripo an, der kann Ihnen zumindest garantieren, dass ich meine Spesenabrechnung machen kann, ohne mehr als zehn Orthographiefehler reinzubringen. Und dass ich die Schnauze halten kann. Dass ich nicht mit Ihrem Silberbesteck abhaue, wird er Ihnen allerdings nicht garantieren.«
»Sie arbeiten also mit der Polizei zusammen?«
»So einen Job macht man nicht, ohne bestimmte Leute zu kennen. Sie segeln auch nicht ohne Kompass.«
»Nein? Aber in diesem Fall darf die Polizei nichts erfahren.«
»Warum sagen Sie mir nicht, worum es geht?«
»Jedenfalls nicht um mein Silberbesteck.«
»Das hätte mich auch nicht interessiert.«
»Ach, Sie nehmen nicht jeden, der zu Ihnen kommt?«
»Nein. Sie?«
Wir starrten uns einen Augenblick lang an, dann rang sie sich ein Lächeln ab. Es war kompliziert, weil das ganze Gesicht damit zu tun hatte, aber als es da war, bekam ich einen trockenen Mund.
»Vielleicht sind Sie doch der Richtige für diese Arbeit«, sagte sie.
»Dann engagieren Sie mich also, Frau Schäfer-Scheunemann?«
»Sagen Sie bitte Nora, Harder. Zumindest erzähle ich Ihnen, worum es geht. Meine Tochter ist verschwunden.«
3
»Paul und ich heirateten, als Miriam unterwegs war«, erzählte Nora Schäfer-Scheunemann. »Mein Mann war vierzig, ich zweiundzwanzig. Es war vielleicht nicht gerade das, was man eine Liebesheirat nennt, aber diese Ehe schien doch eine lohnende Aufgabe für mich zu sein. Ich ließ mich, wenn Sie den Ausdruck noch kennen, in eine Pflicht nehmen. Wo ich herkomme, galt das noch etwas.«
»Wann war das?«
»Miriam kam im Dezember 1965 zur Welt.«
Dann wurde sie also nächsten Monat neunzehn, und ich war drei Jahre jünger als die Blondine, die so tat, als stamme sie aus der fernen fremden Welt der Welfen.
»Woher kannten Sie Ihren Mann?«
»Paul war damals noch in der Baubranche. Ich hatte meine Eltern verloren und musste mir selbst meinen Lebensunterhalt verdienen, und im April 1964 fing ich als Sekretärin in Pauls Firma an. Pinggel&Scheunemann, Hannover. Pinggel war schon seit den fünfziger Jahren groß im Geschäft, sozialer Wohnungsbau. Paul war als Architekt in die Firma eingetreten und wurde dann Pinggels Kompagnon. Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre wussten sie gar nicht, wie sie die Siedlungen so schnell hochziehen sollten. Es war ein richtiger Boom, aber es ging dann auch sehr fix zu Ende, als sie sich finanziell übernahmen. 1971 kam der geschäftliche Zusammenbruch. Pinggel ging später ins Investmentgeschäft, er sitzt heute irgendwo in der Karibik und kämpft gegen seine Auslieferung. Paul ging in die Politik. 1978 ließ ich mich scheiden, aber die Ehe bestand damals schon lange nur noch auf dem Papier.«
»Hatten Sie sich auseinandergelebt?«
»Mein lieber Harder, als Journalist werden Sie das ja wohl nachvollziehen können. Politik aus nächster Nähe beobachten zu müssen, dieses widerliche Geschäft …«
»Schmutzig ist es schon«, sagte ich. »Wie nahe war denn die nächste Nähe?«
»Paul hat es nicht ganz nach oben gebracht, aber er musste natürlich da mitmischen, wo es um Geld ging. Er sah sich als Abgeordneter oder Minister in Bonn, und diese Leute haben immer nur seine Verbindungen und seine Möglichkeiten ausgenützt, um ihre Kassen aufzufüllen. Und dafür haben sie ihn auch noch verachtet, diese Gewerkschaftssekretäre und kleinen fetten Parteibonzen, diese unappetitlichen Raffkes …«
So viel Ekel konnte nicht nur gespielt sein, aber je länger sie mit ihm spielte, desto mehr entstellte er sie. »Kein Wunder, dass Sie das irgendwann satthatten«, unterbrach ich sie. »Demokratie ist wirklich nicht gut für den Teint.«
Sie brauchte einen Augenblick, aber dann konnte sie schon fast wieder lächeln. »Sie sind auch ein Zyniker«, sagte sie, »aber mit dieser Art Zynismus kann ich umgehen. Mit Pauls Zynismus ging es nicht.«
»Aber dieses Haus hatten Sie damals schon?«
»Das Haus baute Paul noch Anfang der siebziger Jahre, und bei der Scheidung hat er es mir übertragen. Ich habe dafür auf den Unterhalt verzichtet.«
»Ziemlich großmütig.«
»Ich weiß nicht, wie Sie das geregelt haben. Das, was Paul ins Haus brachte, als er noch Geschäftsmann war, konnte ich nehmen. Das schmierige Geld aus der Politik nicht.«
»Schmiergeld?«
»Schmieriges Geld. Ich habe selbst auf Zahlungen für Miriam verzichtet, als sie sechzehn wurde.«
»Das wird dann aber nicht leicht gewesen sein, das Haus hier zu halten.«
Es hörte sich schon an wie ein Gespräch unter Bekannten, und der Blick, mit dem sie mich streifte, kam mir merkwürdig vertraulich vor. Obacht, dachte ich. Draußen dämmerte es allmählich.
»Es war auch nicht leicht«, sagte Nora. »Es ist nicht leicht. Nicht als alleinstehende, geschiedene Mutter. Nicht als die Frau, die vor Jahren mal den Chef geheiratet hat. Nicht unter diesen Leuten, Harder, in diesen Häusern. Ich habe das einmal verloren, und jetzt wollte ich es nicht mehr verlieren. Ich wollte, dass Miriam in ihrem eigenen vertrauten Haus aufwächst und nicht in einer Mietwohnung in Hannover-Südstadt. Ich habe mich auch an diesen Blick gewöhnt, an die Luft, die man noch atmen kann, an den Wald, der noch da ist. Miriam und ich, wir haben oft ganze Tage hier oben gesessen und hinuntergeblickt, auf die Felder und die Dörfer und die Autos und die Ameisen. Es gab eine Zeit, nachdem Paul endgültig fort war, ich glaube, so glücklich werde ich nie mehr sein. Leicht, nein leicht war es nicht. Wenn das Glück leicht ist, spürt man es ja auch nicht.«
Rührend. »Und Paul, was macht er heute?«
»Ich denke, er macht immer noch seine schmutzigen Geschäfte.«
»Wo?«
»In Hannover.«
»Sie haben überhaupt keinen Kontakt mit ihm?«
»Wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr, das genügt.«
»Und Miriam?«
»Miriam würde lieber eine Giftschlange anfassen, als Paul die Hand zu geben.«
»Seit wann ist Miriam verschwunden?«
Plötzlich zuckten ihre Schultern, und sie legte die Hände vors Gesicht und schluchzte. In meinem Beruf gewöhnt man sich an schluchzende Frauen, aber nicht so sehr, dass man ihnen nicht den Arm um die Schulter legen möchte – vor allem, wenn sie so aussehen wie Nora Schäfer-Scheunemann. Andererseits hatte sie mir auch schon eine Menge Sülze aufgetischt. Ich blieb sitzen und steckte mir eine Zigarette an und wartete, bis sie sich wieder gefasst und mit einem Taschentuch abgetupft und einen neuen Campari gemixt hatte, dessen Farbe nun schon tiefrot blieb.
»Miriam ist seit einem halben Jahr verschwunden, Harder«, sagte sie dann, und ihre Stimme klang jetzt rauh und hart und erregt. »Und ich spüre, dass Paul etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Er hat sich nie damit abgefunden, dass Miriam bei mir ist. Und jetzt hat er sie in seine Gewalt gebracht.«
»Das ist eine ziemlich happige Beschuldigung«, sagte ich. »Haben Sie dafür Beweise, Nora? Dann wäre es am besten, Sie wenden sich an die Polizei.«
»An die Polizei? Die lachen mich doch aus. Ich dachte, Sie wüssten, in welcher Welt wir leben.«
»Das wissen wir alle. Mehr oder weniger. Wenn Sie Anhaltspunkte dafür haben, dass Ihr Exmann Ihre Tochter gekidnappt hat, dann schalten Sie die Polizei ein, Nora. Die Leute da wissen nämlich mit am besten, in welcher Welt wir leben.«
»Ich behaupte ja nicht, dass er sie gekidnappt hat.«
»Miriam ist achtzehn, fast neunzehn. Wenn keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen vorliegen, kann die Kripo ohnehin nur wenig unternehmen. Sie haben die Polizei aber doch von Miriams Verschwinden in Kenntnis gesetzt?«
»Wozu, Harder? Sie sagen doch selbst, dass die Polizei in solchen Fällen nichts machen kann.«
»So ist es nun auch wieder nicht. Wenn sie irgendwo polizeilich gemeldet oder ihr Name zur Personenfahndung ausgeschrieben ist, dann wird sie auch unweigerlich irgendwann ermittelt.«
Sie stand immer noch an der Bar, und die Eiswürfel in ihrem Glas klirrten, als sie die Hand ausstreckte. Sie war jetzt richtig zornig.
»Vielleicht sind Sie doch nicht der geeignete Mann für solch einen Auftrag, Herr Harder. Aufgrund Ihrer Annonce hatte ich damit gerechnet, dass Sie zumindest eine gewisse Entschlossenheit mitbringen, um diese Art von Arbeit auch durchzuführen, eine gewisse Bereitschaft, sich abseits der üblichen Pfade zu bewegen. Und dann kommen Sie und erzählen mir etwas von den polizeilichen Methoden der Personenfahndung. Von jemandem, der meine verschwundene Tochter bergen will, erwarte ich doch etwas mehr.«
Ich stand langsam auf, ging aber nicht, wie sie erwartet hatte, auf sie zu, sondern zur Fensterfront. Ich machte einen Zug aus der Zigarette und schnippte die Asche auf den Perserteppich. An dem mit Stahlplatten verschalten Bungalow gegenüber glühte überm Eingang eine pinkfarbene Neonröhre in Form eines Herzens.
»Nett«, sagte ich. »Sie und Miriam hier oben, der böse Papi ist endlich aus dem Haus, da kommt Freude auf. Zum Leben braucht man ja nicht mehr viel, wenn man das hier hat, ein bisschen Obst aus dem Garten, wer auf dem Land lebt, lebt reell. Wunderbar, wie man auch heute noch seine eigene kleine Märchenwelt haben kann, fünf Minuten von der B 217, eine halbe Stunde nach Hannover, so viel ist vom Wald ja noch da. Und der böse, böse Papi mit der bösen, bösen Politik ist weit, weit weg. Überhaupt die böse, böse Welt.« Ich drehte mich um. Sie hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Der Hund, der in einem Korb in der Essecke lag, grunzte im Schlaf. »Und dann wird das kleine Töchterchen doch mal größer, und irgendwann ist dann auch die böse Welt wieder da, mitten im Haus. Sie können sich mitten im Deister in einem Atombunker einbuddeln, Verehrteste, und die böse Welt wird doch dabei sein. Sie ist nämlich in Ihrem Kopf. Und wenn Ihre Tochter einen Kopf hat, dann ist sie auch in ihrem Kopf. Kommen Sie mir also nicht mit irgendeiner Entschlossenheit, die Sie von mir erwarten. Geben Sie erst mal mit größter Entschlossenheit zu, dass Ihre Tochter verschwunden ist und dass Sie keine Ahnung haben, warum, wohin und wie lange noch, und dass Ihnen das weh tut, verdammt weh tut, und dass Sie schlichtweg Angst haben, ganz dicke, große, fette Angst, dass dahinter irgendetwas steckt, was Ihr Leben noch ganz furchtbar verändern kann. So verändern kann, dass es kaputtgeht davon. Deshalb sind Sie nicht zur Polizei gegangen, und deshalb klammern Sie sich an die Vorstellung, Ihr Exmann hätte seine Finger im Spiel. Und deshalb haben Sie auf meine Annonce reagiert. Sie brauchen jemand, der Ihre Angst übernimmt. So, und jetzt geben Sie mir mal einen Wodka. Pur, vierstöckig und mit Eis.«
Sie gab mir den Wodka und ein Foto von Miriam, das sie schon bereitliegen hatte, und dann ließ sie sich auf dem Sofa-Diwan nieder, den Rücken an ein Polster gelehnt, die Füße, die in goldenen Ballettschuhen steckten, am Kopf des Hundes, der zu ihr getappt war, als er gespürt hatte, dass Frauchen ihn brauchte. Die Augen auf die rauchige Dämmerung geheftet, erzählte sie mir von ihrer Tochter, aber viel kam nicht dabei heraus. Ich meine, wessen Tochter war schließlich nicht sensibel und künstlerisch veranlagt und tierlieb und religiös und unheimlich bewusst, was die große Krise der Zivilisation betraf, wenn man ihr das bisschen Welt nahebringen konnte, das sie dafür brauchte? Annas Internat kostete achthundert Eier im Monat, und ich hoffte, dass ihr die Engländer etwas mehr beibrachten. Miriam hatte die Schule schon vor einem Jahr geschmissen.
»Warum?«
»Sie glaubte, dass sie das nicht brauchte, was sie dort lernen sollte.«
»Ohne Abitur steht sie aber dumm da.«
»Sie haben doch auch kein Abitur.«
»Ich bin aber auch nicht besonders sensibel. Was will Miriam denn werden?«
»Auf jeden Fall etwas, bei dem eine andere Art von Kreativität verlangt wird als auf der Schule. Ich wollte sie jedenfalls nicht zwingen, in irgendeine Richtung zu gehen.«
»In irgendeine Richtung ist sie aber gegangen, als sie hier verschwand. Nimmt sie Drogen?«
»Tun wir das nicht alle, Harder?«
»Möglich. Ist sie abhängig?«
Sie dachte einen Augenblick nach. »Sie braucht Zuneigung, wie Blumen Wasser brauchen.«
»Ah ja.« Ich betrachtete das Mädchen auf dem Foto. Es war ein 9 × 13-Abzug, und die Aufnahme war von jemandem gemacht worden, der Ahnung vom Fotografieren hatte und das Mädchen kannte, denn er hatte ihr Gesicht so getroffen, dass das, was sein Vorteil war – die Lebendigkeit der Augen und des Mundes –, sofort auffiel. Das Lächeln war wirklich hinreißend, die Ähnlichkeit mit dem der Mutter frappierend. So lächelte man nur für jemand, den man gern hatte.
»Was ist das für eine Haarfarbe? Brünett? Rot?«
»Sie hat dunkle Haare, Harder.«
»Von ihrem Vater, nehme ich an.«
»Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.«
»Haben Sie sich vielleicht schon darüber Gedanken gemacht, ob Miriam irgendwo einen Freund hatte oder eine Freundin oder eine Gruppe von Freunden, die vielleicht alle heimlich davon geträumt haben, die Mücke zu machen? Das große Abenteuer zu suchen?«
Sie nahm noch einen Schluck Campari – es war ihr dritter – und schüttelte dann den Kopf. »Die paar Freunde, die sie hier hatte, die von der Schule, von denen hat keiner eine Ahnung, Harder. Von Miriam nicht, von gar nichts. Und in Berlin …«
»Berlin? Davon war ja noch gar nicht die Rede.«
»Es war von vielem noch nicht die Rede. Sie hat Verwandte in Berlin, in Kladow, die sie gelegentlich besucht hat. Verwandte Pauls, aber ich habe ihr immer zugeraten zu diesen Besuchen, gerade weil es solche Spießer sind im Grunde. Man muss wissen, was die Spießer denken, wenn man in diesem Land lebt.«
Ich notierte mir die Adresse in Kladow. Vielleicht hatte ich dieser Frau Unrecht getan, die so weit abgewandt tat, ein zarter Traum in Blond und Pastell mit goldenem Ballettschuh. Hinter der Geschichte steckt mehr, dachte ich.
»Das ist doch mal ein Anhaltspunkt«, sagte ich. »In Berlin kann man leicht unter die Räder kommen.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, wo Sie anfangen müssen zu suchen. Bei Paul.«
»Mach ich auch«, sagte ich. »Vorausgesetzt wir werden uns einig.«
»Ich dachte, wir wären uns schon einig.«
Unsere Blicke kreuzten sich, und mein Mund wurde wieder trocken. Ich nahm einen Schluck Wodka. Er schmeckte jetzt lange nicht mehr so gut, wie diese Sorte Wodka sonst schmeckt.
»Wir werden uns bestimmt einig«, sagte ich. »Wann war Miriam zuletzt in Kladow?«
»Über Ostern. Dann kam sie zurück, alles war wie immer, und ein paar Tage später war sie verschwunden.«
»Hat sie Sachen mitgenommen?«
»Bei ihren Kleidern wüsste ich das nicht. Von ihren Lieblingsbüchern fehlt keins. Von dem Konto, das ich ihr eingerichtet hatte, ist seither nichts abgebucht worden.«
»Was für eine Einstellung hat Miriam zum Geld?«
»Wie meinen Sie das, Harder?«
»Ihnen wird doch auch schon der Gedanke gekommen sein, dass jemand vom Verschwinden Ihrer Tochter profitieren könnte. Unter Umständen auch sie selbst.«
»Ein hässlicher Gedanke.«
»Solche Dinge sind immer hässlich.«
»Und wozu dann ein halbes Jahr warten?«
»Auch wahr. Ihre Tochter ist spurlos verschwunden, und nach einem halben Jahr sehen Sie zufällig eine etwas merkwürdige Anzeige in einer Zeitschrift und entschließen sich ganz spontan, die Hilfe, von der in der Anzeige die Rede ist, in Anspruch zu nehmen. Sie müssen wirklich verzweifelt sein, Nora. Und was waren Sie in den sechs Monaten seit Ostern?«
Sie hatte sich aufgerichtet und fuhr dem Hund mit den Fingern durch seine Wolle. »Nun, ich gebe zu, ich habe zuerst gedacht, Miriam sei … über alle Berge. Wir hatten in letzter Zeit kein solch enges Verhältnis mehr. Emotionell immer noch, aber im täglichen Leben – nun ja, sie ist eben kein Kind mehr.« Sie sah mich an. Von ihren Augen war nichts abzulesen. »Ich dachte, sie wird sich schon melden. Ein Freund, eine Reise, ein Abenteuer – natürlich gibt es das. Aber nach drei Monaten habe ich nicht mehr daran geglaubt, und jetzt glaube ich erst recht nicht mehr daran. Ich spüre es, dass jemand seine Hand im Spiel dabei hat. Paul. Paul wollte sie mir immer wegnehmen. Als sie noch klein war, war er nicht an ihr interessiert, aber jetzt, wo sie so geworden ist, wie ich es mir wünschte, jetzt hat er sie mir weggenommen.«
»Und was, stellen Sie sich vor, hat er mit ihr gemacht? In ein Kloster gesteckt?«
»Es gibt viele Möglichkeiten, jemanden festzuhalten.«
»Ein waches, intelligentes Mädchen, das ihn nicht leiden kann?«
»Wenn Sie wüssten, wozu Menschen wie Paul fähig sind, würden Sie nicht hier sitzen und Fragen stellen. Sie würden das tun, was Sie in Ihrer Anzeige versprechen. Sie würden handeln.«
Ich steckte mein Notizbuch ein. »Das werde ich auch, Nora. Was ich an Anhaltspunkten habe, passt zwar unter einen Stecknadelkopf, aber ich werde versuchen, Ihre Tochter zu finden.«