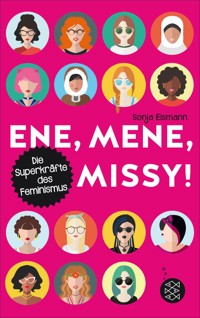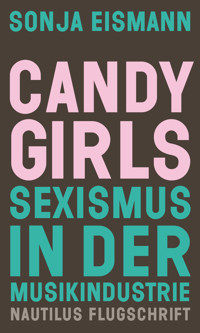
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Junge Frauen und ihre Körper – selbstverständlich normschön, jugendlich, sexy – sind das Rohmaterial, aus dem die Musikindustrie und die Logik des Pop gemacht sind. Sie werden in Songtexten angeschmachtet und fetischisiert, beschimpft und degradiert, sie dienen auf der Bühne und im Backstage als Projektionsfläche. Weibliche Fans werden als kreischende Masse oder willenlose Groupies betrachtet, nicht fähig zu einem ernsthaften Interesse an der Musik oder einem ernstzunehmenden Geschmack. Und wenn eine Frau als Künstlerin auftritt, dann ist sie zunächst eine Frau und erst dann eine Musikerin, dann ist ihr Körper entweder zu dick, zu dünn, zu perfekt oder sonst wie falsch, dann ist sie entweder Hure oder Heilige, und dann – plötzlich – ist sie sowieso zu alt. In einer so wütenden wie lehrreichen Mischung aus Analyse und Abrechnung zeigt Sonja Eismann, wie tief Sexismus und Ageismus in die Musikindustrie eingeschrieben sind, wie wir als Konsument*innen den male gaze erlernt und verinnerlicht haben, wie Missbrauch und Pädosexualität in fast allen Szenen und Genres akzeptiert werden. Sie schreibt über alte Männer, die minderjährige Sängerinnen sexualisierte Songs performen lassen, über die scheinbare Unmöglichkeit eines richtigen Alterns, sexistischen Musikjournalismus, Superstars wie Taylor Swift, Beyoncé oder Peaches, über Feminizide in Songlyrics – und natürlich über Beispiele der selbstbewussten Aneignung, des Widerstands, der wütenden Mittelfinger gegen das Musikpatriarchat. »Feminismus ist nicht Fun, er ist komplex und er kotzt die Leute an – und er macht Arbeit! Und die hat sich Sonja Eismann gemacht, indem sie mit Verve und Zorn und zahllosen Beispielen beweist, wie patriarchal es in der Musikindustrie immer noch zugeht.« Christiane Rösinger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SONJA EISMANN(*1973) ist Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Sie studierte Komparatistik in Wien, Mannheim, Dijon und Santa Cruz (USA) und war Mitgründerin des Magazins nylon und des Missy Magazine, wo sie bis heute Teil der Redaktion ist. Sie war/ist u. a. für Spex, taz, der Freitag und Deutschlandfunk Kultur als Autorin tätig undforscht zu Genderdarstellungen im Pop. Von 2016 bis 2022 war sie Mitglied im Musikbeirat des Goethe-Instituts, 2024 hatte sie die Popdozentur der Universität Paderborn inne. Sie lebt in Berlin.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49a
22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten, ausdrücklich auch die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG
© Edition Nautilus 2025
Deutsche Erstausgabe September 2025
Umschlaggestaltung: Maja Bechert
www.majabechert.de
Satz: Corinna Theis-Hammad
www.cth-buchdesign.de
Porträt der Autorin auf S. 2:
© Juliette Moarbes
1. Auflage
ePub ISBN 978-3-96054-487-6
Inhalt
Einleitung
Zu jung
Zu alt
Dein Körper ist immer falsch
Die dummen Fans
Die geilen Groupies
Songtexte
Schreiben über Frauen im Pop
Strukturen
Die andere Seite
Anmerkungen
»Misogyny is the backbone of the music industry.«1 Kim Deal
Einleitung
Candy Girls sind süß. Sie sind frisch und lecker. Sie sind an jeder Ecke zu haben und sie sind billig. Sie sind mit und ohne Verpackung hübsch. Sie lassen sich schnell konsumieren oder unauffällig wegwerfen. Sie sind genau so, wie die Musikindustrie sich Weiblichkeit erträumt.
»My girl’s like candy, a candy treat«, singen New Edition 1983 in »Candy Girl«. Ein Treat ist ein Vergnügen, aber auch eine Belohnung, hier extra für Boys. »Sex and Candy« riecht der Sänger von Marcy Playground 1997, als er sich eine supererotische Erscheinung zusammenfantasiert, eine Frau so schmackhaft wie »double cherry pie«. Iggy Pop will 1990 seine »Candy« gar nicht mehr loslassen, weil sie ihm »love for free« gegeben hat, sie muss ihm gehören, »Candy Candy Candy I can’t let you go!« In 50 Cents »Candy Shop« von 2005 existiert nur eine einzige Süßigkeit: Sein eigener »Lollipop«, den alle Candy Girls der Welt unbedingt probieren sollten, denn: »I’ll melt in your mouth, girl, not in your hand, ha-ha!« Den Rolling Stones schmeckt 1971 der »Brown Sugar«, den der »scarred old slaver« mitgebracht hat, so unglaublich gut, dass das versklavte junge Mädchen auf den Boden gestoßen wird, »ah, get down on your knees, brown sugar« – den Rest können und sollen wir uns denken.
Candy Girls haben keine eigene Handlungsmacht. Sie sind dafür da, besungen, beglotzt, fetischisiert, exotisiert, aufgerissen und verschlungen zu werden. Sie sollen köstlich sein, nicht bitter, denn dann werden sie beschimpft oder gleich komplett entsorgt.
In den letzten Jahren war viel davon die Rede, dass Frauen den gesamten Popladen übernommen hätten, dass die Zeit des goldenen Popmatriarchats angebrochen wäre, der Feminismus sich im Pop flächendeckend durchgesetzt hätte. Beyoncé gewinnt die meisten Grammys! Taylor Swift wird am reichsten mit ihren Touren! Billie Eilish kann auch alte Männer begeistern! Überall Frauen, an der Spitze der Charts, in Konzerthallen, hinter den Plattenspielern und vielleicht sogar bei Musiklabels und im Journalismus. Erst im Zuge von #MeToo, das mit der Ausstrahlung der TV-Doku-Serie »Surviving R. Kelly« 2019 nach der Filmbranche auch im Musikbereich Fahrt aufnahm, dämmerte so einigen, dass hier vielleicht doch noch nicht alles rund läuft. Dank der unermüdlichen Arbeit von Opfern, Aktivist*innen und Unterstützer*innen wurde die Öffentlichkeit auf die sexualisierten Macht- und Abhängigkeitssysteme von Musikern wie R. Kelly, Till Lindemann, P. Diddy, Marilyn Manson, Michael Jackson, Ryan Adams, Win Butler und vielen, vielen anderen aufmerksam gemacht. Dieser Einsatz ist für einen längst fälligen Bewusstseinswandel in der Musikindustrie in seinem Wert gar nicht zu überschätzen. Dennoch ist dies kein Buch über #MeToo in der Musikbranche – diese Zustände haben andere bereits ausführlicher bearbeitet. Es ist vielmehr der Versuch nachzuzeichnen, welche tiefverwurzelten Strukturen die Verhältnisse, deretwegen #MeToo notwendig wurde, ermöglicht haben und bis heute ermöglichen.
Wie und wo ist die Musikbranche sexistisch? Kurze Antwort: überall. Die lange – und mitunter anstrengende, zermürbende und vor allem wütend machende – Antwort findet sich in diesem Buch. In Kapiteln über (niemals) zu junge und (immer) zu alte weibliche Identitäten im Pop, über Frauenkörper, die eigentlich immer falsch sind, über vermeintlich dumme Fans und willige Groupies, über misogyne Songtexte und problematischen Journalismus, über erdrückend patriarchale Strukturen und die Frage, was wir dem entgegensetzen könnten.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert beschäftige ich mich bereits mit den Themenkomplexen Feminismus und Popkultur. Die meiste Zeit davon habe ich euphorisiert damit verbracht, Gegenbeispiele zu allem, was ich in diesem Buch beschreibe, zu suchen. Ich habe sie zuhauf gefunden – in den letzten Jahren in einer solchen Fülle, dass ich schon das – gleichzeitig überfordernde wie begeisternde – Gefühl hatte, nicht mehr hinterherzukommen. Aber spätestens der #MeToo-Skandal um Rammstein hat mir in drastischer Weise vor Augen geführt, dass sexistische Strukturen nicht einfach verschwinden, nur weil es mehr und mehr fantastische Musikerinnen, engagierte Organisationen und feministischen Pop-Aktivismus gibt.
Während ich Candy Girls schreibe, blättere ich mit meiner achtjährigen Tochter durch einen Werbeprospekt zu empowernden Büchern für Kinder. Sie ist ein riesiger Fan der Reihe, hat die Bände über Rosa Parks, Marie Curie oder Malala Yousafzai verschlungen. Sie tippt neugierig auf das Cover mit David Bowie als Ziggy Stardust. David Bowie, der als erwachsener Mann in den Anfängen seiner Karriere laut mehreren Quellen Sex mit minderjährigen Mädchen hatte.2 Auch wenn es die damals 14-jährige Lori Mattix, eine der Betroffenen, nicht tut,3 könnten wir benennen, was das bedeutet: Vergewaltigung. Meine Tochter tippt auf das Bild von Udo Lindenberg. Den als deutsches Nationalheiligtum gehandelten Musiker, der 1991 in seinem Song »Lolita« die denkwürdigen Zeilen sang: »Ich war an der Schwelle zum Blausein / Und sie war an der Schwelle zum Frausein / (…) Ich war so um die 40 / Und sie war 15 / Wir wollten uns zusammentun / Ja, wo is’n da das Problem?« Ja, wo ist das Problem? Man würde denken, es steht so überdeutlich als Elefant im Raum, dass es nicht zu übersehen ist. Aber eine gesamte Industrie mit ihren Akteur*innen und Stars, die sich, wie auch Lindenberg und Bowie, nie entschuldigen, ja die Gesellschaft als Ganze guckt amüsiert um den Elefant herum und macht weiter. Musikerinnen auf Bühnen wird weiterhin reflexhaft »Ausziehen!« entgegengebrüllt, Femizide werden in Songlyrics von Männern romantisiert, Frauen werden auf Festivals vergewaltigt, jedes musikbegeisterte Mädchen, das sich backstage mit einem männlichen Musikstar austauschen möchte, wird als penetrierbarer Körper wahrgenommen, es gibt Women-in-Music-Awards, aber keine Men-Awards, weil eigentlich jeder Award per se ein solcher ist und nur durch Abweichung weiblich werden kann.
Ich spreche in diesem Buch an vielen Stellen von »Männern« und »Frauen«, von »weiblich« und »männlich«, obwohl ich das in meiner Praxis als feministische Journalistin in dieser Eindeutigkeit mittlerweile selten tue und häufig den Terminus »FLINTA« (Frauen Lesben Inter Nichtbinäre Trans Agender) verwende, um alle Identitäten zu benennen, die im Patriarchat marginalisiert und diskriminiert werden. Doch ich verwende diese Kategorien hier ganz bewusst, um darauf hinzuweisen, dass die Begehrensökonomie von Popkultur auf genau dieser Zwangsbinarität aufgebaut ist, um zu erklären, wie Pop funktioniert, wenn er uns wieder und wieder zu Männern und Frauen, zu Boys und Girls macht (wohl wissend, dass es mittlerweile zahllose Akteur*innen gibt, die genau dieses Zwangssystem herausfordern und mit diversesten Konstruktionen ins Wanken bringen … aber hier sind wir noch nicht). Ich erlaube mir daher, tatsächlich Sexismus in den Vordergrund zu stellen, wenn mir natürlich auch die Intersektionen von Gender, Race, Class, Ableismus und vielen anderen Diskriminierungskategorien bewusst sind, und ich versuche, sie immer, implizit oder explizit, mitzudenken. Auch die Termini Pop und Popkultur, Musik- und Imageindustrie verwende ich nicht so trennscharf, wie es in der mittlerweile imposant angewachsenen wissenschaftlichen Forschung dazu Usus ist, sondern als Spiegelung von Alltagsdiskursen, in denen damit populäre Musik-Phänomene aller Genres ab ungefähr der Mitte des 20. Jahrhunderts, mit kleinen Ausflügen bis in die 1920er, bezeichnet werden. Die meisten meiner Beispiele stammen aus den beliebtesten Musikgenres wie Pop, Rock und HipHop und aus dem angloamerikanischen Raum. Damit soll in keinster Weise zum Ausdruck gebracht werden, dass mir die Popentwicklungen anderer Weltregionen uninteressanter erscheinen, im Gegenteil kommen meiner Meinung nach von dort, nicht nur in den letzten Jahrzehnten, seit es auch im Globalen Norden eine erhöhte Aufmerksamkeit für vermeintlich »marginale« Stile gibt, die spannendsten Entwicklungen und Impulse, so dass eine Einteilung von »Zentrum vs. Peripherie« schon lange keinen Bestand mehr hat. Vielmehr trage ich damit eher den dominanten Kanonisierungen Rechnung, die formen, was wir alle uns unter »Popkultur« vorstellen und was in unserem kollektiven Erfahrungsschatz als solche archiviert und damit abrufbar wird.
Mir ist bewusst, dass dieses Buch nur einen winzigen Ausschnitt in einem Ozean von Musik-Sexismen abbilden kann, und es wäre ohne weiteres möglich, zu jedem Unterpunkt in jedem Kapitel gesamte Einzelbände zu schreiben – die nicht genannten Beispiele sind daher jetzt schon Legion. Wenn ich mit meinen Ausführungen und gelegentlichen Polemiken zum Widerspruch oder auch zur Ergänzung anrege, freue ich mich. Denn nur, wenn wir gemeinsam im Gespräch bleiben, uns streiten, Stereotypisierungen in Frage stellen und alte Deutungen herausfordern, kann sich etwas ändern. Ich widme dieses Buch allen, die immer gedacht haben: »Vielleicht bilde ich mir das nur ein?« Ihr bildet es euch nicht ein.