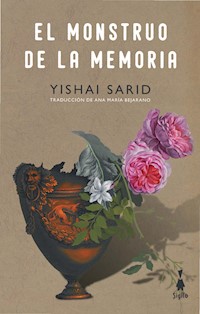18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Shai Tamus ist ein Journalist, der am Anfang seines Weges durch seinen frischen Schreibstil und seine häufigen Fernsehauftritte einige Berühmtheit erlangte. Doch über die Jahre sinkt sein Erfolg, seine Kolumnen werden auf die hinteren Seiten der Zeitung verbannt, und er ist fast vergessen. Auch die Liebe seiner Frau Alona, die sich in angesehenen Galeristenkreisen bewegt, scheint er zu verlieren. Und die Kinder interessieren sich immer weniger für ihn. Als er die Gelegenheit erhält, wieder im Fernsehen aufzutreten, auf der ganz anderen Seite, im patriotischen Kanal, ergreift er sie wie einen Rettungsring. Shai merkt nicht, wie er instrumentalisiert wird, und tut nun alles, damit ihm der Erfolg nicht wieder abhandenkommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
www.keinundaber.ch
Über den Autor
Yishai Sarid wurde 1965 in Tel Aviv geboren, wo er bis heute lebt. Nachdem er als Nachrichtenoffizier tätig war, studierte er in Jerusalem und an der Harvard University und arbeitete später als Staatsanwalt. Heute ist er als Rechtsanwalt tätig und veröffentlicht Artikel in diversen Zeitungen. Bei Kein & Aber erschienen bislang seine Romane Limassol (2010), Alles andere als ein Kinderspiel (2014), Monster (2019), Siegerin (2021) und zuletzt Schwachstellen (2023).
Über das Buch
Shai Tamus, ein einst erfolgreicher Journalist in Tel Aviv, hatte durch seinen pointierten und nahbaren Schreibstil und seine häufigen Fernsehauftritte einige Berühmtheit erlangt. Doch seine Karriere ist versandet. Seine Artikel und Kolumnen werden auf die hinteren Seiten der Zeitung verbannt. Und auch seine Frau Alona, die ihrerseits Karriere als Galeristin macht, wie seine Kinder schenken ihm immer weniger Aufmerksamkeit. Verzweifelt strebt Shai nach Liebe, Anerkennung und einem beruflichen Wiederaufstieg. Als er vom patriotischen TV-Sender eine Rückkehr ins Rampenlicht angeboten bekommt, ergreift er die Chance wie einen Rettungsring, ohne zu merken, dass er sich Stück für Stück als Sprachrohr der Rechten instrumentalisieren lässt – und sich damit mehr und mehr von seiner Familie entfernt.
Ebenfalls von Yishai Sarid:
Limassol
Alles andere als ein Kinderspiel
Monster
Siegerin
Schwachstellen
»Shai Tamus«, las die Arzthelferin aus seinem Personalausweis ab, ohne ihm einen zweiten Blick zuzuwerfen. Sein Name und Gesicht sagten ihr nichts. »Wenn Ihre Nummer aufleuchtet, gehen Sie bitte in Zimmer drei. Gute Besserung.«
Er war nicht krank, nicht dass er wüsste zumindest, und ihr Genesungswunsch irritierte ihn, als würde sie eine schlechte Nachricht kennen, die man ihm noch nicht eröffnet hatte. Auch als er später hinter den Wandschirm trat, um sich auszuziehen, und, nur mit einem dünnen Papierkittel bedeckt, im Behandlungszimmer wartete, wo die Ärztin und ihre Assistenten den Eingriff vorbereiteten, erregte er kein besonderes Interesse. Er war ein weiterer beliebiger Patient in einer langen Reihe von Männern über fünfzig, denen diese Vorsorgeuntersuchung empfohlen wurde. Auf der Liege spritzte man ihm ein leichtes Betäubungsmittel in den Arm und schob ihm einen elastischen Schlauch in den Darm, um zu prüfen, ob sich dort ein Krebsgeschwür eingenistet hatte. Alles verlief ganz normal.
Als er eine halbe Stunde später im Aufwachraum wieder zu sich kam, saß Alona, seine Frau, bei ihm und fragte, wie es ihm ginge. »Bestens«, sagte er ehrlich, »als wäre ich friedlich gestorben«, und im Stillen dachte er, dies sei eigentlich eine wunderbare Art zu sterben, bedauerte geradezu, wieder aufgewacht zu sein. Die Ärztin trat ein und prüfte vor seinen Augen die Untersuchungsergebnisse, die überwiegend gut ausgefallen seien, bis auf einen kleinen Polypen, den man entfernt und zur Biopsie eingeschickt habe, doch es bestehe kein Grund zur Sorge, schloss sie und bat ihn, in sieben Jahren wiederzukommen oder bei auffälligen Symptomen auch früher.
Beim Verlassen der Klinik schlug er Alona vor, einen Kaffee trinken zu gehen, aber sie wollte schnell wieder zur Arbeit in die Galerie, brachte ihn nur heim und vergewisserte sich, dass es ihm gut ging und er sich zur Ruhe legte.
Omer, sein Sohn, briet sich ein Omelett in der Küche. Es war schon nach zehn Uhr, aber er war gerade erst aufgewacht, trug noch seine Schlafkleidung und hatte sich lange nicht mehr rasiert. Shai arbeitete von zu Hause aus, und auch Omer blieb den ganzen Tag dort. Seine Wehrentlassung lag über ein Jahr zurück, doch wenn man ihn fragte, wann er mit dem Studium anfangen werde, erklärte er ausweichend, heutzutage sei ein Universitätsabschluss nicht mehr so wichtig. Er hatte nebulöse Pläne für ein Online-Unternehmen und arbeitete vorerst einige Stunden pro Tag in seinem Zimmer, hinter verschlossener Tür, verkaufte irgendwelche Produkte, deren Art Shai nicht kannte und lieber auch nicht erfahren wollte. Er wusste nicht einmal, ob sein Sohn etwas dabei verdiente, denn vorerst lebte er komplett auf Kosten der Eltern.
»Alles in Ordnung bei der Untersuchung«, berichtete er Omer, der etwas über seine Ohrstöpsel hörte und nicht reagierte. »Wo ist Goni?«, fragte Shai, plötzlich ungehalten, nach seiner Tochter. »Weißt du, wo sie steckt?« Er wurde lauter, baute sich richtiggehend vor dem Sohn auf, der einen der Stöpsel aus dem Ohr zog und antwortete: »Weiß nicht, sicher in der Schule, was regst du dich denn auf, bin gerade erst aufgestanden.«
Shai öffnete ihre Zimmertür, was strengstens verboten war, konnte dem Chaos dort – der halbe Kleiderschrank auf dem Boden verstreut, Zigarettenkippen in gebrauchten Kaffeetassen – jedoch nicht entnehmen, ob sie die Nacht dort geschlafen hatte. Ihr Telefon war ausgeschaltet. Er rief Alona an, die ihm zuflüsterte, es sei gerade jemand in die Galerie gekommen, doch er beharrte: »Nur ganz kurz, verzeih die Störung, vielleicht weißt du, wo Goni ist?« Gewiss in der Schule, meinte sie und warum er denn frage. »Weil sie nicht antwortet und ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe, ist ja wie ein Gespenst«, sagte er, worauf Alona ungeduldig erwiderte, sie habe Goni am Vortag im Kühlschrank stöbern sehen, als er schon schlafen gegangen war, und er solle sich mal nicht so aufregen.
Vor vielen Jahren, noch als Student, hatte Shai als kleiner Nachrichtenredakteur bei einer Zeitung angefangen. Ein Bekannter hatte ihn empfohlen. Internet gab es noch nicht oder bestenfalls in den Labors amerikanischer Wissenschaftler, und ein Smartphone existierte nur in Steve Jobs’ Gehirn. Es war eine andere Welt, und alle lasen Printmedien. Er wollte schreiben, und als sich die Gelegenheit bot, begann er, Konzerte zu besprechen. Sein Stil war jung und locker, doch er wollte seinen Lesern auch nützliche Informationen liefern. Unter dem Einfluss amerikanischer und britischer Musikmagazine, die er gebraucht im Dizengoff Center kaufte, gefielen seine Artikel in den Gegenden Tel Avivs, in denen er verkehrte, und bei Menschen, denen er begegnete. Er spürte seinen Einfluss stetig wachsen und schwor sich, ihn stets zum Guten zu nutzen. Aufgrund seiner Aufsätze lud man ihn ein, in einer experimentellen TV-Kultursendung einen festen Beitrag über interessante Events zu moderieren, zum Beispiel über Aviv Geffen, der in einem kleinen Club auftrat, als noch kaum jemand ihn kannte, und über junge Rockbands wie Eifo HaYeled. Man engagierte Shai als neues Gesicht, das die Stimme der jungen Generation vertrat, und bat ihn, ein buntes Hemd anzuziehen. Sein Auftreten war unsicher und seine Körpersprache fahrig. Er wollte die Sache nur heil überstehen und hoffte, man übersah die Schweißflecken, die sich vor Nervosität in seinen Achselhöhlen bildeten. Seine Eltern und ein paar Freunde sagten ihm, er sei gut gewesen. Bald jedoch wurde die ganze Sendung abgesetzt, was Shai als nützliche Erfahrung und nicht als persönlichen Misserfolg wertete. Seine Zeitungskolumnen hingegen wurden immer besser, lasen sich so farbig und interessant, dass sein Redakteur ihn auch über andere kulturelle Themen wie Theater und Bücher schreiben lassen wollte, und da Shai sich ohnehin dafür interessierte, stimmte er gern zu. Wenn er abends ausging, suchten junge Musiker, Nachwuchsschauspieler, Literaten und deren Fans seine Nähe. Auf einmal hatte er viele interessante Freunde.
Alona lernte er in einer dieser Nächte kennen, als er in einem Pulk rauchender junger Journalisten und Künstler und ihrer Begleitungen draußen vor einer Bar in der Balfour-Straße saß. Es war im Sommer 1995, und die Welt sah offen und einladend aus. Sie sprachen über Nick Cave, und Shai erzählte Dinge, die er in der ausländischen Presse gelesen hatte. Alona war mit einer Freundin da und erst kürzlich zum Studium in die Stadt gezogen. Über einem Bier blickte sie neugierig in die Runde, um die Szene zu erfassen. Ihre glänzenden Augen fielen auf ihn, und er verstummte, um ihre Stimme zu hören, während sie leise mit ihrer Freundin sprach, aber die Musik war zu laut. Plötzlich interessierte er sich nicht mehr für das Gerede, Geklatsche und Gelächter ringsum, sondern nur noch für sie.
Nach Mitternacht sah er sie und ihre Freundin zu den dumpfen Lichtern der Allenby-Straße aufbrechen. Los, geh ihr nach, feuerte er sich an, fühlte sich jedoch wie mit tonnenschweren Gewichten an seinen Stuhl auf dem schmutzigen Gehsteig gefesselt. Was taugen all deine Worte, wenn du nicht mal den Mut aufbringst, sie anzusprechen, dachte er, blieb bei den anderen Gästen sitzen, hörte ihre besoffenen Gespräche und ging in sich. Er hoffte, sie wiederzusehen, schwang unterdessen Abend für Abend seine Reden, trank und rauchte, bis er ihr einige Wochen später eines Abends wiederbegegnete, in einem anderen vollen Lokal mit derselben Freundin. Sie redete und lachte, und ihr Gesicht strahlte vor Schönheit und Intelligenz zwischen all den erloschenen Visagen. Einer seiner Tischnachbarn sah, dass er sie unablässig anstarrte und flüsterte ihm zu: »Nun geh schon hin, du guckst sie ja an wie ein Hornochse«, und Shai ging wütend und beschämt in eine andere Ecke zu anderen Leuten, die ebenfalls wollten, dass er in der Zeitung über sie schrieb. Er sah seine Angebetete aufstehen, ihre Handtasche nehmen und mit ihrer Freundin dem Ausgang zustreben. Schwerfällig kam er hoch, fühlte sich ungelenk und verloren, ging aber bald knapp hinter den beiden. Die Freundin war größer als Alona und ihre Figur fantasieanregender, aber das interessierte Shai nicht, nur Augen und Gesichtszüge hatten es ihm angetan.
Nun hörte er sich – mit fremder Stimme – sagen: »Verzeihung, ich heiße Shai, kann ich vielleicht deine Nummer haben?« Beide wandten sich zu ihm um, kurz verlegen, weil sie unsicher waren, wen er meinte, bis sie ihn im Dunkeln erkannten, einander zulächelten und Alona sachlich sagte: »Ah, du bist es, hast du was zum Schreiben?« Und er antwortete: »Nein, aber ich werde mir die Nummer merken können.« Sie brauchten damals keine Mobiltelefone. Beide kramten in ihren Handtaschen, die eine fand einen Zettel, die andere einen Stift, Alona notierte ihre Nummer und darüber ihren Namen, gab ihn der Freundin zum Weiterreichen, und er fasste ihn vorsichtig mit den Fingerspitzen. Früher, als er noch klein war, hatte sein Vater einmal Konzertkarten für die ganze Familie bekommen, ein großer Chor stand gestuft auf der Bühne über dem Philharmonie-Orchester. Jetzt erfüllte dieses mächtige Halleluja die feuchte Luft der Stadt. »Vielen Dank«, sagte er, »auf Wiedersehen«, und die beiden zogen kichernd weiter. Er überquerte die Straße, den Zettel wie eine immense Jagdbeute in der Hosentasche.
An einem Samstagabend zwei Monate später landeten sie in Alonas süß duftendem Bett in ihrer WG. Äußerlich wirkte er entspannt, aber innerlich konnte er immer noch kaum glauben, dass er ihr gefiel. Würde er auch nie. Die Mitbewohnerin war übers Wochenende zu ihren Eltern gefahren. Alona fragte, ob er zur Kundgebung auf dem Platz gehen wolle, und Shai antwortete, er sei zwar für die Regierung, aber gegen die Idee, dass der Staat Demonstrationen für sich selbst organisiere, das erinnere an kommunistische Regime. Er studierte Theater und Staatswissenschaft an der Universität und wälzte solche Gedanken. Als sie hinterher in der Küche gemütlich Pasta kochten und Wein tranken, rief sein Redakteur an: Jemand habe auf Jitzchak Rabin geschossen, und er brauche dringend fünfhundert Wörter von Shai. »Ich schreibe doch sonst nicht über Politik«, murmelte er, völlig überrumpelt von der Nachricht, aber der Redakteur sagte, die Zeitung gehe in drei Stunden in Druck, er müsse die Seiten füllen, und Shai solle keinen Stuss reden. Der Fernseher in der Wohnung war kaputt, so gingen sie runter in den Kiosk, um die Sondersendung zu sehen, bis Rabins Tod gemeldet wurde.
»Ich muss zum Schreiben in die Redaktion«, sagte er, und sie fragte leise weinend, ob sie mitkommen könne. Er wusste nicht, was er antworten sollte, sein Kopf war schon bei der Kolumne. Am nächsten Morgen würden haufenweise Artikel der besten Journalisten erscheinen, und er wollte sie alle übertreffen. Es war seltsam, gerade jetzt die Liebe seines Lebens zur Arbeit mitzubringen. »Ja«, sagte er schließlich, hoffte, sie würde darauf verzichten, doch sie ging neben ihm her und hielt seine Hand. Die Straßen lagen in Trauer, aus den Häusern schallten Fernseher, und er sagte ihr, das Land werde künftig nicht mehr dasselbe sein. Er überlegte, was Rabin durch den Kopf gegangen sein mochte in dem Bruchteil der Sekunde zwischen der Erkenntnis, dass er angeschossen war, bis zum Bewusstseinsverlust. In der Redaktion angekommen, hatte er den Beitrag in Gedanken bereits fertig und musste ihn nur noch schreiben.
Am Morgen erschien seine Kolumne gerahmt auf der Titelseite. Sie hatte etwas erfrischend Eigenes, das nicht die Klischees anderer Blätter wiederholte. Der Artikel wurde in ganzer Länge im Radiomorgenprogramm zitiert, und eine langjährige Journalistin, die der Familie des ermordeten Ministerpräsidenten nahestand, sagte ihm, er habe ihnen aus dem Herzen gesprochen.
So betrat Shai das Feld der Topjournalisten und begann, über Politik zu schreiben. Stets bemüht, eine originelle und tiefgehende Perspektive zu finden, schuf er sich eine Sonderstellung. Er begnügte sich nie mit gängigen Meinungsäußerungen, wie jeder Straßenpassant sie spontan abgeben könnte. Er wurde ein Star. Man sprach über seine Artikel. Alle paar Wochen zog er los, um dem Volk den Puls zu fühlen und mit echten Menschen zu sprechen, jedes Mal woanders, und seine Aufsätze füllten mehrere Seiten in den Wochenendbeilagen. Eines Tages wurde er in die oberste Etage ins Büro des Herausgebers gerufen, der sonst kaum mit einfachen Reportern sprach. »Sie haben sich zu einem unserer wichtigsten Journalisten entwickelt«, lobte ihn der Chef, »und ich möchte Sie gern persönlich kennenlernen.« Er bat Shai, ihm von seinen Eltern, seiner Kindheit, seiner Wehrdienstzeit und seinem Studium zu erzählen, und lauschte geduldig. Danach sprachen sie lange über die Lage im Land und über Weltanschauliches, woraus Shai entnahm, dass der Chef ihn einzuschätzen versuchte.
»Nach meiner Erfahrung ist der Mittelweg fast immer der richtige«, sagte der Herausgeber, der mit anderen Unternehmen reich geworden war und die Zeitung erworben hatte, um mediale Macht und Einfluss zu gewinnen, »nur in den seltensten Fällen zahlt sich Extremismus aus. So denken auch unsere Leser, sie wünschen sich ausgewogene und patriotische Texte.«
Shai widersprach nicht, zum einen aus Hochachtung für den Herausgeber, aber vor allem, weil das Gesagte seiner Meinung und seinem Temperament ohnehin entgegenkam, denn er war von Natur aus gemäßigt und mied Konfrontationen. Seine Beiträge stellten meist unterschiedliche Blickwinkel vor und zeigten auch Verständnis für die Meinungen der Gegenseite. Das Besondere an seinen Artikeln war die frische und doch seriöse und kenntnisreiche Darstellung der Dinge. Er verflocht komplizierte Gedanken, die er sich angelesen hatte, mit Aussagen von Taxifahrern oder seines Lebensmittelhändlers, die eine Art Volksweisheit beisteuerten. Häufig fügte er kleine Alltagsgeschichten ein, die teils echt, teils erfunden waren. Aufgrund seines Eintretens für den Frieden und für die Grundsätze von Recht und Gerechtigkeit konnte man ihn als gemäßigt links einstufen, denn er fand, dass Israel auch stark sein und sich gegen alle potenziellen Angreifer verteidigen musste. Wo er Kritik übte, versüßte er sie mit etwas Honig und ließ stets Raum für Korrekturen. Den Lesern gefiel das. Auf dem Schreibtisch des Herausgebers lag ein Umfrage-Ergebnis, nach dem Shai deren Beliebtheitsskala anführte. Zum Abschluss des Gesprächs erfuhr er, dass er eine Gehaltserhöhung erhalten und ins Leitungsforum aufgenommen werde, das allwöchentlich tagte, um politische Fragen zu besprechen und die Ausrichtung des Blattes zu bestimmen. Er war das jüngste Forumsmitglied in den achtzig Jahren des Bestehens der Zeitung.
Shai schrieb gern und gut, wollte aber eigentlich zum Fernsehen. Um wirklich berühmt und einflussreich zu werden, musste man häufig auf dem Bildschirm erscheinen. Trotz seiner brillanten Artikel, Kolumnen und Reportagen erkannte ihn kein Mensch auf der Straße. Wenn er mit Freunden draußen saß, hörten sie ihm interessiert zu, doch sobald einer vom Fernsehen auftauchte, und sei er noch so untergeordnet, zog er die Aufmerksamkeit auf sich. Der Bildschirm bestäubte seine Sprecher mit Glanz und Sternenstaub. Das geschriebene Wort konnte damit nicht mithalten. Nach frustrierender Wartezeit lud man ihn hin und wieder ins Studio ein. Er zog die Lehre aus seinen früheren unreifen Auftritten, ließ sich vor der Sendung die Haare schneiden und wählte, mit Alonas Hilfe, passende Kleidung. Außerdem legte er sich kurze, knackige Eröffnungssätze zurecht, um sich nicht gleich in komplizierte Formulierungen zu verlieren. Die Mühe zahlte sich aus: Die Programmleiter setzten ihn auf ihre Gästelisten. Er ergatterte keine Spitzenplätze, vielleicht weil er zu höflich und konfliktscheu war, aber seine ausgeglichenen Worte brachten Ernst und Anstand in die Diskussionen, und man glaubte, das entspreche den Wünschen der Zuschauer, vor allem an Freitagabenden, an denen er Stammgast eines der Hauptkanäle wurde und seine Meinung zu den Geschehnissen der Woche äußerte. Deshalb musste das Schabbat-Abendessen bei seinen Eltern vorverlegt werden. Seine Mutter richtete ihm einen Extrateller, und er ging, sofort nachdem er aufgegessen hatte, aber alle waren stolz auf ihn. Mit dreißig Jahren war er ein bekanntes Gesicht in fast jedem Haus.
Als er Anfang des Jahrtausends erfuhr, dass er aus dem Freitagabendstudio gestrichen sei, meinte er zu ersticken. Die furchtbare Bedeutung dieses Schritts war ihm auf Anhieb klar. Er bat um eine Aussprache mit dem Intendanten, der die Entscheidung angeblich selbst getroffen hatte, wollte das Warum erfahren. Er musste lange vor dessen Büro warten, und als er endlich eingelassen wurde, sagte der Boss: »Setzen Sie sich, ich habe nur ein paar Minuten.« Shai kratzte den Rest seiner Selbstachtung zusammen. Er trete schon seit zwei Jahren jeden Freitagabend auf, finde stets Achtung und Gehör, und das Feedback von Zuschauerseite sei hervorragend, argumentierte er, in dem Glauben, das Schlimmste noch abwenden zu können, und seine Stimme bebte vor Aufregung und Schmach. Der Intendant ließ ein Glas Wasser bringen und erwiderte, das treffe alles zu, er habe dem Sender gute Dienste geleistet, und man danke ihm dafür.
»Was ist denn dann passiert?«, fragte Shai in das entstandene Schweigen hinein, und der Intendant fragte zurück, ob er die Antwort wirklich hören wolle, sie werde ihm kaum gefallen.
»Ja, das möchte ich«, antwortete Shai und sah eine mächtige Woge auf sich zurollen.
»Sie haben kein Charisma«, erklärte der Intendant, »erregen weder Zustimmung noch Wut bei den Zuschauern. Das ist nicht gut für uns. Die Leute sehen Sie und zappen weiter. Bedaure. Sie wollten es hören.« Shai sah seine Felle davonschwimmen, startete jedoch einen letzten Versuch, in Gedanken bei Alona, und fragte, wieso man ihn dann über zwei Jahre im Programm belassen habe.
»Ich weiß es wirklich nicht«, antwortete der Intendant, nunmehr mit einem zynischen Gesichtszug. »Ich werde es Ihnen ehrlich sagen: Meist sehe ich freitagabends keine Nachrichten. Aber die Einschaltquoten der Sendung sinken seit Monaten, die Konkurrenz wird schärfer, und so wollte ich mir ein eigenes Bild verschaffen. Da wurde mir schnell klar, was das Problem ist. Zur Sicherheit haben wir noch eine Umfrage unter fünfhundert Zuschauern gemacht. Sie erregen kein Interesse. So ist es, Shai. Sie schreiben sehr schön und sagen die richtigen Dinge, aber beim Fernsehen braucht man andere Qualitäten, die Sie nicht besitzen. Tut mir leid. Das wars. Machen Sie’s gut.«
Das war viele Jahre her, und doch wachte er jeden Morgen damit auf, ging jeden Abend damit schlafen und dachte manchmal auch tagsüber daran. Sie haben kein Charisma, erstickte ihn immer wieder die scharfe Stimme des Fernsehintendanten.
Shais einstiger Ruhm geriet in Vergessenheit, und ins Fernsehen lud man ihn nicht mehr ein. Seine Kolumnen erschienen nach wie vor in der Zeitung, waren aber nirgends Tagesgespräch. Sein Gehalt wurde mehrfach gekürzt. Gelegentlich erhielt er die Tabelle der Klicks in der Digitalausgabe, auf der er stets weit unten rangierte. Die Zeitung wechselte mehrmals den Eigentümer, die Abonnentenzahl sank, und nur noch wenige treue Leser schätzten seinen gemäßigten und ausgewogenen Stil. Doch in der Redaktion errechnete man, dass es teurer käme, ihn zu ersetzen, als ihn bei seinem bescheidenen Lohn weiterzubeschäftigen. Um sein Gehalt zu rechtfertigen, bat man ihn, auch die Theaterszene abzudecken, anstelle eines jungen Journalisten, der nach Berlin gezogen war. »Ich habe früher schon mal übers Theater geschrieben, als ich gerade erst anfing. Ich war damals jünger als Sie«, erklärte Shai dem untergeordneten Redakteur, der ihn angerufen hatte, worauf der gutgelaunt antwortete: »Super, dann bringt Ihnen das vielleicht einen Hauch Jugend zurück.« Er schämte sich, Alona davon zu erzählen. Sie entdeckte es erst, als sie beim Morgenkaffee in der Küche flüchtig in die Zeitung blickte.
»Schreibst du wieder übers Theater?«, fragte sie, und er hörte Verwunderung und Verdruss mitschwingen, »Interview mit dem kommenden Musicalstar?« Shai erklärte, es sei zusätzlich zu seiner regulären politischen Berichterstattung, man habe ihn gebeten, neuen Wind in das Ressort zu bringen.
»Was ist mit deinem Theaterstück?«, wollte Alona wissen, und Shai erwiderte, er sei im zweiten Akt in eine Sackgasse geraten, aber sobald er etwas freie Zeit habe, werde er sehen, wie er da wieder rausfände.
»Eine Sackgasse im zweiten Akt wird dich im dritten begraben«, lachte sie. Sie war bildschön in seinen Augen, sogar noch schöner als früher, als sie sich gerade erst kennenlernten, und er begehrte sie dauernd. Aber wenn er von seiner Arbeit redete, verengte sie die Augen und verzog den Mund, und er hatte das Gefühl, dass sie ihm sein Versagen übelnahm, ihn vielleicht gar nicht mehr liebte. Sodbrennen schoss ihm die Kehle hinauf, und er nahm schnell eine Tablette aus der Medikamentenschublade im Badezimmer.
Einige Jahre zuvor war die Zeitungsredaktion aus der Stadt hinausverlegt worden. Shai fuhr trotz Staus und Benzinkosten jeden Morgen weiter dorthin, um einen Grund zu haben, sich anzuziehen und das Haus zu verlassen. Bis ihn eines Morgens einer der jungen Redakteure fragte, warum er eigentlich herkäme, wo man doch zu Hause schreiben und mailen könne, wie alle anderen es täten. »Mir fällt es schwer, daheim zu schreiben«, sagte Shai, »die Kinder und das Durcheinander und die Putzfrau einmal die Woche – ich brauche Luftveränderung, um mich zu konzentrieren.«
Doch als die Pandemie ausbrach, blieb Shai keine Wahl mehr. Er richtete sich eine Arbeitsecke zwischen Küche und Wohnzimmer ein, mit Tisch, PC und Stuhl. Um beim Schreiben ein wenig Privatsphäre zu haben, stellte er einen leichten japanischen Wandschirm auf. Alona missfiel das, und so einigten sie sich darauf, dass er ihn nach beendeter Arbeit zusammengeklappt beiseitestellte. Nach einigen Tagen versank er in dieser Ecke wie in einem warmen Nest. Wenn er sich hinsetzte und den Computer hochfuhr, verlor er sich rasch in den sozialen Medien und den Nachrichtenplattformen, quälte sich stundenlang damit. Er las die – wenigen – Reaktionen auf seine Artikel, zählte die Pro- und Gegenstimmen und versuchte vergeblich, die Verfasser hinter den Fantasienamen auszumachen. Danach suchte er neue Posts über sich in den sozialen Medien, vielleicht hatte jemand ihn erwähnt, er dürstete nach Aufmerksamkeit und Zuneigung. Fand er – eher selten – einen neuen Post, freute er sich sogar dann, wenn er negativ war. Hauptsache, jemand erinnerte sich an ihn. Gelegentlich sah er sich alte Mitschnitte der Fernsehsendungen seiner Auftritte an und war immer wieder überrascht, wie jung er gewesen war, mit vollem dunklem Haar und glattem Gesicht. Damals sah ich eigentlich recht gut aus, dachte er, saß sorglos da, als wäre mir der Studioplatz auf ewig sicher. Aber der Ton seiner jungen Stimme gefiel ihm nicht, klang ihm zu hoch, wie ein Chorknabe, und dann noch die übertriebene Gestik und das gekünstelte Lächeln. Heute würde ich viel natürlicher und seriöser auftreten, wenn man mich nur ließe, dachte er.
Fast jeden Tag postete Shai etwas auf dieser oder jener Plattform, teilte Ansichten über Israel und die Welt und bemühte sich, tiefer zu schürfen als die meist oberflächlichen übrigen Kommentare. Er wollte Pep, Glanz und Frische in seine Texte bringen, um Aufmerksamkeit zu erregen, denn er sah alte Kollegen, deren Posts Mitleid erregten, und fürchtete, mit ihnen zum Alteisen geworfen zu werden. Er hoffte, seine Karriere übers Internet zu beleben, was einigen glückte, ihm jedoch versagt blieb. Meist erntete er nur zwanzig bis dreißig Likes von betagten Lesern. Niedergeschlagen beschloss er gelegentlich, für einige Wochen oder sogar Monate aus dem Netz zu verschwinden, aber die Versuchung war zu groß. Schon nach wenigen Tagen lud er etwas Neues hoch, was wenige kühle Reaktionen hervorrief. Das zwanghafte Surfen auf den Plattform ermüdete ihn, und wenn er endlich dazu kam, seinen Text für die Zeitung zu schreiben, verließen ihn die Kräfte, und seine Augen brannten. Sogar Moses im Sinai und Jesus von Nazareth würden heutzutage gerade mal ein paar Dutzend Likes rausholen, versuchte er sich zu trösten, ihre Worte würden in dem Meer von Geschwätz untergehen – oder vielleicht doch nicht. Sie hatten etwas in Fülle, was dir abgeht.
Nach ihren ersten Wochen in Tel Aviv hatte Alona einen Studentenjob in einer Galerie in der Ben-Jehuda-Straße gefunden. Sie war einfach von einer Galerie zur anderen gegangen und hatte gefragt, ob sie Arbeit für sie hätten. Der Galerist war beeindruckt, förderte sie und machte sie mit Künstlern bekannt, mit denen er arbeitete: alte und berühmte wie Igael Tomarkin und Yair Garboz und vielversprechende neue wie Miriam Cabessa und Adi Nes. »Das ist Alona aus Beer Scheva«, stellte er sie jeweils vor, als sei er Paul Gauguin und sie eine exotische Schöne aus Tahiti.
Nach einigen Tagen brachte sie eine Mappe eigener Werke – Zeichnungen und Fotos – mit, in der Hoffnung, der Galerist werde sie als Künstlerin entdecken. Er warf einen Kennerblick darauf, lobte ihre gute Technik – und mehr nicht. Dafür brachte er ihr bei, gewinnbringend mit Kunden und Künstlern umzugehen. Sie liebte die Arbeit in der Galerie und meinte, den passenden Beruf gefunden zu haben. Sie fühlte sich zur Kunst hingezogen, begriff jedoch aufgrund ihrer wachsenden Bekanntschaft mit Künstlern, dass ihr deren hartnäckiger Schöpferdrang abging. Als sie ihren Universitätsabschluss in der Tasche hatte, sagte der Galerist, er würde sie gern weiterbeschäftigen, aber um in diesem Metier voranzukommen, müsse man die Welt gesehen haben. Dank seines breit gefächerten Netzwerks konnte er ihr eine Fortbildung bei Christie’s in New York verschaffen. Shai war begeistert, denn auch er wollte sich im Glanz Amerikas suhlen. Vor dem Abflug heirateten sie, und Shai vereinbarte mit der Zeitung, dass er von dort schreiben werde.
Es war gegen Ende des Jahrtausends. Sie wohnten in einer winzigen Wohnung im Süden Manhattans, mehr konnten sie sich nicht leisten, aber dort gab es nette Cafés und kleine Buchläden, und das Fenster blickte auf eine Grünanlage. Alona arbeitete in der Abteilung für moderne Kunst, die Werke für Millionen Dollar verkaufte, und Shai berichtete für die Zeitung über amerikanische Politik und Kultur und fühlte sich frei. An den Wochenenden entdeckten sie die Stadt oder machten Ausflüge in die Natur. Die Welt stand ihnen offen, sie waren sich nah und glücklich.
Shai ging am Vormittag auf der Straße spazieren. Er hatte gerade die Kolumne für die Freitagszeitung fertig geschrieben und fühlte sich erleichtert, bevor die Aufgaben der nächsten Woche ihn wieder unter Druck setzen würden. Gegenüber sah er sie in der leeren Galerie am Tisch sitzen und spürte einen Stich im Herzen. Er erwog, die Fahrbahn zu überqueren und ihr Guten Tag zu sagen, aber bei solchen Treffen schwang immer eine Schuldzuweisung mit, und so ging er lieber weiter. Nach etwa einem Jahr in Amerika war Alona schwanger geworden. Zuerst wollten sie deswegen nicht eigens nach Israel zurückkehren, denn sie sahen sich erst am Anfang ihres Weges in Amerika. Alona trug modische Umstandskleider, und sie kauften einen Kinderwagen für Spaziergänge mit dem Baby im Central Park. Omer kam in den Vereinigten Staaten zur Welt, damit er die amerikanische Staatsbürgerschaft bekam. Sie brachten ihn in ihre Wohnung, die zu klein und zu kalt für ein Baby war, waren kaum vorbereitet auf endlose Nächte mit wiederkehrendem Geschrei und der großen Müdigkeit danach. Das Baby passte ihnen nicht in den Kram, und die Stadt wurde auf einmal fremd und feindselig. Alona kehrte schon nach anderthalb Monaten zu Christie’s zurück, weil man ihr klarmachte, dass man nicht länger warten könne, und Shai blieb bei dem Baby zu Hause. Ihr Arbeitstag war lang, manchmal musste sie abends noch an einer Versteigerung teilnehmen, während sich sein Lebensradius auf die kleine Wohnung verengte. Statt die Veranstaltungen, die er besprechen sollte, zu besuchen, sah er sie sich im Fernsehen an und hatte das Gefühl, nur halbe Arbeit zu leisten. Die Spannungen zwischen ihnen wuchsen, bis Alona ihm nach einigen Monaten mitteilte, sie müssten heimkehren, denn so könne es nicht weitergehen, sie bräuchten die Hilfe der Familie und das Gefühl, zu Hause zu sein. Vielleicht würden sie später, in einem anderen Leben, wieder in die USA kommen. Er willigte sofort ein.
Zurück in Israel begannen seine guten Jahre, in denen er bekannt wurde, im Fernsehen auftrat, für Vorträge angefragt wurde und die Familie gut ernährte. Alona fand eine Anstellung als Assistentin der Chefkuratorin im Tel Aviver Kunstmuseum. Viereinhalb Jahre nach Omer wurde Goni geboren. Alonas beruflicher Durchbruch kam, als Omer schon in die Schule ging und sie zur Chefkuratorin im Städtischen Museum der Nachbarstadt Bat Jam erkoren wurde. Sie stürzte sich voll Eifer auf ihre neue Aufgabe und brachte faszinierende Ausstellungen bahnbrechender Künstler in das etwas verschlafene Museum, die gute Kritiken in den Feuilletons ernteten und auch auswärtige Kunstfreunde anzogen. Unter ihrer Leitung entwickelte es sich zu einer wichtigen Kultureinrichtung, und sie betrachtete es als ihr Lebenswerk. Doch zehn Jahre später wurde ein neuer Bürgermeister gewählt, der kein Kunstfreund war und Alona nicht kannte. Er zitierte sie in sein Büro, zeigte ihr die defizitären Bilanzen des Museums und erklärte, er würde lieber Essen für notleidende Familien kaufen, als Gemeindemittel für Ausstellungen zu verschwenden, die auf die Bewohner von Tel Aviv zugeschnitten seien, in seiner Stadt jedoch niemanden interessierten. Er fragte Alona, warum sie keine heimischen Künstler ausstelle, die aus der Stadt selbst stammten und ihre Atmosphäre einzufangen wüssten, sondern immer nur Außenstehende, bei denen kein Mensch verstände, was sie eigentlich aussagen wollten. Als er mit seinem Sermon fertig war und ihr Gelegenheit zur Erwiderung gab, erklärte Alona ihm stürmisch, dass Museen nirgendwo auf der Welt Geld einbrächten, berichtete von den vielen Bildungsinitiativen, die sie für die Kinder der Stadt im Museum angestoßen hatte, und sagte, sie würde liebend gern einheimische Künstler ausstellen, wenn sie die künstlerischen Standards erfüllten, sei aber keinesfalls bereit, das Museum in eine Laienkünstlergalerie zu verwandeln. Einige Tage später erhielt sie das Entlassungsschreiben. Sie war niedergeschmettert.
Um sich von dem Schlag zu erholen, begann sie, wieder zu fotografieren, und machte in einer Galerie eine kleine Ausstellung ihrer Werke, die aber keine besondere Aufmerksamkeit erregte. Sie musste Arbeit finden, denn Shais gekürztes Gehalt genügte ihnen nicht. Nach einigen Monaten, in denen sie immer wieder als »überqualifiziert« abgewiesen worden war, suchte sie den mittlerweile stark gealterten Galeristen auf, bei dem sie den Beruf erlernt hatte, und fragte ihn, ob er Arbeit für sie hätte. Seine Galerie hatte ihre hohe Reputation längst verloren, ihre wichtigen Künstler waren verstorben, aber es gab immer noch ein paar wohlhabende alte Kunden, die Kunst kauften. »Sicher«, sagte er, »bis du was Besseres findest, aber viel zahlen kann ich nicht.«
Ihr blieb nichts anderes übrig, als sein Angebot anzunehmen. Ganze Tage lang saß sie hinten am Tisch und wartete darauf, dass jemand die Galerie besuchte. Sie sah Shai von der anderen Straßenseite herüberschauen, tat aber so, als sehe sie ihn nicht. Beide konnten sich selbst kaum ertragen, und wenn sie zusammen waren, wurde das Gefühl des Versagens unerträglich.
Die Eigentumswohnung hatten sie in den guten Jahren nach ihrer Rückkehr aus Amerika, vor den Gehaltskürzungen, mit einer Hypothek und der Unterstützung seiner Eltern gekauft. Sie befand sich in einem älteren Haus im Schatten ausladender Bäume, in einem ruhigen Innenstadtviertel nahe am Meer, das britische Architekten in der Mandatszeit hervorragend geplant hatten. Die Wohnungspreise dort stiegen rapide. Jede Wohnung, die durch den Tod eines alten Menschen frei wurde, fand im Handumdrehen einen wohlhabenden Käufer. Heute könnten sie sich diese Gegend gar nicht mehr leisten. Als die Kinder klein waren, hatten sie jeden Sommer einen Auslandsurlaub mit ihnen gemacht, vor einigen Jahren jedoch damit aufgehört. Es sei ja ohnehin zu heiß, und alle Touristenorte seien überlaufen, tröstete sich Shai. Er übernahm die Einkäufe im benachbarten Supermarkt und fuhr einmal die Woche mit dem Bus zum Carmel-Markt, um relativ billig frisches Obst und Gemüse zu bekommen. Sie mochten gute Käsesorten, die er offen an der Theke kaufte. Der Verkäufer schaute ihn mitleidig an, wenn er hundert Gramm von einem dicken Laib teuren französischen Käses verlangte. Ringsum sah er Leute reich werden, teure Autos fahren, Besitz erwerben, in neuen Restaurants essen, während sie den Gürtel immer enger schnallen mussten. Die Wohnung war dringend renovierungsbedürftig: Im Winter sickerte Wasser durch die Fensterschlitze, einige Fliesen wackelten, die Küchenschränke waren rissig und schimmlig, aber Reparieren und Renovieren konnten sie sich nicht erlauben. Trotz allem Sparen floss das Geld dahin: Goni verlor ihr Handy und brauchte ein neues; am zwölf Jahre alten Familienauto ging die Kupplung kaputt und musste ausgewechselt werden; die Hausverwaltung forderte ihren Anteil für das Ersetzen eines geplatzten Abwasserrohrs. Jede solche Extraausgabe löste eine Krise aus. Sie hatten schon einige Kredite aufgenommen, um über die Runden zu kommen, und mehr sei nicht drin, hieß es bei der Bank.
»Wir sind arme Leute«, sagte Alona eines Abends, als sie aus der Galerie heimkam. Er hielt wütend dagegen, es gebe sehr viele ärmere Menschen, bis er eingestand, dass sie für ihre Wohngegend und ihre Stadt tatsächlich arm waren.
»Wir kommen da wieder raus«, versicherte er, doch Alona blickte ihn traurig an. Das glaube sie nicht, sagte sie, vielleicht sollten sie die Wohnung verkaufen, in einen abgelegenen Ort billig zur Miete ziehen und von dem Erlös leben, bis auch er aufgebraucht wäre. Shai wusste, dass sie das nicht im Ernst vorhatte, sondern ihm nur die Schmach an den Kopf werfen wollte. Früher hatten sie nicht so offen über ihre Lage gesprochen, aber in der Not waren die Hemmschwellen gefallen.
Gonis Klassenlehrerin teilte telefonisch mit, die Tochter käme kaum noch in die Schule, fehle häufig in den letzten Monaten, ob sie davon wüssten. »Ich weiß von nichts«, antwortete Shai mit erstickter Stimme. Er kannte diese Lehrkraft kaum, hatte sie nur mal an einem Elternabend gesehen. »Wenn sie weiterhin dem Unterricht fernbleibt, können wir ihr kein Abiturzeugnis ausstellen«, warnte die Lehrerin, und Shai versprach, sich sofort darum zu kümmern. Er rief Alona an, die behauptete, auch nichts geahnt zu haben, ihm aber nicht erschrocken genug klang. Goni war mal wieder unerreichbar. Spätabends hörte er die Wohnungstür aufgehen und sprang vom Sofa auf.
»Wow, hast du mich erschreckt«, rief sie, und Shai konfrontierte sie mit dem Bericht der Klassenlehrerin. Goni reagierte gelassen, sie bemühe sich ja, jeden Tag hinzugehen, aber manchmal sei ihr nicht gut.
Shai hielt mühsam an sich, seine Liebe für die Tochter rang mit seiner Wut im Bauch. Dann sagte er, wenn sie so weitermache, bekäme sie kein Abiturzeugnis.
»Wegen dem Abitur bin ich nicht im Stress«, erwiderte Goni, »heute ist das nicht mehr so wichtig.«
Shai atmete tief durch, um seinen Zorn runterzuschlucken. »Wo treibst du dich rum, wenn du nicht in die Schule gehst?«, fragte er.
»Ich bin beschäftigt, treibe mich nicht rum.« Sie feixte ihn herausfordernd an. »Freundinnen und Freunde, Dinge, die ich gerne mache, leben. Das geht euch nichts an, ich bin siebzehn.«
»Schade, du vermasselst dir deine Zukunft«, erklärte er.
»Ihr habt alle Abitur«, erwiderte Goni, »und was habt ihr nun davon? Du gibst stolz damit an, was für tolle Noten du hattest, auch Omer hat Abitur mit Leistungskursen in Mathematik und Physik. Schau doch, wohin ihr’s gebracht habt. Oder eben nicht. Steckt wie rostige Stangen im Sand fest. Lass mich meinen eigenen Weg gehen, Papa. Ich glaube nicht, dass ihr mir sagen könnt, was ich tun oder lassen soll.«
Ein- oder zweimal die Woche ging Shai die paar Minuten zu Fuß runter ins Gordon-Bad zum Schwimmen in dem kalten Salzwasser, das aus dem Meer hochgepumpt wurde. Darauf wollte er keinesfalls verzichten. Durch Schwimmen und Zufußgehen war er recht fit und konnte den Bauch relativ flach halten im Vergleich zu anderen Männern seines Alters. Ihn ganz loszuwerden, brachte er nicht fertig, trotz zeitweiser Abstinenz von Brot und Teigwaren. Er kannte das Freibad seit Kindertagen, da sein Vater ihn schon in zartem Alter dorthin mitgenommen hatte, und einige aus dessen altem Bekanntenkreis traf er dort immer noch. Normalerweise schwamm er allein dreißig Bahnen, anderthalb Kilometer, in mittlerem Tempo, ohne Rekorde brechen zu wollen, aber auch nicht als einer von denen, die langsam voranpaddeln und die Nachfolgenden behindern. Manchmal schloss er sich einer gemischten Gruppe an, deren Teilnehmer nach einem festen Trainingsplan auf der Schnellbahn soundso viele Bahnen zügig schwammen, kurz ausruhten und erneut loslegten. Manchmal saßen sie danach in Bademänteln draußen und unterhielten sich. Im Becken bemühte er sich, nicht hinter ihnen zurückzufallen, obwohl die Erstrangigen weit bessere, fast schon professionelle Schwimmer waren, einige sogar an kilometerlangen Wettbewerben im Meer teilnahmen.
Letztes Mal war ihm dabei plötzlich unwohl geworden. Der Schmerz setzte im Bauch an und griff auf die Brust über. Er versuchte, sich zu erinnern, was er zu Mittag gegessen hatte, bemühte sich, die anderen wieder einzuholen, aber die Schmerzen nahmen zu. Er stieg aus dem Wasser und versuchte, auf dem Liegestuhl zur Ruhe zu kommen. Vielleicht passiert es jetzt, dachte er und überlegte, ob er den Bademeister, der den Beckenrand abging, bitten sollte, einen Krankenwagen zu rufen, aber der Schmerz wurde dumpf, und er erinnerte sich, gelesen zu haben, dass sich ein Herzinfarkt meist durch jähen, scharfen und nicht durch anhaltenden Schmerz äußere. Ich muss mich untersuchen lassen, sagte er sich und starrte auf seine Bekannten, die stark wie Stiere durchs Wasser pflügten. Eine von ihnen war in ihrer Jugend Schwimmerin in einem Kibbuz gewesen, ein wenig älter als er, und wenn sie außerhalb des Beckens mit Leuten sprach, strahlte ihr hübsches Gesicht. Shai sah ihren Arm aus dem Wasser schnellen und bis zu den Fingerspitzen nach vorn ausholen, während der andere Arm unter Wasser neben dem Körper gebeugt zurückschlug und ihre Füße feinen Schaum aufwirbelten. Ihre Figur war voll und kräftig und ihr Stil fließend und mühelos.
Sie beendeten ihren Übungsplan nach einer knappen Stunde, verließen das Wasser und kamen zu ihm, auch sie, um leicht besorgt zu fragen, ob alles okay sei. Shai rang sich ein Lächeln ab und log, er habe beim Schwimmen einen Wadenkrampf bekommen, der sich mittlerweile aber wieder gelöst habe, denn er wollte sich ihr nicht schwach zeigen. Die Schwimmerin lächelte entspannt nach dem Training, wickelte sich in einen weißen Bademantel, breitete ihr Haar auf dem Kragen aus, und Shai hatte das starke Verlangen, sich auf ihren Schoß zu schmiegen und den Kopf tätscheln zu lassen wie ein kleiner Junge oder ein Welpe.
Sein Theaterstück handelte von einem Soldaten, der am Vorabend eines Krieges von der Front ins Elternhaus türmt. Shai war begeistert von der Idee und grübelte viele Stunden über die künstlerische Umsetzung. Da er mal Theaterwissenschaften studiert hatte und Kritiken für die Zeitung verfasste, schleppte er einen Haufen Theorie mit sich herum und musste viele Zweifel überwinden, bis er endlich den Mut zum Schreiben aufbrachte. Die ersten Seiten verfasste er lustvoll und flüssig, denn er sah die Figuren fast wortlos vor seinen Augen agieren: Eine Tür geht auf, und ein Soldat kommt überraschend nach Hause, während die Familie beim Abendbrot sitzt. Die Mutter schließt ihn freudig in die Arme, erschrickt jedoch, als er stammelnd erklärt, er sei von der Front desertiert. Der Vater springt entsetzt auf. Die Szenen füllten rasch mehrere Seiten, bis er die Personen und den Konflikt eingeführt hatte, doch dann wusste er nicht recht weiter, und die Sache geriet ins Stocken. Damals besuchte er eine Theateraufführung, um eine Kritik für die Zeitung zu schreiben. Schon beim ersten Auftritt erfasste er, dass es um dasselbe Thema ging, nicht haargenau, aber ähnlich genug, um ihm großes Unbehagen zu bereiten. Er saß im Dunkeln auf seinem Sitz und spürte seine Hoffnung und Lebenslust schwinden. Hinterher überlegte er wochenlang, wie er sein Stück umschreiben könnte, um Plagiatsvorwürfen aus dem Weg zu gehen, bis er zu dem Schluss kam, dass die Ähnlichkeit gar nicht so groß sei und »der seelische Antrieb hinter den beiden Werken ein anderer« – eine Wendung, die er mal bei einem Kritiker, den er schätzte, in der New York Times gelesen hatte. Er beschloss, nach dem ursprünglichen Konzept weiterzuschreiben, trat nun aber noch mehr auf der Stelle, kam eher lustlos und schleichend voran.